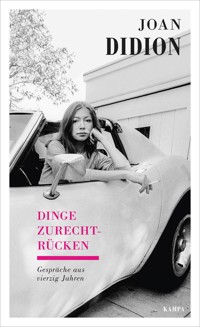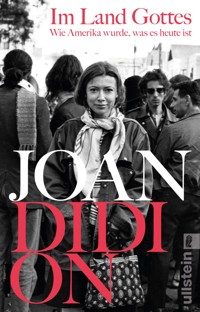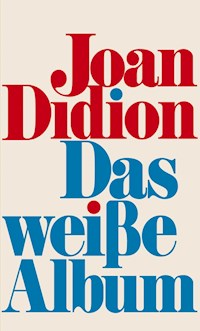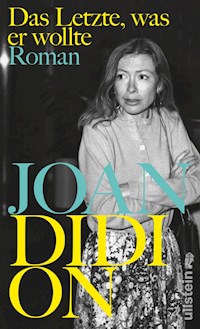12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Ullstein Ebooks in Ullstein Buchverlage
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
"In manchen Breitengraden gibt es vor der Sommersonnenwende und danach eine Zeitspanne, nur wenige Wochen, in der die Dämmerungen lang und blau werden. Während der blauen Stunden glaubt man, der Tag wird nie enden. Wenn die Zeit der blauen Stunden sich dem Ende nähert (und das wird sie, sie endet), erlebt man ein Frösteln, eine Vorahnung der Krankheit: das blaue Licht verschwindet, die Tage werden schon kürzer, der Sommer ist vorbei." In Blaue Stunden erinnert Joan Didion sich an ihre Tochter Quintana, daran,wie es war, sie aufwachsen zu sehen und Abschied zu nehmen, als Quintana mit nur 39 Jahren starb. Eine sehr persönliche Bilanz der großen amerikanischen Autorin und ein ehrliches Buch über Tod und Vergänglichkeit, Erinnerung und Alter, über das, was wir verlieren, und das, was bleibt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
Joan Didion
Blaue Stunden
Aus dem Amerikanischen von Antje Rávic Strubel
Ullstein
Besuchen Sie uns im Internet:
www.ullstein-buchverlage.de
Wir wählen unsere Bücher sorgfältig aus, lektorieren sie gründlich mit Autoren und Übersetzern und produzieren sie in bester Qualität.
Hinweis zu Urheberrechten
Sämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten.
Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken, deshalb ist die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.
In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass sich die Ullstein Buchverlage GmbH die Inhalte Dritter nicht zu eigen macht, für die Inhalte nicht verantwortlich ist und keine Haftung übernimmt.
W. H. Auden: Many Happy Returns. Übersetzt von Antje Rávic Strubel. © 1936, 1940 by W.H. Auden, renewed.
W. H. Auden: Anhalten alle Uhren. Übersetzt von Hanno Helbling. © 1936, 1940 by W.H. Auden, renewed. © der deutschen Übersetzung: 2002 Pendo Verlag in der Piper Verlag GmbH, München und Zürich
Ungekürzte Ausgabe im Ullstein Taschenbuch
1. Auflage Mai 2019
© für die deutsche Ausgabe Ullstein Buchverlage GmbH, Berlin 2012/ UllsteinVerlag
© 2011 Joan Didion All rights reserved including the rights of reproduction in whole or part in any form.
Titel der amerikanischen Originalausgabe: Blue Nights
(Alfred A. Knopf, New York, 2011)
Umschlaggestaltung: Sabine Wimmer, Berlin
Titelabbildung: © 1970 Julian Wasser
ISBN: 978-3-8437-0223-2
E-Book: LVD GmbH, Berlin
Alle Rechte vorbehalten.
Dieses Buch ist für Quintana.
1.
In manchen Breitengraden gibt es vor der Sommersonnenwende und danach eine Zeitspanne, nur wenige Wochen, in der die Dämmerungen lang und blau werden. Diese Phase der blauen Stunden kennt man im subtropischen Kalifornien nicht, wo ich die meiste Zeit, von der hier die Rede sein wird, lebte und wo das Tageslicht schnell zu Ende geht, sich verliert in der Glut der untergehenden Sonne. Aber in New York, wo ich jetzt lebe, kennt man sie. Man nimmt sie das erste Mal wahr, wenn der April endet und der Mai beginnt, eine Veränderung innerhalb der Jahreszeit, noch kaum eine Erwärmung – eigentlich überhaupt keine Erwärmung –, doch auf einmal scheint der Sommer nah zu sein, eine Möglichkeit, ein Versprechen. Man geht an einem Fenster vorbei, man läuft zum Central Park und schwimmt in der Farbe Blau: Das Licht selbst ist blau, und im Verlauf einer Stunde vertieft sich dieses Blau, es wird intensiver, je dunkler es wird, je mehr es vergeht, und schließlich gleicht es dem Blau eines Glases in Chartres an einem klaren Tag oder dem des Tscherenkow-Lichts, das die Brennstäbe in den Abklingbecken von Kernkraftwerken ausstrahlen. Die Franzosen nannten es »l’heure bleue«. Den Engländern war es »the gloaming« – der Abenddämmer. Das Wort »gloaming« strahlt zurück, es wirft ein Echo – glittern, glitzern, glänzen, Glamour –, in seinen Konsonanten trägt es die Bilder von Häusern, die zugeschlossen werden, von dunkelnden Gärten, von Flüssen mit grasbewachsenen Ufern, die durch die Schatten gleiten. Während der blauen Stunden glaubt man, der Tag wird nie enden. Wenn die Zeit der blauen Stunden sich dem Ende nähert (und das wird sie, sie endet), erlebt man ein Frösteln, eine Vorahnung der Krankheit, in diesem Moment stellt man zunächst fest: Das blaue Licht verschwindet, die Tage werden schon kürzer, der Sommer ist vorbei. Dieses Buch heißt »Blaue Stunden«, weil ich mich in der Zeit, als ich es zu schreiben begann, gedanklich immer stärker der Krankheit zugewandt habe, dem Ende des Versprechens, den kürzer werdenden Tagen, der Unausweichlichkeit des Vergehens, dem Sterben des Glanzes. Blaue Stunden sind das Gegenteil sterbenden Glanzes, aber sie sind auch seine Vorboten.
2.
26. Juli 2010
Heute wäre ihr Hochzeitstag gewesen.
Heute vor sieben Jahren nahmen wir die Leis, hawaiianische Blumenketten, aus den Kartons des Floristen und schüttelten das Wasser, in dem sie gelegen hatten, heraus auf das Gras vor der Kathedrale St. John the Divine an der Amsterdam Avenue. Der weiße Pfau fächerte sein Rad auf. Die Orgel spielte. Sie flocht weiße Stephanotis in den dicken Zopf, der über ihren Rücken fiel. Sie zog einen Tüllschleier vor das Gesicht, und die Stephanotis löste sich und fiel herunter. Die Plumeriablüte, die unter ihrer Schulter tätowiert war, war durch den Tüll zu sehen. »Lass es uns tun«, flüsterte sie. Die kleinen Mädchen tänzelten mit Leis und in blassen Kleidern durch den Mittelgang und liefen hinter ihr her zum Hochaltar. Nachdem die Worte gesprochen waren, folgten ihr die kleinen Mädchen durch das Eingangsportal der Kathedrale nach draußen und – an den Pfauen vorbei (zwei blau und grün schillernde Pfaue, ein weißer Pfau) – zum Pfarrgebäude. Es gab Sandwiches mit Gurke und Brunnenkresse, eine pfirsichfarbene Torte von Payard, roséfarbenen Champagner.
Ihre Wünsche, alles.
Sentimentale Wünsche, Dinge, an die sie sich erinnerte.
Ich erinnerte mich auch daran.
Als sie sagte, sie wolle Sandwiches mit Gurke und Brunnenkresse zu ihrer Hochzeit, erinnerte ich mich daran, wie sie Platten mit Gurken- und Brunnenkressesandwiches auf den Tischen verteilt hatte, die wir zum Lunch an ihrem sechzehnten Geburtstag rings um den Pool aufgebaut hatten. Als sie sagte, sie wolle Leis anstelle von Blumenbouquets auf ihrer Hochzeit, erinnerte ich mich daran, wie sie mit drei oder vier oder fünf auf dem Flughafen von Bradley Field in Hartford aus einem Flugzeug stieg und Leis trug, die man ihr beim Abflug in Honolulu eine Nacht zuvor gegeben hatte. An jenem Morgen herrschten in Connecticut minus sechs Grad, und sie hatte keinen Mantel (sie hatte keinen Mantel getragen, als wir von Los Angeles nach Honolulu geflogen waren, wir hatten nicht damit gerechnet, nach Hartford weiterzureisen), aber sie hatte kein Problem darin gesehen. Kinder mit Leis tragen keine Mäntel, erklärte sie mir.
Sentimentale Wünsche.
Am Tag der Hochzeit erfüllten sich alle ihre sentimentalen Wünsche außer einem: Sie hatte gewollt, dass die kleinen Mädchen barfuß in die Kathedrale gingen (Erinnerung an Malibu, sie war immer barfuß gewesen in Malibu, sie hatte immer Splitter in den Füßen gehabt von den Holzbohlen des Piers, Splitter vom Holz und Teer vom Strand und Jod für die Schrammen von den Nägeln in den Treppen dazwischen), aber die kleinen Mädchen hatten für diesen Anlass neue Schuhe und wollten sie tragen.
Mr und Mrs John Gregory Dunne geben sich die Ehre, Sie herzlich einzuladenZur Hochzeit ihrer Tochter Quintana Roo –Mit Mr Gerald Brian MichaelAm Samstag, den sechsundzwanzigsten Juli, vierzehn Uhr –
Die Stephanotis.
War das auch ein sentimentaler Wunsch?
Erinnerte sie sich an die Stephanotis?
Wollte sie sie deshalb, hat sie sie deshalb in ihren Zopf geflochten?
Im Haus in Brentwood Park, in dem wir von 1978 bis 1988 lebten und das von so auffallender Durchschnittlichkeit war (zwei Etagen, die Diele mit Treppe im amerikanischen Kolonialstil, Fensterläden an den Fenstern und ein Wohnzimmer neben jedem Schlafzimmer), dass es in situ schon beinahe idiosynkratisch wirkte (»euer Einfamilienhaus in Brentwood« sagte sie dazu, als wir es kauften, eine Zwölfjährige, die feststellte, dass es nicht ihre Entscheidung war, nicht ihr Geschmack, ein Kind, das den Abstand beanspruchte, den Kinder sich einbilden zu brauchen), gab es Stephanotis, die vor den Terrassentüren wuchsen. Ich streifte die wächsernen Blumen, wenn ich in den Garten hinausging. Vor den Terrassentüren gab es auch Lavendelbeete und Minze, ein Gewirr von Minze, die ein tropfender Wasserhahn hatte üppig werden lassen. Wir zogen in jenem Sommer in dieses Haus, in dem sie in die siebte Klasse der damaligen Westlake-Mädchenschule in Holmby Hills kam. Als wäre es gestern gewesen. Wir zogen in jenem Jahr aus, in dem sie ihren Abschluss am Barnard College machte. Als wäre es gestern gewesen. Die Stephanotis und die Minze waren zu diesem Zeitpunkt eingegangen, vernichtet, nachdem der Mann, der das Haus kaufen wollte, darauf bestanden hatte, dass wir es von Termiten befreiten und es entwesten, indem wir Sulfurylfluorid und Chloropicrin hineinpumpten. Als der Käufer für das Haus geboten hatte, hatte er uns, offenbar um den Vertrag zu besiegeln, über den Makler mitteilen lassen, dass er das Haus haben wollte, weil er sich seine Tochter im Garten bei ihrer Hochzeit vorstellen konnte. Das war einige Wochen bevor er von uns verlangte, das Sulfurylfluorid hineinzupumpen, das die Stephanotis und die Minze vernichtete und auch die rosafarbene Magnolie, die die Zwölfjährige, die sich so beflissen von unserem Einfamilienhaus in Brentwood distanzierte, vom Fenster ihres Zimmers im zweiten Stock aus hatte sehen können. Die Termiten, da war ich ziemlich sicher, würden wiederkommen. Die rosafarbene Magnolie, auch da war ich ziemlich sicher, nicht.
Wir verkauften und zogen nach New York.
Wo ich schon einmal gelebt hatte, von meinem einundzwanzigsten Lebensjahr, als ich gerade mein Studium an der Englischen Fakultät in Berkeley beendet und damit begonnen hatte, bei der Vogue zu arbeiten (ein so grundlegend unnatürlicher Wechsel, dass mir, als die Personalabteilung bei Condé Nast mich darum bat, die Sprachen zu nennen, die ich fließend beherrschte, nur Mittelenglisch einfiel), bis ich neunundzwanzig war und frisch verheiratet.
Wo ich seit 1988 wieder lebe.
Warum sage ich dann, einen Großteil dieser Zeit hätte ich in Kalifornien verbracht?
Warum hatte ich dann ein so deutliches Gefühl von Verrat, als ich meinen kalifornischen Führerschein gegen einen New Yorker eintauschte? War das nicht eine ziemlich einfache Handlung? Dein Geburtstag steht an, dein Führerschein muss erneuert werden, was spielt es für eine Rolle, wo du ihn erneuerst? Was spielt es für eine Rolle, dass du diese eine County-Nummer auf deinem Führerschein hattest, seit er dir zum ersten Mal im Alter von fünfzehneinhalb vom Staat Kalifornien ausgestellt wurde? War da nicht sowieso schon immer ein Fehler auf diesem Führerschein gewesen? Ein Fehler, der dir bekannt war? Hatte dieser Führerschein nicht behauptet, du seiest eins achtundfünfzig? Obwohl du sehr genau wusstest, dass du bestenfalls (die maximale Größe, die jemals erreichte Größe, die Größe, bevor du anderthalb Zentimeter ans Alter verloren hast), obwohl du sehr genau wusstest, dass du bestenfalls eins fünfundfünzig Komma fünf groß bist?
Warum war dieser Führerschein so wichtig?
Worum ging es da?
Machte mir das Abgeben des kalifornischen Führerscheins klar, dass ich nie wieder fünfzehneinhalb sein würde?
Wollte ich das sein?
Oder war die Sache mit dem Führerschein nur ein weiterer Fall von »offensichtlicher Unangemessenheit des auslösenden Ereignisses«?
Ich setze »offensichtliche Unangemessenheit des auslösenden Ereignisses« in Anführungszeichen, weil das nicht meine Formulierung ist.
Karl Menninger verwendet sie in Man Against Himself, um die Neigung zur Überreaktion auf Umstände zu beschreiben, die normal, sogar vorhersagbar erscheinen mögen: eine Neigung, die, wie Menninger sagt, unter suizidgefährdeten Menschen häufig vorkommt. Er zitiert die junge Frau, die depressiv wird und sich umbringt, nachdem sie sich die Haare abgeschnitten hat. Er erwähnt den Mann, der sich umbringt, weil ihm geraten wurde, mit dem Golfspiel aufzuhören, das Kind, das Selbstmord begeht, weil sein Kanarienvogel starb, die Frau, die sich umbringt, nachdem sie zwei Züge verpasst hat.
Beachten Sie: nicht einen Zug; zwei Züge.
Lassen Sie sich das durch den Kopf gehen.
Überlegen Sie, welche besonderen Umstände nötig sind, bevor diese Frau alles aufgibt.
»In diesen Fällen«, berichtet uns Dr. Menninger, »hatten die Haare, das Golfspiel und der Kanarienvogel eine so übertriebene Bedeutung, dass in dem Moment, in dem sie verlorengingen, oder in dem es die bloße Gefahr gab, sie könnten verlorengehen, der Rückstoß durchtrennter emotionaler Bindungen tödlich war.«
Ja, zweifellos, kein Einwand.
»Die Haare, das Golfspiel und der Kanarienvogel« hatten jeweils eine übertriebene Bedeutung bekommen (wie vermutlich der zweite der beiden verpassten Züge), aber warum? Auch Dr. Menninger stellt sich diese Frage, allerdings nur rhetorisch: »Aber wozu sollte es solche überspannten, übertriebenen Bewertungen und falschen Beurteilungen geben?« Glaubte er, diese Frage einfach dadurch beantworten zu können, dass er sie stellte? Dachte er, dass er nichts weiter tun musste, als die Frage zu formulieren, und sich dann in eine Wolke von theoretischen Referenzen zur Psychoanalyse zurückziehen könnte? Sollte ich den Umtausch meines kalifornischen Führerscheins in einen aus New York ernsthaft als eine Erfahrung ausgelegt haben, die »durchtrennte emotionale Bindungen« mit sich brachte?
Betrachtete ich das ernsthaft als einen Verlust?
Betrachtete ich das wirklich als Trennung?
Und bevor wir das Thema der »durchtrennten emotionalen Bindungen« verlassen:
Als ich das Haus in Brentwood Park zum letzten Mal sah, bevor sein Besitzer wechselte, standen wir draußen und schauten zu, wie der dreistöckige Transporter sich entfernte und in die Marlboro Street einbog, mit allem beladen, was wir zu diesem Zeitpunkt besaßen, inklusive eines Volvo-Kombi, auf dem Weg nach New York. Nachdem der Transporter aus dem Blickfeld verschwunden war, gingen wir durch das leere Haus und über die Terrasse, ein Abschiedsmoment, der wegen des noch immer in der Luft hängenden Gestanks des Sulfurylfluorids und der starren toten Blätter dort, wo die Magnolie und die Stephanotis gewesen waren, weniger zärtlich ausfiel. Auch in New York roch ich jedes Mal Sulfurylfluorid, wenn ich einen Karton auspackte. Als ich das nächste Mal nach Los Angeles kam und am Haus vorbeifuhr, war es verschwunden, ein Abriss, um ein oder zwei Jahre später durch ein Haus ersetzt zu werden, das unwesentlich größer war (ein weiteres Zimmer über der Garage, ein halber oder ganzer Meter mehr in der Küche, die bereits groß genug war, um einen anständigen Chickering-Flügel zu beherbergen, der meist unbeachtet blieb), dem aber (für mich) das resolut Herkömmliche des Originals fehlte. Ein paar Jahre später traf ich in einer Washingtoner Buchhandlung die Tochter, von der der Käufer gesagt hatte, er könne sie sich im Garten bei ihrer Hochzeit vorstellen. Sie ging irgendwo in Washington zur Schule (Georgetown? George Washington?), ich war dort, um einen Vortrag über Politik und Prosa zu halten. Sie stellte sich vor. Ich bin in Ihrem Haus aufgewachsen, sagte sie. Eigentlich nicht, hätte ich sagen wollen, aber ich hielt mich zurück.
John sagte immer, wir zogen »wieder« nach New York.
Ich sagte das nie.
Brentwood Park war damals, New York war jetzt.
Brentwood Park vor dem Sulfurylfluorid war eine Zeit gewesen, eine Phase, ein Jahrzehnt, in dem alles miteinander verbunden schien.
Unser Einfamilienhaus in Brentwood.
Genau das war es. Sie nannte es so.
Es gab Autos, einen Swimmingpool, einen Garten.
Es gab Agapanthus-Lilien mit leuchtend blauen Strahlenkränzen, die auf langen Stielen schwankten. Es gab Gauras, Prachtkerzen, Wolken von winzigen kleinen Blüten, die mit bloßem Auge nur bei schwindendem Tageslicht sichtbar wurden.
Es gab englische Chintzrosen und Chinoiserie toile.
Es gab einen Bouvier des Flandres, einen flandrischen Treibhund, der reglos am Treppenabsatz lag, ein Auge offen, wachsam.
Die Zeit vergeht.
Die Erinnerung verblasst, die Erinnerung passt sich an, die Erinnerung fügt sich dem, woran wir uns zu erinnern glauben.
Auch die Erinnerung an die Stephanotis in ihrem Zopf, auch die Erinnerung an das Plumeria-Tattoo, das durch den Tüll zu sehen war.
Es ist grausam, sich sterben zu sehen ohne Kinder. Das sagte Napoleon Bonaparte.
Lässt für die Sterblichen größeres Leid sich erdenken, als sterben zu sehen die Kinder? Das sagte Euripides.
Wenn wir von Sterblichkeit reden, reden wir von unseren Kindern.
Das sagte ich.
Ich denke an diesen Julitag 2003 vor der Kathedrale St. John the Divine und bin erstaunt, wie jung John und ich wirken, wie gut es uns zu gehen schien. Dabei ging es keinem von uns wirklich gut: John hatte sich in diesem Sommer einer Reihe von Herzuntersuchungen unterzogen, zuletzt der Implantation eines Herzschrittmachers, dessen Wirksamkeit fraglich blieb; ich war drei Wochen vor der Hochzeit auf der Straße zusammengebrochen und hatte danach einige Nächte auf der Intensivstation des Columbia-Presbyterian-Krankenhauses mit einer Transfusion wegen ungeklärter gastrointestinaler Blutungen verbracht. »Sie werden jetzt einfach eine kleine Kamera schlucken«, sagten sie auf der Intensivstation, beim Versuch, sich zeigen zu lassen, was die Blutung verursachte. Ich erinnere mich daran, dass ich mich wehrte: Da ich in meinem Leben noch nie ein Aspirin hatte schlucken können, schien es unwahrscheinlich, dass ich eine Kamera schlucken konnte.
»Natürlich können Sie das, es ist nur eine kleine Kamera.«
Eine Pause. Der Versuch von Munterkeit, der ins Betteln abrutschte.
»Es ist wirklich nur eine sehr kleine Kamera.«
Am Ende schluckte ich die sehr kleine Kamera, und die sehr kleine Kamera übertrug die gewünschten Aufnahmen, die nicht zeigen konnten, was die Blutung verursachte, aber zeigten, dass mit ausreichend Betäubungsmitteln jeder eine sehr kleine Kamera schlucken konnte. In einem ähnlichen, nicht weniger wirkungslosen Einsatz medizinischer Spitzentechnologie konnte John sich ein Telefon ans Herz halten, eine Nummer wählen und eine Auswertung seines Schrittmachers bekommen, was bewies, wie mir gesagt wurde, dass in dem jeweiligen Moment, in dem er die Nummer wählte (allerdings nicht unbedingt vorher oder nachher) das Gerät funktionierte.
Die Medizin bleibt, wie ich seither mehr als einmal Anlass hatte festzustellen, eine unvollkommene Kunst.
Und doch schien alles gut zu sein, als wir das Wasser aus den Leis auf das Gras vor der Kathedrale St. John the Divine schüttelten, am 26. Juli 2003. Wären Sie an diesem Tag auf der Amsterdam Avenue vorbeigekommen und hätten einen Blick auf die Hochzeitsgesellschaft geworfen, hätten Sie dann gesehen, wie vollkommen unvorbereitet die Brautmutter auf das war, was passieren würde, bevor das Jahr 2003 überhaupt zu Ende ging? Der Vater der Braut tot am eigenen Esstisch? Die Braut selbst im künstlichen Koma auf der Intensivstation, atmend nur mit Hilfe eines Beatmungsgerätes, umgeben von Ärzten, die vermuteten, dass sie die Nacht nicht überleben würde? Die erste einer ganzen Kaskade von medizinischen Krisen, die erst zwanzig Monate später mit ihrem Tod endete?
Zwanzig Monate, in denen sie insgesamt vielleicht nur einen Monat lang stark genug war, um ohne Hilfe zu laufen?
Zwanzig Monate, in denen sie jeweils wochenlang auf der Intensivstation von vier verschiedenen Krankenhäusern lag?
Auf all diesen Intensivstationen gab es die gleichen blauweiß bedruckten Vorhänge. Auf all diesen Intensivstationen gab es die gleichen Geräusche, das gleiche Gluckern in den Plastikschläuchen, das gleiche Tropfen der Infusionen, das gleiche Trachealrasseln, den gleichen Alarm. Auf all diesen Intensivstationen gab es dieselben Vorschriften, um weitere Infektionen zu verhindern, das Anlegen doppelter Kittel, die Überziehschuhe aus Papier, die OP-Mütze, die Atemmaske, die Handschuhe, die sich nur schwer anziehen ließen und Hautreizungen verursachten, die rot wurden und bluteten. Auf all diesen Intensivstationen rannten sie über den Flur, wenn ein Signal ertönte, die Füße, die auf den Boden hämmerten, das Rattern des Notfallwagens.