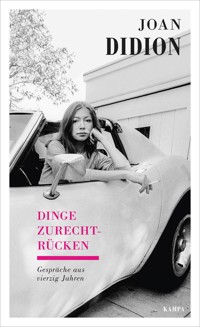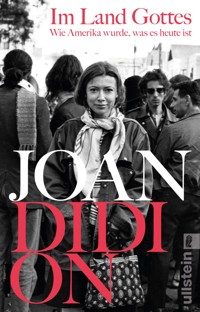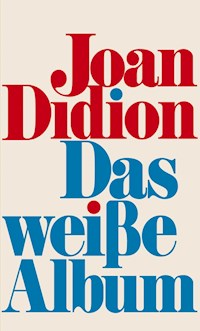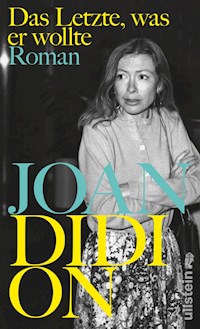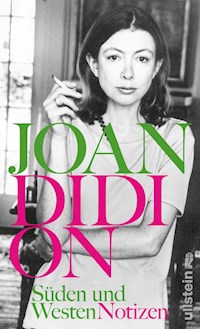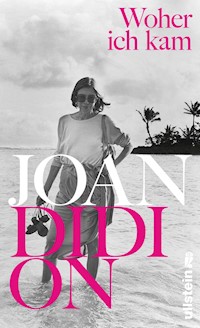
16,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Ullstein eBooks
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
»Unwiderstehlich... Ein Liebeslied über den Ort, an dem ihre Familie seit Generationen lebt, aber ein Liebeslied voller Fragen und Zweifel.« Michiko Kakutani, New York Times Joan Didion wurde in Sacramento geboren und verbrachte die meiste Zeit ihres Lebens in Kalifornien. In Woher ich kam spürt sie der Geschichte und den Mythen dieses Landstrichs nach, und denen ihrer Familie, die seit vielen Generationen an der Westküste beheimatet ist. Sie beschreibt vornehmlich die weibliche Ahnenreihe, aus der sie stammt, von der Ur-ur-ur-ur-ur-Großmutter Elisabeth Scott, geboren 1766 in Virginia, bis zu ihrer Mutter Eduene Jerrett Didion, die 2001 starb und in Joan Didions Augen viele der »Verwirrungen und Widersprüche kalifornischen Lebens« verkörpert hatte. Sie schreibt über die Pioniersfrau und die Rodney-King-Unruhen im Los Angeles der 90er Jahre, über den Bau der ersten Eisenbahn und die kalifornische Besessenheit mit Gefängnissen, und immer wieder über die eigene, höchst wechselvolle Beziehung zu ihrer Heimat.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 269
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Woher ich kam
Die Autorin
Joan Didion, geboren 1934 in Sacramento, Kalifornien, arbeitete als Journalistin für verschiedene amerikanische Zeitungen und war u.a. Redakteurin der »Vogue«. Sie hat fünf Romane und zahlreiche Sachbücher veröffentlicht, darunter »Das Jahr magischen Denkens«. Ihre Essays und Reportagen sind ein zentrales Element ihres Gesamtwerkes. Joan Didion lebt in New York City.Antje Rávik Strubel lebt und arbeitet als Schriftstellerin und Übersetzerin in Potsdam. Zuletzt erschienen von ihr »In den Wäldern des menschlichen Herzens« sowie Übersetzungen der Werke von Karolina Ramqvist und Lucia Berlin.
Das Buch
In ihrem Memoir »Woher ich kam« spürt Joan Didion der Geschichte und den Mythen Kaliforniens nach, und denen ihrer Familie, die seit vielen Generationen an der Westküste beheimatet ist. Sie beschreibt vornehmlich die weibliche Ahnenreihe, aus der sie stammt, von der Ur-ur-ur-ur-ur-Großmutter Elisabeth Scott, geboren 1766 in Virginia, bis zu ihrer Mutter Eduene Jerrett Didion, die 2001 starb und in Joan Didions Augen viele der »Verwirrungen und Widersprüche kalifornischen Lebens« verkörpert hatte. Sie schreibt über die Pioniersfrau und die Rodney-King-Unruhen im Los Angeles der 90er Jahre, über den Bau der ersten Eisenbahn und die kalifornische Besessenheit mit Gefängnissen, und immer wieder über die eigene, höchst wechselvolle Beziehung zu ihrer Heimat.
Joan Didion
Woher ich kam
Internationale Literatur
Aus dem Amerikanischen von Antje Rávik Strubel
Ullstein
Besuchen Sie uns im Internet:www.ullstein-buchverlage.de
ISBN: 978-3-550-2089-2Deutsche Erstausgabe© 2003 by Joan DidionAll rights reserved including the rightsof reproduction in whole or in part in any form© der deutschsprachigen Ausgabe2019 by Ullstein Buchverlage GmbH, BerlinAlle Rechte vorbehaltenUmschlagfoto: Quintana Roo DunneAutorenfoto: Brigitte LacombeE-Book-Konvertierung powered by pepyrus.com
Emojis werden bereitgestellt von openmoji.org unter der Lizenz CC BY-SA 4.0.
Auf einigen Lesegeräten erzeugt das Öffnen dieses E-Books in der aktuellen Formatversion EPUB3 einen Warnhinweis, der auf ein nicht unterstütztes Dateiformat hinweist und vor Darstellungs- und Systemfehlern warnt. Das Öffnen dieses E-Books stellt demgegenüber auf sämtlichen Lesegeräten keine Gefahr dar und ist unbedenklich. Bitte ignorieren Sie etwaige Warnhinweise und wenden sich bei Fragen vertrauensvoll an unseren Verlag! Wir wünschen viel Lesevergnügen.
Hinweis zu UrheberrechtenSämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken, deshalb ist die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass sich die Ullstein Buchverlage GmbH die Inhalte Dritter nicht zu eigen macht, für die Inhalte nicht verantwortlich ist und keine Haftung übernimmt.
Inhalt
Titelei
Die Autorin / Das Buch
Titelseite
Impressum
Teil Eins
1
2
3
4
5
6
7
8
Teil Zwei
1
2
3
4
5
6
7
Teil Drei
1
2
3
4
Vierter Teil
1
2
3
Anhang
Quellenangaben
Social Media
Vorablesen.de
Cover
Titelseite
Inhalt
Teil Eins
.
Widmung
Dieses Buch ist meinem Bruder James Jerrett Didion und unseren Eltern Eduene Jerrett Didion und Frank Reese Didion gewidmet, in Liebe.
Teil Eins
1
Meine Urururururgroßmutter Elizabeth Scott wurde 1766 geboren, wuchs im Grenzland zwischen Virginia und Carolina auf, heiratete im Alter von sechzehn Jahren einen Achtzehnjährigen, der an der Revolution und den Cherokee-Expeditionen teilgenommen hatte und Benjamin Hardin IV hieß, zog mit ihm nach Tennessee und Kentucky und starb in einem anderen Grenzland, dem Oil Trough Bottom am Südufer des White River in der Gegend des heutigen Arkansas, die damals zu Missouri gehörte. Von Elizabeth Scott Hardin ist überliefert, dass sie sich während eines Indianerüberfalls mit ihren Kindern in einer Höhle versteckte (es hieß, es wären elf gewesen, von denen aber nur acht erfasst wurden) und eine so gute Schwimmerin war, dass sie einen Fluss bei Hochwasser mit einem Baby im Arm durchqueren konnte. Von ihrem Mann hieß es, er habe, um sie zu verteidigen oder aus nur ihm bekannten Gründen, zehn Männer getötet, die englischen Soldaten und Cherokees nicht mitgerechnet. Das mag stimmen oder es mag, gemäß der mündlichen Überlieferung dieser Gegend, die zu Geschichten über Gesten der Entschiedenheit neigt, Ausschmückung sein. Ein Cousin, der die Sache recherchierte, erzählte mir, dass der Ehemann, unser Urururururgroßvater, »in der gedruckten Standardausgabe der Geschichte von Arkansas als ›Old Colonel Ben Hardin, der Held so vieler Indianerkriege‹ auftaucht«. Elizabeth Scott Hardin hatte hellblaue Augen und schlimme Kopfschmerzen. Der White River, an dem sie lebte, war derselbe White River, an dem anderthalb Jahrhunderte später James McDougal sein missglücktes Whitewater-Erschließungsprojekt ansiedeln sollte. Dieses Land ist in gewisser Hinsicht nicht so groß, wie wir gern sagen.
Sonst weiß ich nichts über Elizabeth Scott Hardin, aber ich habe ihr Rezept für Maisbrot und für India-Würze: Ihre Enkelin brachte diese Rezepte mit nach Westen, als sie 1846 mit dem Donner-Reed-Treck bis zum Humboldt Sink reiste, um dann nach Norden in Richtung Oregon weiterzuziehen, weil sich ihr Ehemann, Reverend Josephus Adamson Cornwall, entschlossen hatte, der erste Wanderpfarrer der Cumberland-Presbyterian-Kirche in einer Gegend zu werden, die damals Oregon hieß. Weil diese Enkelin, Nancy Hardin Cornwall, meine Urururgroßmutter war, besitze ich außer ihren Rezepten eine Applikationsstickerei, die sie auf der Sierra-Überquerung anfertigte. Diese Stickerei aus grüner und roter Baumwolle auf einem Stück Musselin hängt in meinem Esszimmer in New York und hing vorher im Wohnzimmer eines Hauses am Pazifik, in dem ich wohnte.
Ich besitze auch eine Fotografie des Markierungssteins, der sich an der Stelle befand, an der die Hütte gestanden hatte, in der Nancy Hardin Cornwall mit ihrer Familie den Winter von 1846/47 verbrachte, als sie knapp vor ihrem Ziel im Willamette Valley gewesen, aber nicht in der Lage waren, ihre Wagen durch einen steilen Hohlweg des Umpqua Rivers zu manövrieren, ohne Josephus Cornwalls Bücher zurücklassen zu müssen (diese Möglichkeit schien sich nur ihren Töchtern aufgetan zu haben). »Zur Erinnerung an Rev. J. A. Cornwall und Familie« lautet die Inschrift auf dem Stein. »In der Nähe dieses Ortes errichteten sie die erste Einwanderer-Hütte von Douglas County, daher der Name Cabin Creek. Die Familie überwinterte hier von 1846–1847 und wurde aus großer Not gerettet vom Neffen Israel Stoley, der ein guter Jäger war. Die Indianer waren freundlich. Die Cornwalls reisten ein Stück des Wegs mit dem unglückseligen Donner-Treck in Richtung Westen.«
Meiner Mutter wurde die Fotografie des Markierungssteins von Oliver Huston, dem Cousin ihrer Mutter geschickt, der ein solch leidenschaftlicher Familienhistoriker war, dass er die Nachkommen noch 1957 auf »eine Gelegenheit« aufmerksam machte, die »kein Nachkomme verpassen sollte«, und zwar die Übergabe des »alten Kartoffelstampfers, den die Familie der Cornwalls 1846 auf dem Weg durch die Prärie mitgebracht hatte«, zusammen mit anderen Gegenständen, an das Pacific University Museum. Weiter heißt es in Oliver Hustons Brief: »Diese Vorgehensweise ermöglicht es allen Nachkommen der Geigers und Cornwalls, diese Gegenstände in Zukunft jederzeit anschauen zu können, einfach, indem sie das Museum besuchen.« Ich selbst habe noch nicht die Gelegenheit dazu gefunden, dem Kartoffelstampfer einen Besuch abzustatten, aber ich habe ein Typoskript mit einigen Erinnerungen an diese Monate, die später als Cabin Creek bezeichnet wurden, Erinnerungen, die Narcissa entlockt sind, einem der zwölf Kinder von Nancy Hardin Cornwall:
Wir waren etwa zehn Meilen vom Umpqua River entfernt, und die Indianer, die dort lebten, kamen vorbei und verbrachten den größten Teil des Tages mit uns. Es gab einen, der Englisch sprach, und er sagte Mutter, dass die Rogue-River-Indianer kämen, um uns zu töten. Mutter sagte ihnen, dass, wenn sie uns Probleme machen sollten, im Frühjahr die Bostoner (der indianische Name für Weiße) kommen und sie alle vernichten würden. Ob das irgendeine Wirkung hatte oder nicht, weiß ich nicht, aber jedenfalls töteten sie uns nicht. Aber wir dachten immer, dass sie eines Tages aus diesem Grund kommen würden. Einmal war Vater mit Lesen beschäftigt und bemerkte nicht, dass sich das Haus mit seltsamen Indianern füllte, bis Mutter davon sprach … In dem Augenblick, in dem Vater sie erblickte, stand er auf, nahm seine Pistolen und forderte die Indianer auf, mit hinauszukommen und ihn schießen zu sehen. Sie folgten ihm nach draußen, hielten aber Abstand. Die Pistolen waren für sie ein großes Kuriosum. Ich bezweifle, dass sie je zuvor welche gesehen hatten. Sobald sie alle die Hütte verlassen hatten, sperrte Mutter die Tür zu und ließ sie nicht mehr herein. Vater unterhielt sie draußen bis zum Abend, als sie auf ihre Ponies stiegen und davonritten. Sie kehrten nie mehr zurück, um uns Probleme zu machen.
In einem anderen Zimmer des Hauses am Pazifik hing eine Decke, die von einer anderen Überquerung stammte, eine Decke, die meine Ururgroßmutter Elizabeth Anthony Reese auf einer Reise im Wagen gefertigt hatte, auf der sie ein Kind begraben, ein anderes zur Welt gebracht, zweimal Gebirgsfieber bekommen und abwechselnd ein Gespann Ochsen, ein Eselsgespann und eine 22-köpfige Viehherde vor sich her getrieben hatte. In dieser Decke von Elizabeth Reese waren mehr Stiche, als ich je in einer Decke gesehen habe, eine verrückte und sinnlose Häufung von Stichen, und als ich sie aufhängte, wurde mir klar, dass sie sie eines Tages mitten in der Überquerung fertiggestellt hatte, irgendwo in der Wildnis von Trauer und Krankheit, und einfach weiternähte. Aus dem Bericht ihrer Tochter:
»Tom war am ersten Tag der Überquerung krank und hatte Fieber, keine Aussicht auf einen Arzt. Er war nur einen oder zwei Tage krank, bevor er starb. Er musste sofort begraben werden, weil der Wagentreck gleich weiterzog. Er war zwei Jahre alt, und wir waren froh, eine Truhe zu bekommen, in der wir ihn begraben konnten. Ein Freund gab uns die Truhe. Als das Baby meiner Tante im nächsten Jahr starb, trug sie es noch lange in ihren Armen, ohne es irgendjemanden wissen zu lassen, aus Angst, sie würden das Baby begraben, bevor eine Mission erreicht war.«
Diese Frauen in meiner Familie scheinen pragmatisch gewesen zu sein, und in Anbetracht des klaren Schnittes, den sie in Bezug auf alle und alles machten, was sie kannten, waren sie vom tiefsten Instinkt her krankhaft radikal. Sie konnten schießen und sie konnten mit Vieh umgehen, und wenn ihre Kinder aus ihren Schuhen herauswuchsen, lernten sie von den Indianern, wie man Mokassins anfertigte. »Eine alte Dame in unserem Treck brachte meiner Schwester bei, Blutpudding zu machen«, erinnerte sich Narcissa Cornwall. »Nachdem man ein Reh oder einen Stier getötet hat, schneidet man ihm die Kehle durch und fängt das Blut auf. Man fügt Talg hinzu und ein bisschen Salz und Schrot oder Mehl, wenn man welches hat, und bäckt es. Wenn man sonst nichts weiter zu essen hat, ist es ziemlich gut.« Gewöhnlich war ihnen jedes Mittel recht, um ein unsicheres Ziel zu verfolgen. Gewöhnlich vermieden sie es, sich länger damit aufzuhalten, was dieses Ziel bedeuten mochte. Fiel ihnen nichts mehr zu tun ein, zogen sie tausend Meilen weiter, legten einen neuen Garten an: Bohnen und Kürbis und Platterbsen aus Samen, die sie vom letzten Ort mitgebracht hatten. Die Vergangenheit mochte aufgegeben, Kinder beerdigt und Eltern zurückgelassen worden sein, aber die Samen wurden mitgenommen. Sie waren Frauen, diese Frauen in meiner Familie, die kaum Zeit dazu hatten, sich etwas zweimal zu überlegen, die keine große Vorliebe für Mehrdeutigkeiten besaßen, und die später, als es Zeit oder Vorlieben gab, eine Neigung zu kleineren und größeren Störungen, scheinbar exzentrischen Verlautbarungen, dunklem Verwirrtsein und dem Ansteuern von Orten entwickelten, die nicht direkt auf dem Plan standen; eine Neigung, die ich als für diese Gegend typisch verstehen lernte.
Mutter hielt Charakter für die treibende Kraft im Leben und deshalb für etwas, das unser Leben hier lenkte und auf unser Schicksal im zukünftigen Leben verwies. Ihr Leben war bestimmt von festen und unverrückbaren Prinzipien, Zielen und Motiven. Ihr allgemeiner Gesundheitszustand war ausgezeichnet, und in der Mitte ihres Lebens schien sie beinahe außerstande, zu ermüden. Im Winter wie im Sommer, zu allen Jahreszeiten und täglich, außer sonntags, war ihr Leben ein unermüdlicher Arbeitskreislauf. Sich um die Familie kümmern, für bezahlte Hilfe vorsorgen, Besucher, Prediger und andere bei Geselligkeiten unterhalten, die es häufig gab.
Das war die Sichtweise Nancy Hardin Cornwalls, wie sie von ihrem Sohn Joseph, der während der Überquerung dreizehn war, überliefert wurde. Nancy Hardin Cornwalls Tochter Laura, während der Überquerung zwei Jahre alt, hatte eine nicht ganz unähnliche Sichtweise: »Als Tochter der Amerikanischen Revolution war sie selbstverständlich eine mutige Frau, schien nie Angst vor Indianern zu haben oder sich von Not und Elend zermürben zu lassen.«
Ein Foto:
Eine Frau steht auf einem Felsen in der Sierra Nevada, möglicherweise 1905.
Eigentlich ist es nicht einfach nur ein Felsen, sondern ein Felsvorsprung aus Granit: ein vulkanischer Aufschluss. Ich benutze Worte wie »vulkanisch« und »Aufschluss«, weil mein Großvater mir beigebracht hat, sie zu benutzen, und eines seiner Goldgräberlager im Hintergrund des Fotos zu sehen ist. Er brachte mir auch bei, goldhaltige Erze von den glitzernden, aber wertlosen Serpentinen zu unterscheiden, die ich als Kind mehr mochte; eine zwecklose Bildung, da es zu dieser Zeit nicht länger lohnenswerter war, nach Gold zu graben als nach Serpentinen zu graben, und die Unterscheidung eine rein akademische, oder möglicherweise Wunschdenken.
Das Foto. Der Felsvorsprung. Das Lager im Hintergrund.
Und die Frau: Edna Magee Jerrett. Sie ist Nancy Hardin Cornwalls Urenkelin, sie wird in Kürze meine Großmutter sein. Sie ist Black Irish, englisch, walisisch, möglicherweise (das ist unklar) zu einem Bruchteil jüdisch vonseiten ihres Großvaters William Geiger, der gern behauptete, einen deutschen Rabbi zum Vorfahren gehabt zu haben, aber selbst presbyterianischer Missionar auf den Sandwich Islands und an der pazifischen Küste war; möglicherweise (das ist noch unklarer) zu einem kleineren Bruchteil indianisch, irgendwo aus einem Grenzland, oder vielleicht sagt sie es nur gern, weil sie in der Sonne so schnell braun wird, was sie, wie ihr gesagt wurde, nicht soll. Sie wuchs in einem Haus an der Küste von Oregon auf, das voller aussagekräftiger Kuriositäten des Ortes und der Zeit steckte: Muscheln und Samen aus Tahiti an Schnüren, geschnitzte Emu-Eier, Vasen aus Satsuma, Speere vom Südpazifik, eine Miniatur des Taj Mahal aus Alabaster und die Körbe, die ihre Mutter von den ortsansässigen Indianern bekommen hatte. Sie ist ziemlich schön. Sie ist auch ziemlich verwöhnt, obwohl sie genug über Berge weiß, um ihre Schuhe jeden Morgen aus Vorsicht vor Schlangen auszuschütteln, und neigt eindeutig stärker zu Annehmlichkeiten, als man es sich in diesem Goldgräberlager in der Sierra Nevada in der fraglichen Zeit leisten konnte. Auf diesem Foto trägt sie beispielsweise ein langes Wildlederkostüm, das beim teuersten Schneider in San Francisco für sie angefertigt wurde. »Ihre Hüte waren unbezahlbar«, hatte ihr Vater, ein Schiffskapitän, zu ihren Verehrern gesagt, um sie zu entmutigen, und vielleicht hatten sich alle entmutigen lassen außer meinem Großvater, ein treuherziger Mann von der Georgetown Division, der Bücher las.
Es war eine Extravaganz ihres Wesens, die sie ihr ganzes Leben lang besitzen sollte. Da sie selbst ein Kind war, wusste sie, was Kinder wollten. Als ich sechs war und Mumps hatte, brachte sie mir als Trost nicht ein Malbuch, keine Eiscreme oder ein Schaumbad mit, sondern dreißig Milliliter teuren Parfüms, Elizabeth Ardens »On Dit«, in einer Kristallflasche, die mit goldenem Band verschlossen war. Als ich elf war und mich weigerte, weiter in die Kirche zu gehen, gab sie mir als Anreiz nicht die Angst vor Gott, sondern einen Hut, nicht irgendeinen Hut, keinen manierlichen Glockenhut für Kinder oder eine Baskenmütze, sondern einen Hut, hauchzarte italienische Fäden aus Stroh und französische Seidenkornblumen und ein Label aus schwerer Seide, auf dem »Lilly Daché« stand. Sie machte Champagnerpunsch für die Enkel, die am Neujahrsabend bei ihr zurückgelassen wurden. Im Zweiten Weltkrieg meldete sie sich freiwillig zur Arbeit am Band in der Konservenfabrik Del Monte in Sacramento, um die Tomatenernte im Central Valley zu retten, warf einen Blick auf das Fließband und bekam jene schlimmen Kopfschmerzen, die ihre Urgroßmutter zusammen mit den Samen nach Westen gebracht hatte, und verbrachte den ersten und einzigen Tag am Band unter Tränen, die ihr übers Gesicht liefen. Als Buße verbrachte sie die restliche Zeit des Krieges damit, Socken zu stricken, die das Rote Kreuz an die Front schickte. Die Wolle, die sie kaufte, um diese Socken zu stricken, war Kaschmir in den vorgeschriebenen Farben. Sie hatte Vicuña-Mäntel, handgemachte Seife und nicht viel Geld. Ein Kind konnte sie zum Weinen bringen, und es beschämt mich, das manchmal getan zu haben.
Sie war über vieles, was in ihrem Erwachsenenleben geschah, fassungslos. Einer ihrer Brüder, der zur See fuhr, verlor den inneren Halt, nachdem sein Schiff im Atlantik auf eine Mine gelaufen war; der Sohn eines anderen Bruders beging Selbstmord. Sie war Zeugin des plötzlichen Abgleitens ihrer einzigen Schwester ins Verrücktsein. Sie war, wie es schon von ihrer Großmutter geheißen hatte, im Glauben erzogen worden, ihr Leben würde ein unermüdlicher Kreislauf fester und unverrückbarer Prinzipien, Ziele, Motive und Aktivitäten sein, und doch fiel ihr manchmal nichts anderes ein, als nach Downtown zu laufen, sich bei Bon Marché die Kleidung anzuschauen, die sie sich nicht leisten konnte, einen geknackten Krebs zum Abendessen zu kaufen und mit dem Taxi nach Hause zu fahren. Sie starb, als ich dreiundzwanzig war, und ich habe von ihr eine Petit-Point-Handtasche, zwei Gemälde, die sie als junges Mädchen in einer episkopalen Klosterschule mit Wasserfarben gemalt hatte (ein Stillleben mit Wassermelone, die Mission in San Juan Capistrano, die sie nie gesehen hatte), zwölf Buttermesser, die sie bei Shreve’s in San Francisco hatte anfertigen lassen, und fünfzig Anteile an Aktien von Transamerica. In ihrem Testament stand die Anweisung, die Aktien für etwas zu verkaufen, das ich gern haben würde und mir nicht leisten konnte. »Worauf soll sie sich dann noch freuen können«, schimpfte meine Mutter über meine Großmutter angesichts der dreißig Milliliter »On Dit«, des Lilly-Daché-Huts, des schwarzen Schals zur Linderung der Qual der Tanzschule, der mit Jettperlen bestickt war. Im Theater der Generationen hatte meine Mutter trotz eines Wagemuts, der, wie ich begriff, weit außerhalb des Spektrums meiner Großmutter lag, die Rolle zugewiesen bekommen, die in den Regieanweisungen als die der Vernünftigen beschrieben wurde. »Sie wird schon was finden«, sagte meine Großmutter immer, eine beruhigende Einsicht, wenn nicht sogar eine, die sich voll und ganz auf ihre eigene Erfahrung stützte.
Ein anderes Foto, eine andere Großmutter: Ethel Reese Didion, die ich nie kennengelernt habe. Sie erkrankte in den letzten Tagen der Grippeepidemie von 1918, bekam Fieber und starb, und am Morgen des trügerischen Waffenstillstands hinterließ sie einen Mann und zwei kleine Jungen, einer davon mein Vater. Oft erzählte mir mein Vater, dass sie im Glauben gestorben sei, der Krieg wäre vorbei. Er erzählte mir das jedes Mal so, als wäre es von größter Bedeutung, und vielleicht war es das auch, denn bei genauerer Überlegung ist es das Einzige, was er mir je von ihr und darüber erzählt hat, welche Meinung sie zu irgendeinem Thema hatte. Ihre jüngere Schwester, meine Großtante Nell, erzählte nur, dass meine Großmutter »nervös« und »anders« gewesen sei. Anders als wer, fragte ich dann. Tante Nell zündete sich eine weitere Zigarette an, die sie sofort einem schweren Quartzaschenbecher anvertraute, und schob ihre großen Ringe die dünnen Finger auf und ab. Ethel war nervös, wiederholte sie schließlich. Man durfte Ethel nie necken. Ethel war, na ja, sie war anders.
Auf diesem Foto, das um 1904 aufgenommen wurde, ist Ethel auf einem Picknick der Grange-Gesellschaft in Florin zu sehen, damals eine Farmersiedlung südlich von Sacramento. Noch hat sie ihren Mann, meinen Großvater, nicht geheiratet, dessen erstaunliche Verschlossenheit ihrer Familie so unerklärlich blieb, den Mann, den ich manchmal »Großvater Didion« nannte, aber seit meiner Kindheit bis zu seinem Tod 1953 nie direkt auf eine Weise ansprach, die vertraulicher gewesen wäre als »Mr Didion«. Auf diesem Bild ist sie noch Ethel Reese und trägt eine weiße Hemdbluse und einen Strohhut. Ihre Brüder und Cousins, Farmersöhne mit einem Hang zu Vergnügungen und der Gabe, Dinge ohne Groll zu verlieren, lachen über etwas, das sich dem Blickfeld der Kamera entzieht. Tante Nell, die Jüngste, flitzt zwischen ihren Beinen herum. Meine Großmutter hat ein zaghaftes Lächeln. Ihre Augen sind gegen die Sonne oder gegen die Kamera geschlossen. Mir wurde gesagt, ich hätte ihre Augen, »Reese-Augen«, Augen, die sofort anfangen, sich zu röten oder zu tränen, sobald sie mit Sonne, Schlüsselblumen oder erhobenen Stimmen in Berührung kommen, und mir wurde auch gesagt, ich hätte etwas von ihrem »Anderssein«, wäre wie sie alles andere als ungezwungen, wenn getanzt werden soll, aber diesem Bild von Ethel Reese beim Florin Grange-Picknick um 1904 ist von all dem nichts zu entnehmen. Ihre Tante Catherine Reese, die ein Kind war, als die Familie der Reeses 1852 mit dem Treck nach Westen zog, erinnert sich an die letzte Phase und an die Folgen der Reise, auf der ihre Mutter die Decke mit der verrückten Anhäufung von Stichen machte:
An Carson City vorbeigekommen, die ganze Zeit bergauf, bis Lake Tahoe und weiter hinab. Lebten in den Bergen, als Vater Schüttelfrost und Fieber hatte. Mussten unseren Viehtreiber aufgeben, und Mutter kümmerte sich um das Vieh. Stießen auf zwei oder drei Familien vom alten Landvolk und wohnten bei ihnen, bis wir ins Haus eines Schafhirten zogen und den Winter dort mit ihm verbrachten, ehe Vater ein Haus auf einer Farm auf einem Hügel in der Nähe von Florin bauen ließ, Regierungsland für 2 Dollar der Morgen. Vater bezahlte 360 Morgen in bar, da er vom Verkauf des Gespanns etwas Geld hatte. Begannen mit Getreideanbau und Viehzucht, hatten zwölf Kühe und produzierten und verkauften Butter, Eier und Hühner, hin und wieder ein Kalb. Fuhren einmal die Woche nach Sacramento, um die Sachen zu verkaufen. Vater und Dave kümmerten sich ums Buttern, Mutter und ich ums Melken. Ich lief sechs Meilen zur Schule, die dort war, wo jetzt am Stockton Boulevard der Friedhof ist.
Diese erste Reese-Farm in Florin, die nach ein paar Jahren von 360 Morgen auf 640 Morgen vergrößert wurde, war bis in mein Erwachsenenleben hinein noch immer im Besitz meiner Familie, oder, um präziser zu sein, im Besitz einer Gesellschaft namens Elizabeth Reese Estate Company, deren Gesellschafter allesamt Familienmitglieder waren. Gelegentlich redeten mein Vater, mein Bruder und ich spätnachts davon, die Anteile unserer Cousins an der »Hügelfarm«, wie wir sie immer noch nannten, aufzukaufen (es gab nicht wirklich einen »Hügel«, aber auf dem ursprünglichen Ackerland hatte es eine Erhebung von vielleicht dreißig Zentimetern gegeben), ein Schritt, der ihnen gefallen hätte, da die meisten von ihnen verkaufen wollten. Ich habe nie herausfinden können, ob das Interesse meines Vaters gerade an dieser Farm sentimentale Gründe hatte; er sprach von ihr nur als kaltem Grundbesitz auf kurze Sicht, aber potenziell heißem auf lange Sicht. Meine Mutter hatte kein Interesse daran, die Hügelfarm zu behalten oder überhaupt irgendein Stück Land in Kalifornien: Kalifornien, sagte sie, wäre mittlerweile zu reglementiert, zu stark besteuert, zu teuer. Stattdessen redete sie begeistert davon, ins australische Outback zu gehen.
»Eduene«, sagte mein Vater protestierend.
»Das würde ich«, insistierte sie wagemutig.
»Kalifornien einfach verlassen? Alles aufgeben?«
»Innerhalb einer Minute«, sagte sie, und da sprach die lupenreine Herkunft aus ihr, der Ururururenkelin von Elizabeth Scott.
»Vergiss es.«
2
»Vor hundert Jahren verschoben unsere Ururgroßeltern die Grenzen Amerikas nach Westen, nach Kalifornien.« So begann die Rede, die ich zum Abschluss der achten Klasse auf der Arden-Schule in der Gegend von Sacramento hielt. Der Gegenstand war: »Unser kalifornisches Erbe.« Tiefer in ein Thema einsteigend, das von meiner Mutter und meinem Großvater gefördert wurde, fuhr ich fort, wobei mich die Tatsache, dass ich ein blassgrünes Organdykleid und die Kristallhalskette meiner Mutter trug, stärker ermutigte, als es der Fall hätte sein sollen: