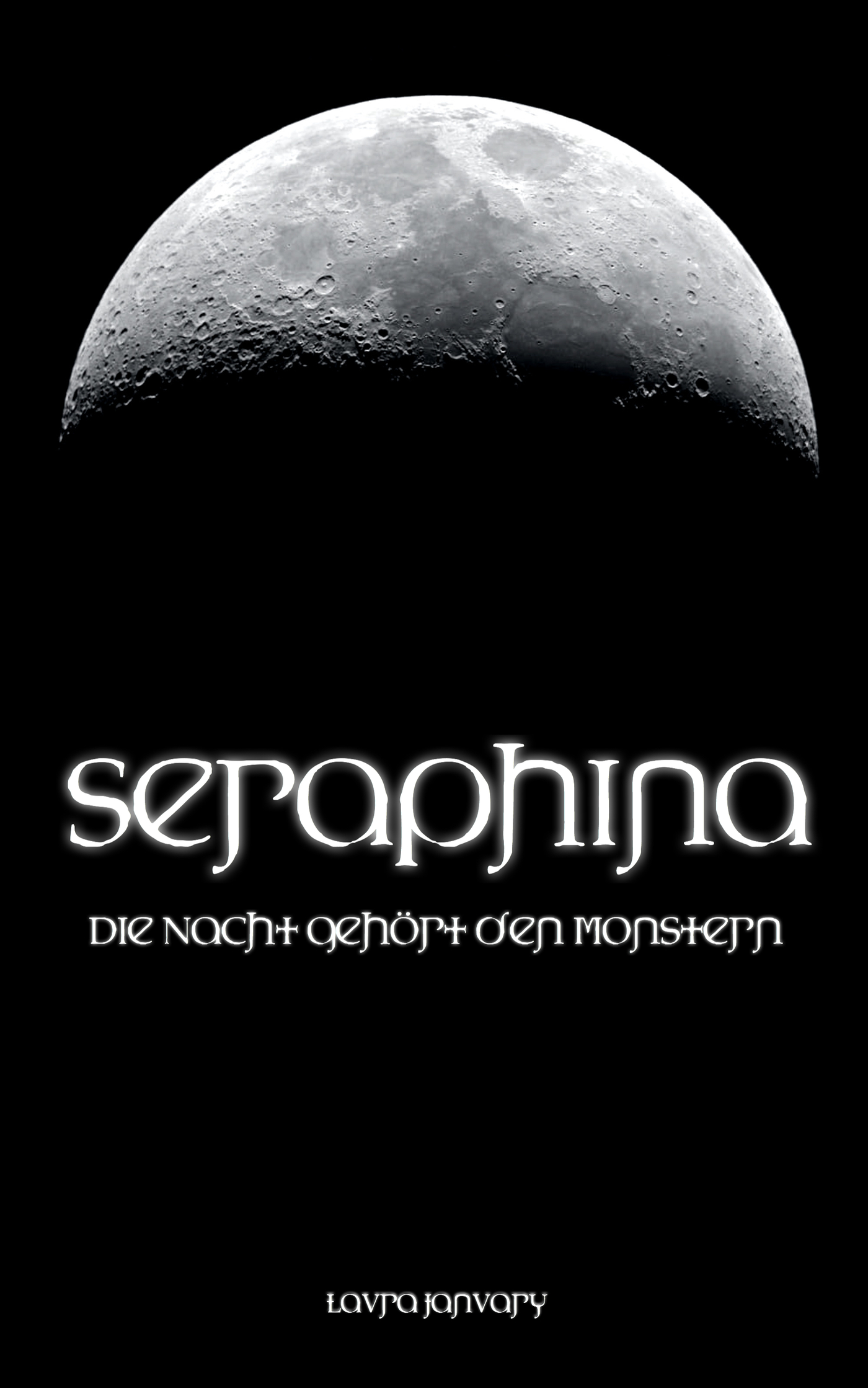
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: neobooks
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Die Nacht gehört
- Sprache: Deutsch
Seraphina lebt in einer Welt, die allmählich von übernatürlichen Wesen eingenommen wird. Vampire, Werwölfe, Elfen und andere Monster drängen die Menschen immer mehr zurück - Menschen, wie auch Seraphina und ihre beste Freundin es sind. Als das Geld knapp wird, überwindet sich Seraphina dazu, etwas von ihrem Blut an einen Vampir zu verkaufen - doch als dieser plötzlich mehr als die abgemachte Menge verlangt, ist es ausgerechnet ein Werwolf, der ihr das Leben rettet. In Adam findet sie einen guten Freund, doch der Vampir gibt nicht so schnell auf und Seraphina verstrickt sich immer mehr in die Welt der Übernatürlichen...
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 368
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Laura January
Seraphina
Die Nacht gehört den Monstern
Dieses ebook wurde erstellt bei
Inhaltsverzeichnis
Titel
Seraphina
Prolog – Die Nacht gehört den Monstern
01 – Verhängnisvolle Entscheidung
02 – Das Mädchen und der Wolf
03 – Das Nachbrennen
04 – Neue Erkenntnisse
05 – Eine andere Welt
06 – Ein Schaf im Wolfspelz
07 – Der Fluch der Langeweile
08 – Das weise Volk
09 – Der Phönix
10 – Doppeldate
11 – Monatsende
12 – Das zweite Gesicht
13 – Atempause
14 – Kleine Überraschungen
15 – Schwingen der Freiheit
Impressum neobooks
Seraphina
Seraphina
Die Nacht gehört den Monstern
Prolog – Die Nacht gehört den Monstern
Prolog - Die Nacht gehört den Monstern
Die Vampire waren die ersten Übernatürlichen, die sich den Menschen offenbart hatten. Niemand kann heute noch sagen, was genau sie vor elf Jahren dazu bewegt hatte, ihr Versteckspiel aufzugeben, doch was es auch war, es hatte die Welt verändert. Die Monster hielten sich nicht damit auf, irgendwelche Warnungen auszusprechen, sondern stürzten sich auf die ahnungslosen Menschen, die schon seit Ewigkeiten ihre Nahrung waren. Doch zum ersten Mal bemühten sie sich nicht mehr darum, die Gedächtnisse ihrer Opfer zu löschen oder die Leichen zu verstecken. Sie wussten, sie waren stärker als die Menschen. Und es war an der Zeit, das Recht des Stärkeren einzufordern.
Es dauerte nicht lange und die Werwölfe folgten dem Beispiel der Vampire. Da sie sich nur in der Zeit um Vollmond verwandelten und tagsüber ganz normale Menschen waren, hoffte man viel zu lange, dass sie die Vampire vertreiben würden. Doch wenn aus Männern und Frauen Bestien wurden, wich ihr Verstand dem Wahnsinn und dem Blutdurst. Es starben mehr Menschen denn je, und zahlreiche Unwissende wurden gebissen und verwandelt.
Den Werwölfen folgten sämtliche andere Therianthropen, allen voran die Werkatzen. Obwohl sie selbst nach der Verwandlung einen klaren Kopf behielten, waren sie nicht weniger gefährlich, denn ihr übernatürliches Wesen machte sie listig und kaltherzig. Die Angst vor Werkatzen wurde immer größer, denn Gerüchten zufolge war es unmöglich, sie zu töten.
Auch Elfen, die in menschlichen Geschichten immer als wunderschön und edel bezeichnet wurden, schlossen sich dem Kampf um die Nacht an. Leider war das einzige, was sie mit den Figuren aus den Märchen gemein hatten, die spitzen Ohren. Sie übertrafen selbst die Vampire in ihrer Grausamkeit, da es ihnen schier Vergnügen bereitete, Menschen vor Schmerzen schreien zu hören. Sie rissen gezielt Familien auseinander und brachten tiefe Trauer über die Welt.
Doch das war alles nur der Anfang.
01 – Verhängnisvolle Entscheidung
01 - Verhängnisvolle Entscheidung
„Ich halte das immer noch für eine bescheuerte Idee, Sera“, teilte mir Phoebe, meine beste Freundin und Mitbewohnerin, zum gefühlt tausendsten Mal mit.
„Ich weiß“, seufzte ich, während ich mit den Füßen in ihre schwarzen High Heels stieg. Sie hatte mir zwar erlaubt, sie mir auszuleihen, war aber nicht gerade begeistert davon, wofür ich sie benutzen würde. „Aber es sind 1000 Euro für nur eine einzige Nacht. Das ist mehr als eine Monatsmiete!“
„Das ist Prostitution.“
„Ist es nicht.“
Sie hob eine Augenbraue und ließ ihren Blick über mein viel zu freizügiges Outfit wandern, ehe sie die Arme verschränkte und mich skeptisch anschaute. Wie immer, wenn sie das tat, hatte ich sofort das Bedürfnis, mich zu rechtfertigen.
„Ich verkaufe nicht meinen gesamten Körper, sondern lediglich mein Blut. Und auch nicht mehr als einen halben Liter oder so“, erklärte ich mürrisch, doch Phoebe war noch immer nicht überzeugt.
„Das ist zu gefährlich“, beharrte sie eindringlich. „Du kennst den Typen doch gar nicht. Er hat bestimmt seine Gründe, auf die illegalen Wege auszuweichen anstatt Blut bei der Bank zu kaufen.“ Ich wollte sie unterbrechen, doch sie erkannte meine Absicht und redete schnell weiter. „Und jetzt erzähl mir nicht wieder, dass kaltes Blut eklig ist und er es lieber frisch mag, schließlich haben wir diese Diskussion schon zig Mal geführt. Es gibt einen guten Grund dafür, dass dieser Direkt-Handel illegal ist.“
Ich schnaubte belustigt und grinste meine beste Freundin an. „Klar gibt es einen guten Grund. Beim Direkt-Handel fallen die Steuergelder weg.“
Ihrem Gesicht nach zu urteilen, fand Phoebe meinen Witz alles andere als lustig. Ich ließ mich mit verschränkten Armen auf einen Stuhl fallen und starrte trotzig zurück.
„Ich weiß gar nicht, warum wir schon wieder darüber streiten. Es ist allein meine Entscheidung, was ich mit meinem Blut mache. Ich hab die vermutlich einmalige Chance, für ein bisschen Blut extrem viel Geld zu bekommen. Und wir können die Kohle wirklich dringend gebrauchen. Der Geschirrspüler ist kaputt und ich will bestimmt nicht für den Rest meines Lebens mit Hand abwaschen“, argumentierte ich.
„Die Waschmaschine gibt in letzter Zeit auch beunruhigende Geräusche von sich“, gab Phoebe zähneknirschend zu.
„Siehst du? Mit unseren Gehältern können wir uns neben der Wohnung ja kaum etwas zu Essen leisten, da muss man eben mal Risiken eingehen.“ Auch, wenn diese beinhalteten, dass man in einer dunklen Gasse sein Blut verkaufte.
„Du könntest dabei draufgehen.“
Ich versuchte, mir mein Unbehagen nicht anmerken zu lassen, und verdrehte vielsagend die Augen.
„Bisschen melodramatisch, findest du nicht?“, meinte ich betont unbesorgt.
„Er könnte zu viel nehmen. Er könnte alles nehmen. Oder dich sogar verwandeln. Wer sagt, dass er kein sadistischer Psychopath ist, der sich nur als Vampir ausgibt, um dich dann langsam umzubringen? Sowas hat es schon seit Ewigkeiten gegeben, noch bevor wir überhaupt wussten, dass es Monster wirklich gibt.“
„Schön, dass du mir so viel Mut machst“, meinte ich ironisch, woraufhin ich ihr ein fieses Lächeln entlockte.
„Ich will nur dein Bestes“, säuselte sie fröhlich. „Und dass du nicht gehst“, fügte sie hinzu.
Ich schwang mich wieder vom Stuhl und ging auf wackeligen Beinen – verdammte Schuhe - zur Tür. „Ich gehe aber. Wird schon schiefgehen. Vielleicht werde ich ja schon vorher aufgegabelt und lebendig verspeist, immerhin ist die Sonne schon untergegangen.“ Die Wahrscheinlichkeit war gar nicht mal so gering. Eine Gänsehaut überzog meinen Körper bei dem Gedanken an all die Wesen, die nachts draußen herumlungerten.
„So wie du aussiehst wird man dich jedenfalls nicht übersehen“, stellte sie fest.
Ich zuckte mit den Schultern. „Die Klamotten waren seine Bedingungen“, erklärte ich wenig begeistert. Ein kurzes, schwarzes Kleid, dass an mir aufgrund meiner Größe eher wie ein T-Shirt aussah, und hohe Schuhe, mit denen ich fast zwei Meter groß war. Bildete ich mir das ein oder war die Luft hier oben dünner?
Selbst über meine Frisur durfte er bestimmen, also hatte ich mir meine langen braunen Haare heute zu weichen Locken gedreht. Sie würden sich bald wieder lösen, aber ich hatte ja nicht vor, lange zu bleiben. Ich öffnete unsere Haustür und spähte vorsichtig ins Treppenhaus, nur für den Fall, dass irgendwelche Übernatürlichen hier herumlungerten. In den Randbezirken erlaubten sie sich solche Späße öfters.
Doch heute war die Luft rein. Ich drehte mich zu Phoebe um und zog sie in meine Arme, wobei ich mich noch tiefer bücken musste als normalerweise. Sie erwiderte die Umarmung auf Zehenspitzen und drückte mich einmal ganz fest.
„Pass auf dich auf, okay? Du kannst mich die ganze Nacht über anrufen, wenn irgendetwas sein sollte, okay? Ich nehme einen Holzpflock mit“, versicherte sie mir.
Mit einem Lachen löste ich mich von ihr. „Woher willst du den Holzpflock denn überhaupt hernehmen?“, fragte ich grinsend.
Sie schürzte unschlüssig die Lippen und zuckte dann mit den Schultern. „Ein Bleistift geht bestimmt auch.“
Wieder lachte ich, ehe ich meine Tasche über meine Schulter hängte und aus der Wohnung trat. „Ich weiß deine Loyalität wirklich zu schätzen, aber du kannst ruhig schlafen gehen. Ich schaff das schon.“ Mein Lächeln sollte eigentlich aufmunternd sein, doch sie schüttelte den Kopf so heftig, dass ihr ihre pinken Haarsträhnen ins Gesicht flogen.
„Vergiss es. Ich kann sowieso kein Auge zu machen, wenn ich nicht weiß, ob du noch lebst. Also schreib mir, wenn du fertig bist. Oder ruf mich am besten gleich an.“
„Okay. Ich hau jetzt ab, sonst komme ich zu spät.“ Und das hätte bestimmt unangenehme Konsequenzen. „Bis gleich“, verabschiedete ich mich.
„Tschüss. Ach, und eins noch!“, rief sie mir hinterher. Ich blieb stehen und drehte mich halb zu ihr um. „Wenn du stirbst und ich die Miete für dieses Höllenloch dann allein zahlen muss, bringe ich dich nochmal um!“, drohte sie mir, doch ich hörte die Sorge in ihrer Stimme. Plötzlich mit einem Kloß im Hals nickte ich nur und drehte mich wieder um.
Ich spürte noch ihren Blick auf mir, als ich die Treppen runterging.
Knappe zwanzig Minuten zu Fuß und mit der U-Bahn später erreichte ich die Adresse, die mir der Vampir gesendet hatte. Sie war noch weiter von der Stadt entfernt als unsere Wohnung und lag direkt am Kanal, der zwei Flussarme miteinander verband. Es stank nach totem Fisch und Abwasser und ich befand mich inmitten einer heruntergekommenen Gegend, deren Hauswände mit Graffiti besprüht und deren Fenster entweder eingeschlagen waren oder komplett fehlten. Dass dieser Ort von Übernatürlichen eingenommen wurde, erkannte man spätestens an der fehlenden Stromversorgung der Laternen. Der Stadtrat hat schon vor Jahren damit begonnen, in den hoffnungslos verlorenen Gebieten den Strom abzuschalten, schließlich gab es hier auch niemanden, der ihn bezahlte. Nicht, dass die Monster sich daran störten. Sie konnten alle im Dunkeln sehen.
Ich leider nicht. Und so musste mein Handy mir in den finstersten Ecken als Taschenlampe dienen, während ich über aufgerissene Müllsäcke hinweg stieg und krampfhaft versuchte, nicht über meine Absätze zu stolpern.
Der ausgewählte Treffpunkt war allen Anscheins nach eine verlassene Lagerhalle, die aus Backstein errichtet worden war und jetzt dem Verfall überlassen wurde. Ich hatte nicht gerade das Bedürfnis, sie zu betreten und das Risiko einzugehen, unter dem baufälligen Dach lebendig begraben zu werden, andererseits hatte ich wohl keine Wahl. Es war schon fünf nach halb elf und damit war ich eigentlich sogar schon zu spät. Zweifellos wartete er dort drinnen auf mich. Genauer gesagt, auf seine Mahlzeit. Vorsichtshalber drückte ich die Klinke runter und lehnte mich dagegen. Die Tür war tatsächlich offen. Unter einem tiefen Seufzen, dass ein eigenartiges Echo in der Halle auslöste, schwang die Tür auf und ich betrat das Gebäude, wobei ich den Glasscherben so gut wie möglich auszuweichen versuchte.
Ich spürte den kalten Luftzug noch ehe ich irgendetwas hörte. Vampire bewegten sich lautlos, davor wurden wir von Klein auf gewarnt. Was hingegen ganz und gar nicht lautlos war, war die Tür, als sie mit einem heftigen Knall hinter mir wieder zugeworfen wurde. Erschrocken fuhr ich herum und riss die Taschenlampe nach oben, um einen möglichen Angreifer zu erkennen. Als ein blonder Mann im Lichtpegel auftauchte, ertönte ein animalisches Knurren, was mir einen Schauer den Rücken herunterjagte.
„Mach das aus!“, verlangte der Mann wütend, wobei er einen Schritt auf mich zumachte.
Statt auf ihn zu hören, richtete ich das Licht lediglich auf den Boden. Der Gedanke, nichts mehr sehen zu können, gefiel mir ganz und gar nicht. „Tut mir leid, ich wollte Sie nicht blenden. Ich hab mich nur erschreckt. Aber ich würde das Licht ganz gerne anlassen, ich kann sonst nämlich nichts sehen“, entschuldigte ich mich mit ungewohnt piepsiger Stimme. Himmel, ich hörte mich an wie eine Maus, die versuchte, mit einer Katze zu verhandeln. Nicht gut.
Zu meiner Verwunderung lachte der Vampir auf. Es klang allerdings nicht besonders amüsiert, eher herablassend. „Natürlich. Ihr Menschen seid ja praktisch blind sobald die Sonne untergeht. Das muss doch fürchterlich nervtötend sein, oder?“, fragte er mit gelangweilter Stimme. Sein Tonfall war respekteinflößend und ich wagte es kaum, ihn weiterhin anzusehen.
Da ich mir nicht sicher war, was für eine Antwort er sich darauf erhoffte, nickte ich schwach. „Ja, schon irgendwie“, brachte ich heraus. Ich hörte mich furchtbar heiser an. Ob er meinen Herzschlag hören konnte? Wusste er, dass ich mir vor Angst gleich in die Hose machen würde?
Jetzt kam er mit zwei geschmeidigen, langen Schritten noch näher, sodass er direkt vor mir stand. Ich müsste nur meinen Arm ausstrecken um seine tote, kalte Haut zu berühren. Er musterte mich mit unverhohlener Neugier, etwa so, wie ein Grillmeister die Waren an der Fleischtheke betrachtete. Ich kämpfte mit dem Drang, davonzurennen. Er hätte mich ohnehin eingeholt, noch ehe ich wieder bei der Tür wäre.
„Du bist also Seraphina?“ Er streckte seine Hand nach mir aus und legte sie an meine Wange, wie um zu prüfen, ob ich echt war. Mir entging nicht, dass seine Hauttemperatur mit der des Raumes übereinstimmte. „Dein Name bedeutet Engel... Oh, wie enttäuscht die Menschen waren, als sie erfuhren, dass Engel die wohl einzigen Fabelwesen sind, die es nicht wirklich gibt.“ Er lachte kurz über seinen Witz, dann schaute er mich wieder an. „Du siehst ein wenig anders aus als auf den Fotos... Besser.“ Er wirkte zufrieden, als er den Blick über meinen Körper wandern ließ, wobei seine Hand seinen Augen folgte. Ich erschauderte, als sie auf meiner Hüfte liegen blieb und ich spürte, wie sein Griff fester wurde. Spätestens jetzt gab es kein Entkommen mehr.
„Wird es... Wird es weh tun?“ Ich konnte einfach nicht anders, als zu fragen. Schließlich würde er mir gleich zwei riesige Reißzähne in die Halsschlagader rammen.
„Nein. Ich habe mir sagen lassen, dass das Gefühl für Menschen berauschender ist als Drogen oder Sex. Deshalb kommen die Bluthuren ja auch immer wieder.“ Ich zuckte zusammen, als ich die Beleidigung hörte. Sie war eine abfällige Bezeichnung für Menschen, die ihr Blut direkt an Vampire verkauften, anstatt es sich bei der Blutbank abnehmen zu lassen. Menschen, zu denen ich nun ebenfalls gehörte.
„Ich habe ein paar Regeln, Seraphina. Oder nennen wir sie Wünsche. Erstens, nicht schreien. Die einzigen, die dich hier hören würden, stehen direkt über dir in der Nahrungskette.“ Er sah mich mit einem bösartigen Lächeln an und wartete darauf, dass ich ihm mein Verstehen zeigte. Mehr als ein schwaches Nicken brachte ich nicht zustande, doch das schien ihm auszureichen. „Zweitens – und das ist dann auch schon die letzte Regel – bitte erspare uns beiden irgendwelche Fluchtversuche. Es ist ebenso lächerlich und sinnlos, wie es nervig ist. Und wenn ich genervt bin, werde ich schnell unfreundlich. Klar soweit?“
Ich sah in sein blasses Gesicht und fand keinen Funken Menschlichkeit in seinen schwarzen Augen. Doch ich atmete tief ein und versuchte ganz fest daran zu denken, weshalb ich das alles tat. „Was ist mit meinem Geld?“, erkundigte ich mich mit bebender Stimme.
„Hm, dein Geld... Das wirst du wohl kaum brauchen, wenn du tot bist.“
Erschrocken wich ich einen Schritt zurück. Er ließ es zu, für ihn war das Ganze nur ein Spiel. Und er würde es gewinnen.
„Was?“, keuchte ich entsetzt und ging im Kopf alle Lösungsmöglichkeiten durch, alle Verteidigungsmaßnahmen die ich kannte. Ich überlegte sogar, die Polizei anzurufen, doch die Zeit würde er mir niemals geben. Ich war ihm völlig ausgeliefert. Phoebe würde Recht behalten und ich war eine naive Vollidiotin.
„Wenn du dich mit meiner Nase riechen könntest...“ Der Vampir machte eine ausschweifende Geste. „Dann würdest du verstehen. Dich gehen zu lassen, wäre einfach nur leichtsinnig.“
Okay, Scheiß auf seine Regeln. Ich sprang von ihm weg und hechtete zur Tür, so schnell ich konnte, nur um plötzlich noch unendlich viel schneller als erwartet gegen ein Hindernis zu stoßen. Es war der Vampir selbst. Für den Bruchteil einer Sekunde konnte ich sein verärgertes Gesicht sehen, ehe er mich mit einem schmerzhaften Schlag auf den Brustkorb von dem Ausgang wegschleuderte. Aufgrund seiner immensen Kraft flog ich quer durch die Halle, bis eine Mauer meinen Flug bremste. Ich landete unsanft auf dem mit Scherben übersähten Boden und schlug mit dem Kopf hart auf den Stein. Eine warme Flüssigkeit verklebte meine Haare und ich zog eine besonders große Scherbe unter Stöhnen aus meiner Schulter. Der Vampir stand schon wieder über mir und betrachtete mich kurz dabei, wie ich verzweifelt versuchte, Abstand zwischen uns zu bringen. Dann packte er mich an den Füßen und schleifte mich über den Boden zurück zu ihm. Ein kurzer Schrei löste sich aus meiner Kehle, womit ich auch die andere Regel brach. Im schwachen Licht meines Handys, dass einige Meter entfernt von mir auf dem Boden lag, erkannte ich lediglich seine Silhouette, die bedrohlich über mich gebeugt war. Ich redete mir ein, dass es besser so war. Ich wollte sein Gesicht nicht sehen.
„Okay, genug gespielt. Ich hab Hunger.“ Er beugte sich über mich und hielt mich unter seinem Körper gefangen. Ich wandte meine gesamte Kraft auf, um ihn abzuwehren, doch ebenso gut hätte ich mit einem Bären kämpfen können.
„Du bist so schön... Vielleicht mach ich dich zu einem Vampir? Die Unsterblichkeit würde dir stehen, Seraphina...“, murmelte er, wobei er eine kalte Hand über meinen nackten Oberschenkel wandern ließ.
„Nein!“, keuchte ich und versuchte erneut, ihn von mir runter zu werfen. Ich konnte das alles nicht glauben. Wie hatte ich mich so verschätzen können? Meine Gutgläubigkeit würde ich mit dem Leben bezahlen.
Der Vampir legte seine Lippen auf meinen Hals und ließ seine Hand weiter über meinen Körper wandern. Mit der anderen Hand umfasste er schmerzhaft fest meine Handgelenke, die in seiner riesigen Pranke nahezu verschwanden. Als er seine Hand unter mein Kleid schob, entfuhr mir ein verzweifeltes Wimmern. Mit kalten Fingern wanderte er zwischen meine Oberschenkel und drückte sie gewaltsam auseinander, um sich dazwischen zu knien. Er stöhnte leise an meiner Kehle und genoss meine offensichtliche Hilflosigkeit. Und es stimmte, Schreien war zwecklos.
Doch als er seinen Mund öffnete und endlich in meinen Hals biss, konnte ich nicht anders. Für einen Moment setzte mein Herz aus, nur um dann umso schneller und verzweifelter zu schlagen, als würde es am liebsten aus meiner Brust springen, nur um zu entkommen. Der Schmerz, der sich unbarmherzig von meinem Hals aus ausbreitete, war schlimmer als alles, was ich je zuvor gespürt hatte.
Dort, wo er seine Zähne hineingeschlagen hatte, fühlte es sich an, als würde er mir mit einer Kettensäge den Kopf abtrennen wollen. Doch das Vampirgift, das durch meine Adern wanderte und angeblich eine so berauschende Wirkung haben sollte, war noch hundert mal schlimmer: Wie Lava durchspülte es meine Blutgefäße und fraß mich von innen auf. Wo das Gift hinwanderte, fühlte ich mich unendlich schwer und wie in Quecksilber getaucht. Gleichzeitig hatte ich das Gefühl, als würde in meinem Innern ein Kampf um Leben und Tod ausgetragen werden. Ich kreischte und bäumte mich unter meinem Peiniger auf, durch den Adrenalinschub mit neuen Kräften versorgt.
Überrascht von meiner heftigen Gegenwehr löste der Vampir seine Lippen von meinem Hals und starrte mich irritiert an, doch ich konnte mich auf nichts anderes als den Schmerz konzentrieren. Ich schrie nicht wegen der Todesangst, die ich empfand, ich schrie wegen dem alles verzehrenden Schmerz. Ich brannte. Ich wurde in Säure getaucht. Ich wurde in Stücke geschnitten und an Hunde verfüttert. Es tat so weh, so unendlich weh.
Ein lauter Knall erschütterte die Halle, doch ich schaffte es nicht, nach der Ursache des Geräuschs zu suchen. Ich konnte nicht einmal sagen, ob der Vampir noch immer bei mir war, denn Tränen der Verzweiflung verschleierten meine Sicht und der Schmerz ließ kein Stück nach. Doch jetzt hoffte ich, dass er noch da war. Denn dann würde er mich töten. Es würde endlich aufhören.
Mein Handylicht ging aus. Das bemerkte ich, da ich nun vollkommen blind war. Ich spürte, wie sich zwei Arme um meinen sich unkontrolliert windenden Körper legten, zu warm, um zu einem Vampir zu gehören. Doch es tat noch immer so weh. Wie viel Schmerz konnte ein Mensch ertragen?
Die Antwort kam abrupt und schneller als erwartet. Genau so viel und kein bisschen mehr. Als ich in die Luft gehoben wurde, verlor ich mein Bewusstsein.
02 – Das Mädchen und der Wolf
02 - Das Mädchen und der Wolf
Als mein Bewusstsein allmählich zurückkehrte, spürte ich zuallererst, wie ich hin und her schaukelte, wie bei leichtem Wellengang. Und ich befand mich in einer Position, die alles andere als angenehm war.
Ich hing über einer stabilen, aber gleichzeitig weichen Kante, die unaufhörlich schwankte und mich dabei ebenfalls bewegte. Sie drückte mir in den Bauch, was vermutlich der Grund für das flaue Gefühl in meinem Magen war. Meine Beine wurden durch irgendwas festgehalten, und mein Unterbewusstsein verriet mir, dass das der einzige Grund war, weshalb ich nicht sofort von der Kante rutschte.
Ich wollte die Augen öffnen, wollte wissen, wo ich war. Doch ich wusste, sobald ich die Augen öffnen würde, würde ich mich an etwas erinnern, dass jetzt noch in irgendeinem Winkel meines Gedächtnisses schlummerte.
Aber irgendwann musste ich die Augen öffnen. Also ließ ich meine Neugier die Oberhand gewinnen.
Ich blinzelte und hatte ein schwarzes T-Shirt direkt vor meiner Nase. Ich schaute nach oben, da ich kopfüber hing wohl eher nach unten, und entdeckte außerdem ein Paar Beine, die in einer dunklen Jeanshose steckten. Sie bewegten sich über eine gepflasterte Straße und mein Gehirn funktionierte wieder in so fern gut genug, um zu begreifen, dass die Kante, über der ich hing, eine Schulter war. Und das, was meine Beine festhielt, war vermutlich ein Arm. Irgendein Fremder hatte mich über seine Schulter geworfen und lief mit mir durch eine dunkle Gasse.
Und in dem Moment stürzte meine Erinnerung über mich herein. Der Vampir, sein Betrug und, am schlimmsten, sein Gift.
Von dem Grauen der Erinnerung beherrscht, fing ich sofort wieder an, zu schreien und strampelte mit übermenschlicher Kraft gegen den Griff des Fremden an. Überrumpelt ließ er mich los und ich versuchte sofort, wegzurennen, doch ich kam nicht weit, ehe ich über meine eigenen Füße stolperte und der Länge nach hinfiel. Ich hatte diese verfluchten Schuhe also immer noch an, und jetzt würden sie Schuld an meinem Tod sein. Ohne einen Blick auf das unbekannte Grauen hinter mir zu werfen, rappelte ich mich auf und wollte weiter rennen, doch da legte sich plötzlich ein warmer Arm um meine Mitte und eine Hand wurde auf meinen Mund gedrückt. Ich schrie meinen Frust in die Hand hinein und stemmte mich gegen die Umklammerung, doch wie schon zuvor bei dem Vampir war ich hoffnungslos unterlegen.
Also versuchte ich es mit einer anderen Taktik. Ich ließ mich zurückfallen und machte mich so schwer, dass er einen Schritt nach vorn stolpern musste, um weiterhin seine Arme um mich zu klammern. Ich nutzte seine Überraschung und versuchte mich aus seinem Griff zu winden, was ihm ein leises Ächzen entlockte. Doch er hatte meine Absicht schon viel zu bald erkannt und zog mich wieder hoch, wobei er mich diesmal so fest an sich presste, dass mir absolut kein Aktionsspielraum blieb.
„Hey, beruhige dich! Bitte, ich will dir doch nichts tun!“, rief eine tiefe Stimme eindringlich an meinem Ohr. Ich glaubte ihm nicht so schnell, allerdings hatte ich keine Chance gegen ihn und verletzte mich bei meinem Fluchtversuch nur selbst. In einigen meiner Wunden steckten noch immer Glassplitter und mein Kopf pochte wie verrückt. Ich ließ locker und versuchte erneut, ihn mein ganzes Gewicht spüren zu lassen, doch diesmal war er darauf gefasst und hatte mich besser ausbalanciert, wodurch er mich mit seinen übernatürlichen Kräften kaum zu spüren schien.
„Ich nehme jetzt die Hand von deinem Mund, in Ordnung? Du würdest mir wirklich einen großen Gefallen tun, wenn du nicht schreien würdest, sonst machst du nämlich die falschen Leute auf uns aufmerksam“, sagte er mir. Dann nahm er seine Pranke aus meinem Gesicht und wartete meine Reaktion ab.
„Lass mich los!“, verlangte ich. Augenblicklich riss er den Arm weg, als stünde ich plötzlich unter Strom und er hätte einen Schlag bekommen. Ich brachte sofort Sicherheitsabstand zwischen uns und fuhr zu ihm herum. Doch die schnellen Bewegungen ließen Schwindel in mir aufsteigen und ich konnte gerade noch einen Schritt zur Seite machen, ehe ich gefallen wäre. Mein Kopfschütteln ließ mich kurz die Orientierung verlieren. Verdammt, wie viel Blut hatte ich denn bitte verloren?
„Tut mir leid, ich wollte nur nicht, dass du wegrennst. In deiner Verfassung ist das keine gute Idee, außerdem befindest du dich immer noch im Gebiet der Übernatürlichen“, entschuldigte der Mann sich. Daraufhin sah ich ihn zum ersten Mal direkt an, darum bemüht, nicht so schwach zu erscheinen, wie ich mich gerade fühlte. Er war eine imposante Gestalt. Trotz meiner hohen Schuhe überragte er mich noch immer um einige Zentimeter, wobei er jedoch nicht schlaksig, sondern muskulös aussah. Alles an ihm war irgendwie dunkel, seine Kleidung, seine Haut, seine Augen und auch seine Haare, die ihm wirr vom Kopf abstanden, als wäre er gerade erst aufgestanden. Oder als hätte er gekämpft. Ich erkannte einige Narben auf seinen Armen, die von tiefen Wunden stammen mussten. Und einen frischen Kratzer, dem ich ihm wohl zugefügt haben musste. Selbst in seinem Gesicht befand sich eine Narbe auf der linken Wange. Seine markanten, aber dennoch hübschen Gesichtszüge waren besorgt verzerrt und betrachteten mich ebenso eindringlich, wie ich ihn.
Schließlich räusperte er sich und fragte: „Wie geht es dir?“ Seine Stimme hatte einen rauchigen Klang, der mich aus irgendeinem Grund an Lagerfeuer-Erlebnisse aus meiner Kindheit zurückerinnerte.
Ich zögerte noch einen Augenblick mit meiner Antwort, ehe ich schließlich den Mund aufmachte. „Ich bin nicht tot“, stellte ich fest, doch es war auch eine Frage. Warum war ich nicht tot?
„Nein, bist du nicht, Glück gehabt...“ Er lächelte unsicher und seine Haltung entspannte sich ein wenig. Offenbar glaubte er, dass ich keinen weiteren Fluchtversuch starten würde. Vermutlich würde ich auch nach den ersten drei Metern desorientiert umfallen. Ich konnte mich ja kaum auf den Füßen halten. „Du hast so laut geschrien, dass ich mit sonst was gerechnet hatte, als ich da reingeplatzt bin. Was ich gesehen habe, hat mich überrascht. Normalerweise reagieren Menschen... anders auf Vampirbisse.“ Er warf mir einen prüfenden Blick zu und ich hob ahnungslos die Schultern.
„Das hat er auch behauptet, aber...“ Ich wich seinem Blick aus, damit er die Angst in meinem Blick nicht sehen konnte und schlang die Arme um mich selbst, um die Kälte zu verdrängen. „Es hat sich für mich eher so angefühlt, als würde man meine Adern mit Feuer ausbrennen.“
Der Mann nickte nachdenklich, wirkte jedoch so, als hätte er sich das schon gedacht. „Du bist doch aber keine Übernatürliche, oder?“, fragte er nach.
„Wenn ich das wäre, hätte ich wohl kaum mein Blut verkaufen wollen.“ Ich stolperte über meine eigenen Worte und mir fiel etwas ein. „Oh. Verdammt!“
„Was ist los?“
„Ich hab das Geld nicht! Der Typ hat mich verarscht! Ich habe Höllenqualen erlitten, nur um genauso arm zu sein wie vorher!“, rief ich entgeistert. Ich wühlte durch meine wirren Haare und schaute verzweifelt hinter den Fremden, als würde der Vampir dort mit meinem versprochenen Geld stehen und winken.
„Naja, du lebst noch. Das können nicht viele von sich behaupten, wenn sie so einen Angriff hinter sich haben. Und was die Höllenqualen angeht... Wenn du mit in meine Wohnung kommst, könnte ich dich verarzten. Wenn... wenn du willst“, bot der Fremde mit einem sanften Lächeln an. Doch meine Naivität war mir schon einmal teuer zu stehen gekommen.
Sofort wieder misstrauisch geworden sah ich ihn skeptisch an. „Du bist doch auch Einer, oder? Ein Übernatürlicher. Natürlich, sonst hättest du gegen den Vampir doch keine Chance gehabt!“ Ich hatte es ja schon gemerkt, als ich mit ihm gekämpft hatte. Eigentlich war die Frage vollkommen überflüssig.
Er sah ertappt aus und lächelte entschuldigend. „Ich wollte dir das eigentlich ersparen, nachdem du fast von einem Vampir getötet worden wärst...“, erklärte er. Hatte er wirklich gedacht, es wäre nicht offensichtlich?
„Bis jetzt hast du noch nicht versucht, mich zu töten, so schlimm kann es ja nicht sein. Was bist du?“, fragte ich. Ich bemühte mich, aufgeschlossen zu wirken, obwohl ich eigentlich am liebsten 100 Kilometer Abstand zu allen Übernatürlichen hätte. Aber es war besser, zu wissen, mit wem man es zu tun hatte. Auch, wenn ich gegen niemanden eine realistische Chance hätte.
„Ein Werwolf“, sagte er und verzog das Gesicht, als würde er sich schämen.
„Okay, könnte schlimmer sein“, rutschte es mir eine Spur zu ehrlich heraus. Doch anhand seiner Reaktion vermutete ich, ihn nicht beleidigt zu haben.
„Ach echt? Ich dachte jetzt, du würdest ausflippen! Schließlich sind die meisten Morde an Menschen durch Übernatürliche auf unser Konto gegangen. Wir sind die instinktgesteuerten Monster, die nichts als Tod und Schmerz bringen.“ Seine Stimme war von Schmerz und Selbsthass geschwängert, als er die Worte ausstieß. Sein Ausdruck traf mich unerwartet hart und ich konnte nicht anders, als plötzlich Mitgefühl zu empfinden. Er wird es sich nicht ausgesucht haben, in einen Werwolf verwandelt worden zu sein. Wenn nicht gerade Vollmond war, war er genauso wie ein Mensch – und er musste sich mit dem Wissen auseinandersetzen, dass er ein Mörder sein konnte. Aber die Gewissheit fehlte ihm immer.
„Tja, jetzt gerade bist du nur ein Mensch“, erklärte ich überflüssigerweise, während ich im Himmel nach dem eiförmigen Mond suchte. „Und in dieser Gestalt unterscheidest du dich nur durch deine Stärke und die besseren Sinne von uns anderen. Und bis Vollmond sind es ja noch ein paar Tage.“ Ich wusste nicht, ob ich ihn oder mich selbst davon überzeugen wollte.
Wieder schnitt er eine Grimasse, als er mich berichtigte: „Vollmond ist übermorgen. Und die erste Verwandlung ist schon morgen.“
„Hm. Wie die Zeit schon wieder vergeht.“
„Willst du trotzdem mitkommen?“
„Wohin nochmal?“
„Zu mir“, erklärte er verlegen. „Ich hab einen Verbandskasten daheim und weiß dank jahrelanger Erfahrung auch, wie man mit Wunden am besten umgeht.“
Ich sah ihm kritisch entgegen und schürzte die Lippen. Die Wahrheit war, dass ich mir in meinem derzeitigen Zustand kaum zutraute, den Weg bis nach Hause zu schaffen. Am liebsten hätte ich mich hingesetzt, aber ich wollte vor dem Werwolf auf keinen Fall schwach wirken.
„Ich weiß nicht so recht...“, murmelte ich unsicher. Denn einen zweiten Übernatürlichen, der sich in irgendeiner Art und Weise über mich hermachen wollte, konnte ich auf keinen Fall gebrauchen. Zugegeben, würde der Mann vor mir mich umbringen wollen, könnte er das wohl sofort tun, ohne mich erst in sein Haus locken zu müssen. Und wenn ich ihn wegschickte, stieg dadurch wohl eher die Wahrscheinlichkeit, von anderen Übernatürlichen angegriffen zu werden.
Eindringlich musterte ich ihn. Gerade war er ein Mensch, aber bedeutete das auch, dass er sich menschlich verhielt? Würde ich mit ihm gehen, wenn er kein Monster war?
Meine Antwort schien ihn nicht gerade zu begeistern, aber er sah auch nicht überrascht aus. Vermutlich hatte er schon damit gerechnet, abgelehnt zu werden. „Ist schon klar, ich bin der große böse Wolf“, machte er einen halbherzigen Witz. „Aber in deinem Zustand würde ich dich nur ungern allein lassen. Hast du jemanden, den du anrufen kannst, um dich abzuholen?“
„Ähm...“ Meine Gedanken schweiften zu Phoebe, aber ich würde sie ungern mitten in der Nacht mitten ins Gebiet der Übernatürlichen herbestellen. Doch als ich nach meinem Handy suchte, um in meinen Kontakten nachzusehen, wen ich sonst vielleicht anrufen könnte, fand ich es nicht. Bis ausgerechnet er es mir hinhielt.
Überrascht sah ich auf, woraufhin er entschuldigend mit den Schultern zuckte.
„Ich hab vergessen, dass ich es selbst eingesteckt hatte, tut mir leid.“
„Alles gut“, erwiderte ich. Immerhin hatte er es überhaupt mitgenommen. Andernfalls läge es wohl immer noch in der Lagerhalle. Ich nahm es ihm ab, doch als ich den Bildschirm anschalten wollte, blieb dieser schwarz.
„Ich glaub, der Akku ist alle“, meinte ich. Zumindest hoffte ich, dass es nur am Akku lag und mein Handy nicht tatsächlich kaputt war.
„Also... kann dich niemand abholen?“, hakte er nach.
Ich schüttelte langsam den Kopf. „Aber das geht schon. Ich finde auch alleine nach Hause. Danke nochmal“, murmelte ich und wollte mich schnell umdrehen, doch dabei war ich wohl etwas zu schnell. Ich schwankte und spürte schon, wie ich zur Seite kippte, ehe mein Fall plötzlich gebremst wurde. Verwirrt stellte ich fest, dass es erneut der Werwolf war, der mit unmenschlicher Geschwindigkeit zu meiner Rettung geeilt war. Wieder einmal.
„Danke“, wiederholte ich. „Du kannst mich wieder loslassen.“
Er stellte mich vorsichtig zurück auf die Füße, sah mich aber weiterhin besorgt an. „Ich will wirklich nicht aufdringlich wirken, aber so kann ich dich nicht mit gutem Gewissen gehen lassen.“
„Wieso? Du hast schon genug getan, wirklich. Ich will dich nicht weiter behelligen“, behauptete ich. Vor allem traute ich ihm aber nicht weiter, als ich ihn werfen konnte. Gemessen an der Tatsache, dass er über zwei Meter groß und ein Schrank von einem Mann war, war das dementsprechend nicht sehr weit. Er war eben ein Werwolf und ich nur Hundefutter.
„Okay, wenn du zehn Meter geradeaus gehen kannst, ohne zu wackeln oder umzufallen, glaube ich dir.“ Er verschränkte die Arme und sah mich herausfordernd an. Ich starrte ungläubig zurück. Für wie schwach hielt der mich eigentlich?
„Gut, wir haben einen Deal.“ Selbstbewusst, aber auch betont langsam, trat ich einen Schritt zurück und fixierte die dunkle Straße vor mir. Wie schwer konnte das schon sein? Ich war mein ganzes Leben lang geradeaus gelaufen. Doch jetzt schien mir die gerade Straße, die mit Müll und Glasscherben übersät war, wie ein unüberwindbares Hindernis. Ich wollte einfach nur nach Hause und schlafen.
Doch ohne mir meine Gedanken anmerken zu lassen, straffte ich die Schultern und machte die ersten Schritte. Er folgte mir langsam, ohne dabei ein Geräusch zu verursachen, während ich wie ein Elefant in einem Porzellanladen herumpolterte. Ich konnte auf diesen Schuhen einfach nicht laufen, da half es auch nicht, dass sie mir eine Nummer zu klein waren und meine Zehen zerquetschten. Die ersten Meter waren geschafft, obwohl die ganze Zeit über schwarze Punkte vor meinen Augen tanzten und sich eine Art Druck in meinem Ohr aufbaute. Doch ich war wild entschlossen, die zehn Meter zu schaffen, also ging ich immer weiter.
Als ich mein Ziel endlich erreicht hatte, ließ ich mich erleichtert in die Hocke sinken, wo ich dann doch noch das Gleichgewicht verlor und auf meinen Hintern plumpste. Der Werwolf sah auf mich herunter und ich erwiderte seinen Blick so würdevoll wie möglich.
„Ich mache nur eine kleine Verschnaufpause“, rechtfertigte ich mich.
„Okay, das reicht, ich nehme dich mit.“
Eine weitere Vorwarnung bekam ich nicht. Zu schnell, als dass mein übermüdetes Hirn hätte reagieren können, hatte er sich über mich gebeugt, hochgenommen und erneut über die Schulter geworfen, als wäre ich nicht schwerer als ein Handtuch. Einen Moment lang war ich wie erstarrt, doch dann begann ich mit Fäusten gegen seinen Rücken zu trommeln, als er sich wieder in Bewegung setzte.
„Lass mich sofort wieder runter!“, zischte ich schließlich empört, zu überrascht, als dass sich Panik in mir hätte ausbreiten können.
„Ach komm, vorhin hat es dir doch auch nichts ausgemacht!“, antwortete er nur belustigt.
„Vorhin war ich ohnmächtig!“, entkräftete ich seine Behauptung.
„Okay, guter Punkt. Aber wenn ich dich hier so auf der Straße hocken lasse, bin ich mir ziemlich sicher, dass du den Ärger schneller anziehst, als uns beiden lieb ist. Deshalb helfe ich dir jetzt, ob du willst oder nicht.“
„Ich glaube, das nennt man Kidnapping.“
„Zeig mich doch an.“
„Ich weiß ja nicht einmal, wie du heißt!“
„Adam“, stellte er sich damit vor. „Adam Miles, wenn du es genau wissen willst. Aber meine Papiere sind wohl vor einigen Jahren abgelaufen. Und du bist?“
„Zu schwer, um die ganze Zeit von dir getragen zu werden!“, quengelte ich. „Lass mich doch wenigstens selbst laufen“, wollte ich verhandeln.
„Im Ernst, auch wenn ich dich trage, sind wir immer noch zehnmal schneller bei meiner Wohnung, als wenn du im Dunkeln so rumstolperst wie eine Babygiraffe, die gerade das Laufen lernt“, lehnte er ab.
„Wie eine Babygiraffe?“, hakte ich entrüstet nach.
„Weil du so groß bist“, erklärte er gut gelaunt.
„Sagt der, der so groß wie ein verdammter Blauwal ist“, brummte ich mürrisch.
Ich spürte seinen Brustkorb vor Lachen leicht vibrieren und musste unwillkürlich ebenfalls grinsen, ehe ich meine Mundwinkel wieder unter Kontrolle brachte. War er nicht ein bisschen zu gut gelaunt? Das hier war schon eine Entführung, streng genommen.
„Verrätst du mir jetzt vielleicht auch, wie du heißt?“, nahm er einen zweiten Anlauf, um meinen Namen herauszufinden. Ich gab mich mit einem Seufzen geschlagen.
„Seraphina. Aber eigentlich nennt mich jeder nur Sera.“
„Freut mich, dich kennenzulernen, Sera.“
„Hmpf. Gleichfalls, Adam“, erwiderte ich leicht mürrisch und brachte ihn damit erneut zum Lachen. Sein Gang schien durch mich in keiner Art und Weise beeinträchtigt zu sein, und das erinnerte mich an eine Frage, die ich noch stellen wollte. Es konnte kaum schaden, ein bisschen was über ihn herauszufinden, wenn ich schon in dieser Situation steckte. Wenn ich schon über dem Rücken eines Fremden hing, konnte ich die Zeit wenigstens sinnvoll nutzen.
„Wie stark sind Werwölfe eigentlich? Ich meine, wenn du sogar einen Vampir besiegen konntest...“ Ich ließ den Satz in der Luft hängen und hoffte, dass er ihn aufgreifen würde.
„In den Nächten vor Vollmond sind wir am stärksten. Selbst in unserer menschlichen Gestalt sind wir dann stärker als die meisten anderen Übernatürlichen. Aber nach der letzten Verwandlung, die in der Nacht nach Vollmond stattfindet, ist unsere gesamte Kraft erst mal erschöpft. Wir sind dann genau so lahm und schwach wie Menschen. Allerdings sind unsere Sinne immer noch so scharf wie sonst auch. So ist es übrigens bei allen Therianthropen“, erklärte er.
„Theri...- was?“
„Therianthropen“, wiederholte er lachend. „Der Sammelbegriff für Menschen, die sich in eine Kreatur verwandeln, die Merkmale von Mensch und Tier hat. Wie Werwölfe und Werkatzen. Allerdings ist der Werwolf der einzige Therianthrop, der sich in drei Nächten verwandelt, die anderen tun das wirklich nur in der Vollmondnacht. Ich vermute ja, dass das damit zusammenhängt, dass wir so unzivilisiert sind, dass das Tier in uns einfach öfter ausbricht.“ Im letzten Teil seiner Erzählung hat er eher mit sich selbst gesprochen, fast so, als würde er einem Rätsel auf den Grund gehen.
„Sind Formwandler auch Therianthropen?“, hakte ich nach.
„Nein. Wir können uns lediglich an Vollmond und nur in eine andere Kreatur verwandeln, Formwandler sind, was das angeht, absolut uneingeschränkt.“
„Wow. Das ist... ziemlich interessant. Schade, dass es nicht auf dem Lehrplan steht“, bedauerte ich. Der Unterricht wäre dadurch auf jeden Fall bereichert worden. Und es wäre sicherlich von Vorteil, mehr über die Monster zu erfahren, die uns das Leben so viel schwerer machten. Doch die nächsten Worte Adams leuchteten ein.
„Naja, eigentlich bemühen sich die Übernatürlichen, die Geschichten geheim zu halten.“ Doch bevor ich weiter bohren konnte, wechselte er abrupt das Thema. „Hey, wir sind da.“ Er setzte mich behutsam ab, jedoch nicht ohne eine Hand um meinen Arm geschlossen zu lassen, und erst jetzt konnte ich sehen, das wir vor einem zweistöckigen Haus inmitten einer Wohnsiedlung standen. Die gepflasterten Wege waren größtenteils intakt und verdorrte Rasenflächen deuteten darauf hin, dass die Gegend bestimmt einmal schön gewesen war. Jetzt, da sich niemand mehr um diesen Ort kümmerte, wirkte er allerdings nahezu gespenstisch.
„Sagtest du nicht etwas von Wohnung? Das hier ist ein Haus“, murmelte ich, als ich meinen Blick über die Fassade gleiten ließ. Abgesehen von dem abblätternden Putz sah das Haus sogar noch recht hübsch aus mit den weiß angestrichenen Fenstern und dem roten Ziegeldach.
„Schon, aber wir sind hier nur zur Miete“, grinste Adam, während er einen Schlüssel aus seiner Hosentasche zog und damit aufschloss. Er winkte mich herein und der Holzboden des Flurs knarzte laut, als wir ihn betraten.
„Ihr bezahlt Miete?“, wunderte ich mich.
„Nein.“ Er lachte leise bei seinem Geständnis.
„Und wenn du 'wir' sagst...“
„Dann meine ich mich und meine Mitbewohner.“ Er lächelte entschuldigend und ich zog überrascht meine Brauen in die Höhe, während ich ihm durch das Haus folgte.
„Du hast Mitbewohner?“
„Ja, alles Werwölfe. Obwohl wir eigentlich Einzelgänger sind, haben wir in unserer menschlichen Form oft das Bedürfnis, uns Gleichgesinnte zu suchen. In so einer Art Rudel zu sein, gibt uns das Gefühl, noch Kontrolle zu haben, auch nachdem... wir uns verwandeln. Zwar greifen sich verwandelte Werwölfe auch oft gegenseitig an, aber es ist trotzdem schön zu wissen, dass man nicht allein ist“, erzählte er mir. Als wir die Treppe zum ersten Stock betraten, schaute ich mich vorsichtig nach den anderen Übernatürlichen um, ehe ich zurück zu ihm schaute.
„Hast du deswegen so viele Narben?“, fragte ich neugierig. Als er mich daraufhin scharf ansah, biss ich mir auf die Zunge und ruderte sofort zurück. „Äh, du musst das natürlich nicht beantworten, wenn das zu privat ist. Tut mir leid. Manchmal spreche ich, ohne vorher nachzudenken.“
„Ist schon okay, ich hätte nur nicht gedacht, dass sie dir aufgefallen wären... Hier sind wir. Das ist mein Zimmer.“
Er öffnete eine hölzerne Tür und ließ mich vorangehen, wobei mir dennoch auffiel, dass er die Frage nicht beantwortet hatte. Sein Zimmer war zwar nicht besonders groß, dafür jedoch hoffnungslos überfüllt. Dass es vermutlich mal ein Kinderzimmer gewesen war, erkannte ich daran, dass unter dem weißen Anstrich die vorherige Blumentapete durchschimmerte. An den Schränken waren bunte Griffe festgeschraubt und eine Spitzengardine hielt neugierige Blicke fern. Das Kinderbett hatte Adam zu einem Sofa umfunktioniert und stattdessen eine riesige Matratze auf den Boden gelegt. Überall standen leere Wasserflaschen und dreckiges Geschirr herum.
„Ähm, die Unordnung tut mir leid, ich -“ Hastig sammelte er Teller vom Boden auf und klemmte sich drei Flaschen unter den Arm. „Ich hab heute nicht mit Besuch gerechnet. Und die Einrichtung ist auch nicht auf meinem Mist gewachsen.“
Ich erkannte, wie sich rote Flecken in seinem Gesicht bildeten und grinste, als ich beschwichtigend die Hände hob. „Ich urteile überhaupt nicht. Du solltest mal mein Zimmer sehen. Wobei, lieber doch nicht.“, lachte ich und er erwiderte mein Lächeln, sichtlich erleichtert, dass ich ihn nicht deswegen aufzog.
„Ich bring mal was von dem Zeug weg.“, informierte er mich und deutete mit dem Kinn auf die Sachen, die er sich geschnappt hatte. „Hast du vielleicht Hunger? Soll ich dir was zu Essen mitbringen?“
„Nein danke... Aber vielleicht was zu trinken?“, bat ich ihn.
„Klar, was hättest du denn gerne? Wir haben Wasser, Kaffee... Und das war's, fürchte ich.“ Er lächelte entschuldigend.
„Dann nehme ich Wasser, schätze ich.“ Ich erwiderte das Grinsen und er nickte.
„Kommt sofort. Mach es dir ruhig so lange gemütlich, ich bleib nicht lange weg.“ Mit diesen Worten verließ er das Zimmer und schloss die Tür hinter sich. Ich blieb unschlüssig mitten im Raum stehen und sah mich um, ehe ich mich schließlich dazu entschloss, mich auf das Sofa-Bett zu setzen. Die Matratze war so alt, dass ich die Federn spüren konnte, also rückte ich weiter an den Rand, wo sie noch nicht so durchgelegen war. Jetzt, da Adam weg war, kamen alle Sorgen mit heftiger Intensität zurück. Mir fiel auf, dass ich die wichtigsten Fragen noch gar nicht gestellt hatte: Was war mit dem Vampir passiert? War Phoebe immer noch wach und drehte meinetwegen gerade durch? Würde mich der Biss selbst in einen Vampir verwandeln? Und, die wichtigste Frage: Warum zur Hölle hat mich ein fremder Mann, der sich dreimal im Monat in ein menschenfressendes Monster verwandelt, in seine Wohnung gebracht, anstatt mich einfach direkt nach Hause gehen zu lassen? Konnte ich Adam wirklich vertrauen?
Ein Teil von mir tat es bereits. Irgendwie. Er benahm sich nicht viel anders als die menschlichen Männer, die ich bisher kennengelernt hatte und lachte ständig. Außerdem hatte er mein Leben gerettet, und wenn er mich töten wollte, hätte er sich nicht die Mühe machen müssen, mich vorher in seine Wohnung zu schleppen, es sei denn, er wollte mich mit seinen Mitbewohnern teilen.
Der Gedanke bereitete mir Unbehagen, aber davon einmal abgesehen hatte ich auch überhaupt keine Ahnung, wo ich war. Da mein Handy gerade tot war, hatte ich keinen Stadtplan und müsste mir wohl oder übel von Adam erklären lassen, wie ich zum nächsten Bahnhof kam.
In dem Moment kehrte er zurück. Er trug zwei volle Wasserflaschen bei sich und hielt einen Erste-Hilfe-Koffer im Arm. Er setzte sich zu mir auf das Sofa und drückte mir eine der Flaschen in die Hand, ehe er den Koffer öffnete und den Inhalt unter die Lupe nahm. Wenn ich ihn so ansah, fiel mir auf, dass ich mich eigentlich noch gar nicht angemessen bedankt hatte.
„Danke“, sagte ich also so inbrünstig, dass er überrascht den Blick von einer Packung Pflaster abwendete und stattdessen mich ansah, mit einem fragenden Blick im Gesicht.
„Keine Ursache, ist doch nur Wasser. Vermutlich auch nicht bezahlt, so wie ich Mike kenne...“, murmelte er.





























