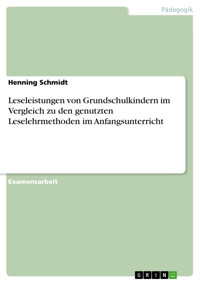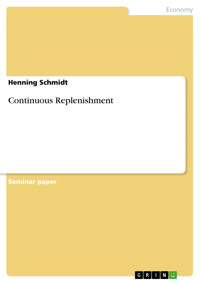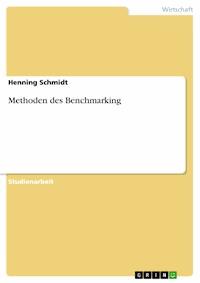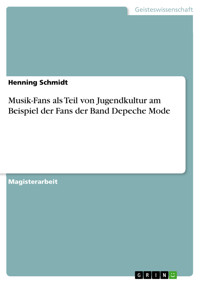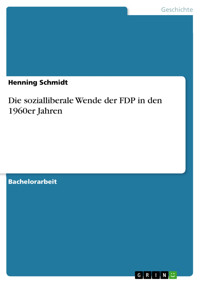15,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: novum Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Neben den bekannten Zivilisationskrankheiten gibt es tief verwurzelte sexuelle "Kulturkrankheiten", die unser Leben seit Jahrhunderten prägen. Sie erscheinen uns je nach Epoche, Ort und Gesellschaft entweder als Krankheit, als funktionale Störung, als sexuelle Sonderform, als religiöse Eigenart oder als kulturelle Normalität. Dieses Buch beleuchtet die historischen, gesellschaftlichen und psychologischen Hintergründe bestimmter sexueller Normen und Praktiken und wirft einen kritischen Blick auf ein Thema, das seit jeher unser Denken und Handeln beeinflusst. Eine provozierende und aufschlussreiche Aussage über einen Teil unseres Lebens, den wir gemeinhin als selbstverständlich betrachten.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 160
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Inhalt
Impressum
Vorwort
Einleitung
1 Sünde
2 Schmutz
3 Diskrete Teile
4 Wille
5 Problemzonen
6 Herrschaft
7 Beziehungen
Nachwort
Literatur
Seitenliste
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
Navigationspunkte
Cover
Impressum
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie.
Detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://www.d-nb.de abrufbar.
Alle Rechte der Verbreitung, auch durch Film, Funk und Fernsehen, fotomechanische Wiedergabe, Tonträger, elektronische Datenträger und auszugsweisen Nachdruck, sind vorbehalten.
© 2025 novum publishing gmbh
Rathausgasse 73, A-7311 Neckenmarkt
ISBN Printausgabe: 978-3-7116-1064-5
ISBN e-book: 978-3-7116-1065-2
Lektorat: novum Verlag
Umschlaggestaltung, Layout & Satz: novum publishing gmbh
www.novumverlag.com
Vorwort
Wieso schreibt jemand wie ich, der weder Arzt noch Psychologe noch Therapeut ist, ein Buch über Sexualität? Nun, die Antwort ist, dass es eigentlich und im Grunde gar nicht um Sexualität geht, sondern um Kräfte unseres Denkens, die auf unsere Sexualität einwirken und sie dadurch verändern. Und wieso werden gerade die Kräfte ausgewählt, die auf die Sexualität wirken? Weil ein umfassendes Panorama aller Kräfte auf alles eine vielbändige Lebensaufgabe wäre. Dabei würde das Thema, das die meisten Menschen am brennendsten interessiert und betrifft, leicht im breiten Fluss der Fakten übergangen werden.
Die durch die kulturellen Kräfte erzeugten Veränderungen verankern sich in unserem Bewusstsein auf eine Weise, dass wir häufig den ursprünglichen Originalzustand, also das ursprüngliche Konzept der Sexualität, gar nicht kennen oder vergessen haben. Durch bestimmte Verfahren werden zum Beispiel aus Baumwolle Hemden gefertigt. Ein Kind, das immer nur Baumwollhemden trägt, hat womöglich keinen Begriff von der Baumwollstaude und deren Anbau.
Um auf die oben gestellte Frage zurückzukommen, wieso ein Nichtfachmann über Sexualität schreibt, denken wir wieder an die Baumwolle: Um zu erkennen, dass ein Webstuhl die Baumwolle umarbeitet, muss ich kein Botaniker sein, der Baumwolle studiert. Und so muss ich kein Sexualexperte sein, um zu erkennen, welche Einflüsse unsere Sexualität verändern.
Für das in diesem Buch behandelte Thema hat das „veränderte“ Bewusstsein deswegen eine große Bedeutung, weil es kaum überwunden oder wieder rückgängig gemacht werden kann. In unserem Vergleich hieße dies, dass das Kind auch später mit „Baumwolle“ immer nur Hemden assoziieren würde, trotz aller Einsichten, die es möglicherweise gewonnen hat.
Wenn ein Erwachsener sieht, welche Schwierigkeiten ihm sein verändertes Bewusstsein macht, glaubt er zumeist, sie seien durch „falsche“ Erziehung entstanden, und wenn er bedenkt, was alles in seiner Erziehung falsch gemacht wurde, dann möchte er gern einen Schuldigen verantwortlich machen. Dies ist eine Erfahrung, die wir sicherlich alle kennen. Meistens sind es dann die Eltern, vornehmlich die Mutter, denen man den Vorwurf der verfehlten Erziehung macht.
Ich glaube, wer sich so verhält, ist noch nicht wirklich erwachsen geworden, weil er den Vorwurf eigentlich noch aus der Kindperspektive macht. Es fehlt eine weitere wichtige Erkenntnis, nämlich dass auch die Eltern nicht aus Nachlässigkeit oder gar Böswilligkeit heraus „falsch“ erzogen haben. Sie waren ja selbst bloß Opfer von kulturellen oder pädagogischen Kräften, die auf sie einwirkten und von denen sie sich nicht befreit haben bzw. nicht haben befreien können. Das setzt sich weiter in die Vergangenheit fort, sodass am Ende niemand persönlich haftbar gemacht werden kann.
Wer oder was ist schließlich der Gegner, der verantwortlich gemacht werden muss? Es ist die Tradition, die Kultur oder der Geist, der über uns herrscht. All die „falschen“ Inhalte werden uns neben den „richtigen“ sozusagen atmosphärisch vermittelt, nicht notwendig durch Worte oder erzieherische „Maßnahmen“. Unsere Aufgabe ist es, über unsere Vernunft und unser rationales Denken die falschen Inhalte zu ermitteln und sodann auszusortieren, denn sehr häufig widersprechen sie sogar der Vernunft und aller menschlichen Logik.
Um nur ein Beispiel dieser Unlogik zu nennen, so denke man an die Aussage, Gott sei der Schöpfer und Erhalter aller Lebewesen und daher auch des Menschen und der Tiere, dann müsste doch auffallen, dass er die menschliche Sünde der Unzucht zwar verurteilt, aber offenbar die gleiche „Sünde“ bei Tieren akzeptiert oder gar begrüßt.
Solange es nicht möglich ist, die Widersinnigkeit solcher Widersinnigkeiten zu vermitteln mit der Hoffnung auf Einsicht, so lange, glaube ich, gibt es keine Hoffnung auf eine Verbesserung unserer betrüblichen Situation.
Einleitung
Liest man sexualtherapeutische Literatur, so erscheinen die sexuellen Störungen weitgehend als ein individuelles Problem, das der Patient hat. Zur Behebung werden die unterschiedlichsten Methoden der Psychotherapie angewandt, immer mit Blick auf den Patienten, dem aus seiner Misere herausgeholfen werden soll. Das gelingt oder auch nicht oder zum Teil. Einige Therapien beziehen das Umfeld des Patienten mit ein, seine Familie, seinen Beruf, seinen Lebensstil. Man könnte dieses Vorgehen als „induktiv“ bezeichnen, indem man vom einzelnen Patienten und dessen Symptomzustand ausgeht, um von dort zu typischen Aussagen über das Krankheitsbild zu gelangen, die ermöglichen sollen, entweder eine Ursache der Krankheit zu finden, die sodann bekämpft wird, oder über einen Umlernprozess das Symptom sozusagen wegzutrainieren. Naturgemäß sind die Darstellungen in den Krankenakten und später die daraus entstehende Literatur sehr weitläufig, denn die individuellen Fallbeispiele sind endlos vielfältig.
In diesem Buch geht der Weg nicht vom Patienten aus – das ist Sache der zuständigen Therapeuten –, sondern zu ihm hin. Will sagen, das ungesunde Umfeld, der übergeordnete Kontext, steht im allerweitesten Sinne an erster Stelle. Und irgendwo in diesem weiten Feld steht der Missstand, die Krankheit, das Symptom und schließlich auch der Patient. Dies wäre der „deduktive“ Weg. Der Patient ist dann weniger der beklagenswerte Leidtragende, dem aus seinem schweren Schicksal herausgeholfen werden soll, sondern er ist Ausdruck all jener widrigen Kräfte, Einflüsse und Einflüsterungen, die auf ihn eingewirkt haben. Am nachhaltigsten wirken diese krankmachenden Einflüsse, wenn er noch Kind ist, wenn ihm noch keine selbstständige Orientierung zur Verfügung steht, die ihm erlauben würde, sich auch gegen bestimmte Einflüsse zu wehren.
Bei der hier gewählten Darstellungsweise lässt sich der Umfang der ganzen Problemlage dadurch begrenzen, dass nur von wenigen zentralen, Einfluss ausübenden Kategorien ausgegangen wird und dass man nicht in zu viele individuelle Details geht. Dadurch erhält man zwar in abstracto einen annähernden Begriff von Vollständigkeit, aber nicht unbedingt eine Fundstelle der eigenen individuellen Symptomatik.
Bevor wir nun das Buch der kulturellen Einflüsse auf unsere Sexualität aufschlagen, muss doch noch ein Punkt geklärt werden, der nicht für jedermann selbstverständlich ist. Da die Sexualität sowohl eine physische als auch eine psychische Seite hat, kann man grundsätzlich fragen, ob die Kultur demnach auf physische und psychische Weise wirkt. Physische Einflüsse auf die Körperlichkeit könnten etwa sein: medizinische Eingriffe, Tätowierungen, Prügelstrafen, die Verwendung von Parfüm und Deos, Mode, Drogen, Diäten und Sexspielzeuge. Deren Einfluss auf die physische Sexualität kann grundsätzlich stattfinden, aber auch wenn er stattfindet, soll er uns hier wegen der für uns nachrangigen Bedeutung nicht interessieren. Weit bemerkenswerter ist der unkörperliche, der psychische oder mentale Einfluss.
Nach dem gleichen logischen Muster wie gerade gezeigt, kennen wir ja einen mentalen Einfluss auf unsere Psyche. Das könnte zum Beispiel sein: ein Aufruf zur Keuschheit, der zu sexueller Abstinenz oder zu aufregenden Phantasien führt. Oder eine Suggestion verspricht den Männern kraftvolle Männlichkeit durch ausschweifenden Frauenkonsum, was dann Don Juans oder im Gegenteil eingeschüchterte Drückeberger hervorbringt. Oder z. B. die Unterweisung, eine Frau habe als Jungfrau in die Ehe zu gehen, erzeugt romantische Enthaltsamkeit oder einen Termin beim Gynäkologen, der ein künstliches Hymen einsetzt. Auch die psychische Disposition zu Vergewaltigung, Kindesmissbrauch, Sadomasochismus, Exhibitionismus und anderen Sonderformen entspringt gewöhnlich einem kulturellen und nicht einem naturgegebenen Diktat.
Wie aber steht es um den psychischen Einfluss auf den Körper, die Physis, und zwar zunächst ganz allgemein? Hier gibt es sehr unterschiedliche Meinungen in der Medizin, in der Rechtsprechung und im allgemeinen Bewusstsein. Klassisch ist die frühere Standardmeinung, ein körperliches Symptom habe immer eine körperliche Ursache, unterstehe also immer einem physischen Einfluss. Daneben hat sich die Auffassung durchgesetzt, dass einige oder sehr viele physische Symptome auch unkörperliche Ursachen haben können, wie z. B. Magengeschwüre, Durchfall, Bluthochdruck und feuchte Hände. Bei den sexuellen Störungen gehen die Meinungen wieder auseinander. Bezüglich Impotenz, einem prominenten Symptom, heißt es: Während heutzutage Urologen bei Impotenz verstärkt körperliche Ursachen sehen und den psychischen Gegebenheiten weniger Gewicht beilegen – man vermutet ca. 80 % organische Ursachen (vgl. Bähren 3) –, verhalten sich Sexualtherapeuten entgegengesetzt und gehen vorwiegend von psychischen bzw. mentalen Ursachen aus. Zum Beispiel sagt Dudley S. Danoff, ein amerikanischer Urologe (!) mit langjähriger Therapieerfahrung: „Ich sage meinen Patienten, dass Penis Power zu einem Prozent zwischen den Beinen und zu 99 Prozent zwischen den Ohren stattfindet. […] Die Mehrzahl der Männer ist völlig normal ausgerüstet. Mit ihrem Penis ist physisch und anatomisch alles in Ordnung. Alle Probleme, die sie haben – oder glauben zu haben –, rühren vom Kopf her“ (Danoff 34). Natürlich kennt auch er rein organische Ursachen. In der Hauptsache unterscheidet er zwischen neurologischen, vaskulären und hormonellen Störungen, die zumeist auf schon bestehenden Erkrankungen beruhen; er nennt u. a. Multiple Sklerose, Parkinson, Tumore und Verletzungen am Rückenmark, Alkoholismus und Diabetes mellitus (vgl. Danoff 89 ff).
Ein solch gewaltiges Auseinanderklaffen der Meinungen zu den Ursachen sexueller Störungen irritiert ungemein. Wie ist das möglich? Sehen die Wissenschaftler der unterschiedlichen Disziplinen nur das, was sie gemäß ihrer Fachrichtung sehen wollen? Denn dass sie einfach kurz- oder uneinsichtig sind, kann man wirklich nicht vermuten. Oder liegt eine unbedachte Sichtweise vor, die nicht explizit geklärt worden ist und daher zu einer scheinbaren Gegensätzlichkeit führt? Dazu gibt es in der Literatur sehr richtige Beobachtungen, nämlich die Feststellung, dass psychische Ursachen auf die Physis, den Körper, Einfluss nehmen, aber auch umgekehrt, der Körper auf die Psyche. Diese Wechselwirkung verwischt natürlich eine genaue Zuordnung. Aber ich glaube, es gibt noch eine weitere unbedachte Sichtweise:
Ein körperliches Symptom, das sichtbar vorliegt und behandelt werden soll, erscheint ja nicht plötzlich isoliert an der Oberfläche; es hat sich dahin entwickelt und bildet die Endstufe verschiedener Vorstufen. Jetzt ist es eine legitime Streitfrage, ob man eine der Vorstufen als Ursache ansehen will oder ob man alle Vorstufen mit der Endstufe sozusagen als ein Symptompaket verstehen und nur den ersten Auslöser zur Ursache erklären will. Nimmt man eine der Vorstufen, dann ist die Ursache natürlich somatisch; nimmt man den ersten Auslöser, dann ist die Ursache sehr häufig unkörperlich, also mental oder psychisch. An folgendem Beispiel des Herzinfarkts soll dieser Mechanismus veranschaulicht werden:
1. Das Herz erhält zu wenig Sauerstoff durch das Blut und kann seine Arbeit nicht verrichten (vaskulär). 2. Das Herzkranzgefäß ist verstopft durch Plaqueablagerungen (vaskulär). 3. Hoher Blutdruck führt zu solchen Ablagerungen (vaskulär). 4. Der hohe Blutdruck geht auf die dauerhafte Innervierung des Sympathikus zurück (neurologisch). 5. Die Innervierung wird durch das Gehirn ausgelöst (zerebral). 6. Das Gehirn nimmt durch die Sinnesorgane beruflichen Stress wahr (mental). Bei dieser Lage kann die Therapie auf jeweils einer der Stufen stattfinden (was nicht alles gleich sinnvoll ist), von Sauerstoffzufuhr durch eine Nasensonde, über einen Stent, Medikamente gegen Arteriosklerose, Senkung des Bluthochdrucks, Beruhigung des Sympathikus durch Sedativa und schließlich durch Änderung der beruflichen Situation. Natürlich lassen sich auch Behandlungen auf mehreren Stufen kombinieren.
Sieht man sich diese Therapievarianten an, dann erstaunt nicht, dass ein Notarzt zu anderen Maßnahmen neigt als ein Kardiologe, ein Angiologe, ein Hypertensiologe, ein Neurologe oder ein Psychotherapeut. Auf jeden Fall ist eine erfolgreiche Therapie der ersten Ursache am gründlichsten, da sie das Entstehen der späteren unterbindet, während beim späteren Eingreifen immer wieder Rückfälle auftreten können. Alle Therapieformen haben irgendwo ihre Berechtigung, und vielleicht sollte man das Kriegsbeil zwischen Somatikern und Psychologen wenigstens halbwegs begraben, indem man einen aufgeschlossenen Blick auch auf die therapeutischen Nachbarn wirft.
Vielleicht noch ein Beispiel aus unserem Themenkreis: 1. Es entsteht keine Erektion. 2. Die Schwellkörper füllen sich nicht mit Blut. 3. Wegen der fehlenden sogenannten venösen Restriktion fließt das einströmende Blut sogleich wieder ab. 4. Der Parasympathikus, über den die Venen verengt werden, arbeitet nicht, stattdessen sein Gegenspieler, der Sympathikus. 5. Der regiert das organische Geschehen, weil 6. das Gehirn eine angstmachende Situation erkennt. Auch hier sind die unterschiedlichsten Maßnahmen denkbar. Allgemein gesagt, wird diejenige therapeutische Methode, die die erste Ursache bekämpft, wie bereits angemerkt, am nachhaltigsten sein, wenn auch nicht mit plötzlichen Erfolgen, während die späteren direkter eingreifen, und die letzte Vorstufe eher schlagartig den Zustand verändern kann.
1 Sünde
Sexuelle Restriktionen hat es wohl in allen Kulturen und Volksstämmen gegeben, z. B. mit wem nicht verkehrt werden darf (Jungfrauen, fremde Ehefrauen, hochgestellte Frauen). Doch beziehen sich diese Vorschriften nur auf die sexuelle Ausübung der Praxis, sind also bestimmte Regeln der Betätigung; das sexuelle Begehren selbst und die grundsätzliche Ausübungsfreiheit der Sexualität aber wurden nie und nirgends eingeschränkt, verunglimpft, verdammt oder zur Sünde schlechthin erklärt. Das gibt es nur seit Paulus in der christlichen Kirche. In unserem Rechtssystem ist z. B. Diebstahl oder Mord verboten, wenn er versucht oder ausgeführt wird; aber der Gedanke daran steht nicht unter Strafe (weil dann wahrscheinlich die ganze Welt im Gefängnis säße). Anders in der christlichen Kirche, vor allem der katholischen. Dort ist schon der Gedanke an Sex eine Sünde, die gebeichtet werden muss. Wenn Menschen diese Praxis für Wahrheit halten, dann versteht man sofort, dass weitreichende Konsequenzen auf den Charakter, das Zusammenleben, die Politik stattfinden müssen.
Karlheinz Deschner sieht den Ursprung der kirchlichen Sexualfeindlichkeit (einer Moral, die noch immer wie eh wirkt, „obwohl das Christentum heute geistig beinah bankrott ist“ (Deschner 17)) in einer Reaktion auf die Riten, Vorstellungen und Gepflogenheiten der frühzeitlichen und antiken religiösen Traditionen, bei denen die Fruchtbarkeit bei Frauen, später bei Männern, durch ausgedehnte sexuelle Handlungen von Priestern, Frauen und Männern in Tempeln und in aller Öffentlichkeit beschworen und herabgewünscht wurden. Beispielsweise wurden Mädchen vor ihrer Heirat sakral entjungfert und durften erst dann heiraten. Im babylonischen Tempelbezirk musste jedes Mädchen der Aufforderung eines beliebigen Mannes folgen und zu seiner Verfügung stehen. Alle Welt, junge, alte, hässliche, schöne, kranke Menschen kopulierten mit Mensch und Tier, Vater, Mutter und Geschwistern „gemeinsam vor den Augen aller“ (Deschner 40).
Als Motiv für die neue Sündenlehre der Christen vermutet Deschner, dass man durch Entsagung, also durch ein Opfer, mehr göttliches Lob und Glück gewinnen würde: Erfolg, Gesundheit, ein ewiges Leben (vgl. 42). Beide Extreme, die fast gewaltsame Freizügigkeit im antiken Orient und die Sexualfeindlichkeit im Christentum, haben unabhängig von Deschners Vermutung auf jeden Fall religiöse Wurzeln und sind nicht durch biologische Evolution entstanden.
Wenn man es recht bedenkt, wäre es auch nicht einzusehen, dass natürliche, seit Urzeiten bestehende Lebensweisen sich plötzlich von allein, ohne externen Eingriff sozusagen, in unnatürliche Extreme verwandeln sollten. Die Religion muss treibende Kraft gewesen sein.
Die breiten kirchlichen Ausführungen, dass und wann Sex Sünde ist, geben unserem biologischen Drang erstmals eine moralische Qualität. Die Ehe als einziges letztlich zugestandenes Betätigungsfeld (Paulus) schließt andere Formen der Sexualität aus.
Die Ehe I
Die Begrenzung der Sexualität auf die Ehe – bis in die 60er-Jahre des vorigen Jahrhunderts und bisweilen heute noch gepredigt – könnte eine sinnvolle Vorschrift sein, wenn sie aus sozialen, pädagogischen, finanziellen, beruflichen Gründen aufgestellt worden wäre. Aber so wird nicht immer argumentiert: Sex vor und außerhalb der Ehe wird als Sünde deklariert, die Gott nicht will. Dabei zeigt die Biologie, dass die größte Potenz bei Männern im Alter von 17–21 Jahren liegt. Das hat die Natur so eingerichtet. Unsere Kultur hingegen sperrt diese Zeit sexuell, weil die Ehe zumeist später eingegangen wird, wenn überhaupt. Damit wird vor- und außerehelicher Verkehr in ein zwielichtiges Licht gerückt und geradezu zwangsweise produziert. Er stempelt die jungen Leute notwendig zu Sündern. Damit werden Unmengen von Sündern geschaffen, und die Ehe wird ihrerseits zur „heiligen“ Einrichtung.
Um den Sündern (durch die Beichte) zu helfen und die Ehe zu erhalten, wird die Kirche benötigt, die dann auf die Einhaltung der göttlichen Vorschrift dringt. Wenn man an dieses Konstrukt glaubt, wenn man also überzeugt ist, Gott habe mich mit meiner Frau „zusammengefügt“ und wolle, dass wir bis zum Tode verbunden bleiben, und er werfe missbilligende Blicke auf mich, wenn ich mich nicht daran halte, dann kann man in enorme Probleme geraten. Die weltlichen, d. h. die materiellen, emotionalen und familiären Schwierigkeiten, die bei Ehebruch und Trennung entstehen, sind doch schon schwer genug; aber für den Gläubigen kommt sodann künstlich ein Sündenbewusstsein hinzu, möglicherweise Angst vor Höllenstrafen, zumindest ein heftiges göttliches Donnerwetter. Dies erschwert die Sachlage natürlich und macht sie bisweilen auswegslos. Es wäre doch ehrlicher, wenn man über die Vernunft die Einsicht vermittelte, weshalb eine gesetzlich bevorzugte Eheinstitution vom Staat gewünscht und daher gefördert wird. Damit bliebe die Freiheit der Entscheidung gewahrt, und die problemerzeugende Einmischung der Kirche entfiele.
Es soll hier nicht gesagt sein, dass die Erklärung der außerehelichen Sexualität zur Sünde von Anfang an immer nur eine willkürliche, boshafte Vorschrift einer religiösen Institution gewesen ist. Es gibt anthropologische Theorien, die bei der ursprünglichen Entstehung dieser Erklärung einen rationalen Sinn sehen. Z. B. sagen Schaik & Michel in ihrem Buch Das Tagebuch der Menschheit, Was die Bibel über unsere Evolution verrät zur Prävention der durch individuelles Fehlverhalten verursachten göttlichen Kollektivstrafen: „Weil Krankheiten vermehrt im Kontext von Sexualität, Hygiene oder Essgewohnheiten auftauchten, waren Praktiken in diesen Bereichen besonders gefährdet, zur Sünde erklärt zu werden“ (Schaik 120).Aber auch wenn es so oder anders historisch abgeleitet werden kann, so ist nicht einzusehen, warum wir auch heute noch solche Vorschriften befolgen. Dennoch sind bestimmte Einschränkungen der Sexualität durchaus sinnvoll, wenn – wie heutzutage von hoher Brisanz – HIV ganze Bevölkerungsgruppen bedroht. Aber solche Einschränkungen sind rational verständlich und rechtfertigen dadurch ihre Anwendung, und – vor allem – sie richten keinen Schaden in den Tiefen unserer Psyche an.
Sündenbewusstsein I
Warum die organisierte Religion, also die Kirche, dermaßen antibiologische Vorschriften aufstellt, indem sie Sexualität mit Sünde gleichsetzt, kann man „innerkirchlich“ oder eben religiös leicht begründen, indem das entsprechende lustfeindliche Gottesbild ins Feld geführt wird, an das nicht zu glauben die allergrößte Sünde ist. Also glaubt man lieber an Gott und somit an die weniger gewaltige Sünde der Sexualität. Um hiermit umzugehen, entwickelte sich im Laufe der Jahrhunderte die Institution der Beichte zusammen mit der Lossprechung durch den Priester. So wurde durch die Absolution die Gefahr der Hölle beliebig oft verschoben.