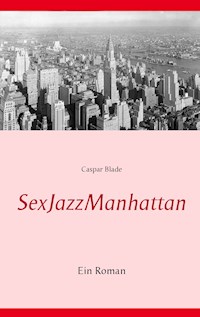
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Die gebrochenen Charaktere in der bekanntesten Großstadt und ihr mystisches und zugleich triviales Zusammentreffen im New Yorker Leben des Protagonisten Idas Lynkeus beschreiben ein sonderbares Gesamtbild voller Gefühle, Gedanken und Wege des Schicksals, die sich im Dickicht von Kunstgalerien und Jazzabenden stets wiederfinden. Dieser Roman zeichnet Charakterstudien von Personen die das Leben in Manhattan auf intensive, reflektierende Art erleben und zwischen, Sex, Gewalt und Drogen, kurz, Eros und Tod dem Sinn ihres Lebens auf der Spur sind. Ist es eine Flucht in das Individuum selbst oder aus ihm heraus? Ist es Erleuchtung, Zwang oder philosophische Sinnsuche als Ausbruchsmöglichkeit?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 193
Veröffentlichungsjahr: 2014
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Über das Buch:
Die gebrochenen Charaktere in der bekanntesten Großstadt und ihr mystisches und zugleich triviales Zusammentreffen im New Yorker Leben des Protagonisten Idas Lynkeus beschreiben ein sonderbares Gesamtbild voller Gefühle, Gedanken und Wege des Schicksals, die sich im Dickicht von Kunstgalerien und Jazzabenden stets wiederfinden.
Dieser Roman zeichnet Charakterstudien von Personen die das Leben in Manhattan auf intensive, reflektierende Art erleben und zwischen, Sex, Gewalt und Drogen, kurz, Eros und Tod dem Sinn ihres Lebens auf der Spur sind.
Ist es eine Flucht in das Individuum selbst oder aus ihm heraus?
Ist es Erleuchtung, Zwang oder philosophische Sinnsuche als Ausbruchsmöglichkeit?
Über den Autor:
Über Caspar Blade ist relativ wenig bekannt. Sein Werk ist der modernen Trash-Literatur zuzuordnen, in der es sich um konkret Ausgedrücktes handelt und der Autor zugleich sozialkritische Worte anstimmt.
„Was ich bedarf, ist eine Stimme, so durchdringend, wie der Blick des Lynkeus, welcher durch Erde und Felsen hindurchdrang, erschreckend wie das Seufzen der Giganten, anhaltend wie ein Naturlaut, spottend wie ein eiskalter Windstoß, boshaft wie der herzlose Hohn des Echo, umfangreich vom tiefsten Baß bis zu der schmelzendsten Bruststimme, moduliert vom andächtigen Lispeln bis zur Energie der Raserei.“
Sören Kierkegaard, in: Entweder-Oder (1843)
Inhaltsverzeichnis
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Kapitel 31
Kapitel 32
Kapitel 33
Kapitel 34
Kapitel 35
Kapitel 36
Kapitel 37
Kapitel 38
Kapitel 39
Kapitel 40
Kapitel 41
Kapitel 42
Kapitel 43
Kapitel 44
Kapitel 45
Kapitel 46
Kapitel 47
Kapitel 48
Kapitel 49
Kapitel 50
Kapitel 51
Kapitel 52
Kapitel 53
Kapitel 54
Kapitel 55
Kapitel 56
Kapitel 57
Kapitel 58
Kapitel 59
Kapitel 60
Kapitel 61
Kapitel 62
Kapitel 63
Kapitel 64
Kapitel 65
Kapitel 66
Kapitel 67
Kapitel 68
Kapitel 69
Kapitel 70
Kapitel 71
Kapitel 72
Kapitel 73
Kapitel 74
Kapitel 75
Kapitel 76
Kapitel 77
1
Warum sollte auch alles anders sein?
Nicht mehr die Straßen entlang zu gehen, die Fifth Avenue, wenn abends der Nieselregen begonnen hat zu fallen. Wenn die Leute in ihre Trenchcoats eingehüllt durch die Nacht eilen, suchend, fragend.
Wenn sie auf ihre Uhren schauen, um zu sehen, wann die nächste Subway kommt, und die etwas erkaltete Angst, womöglich ein Date zu verpassen, spürbar wird. Vielleicht laufen noch etliche Leute durch diese regnerische Nacht, in der die Regenperlen an den Wangen herunterlaufen, die Haare nass und verklebt in die Stirn hängen. Die Augen sind rastlos, wie die eines Tigers der suchend umherläuft in einer willenlosen Stadt des Aufbruchs.
Da wir schon beim Thema „Willenlos“ sind: Es war nun nicht gerade so als hätte ich ihr den Slip in einer Kirche ausgezogen und ihn dort über das Kruzifix drapiert. Nun ja, vielleicht wars ähnlich, der Vorgang aber war etwas differenzierter. Wie sollte ich es beschreiben? Setzen wir dort ein, wo Sue und ich uns kennengelernt haben? Nein. Das ist zu einfach, zu simpel klischeehaft, dass es einem ganz übel wird davon. Vielleicht beugt man dem vor, wenn man dort beginnt: Wir traten in die Kirche ein. Draußen war alles dunkel. Unsere Schritte hallten durch das weiträumige, altehrwürdige Gotteshaus. Sie hatte sich den Slip unter dem Minirock bereits während des Hineingehens bis zu den Kniekehlen ausgezogen, ich trat ihn ihr mit dem rechten Fuß einfach bis zum Boden. Irgendwann lag er auf dem schimmernden Marmorboden aber später, ich wusste nicht warum, ruhte er auf dem Altar. Ich sage es mit Nachdruck: Nicht über dem Kruzifix!
Wie er dahinkam? Ich denke, keiner weiß so genau was passierte. Wie soll man auch im Eifer des Gefechts wertvolle Gedanken an Textilien verschwenden?
Ihr Slip, Marke Guess, war schließlich ohne Belang.
Sue blickte im Halbdunkel zu mir hoch, als sie sich an mir zu schaffen machte. Ich genoss es nicht so, wie ich es gewöhnlich tat. Ihre Zähne rieben zu sehr.
Ich hob ihr Kinn zu mir hoch und küsste sie, drängte sie über die Stufen nach oben zum Altar. Sie wollte dass ich es ihr von hinten besorgen sollte. Ich ließ mich nicht bitten, also tat ich wie mir geheißen.
Und so fickte ich sie.
Ich kann mich erinnern, dass ich ihr sagte, sie solle ihr Höschen nicht vergessen, aber das gute Ding war irgendwie etwas verwirrt. Also liegt Guess nun auf dem Altar.
Jesus würde sich freuen.
Das war vor einer knappen Stunde.
Wenn man lauscht, so hört man oft noch die Sirenen auf der anderen Seite der Stadt, die Polizisten im Einsatz, eine mehr als verkehrten Welt. NYPD in seiner ganzen Pracht.
Man horcht durch das Geplätscher des Regens hindurch, und man vernimmt erstaunlicherweise die ungewohnte Ruhe der Nacht die in einer Großstadt wie dieser durchaus ungewöhnlich zu sein scheint.
Aber dennoch hüllt alles sich in die graue Vielfalt von verregnetem, dunstigem Asphalt, wo manchmal eine andere Figur an mir vorbeirauscht.
Wenn man den süßlichen Geruch von frauenhaftem Parfüm riecht, der starke und angenehme Rhythmus hochhackiger Schuhe die an einem vorbeifliegen. Tack, Tack, Tack, Tack…. Wenn man in den Himmel blickt, so wirkt er in diesen Momenten wie eine Decke aus staubiger Unbegreiflichkeit, fügsam duldet man das Dasein einer riesigen Stadt, deren Ausmaß tatsächlich unbekannt im Gefühl verschwindet, nicht ahnend, dass auch sie einst einen Anfang hatte, und sobald jede Unruhe in hundertjährigen Gesprächen, Flüstern, Gelächter, Narrheit und Unsinnigkeit verstummt, dann erst wird wieder alles in einen neuen Zyklus eingehen, werden Großaktionäre, Mogule, Geschäftsmänner in schwarzen Boss-Anzügen, mit roten Krawatten von der Bildfläche verschwunden sein, werden Produzenten, Fabrikanten und Industriemagnaten in all ihrer unvergleichlichen Verschiedenheit und inneren Divergenz verschollen im Geiste, nur noch als nebelhafte Erinnerung in den Köpfen der neuen Zivilisation sein.
Fortan würde ein anderes Gesetz gelten, würden andere Hände erbauen, was einst noch undenkbar gewesen war. Wenn man heute die architekturale Zusammensetzung dieser riesigen Hochhäuser betrachtet, die aus dem heiligen Boden herausragen, wie ein Lächeln von Geld und Macht, fühlt man die Herrschaft, die tief verwurzelt in den Herzen der Männer und Frauen vorherrscht, die sich die Erde Untertan gemacht haben.
Doch haben sie allesamt nicht verstanden um was es eigentlich wirklich geht. Sie leben meilenweit tief in einer falschen, erbauten Welt, die sie einst ausspucken wird, wenn sie nicht mehr willig sind, Diener zu sein.
Man sieht die fein ausgearbeiteten Fenster, die in unzähligen Reihen die Wände unglaublicher Fassaden beflaggen und die Türme die hoch und höher aus dem Boden gestampft in die regnerische Abendmacht triumphierend hervorragen.
Andere sind gefallen, sind wie Schachtürme vom Brett genommen worden, die Zwillingstürme, die von Lügen niedergerissenen weißen Türme.
Gestern erst nahm ich an einem Rundgang teil, ganz unerwartet wurde ich Teil einer Gruppe, die mich fortriss im Strome eines wissbegierigen Verbands aus Männern und Frauen, die sich einige wichtige Gebäude unserer Stadt ansahen. Ob ich nun die Erlaubnis dazu hatte oder nicht, schließlich war ich dann doch irgendwie Teil dieser Gruppe geworden und staunte über die Vielfalt von ausschmückenden Worten, mit denen man die hässlichen großen Hochhäuser in ihrer geschichtsträchtigen Scheinwichtigkeit beleuchtete. Da waren Gestalten mit Armani-Anzügen, und dunkelblauen Halstüchern oder braunen Lavallières mit feinem, beigefarbenem Entenfußmuster aus Kashmirstoffen. In allen dezenten Farben und Accessoires eines kulturfreudigen Gesamtausflugsfeelings.
Nun aber ist alles ruhig. Man geht etwas abseits des großen nächtlichen Trubels in dieser Stadt, dort, wo man noch sich selbst begegnet, sich befragt, wo und wessen und warum? Wo man noch ein lauschiges Plätzchen in einer Ecke einer alten, ruhigen Bar findet damit man in einem kleinen wichtigen Büchlein einige tiefgründige Sätze nachlesen kann und dann nachdenklich an einer dicken Zigarre zieht und dem Regen an den Fenstern zuschauen kann und gleichzeitig die schwüle Luft eines Lokals einatmet und angewidert in eigener Lustbarkeit an der Musik ertrinkt. Das machen viele. Das ist für viele Lebensinhalt. Es ist ausgesprochen seltsam.
2
Ab und zu hört man hoch über den Häusern, Gebäuden und Wolkenkratzern das dumpfe Grollen des Donners. Den Blitz sieht man nicht, dafür ist die Stadt zu sehr mit dem Himmel verbunden, zu sehr eins mit der Höhe und Deckung alter hoher Wände. Und tatsächlich: Die Wolkenkratzer sind wie Wände. Bedrohlich und allzu oft einengend und kalt.
Die Ornamente der Wirklichkeit sind oftmals Teil einer puren visuellen Befragung ihrer selbst, und ob es tatsächlich wirkend im eigenen Leben wird, ob es sich entfaltet in allen Regionen optischer Erkennung ist eine Frage, die so wahrscheinlich nicht beantwortet werden kann. Wenn die Schatten im Regen verwischen, die Farben der Kleidung im Dunst verschmiert und wiederholt eine Bewegung nachzeichnen, wenn Straßenmädchen und Rechtsanwälte abends gemeinsam den dunklen Asphalt teilen, sich in seelischen Decknamen und wissentlich in individueller Identifizierung glauben, sich selbst bestimmen zu können, und deshalb dann sich und andere beurteilen, dann liegt Verfänglichkeit in der Luft, verscheucht dies alles die Stille einer schönen, regnerischen, beruhigenden Nacht.
Das Herzstück einer Großstadt ist was?
Hat man sich das jemals gefragt, ist es an Deutlichkeit und Erkenntnis reich genug? Dort wo die übermüdeten Nachtgänger und Straßenwandler, kichernden Mädchen, tropfend und triefend vom Regen nach Hause eilen, in die Mitte der großstädtischen Potentialität.
Das Herzstück einer Großstadt ist was?
Ist es der älteste Teil dieser Stadt? Ist es das? Dort, wo die morschen Türen und die brüchigen alten Wände das Alter widerspiegeln?
Die Hälfte aller Menschen sind reaktive Menschen. Tatsächlich ist es nicht weit von der Wahrheit entfernt. Es scheint allerdings, daß der aktive Teil die Stadt an sich ist. Seltsam genug. Dennoch bringt stets die Stadt die Kraft auf, welche lenkt und anführt. Es sind nicht die scheinbar leitenden Wortführer großer Konzerne…
Oftmals spürt man diesen Windhauch von re-aktiver Substanz im Inneren eines Menschen, wenn er gerade an Dir vorbeigeht. Die Pflicht des Daseins, die Verbindlichkeit einer zeitlichen Verstrickung mit der Stadt und ihrer inneren Ordnung..
3
Als ich die Straße überquere, scheint der Asphalt rutschig und spiegelnd, in der Ferne höre ich noch das Aufheulen einiger Autos, das von Reifen aufgepeitschte Wasser. Hier, einige Straßen vom Zentrum entfernt, wird es etwas stiller, der Intervall von Geräuschen wird schwächer, unmittelbar wird die Nähe Teil des begleitenden Gefühls. Irgendwo sind noch einige Pubs offen. Weiche Klänge dringen von weit her an meine Ohren, eine Melodie, eine Stimmung von Blues und Sinatra.
Als ich mich den Klängen nähere, fühle ich mich etwas entkräftet, doch bittersüß empfängt mich die lodernde Wärme, als ich die Tür des Pubs öffne. Es sind nicht mehr viele Leute anwesend, die meisten sind vor Stunden gegangen. Einige sitzen wohlig warm, schläfrig und gähnend vor ihrem Glas Wein, streifen den Tag ab, der längst hinter ihnen liegt.
Morgen wartet ein anderer Tag.
Ganz hinten in den dunklen Ecken sehe ich einige Hippies hockend oder halb liegend, friedlich, hundemüde, doch glücklich den Klängen der Liveband zugewandt. Nur kurz will ich bleiben, mich aufwärmen an der Gesamtkomposition dieser Lebensminuten. Nicht das Einzelne zählt, sondern der gesamte Eindruck, dieses herrliche, gesamte Spiel menschlicher Wärme, die rar gewordene Freundlichkeit im Gefühl wahrer Brüderlichkeit unter Menschen. Längst sollten alle zuhause sein, schlafen, oder an großen Fenstern gelehnt dem ruhig und stetig fallenden Regen zuschauen, oder im Bett liegend der schlafenden Frau die wärmende Decke über die bloßen Schultern legen, oder ihr die Haarsträhnen aus dem Gesicht streichen…all das zum Beispiel. Oder sich die Leidenschaft aus dem Leib ficken.
Aber nun sitzen wir hier. Allesamt, wie zueinander gefundene Einzelwesen in einer kühlen, verregneten Nacht.
Der Bassist zupft an seinem Instrument, müde, doch im Gefühle erwacht und präsent. Der Pianist lehnt sich bei jedem Klang etwas nach hinten, wirft die langen blonden Haare nach hinten; seine Stirn in Falten geworfen, konzentriert und sensitiv. Seine Augen sind geschlossen, genießen jeden Tastenklang blues-hafter Sonderkultur.
Fast fühle ich mich verbunden mit diesen Tonschöpfern in einer verregneten Nacht.
Unmerklich huscht die Bedienung zwischen den Tischen umher und manchmal hört man ein Flüstern aus den dunklen Ecken.
Die Intensität des Fühlens steigt in mir hoch, es ist so ein Gefühl, das mich manchmal ergreift, wenn ich ganz konzentriert auf eine bestimmte Sache bin. Das ist sehr eigenartig. Oft entdeckt man sich selbst dabei, wenn man sich darauf einlässt.
Draußen regnet es immer noch, ich stelle mir vor wie es ist, nun draußen zu sein. Hier ist es warm und stickig, die Anwesenheit dieser Leute hier beruhigt mich.
4
Eine Stunde später stehe ich am Straßenrand, höre einige Autos die in der 66th Street Richtung Central Park fahren. Irgendwo bellt ein Hund. Wenn man die Milde einer solchen regenreichen Nacht sieht, erblickt man übereinstimmend die glättende Wirkung einer zarten Berührung? Ist es das? Es sind jene Momente in denen man im selben Atemzug gewissermaßen die Fröhlichkeit der Begnügsamkeit erspürt. Ob man mich versteht?
Vielleicht bin ich verrückt?
Als ich gestern zusammen mit dieser Gruppe an ihrer Sightseeingtour teilgenommen hatte, fühlte ich die Annäherung der Stadt an mein Inneres, jedoch fragte ich mich, ob es wirklich und tatsächlich möglich wäre, daß eine Stadt ein Gefühl in einem Menschen wachrufen kann, dieses süßliche, klare „Ich-bin-Teil-dieser-Stadt“.
Es war bestimmt nur Einbildung! Dennoch: Woher nur? Der Gedanke verliert an Deutlichkeit, an Anschaulichkeit.
Die Luzidität dieser Nacht ergreift mich. Ich gehe die leere Straße entlang, und ich erinnere mich an die Zeilen eines Liedes, das ich seit längerer Zeit nicht mehr gehört hatte.
Jede Berührung wäre nun zuviel, oder ich denke, daß ein Näherkommen vielleicht gerade jetzt eine beruhigende Wirkung auf mich hätte, ich weiß es nicht. Üblicherweise laufe ich nicht in einer solchen Nacht durch die kargen und mageren Straßen dieser Großstadt, trete nicht in kümmerliche kleine Bars ein, in der streunenden Attraktivität aus innerem Kontrast und langsamen Bewegungen innerhalb meiner Selbst. Allgemach gehe ich die Straße entlang, höre meine eigenen Schritte, regelmäßig und gleichförmig.
Vielleicht wäre es eine gute Idee, wenn ich ein Taxi rufen würde, es würde eine erleichternde Wirkung auf mich haben. Alles andere ist jetzt zu dieser Stunde geisttötend in einer öden, wasserreichen Steppe einer überdimensionalen Stadt aus Steinplatten- und Spiegelwänden, die fliehend hoch hinausragen in die Dunkelheit der Nacht, bei Tag in den Dunstwolken des Verkehrs in den Straßen versteckt. An einer Kreuzung bleibe ich stehen.
Dort erkenne ich eine Gestalt, ihre Haltung, ihre Bewegungen sind mir nicht fremd. Kein Fremder. Was tut ein Nichtfremder an diesem Ort? Es ist ein lächerlicher Gedanke der sehr schnell wieder verworfen ist. Ich sehe seine kurzen schwarzen Haare, sein langer schwarzer Mantel hängt nass über seinen Schultern, schwer und lastend. Stumm blickt er in die Pfützen die sich auf der unebenen Straße gebildet haben, gedankenverloren. Erschöpft sieht er aus, als wüsste er nicht wohin. Es ist Edward. Als er meine Schritte hört, schaut er in meine Richtung. Er erkennt mich. Wir umarmen uns, Edward ist ein sehr guter Freund.
„Oh, was tust du denn um diese Uhrzeit noch in der Kälte dieser Nacht“ fragt er.
„Ich weiß nicht. Vielleicht wollte in nur die Ruhe genießen.“ antworte ich.
Er blickt in die Pfützen.
„Und du?“ frage ich.
„Ich wollte nach Hause, dachte dann, es wäre schön noch etwas Musik zu hören“ sagte er.
-„Jetzt? So spät?“
„Vielleicht will ich nicht nach Hause…“ sagt er, fast flüsternd.
Die lichtlose Straße wirkt verloren, der neblige Morgendunst wird bald in die Straßen ziehen, und bedeckt die Nacht. Am hellen Morgen werden die ersten Sonnenstrahlen die großen Gebäude wie ruhende, wartende, abstrakte Figuren umrisshaft erscheinen lassen.
„Lass uns ein Taxi nehmen“ schlage ich vor.
In seinen Augen blitzt Dankbarkeit auf. Jemand spricht zu ihm. Er ist froh, denn es scheint ihm schlecht zu gehen.
Edward ist ein sehr guter Freund. Wir haben bereits viel zusammen erlebt, seit unserer frühen Jugend kennen wir uns. Er ist mir wie ein Bruder. Zu jederzeit für jedermann da. Vorhanden. Einfach präsent, interessiert. Mitleidend. Und er freut sich mit, wenn das Glück aufblüht.
5
So sitzen wir im Taxi. Edward spricht von seinem Tag, über die letzten Vorkommnisse.
Über die Frauen. Er bevorzugte eigentlich keine gewissen Frauen, er liebt alle Frauen. So ist er halt. Noch will er nicht mit mir darüber sprechen, was mit ihm los ist. Aber das ist auch wohl nicht der richtige Zeitpunkt dafür, so spät in einer verregneten Nacht. Wir sind beide müde, er weiß es. Nachdenklich spielt er mit seinen Händen, nervös und unbedacht.
Manchmal sieht er mich an, und seine Augen zeigen, dass er wahrscheinlich froh ist, mich in den leeren Straßen getroffen zu haben.
Ich erinnere mich an einen Vers aus der Bhagavad-Gita, der da heißt:
„Der steht mit seinem Selbst im Bund, der sich aus eigner Kraft besiegt; in Feindschaft lebt mit seinem Selbst, wer seinen Trieben unterliegt.“
Das ist plakativ, klingt logisch, klingt zumindest kohärent, besitzt aber keine Substanz.
Edward spricht über sich und die Frauen. Ein schönes farbiges Thema, bunt und schillernd, in einer grauen Nacht in dieser Stadt. Im Bund sein? Mit was? Mit dem Selbst? Was ist das überhaupt? Ist es das was außerhalb von Zeit und Raum existiert? Oder gerade das was alles verbindet?
Edward meint, das sei alles etwas kompliziert. Ich bin mir da nicht so sicher.
„Der Mensch ist ein Leistungstier, wenn es darum geht sich geistig mit Dingen zu beschäftigen, die ihn bei weitem überragen,… ganze Populationen ringen um Erkenntnis, um Verständnis und letzten Endes wird nur ein geringer Teil von ihnen an eine weitreichende Veränderung gelangen können, wenn überhaupt. Alles abstrakte Denken ist irgendwann nur geistige Onanie.
Das sind alles so Fragen…
Wenn wir daran teilnehmen, also an einem großen Schwindel der Weltmacht, glauben erklären zu können, was nicht erklärbar ist und ohnehin kläglich am Leben scheitern, wann ist da noch Erkenntnis mit einem Leben an sich zu verbinden?“ sage ich.
Edward nickt.
„Was meinst du mit `Schwindel der Weltmacht`“ fragt er mit erhobenen Augenbrauen.
„Siehst du die Welt wie sie ist? Schaust du wirklich hin?“ frage ich.
-„Ja.“
-„Nun, was sehen wir denn? Es ist nicht die Erde an sich. Die ist gut, das ist alles neutral, darum geht es nicht“ sage ich, schaue dann zu Edward hinüber, versuche seine Reaktion zu sehen, „es geht darum, daß alles bloß eine ganz schöne Bewegung von Lügen ist. in diesem Jahrzehnt, oder Jahrhundert, oder vielleicht sogar seit Jahrtausenden, ist das Ganze immer nur Zweck für Wenige, nicht umgekehrt, die Oberen, die Präsidenten, sind es nicht verkappte Schwindler, Egomane, Falschspieler, ohne klare Linien, und dann die Wissenschaftler, sind sie es nicht, die heute einer Inquisition gleich, alles tun um die verdummte Herde namens Zivilisation für noch dümmer zu verkaufen als man sie durch die Medien schon erzogen hat?
Damals glaubte man an die Religion, den Einen Gott, jetzt glauben sie an die Wissenschaft. Beides ist korrupt. Das goldene Kalb wird wieder angebetet, und dann fragt man sich ernsthaft: Hat die Menschheit etwas gelernt in den letzten Tausenden von Jahren?
-„Scheint nicht so“ wirft Edward ein.
-„Und ist es nicht so, daß wir sogar heute keine wahren Philosophen mehr haben, sondern nur noch Nachäffer, Nachahmer, geistige Mitgiftjäger die mittels ihrer hochtrabenden Ideen eher geistige Masturbation betreiben? Sie befriedigen ihr aufgeplustertes Ego.“
Edward wird nachdenklich. Ich sehe wie es ihn anstrengt, wie er in sich zusammensackt. Kein gutes Thema. Kein aufbauendes Gespräch. Nur Destruktion aller Illusionen.
Ich schaue den Regentropfen zu, wie sie an der Windschutzscheibe ihre Bahnen ziehen.
Dann sage ich: „Wir sind bald da“. Edward nickt.
Stets haben wir viel philosophiert, die Welt angesehen, sie be-redet.
Haben wir sie verstanden? Sitzen wir nun in einem Taxi, einem yellow cab, und suchen nach den eindeutigen Zeichen Gottes?
Edward schaut mich an, lächelt. Dann sagt er nach einer Zeit:
„Bist du noch Journalist? in den letzten Monaten habe ich nichts mehr von dir gelesen“
-„Nein, nicht ganz- also eigentlich ja und neinich bin jetzt bei einer anderen Wochenzeitschrift angestellt. Bessere Bezahlung. Ein Bürojob. Muß nicht, wie die Journalisten jeden Tag raus um durch den Regen zu laufen und Bösewichte zu entlarven, oder korrupte Politiker aufzuscheuchen.“ antworte ich lakonisch.
Edward lacht.
„Oh ja, ich kenne das…das lässt sich in jedem Job finden“. Seine Augen funkeln.
Ich weiß nicht mehr, was er gemacht hat. Das war auch nie sonderlich leicht, schließlich hat er stets seine Jobs gewechselt, und das nicht nur von einer Zeitung zu einer anderen, womöglich sogar von einer Zeitung zu einer Wochenzeitschrift, was durchaus eine kompliziertere Angelegenheit sein kann, nein, er, Edward, brachte es immer fertig, wirklich von der einen Welt in eine andere Welt zu springen, mit ganzer Leidenschaft in eine Welt zu tauchen, suchend, immer neu entdeckend,….abweichend, dissidentisch. Tauchlehrer, Kurator, Businessman.
„Du bist ein dissidentisches Wesen“ habe ich ihm einmal gesagt.
Damals lachte er, er kam gerade aus Australien zurück. Nun lebt er hier.
6
Wir sind an meiner Wohnung angekommen, wir steigen aus, bezahlen den Taxifahrer.
Ich sehe nach oben: kein Licht brennt, alle schlafen. Es ist ein hohes Gebäude, viele moderne Apartments stapeln sich.
Edward hält sich die Hand schützend vor die Augen, als er nach oben blickt. Der Regen hat nicht nachgelassen. Etwas verloren stehen wir in der Straße. Man riecht die Feuchtigkeit.
„Willst du nicht noch mit hoch, aufn Bier?“ frage ich.
-„Nein, nein, ich denke, es ist besser, wenn ich jetzt gehe, aber wir könnten morgen essen gehen, wenn Du Zeit hast.“ lacht er heiter. Seine Art zu lachen. Mein Bruder. Mein Freund.
„Na gut, ich ruf dich an“. Ich klopfe ihm auf die Schulter. Es fühlt sich trotzdem fremd an.
Kurz darauf fällt die schwere Eingangstür ins Schloss. Plötzlich ist alles anders. Die hellen Farben des Flurs strahlen mir entgegen.
Wahrscheinlich ist es eine Frage des Wesens, alles ist stets eine Frage des Wesens. Anschauung, Interesse, Willkür. Als ich so meine Schritte im Flur höre, muss ich daran denken, wie mein Abend verlaufen ist. Eigenartig, Edward getroffen zu haben.
Eine blonde Schönheit in einem viel zu engen Kleid stöckelt auf weißen viel zu hohen Manolo Blahniks an mir vorbei. Sie riecht nach Sex. Ich würd sie gern ficken. Sie lecken. Aber sie geht an mir vorbei, lächelnd, aufreizend. Ihre aufblitzenden Augen als sie an mir vorbeigeht.
Als ich im dreizehnten Stockwerk angekommen bin, und meine Wohnungstür sich hinter mir schließt, lege ich erst mal alle nassen Sachen ins Bad, dann gehe ich zu den wandhohen Fenstern, und schaue in die Nacht, auf die kaum sichtbare Straße. Hauptsache, wir haben uns gesehen. Wir haben bereits viel erlebt zusammen, Edward und ich, damals, als wir zusammen studiert haben.
Trotzdem ist diese Hure (war es eine?) von vorhin fast interessanter, obgleich ich sie nur einige Sekunden gesehen habe. Es war intensiver. Klarer. Ehrlicher?





























