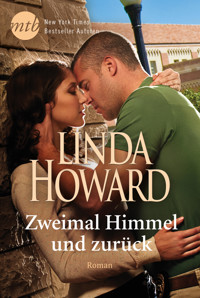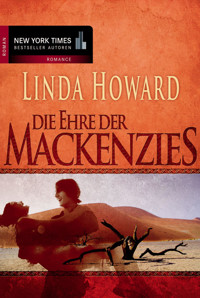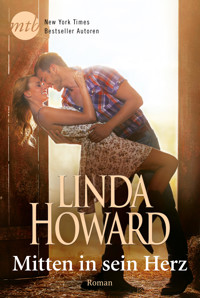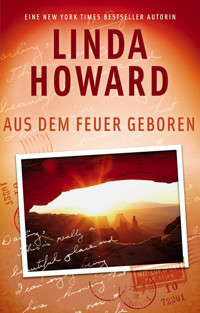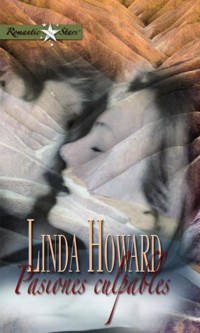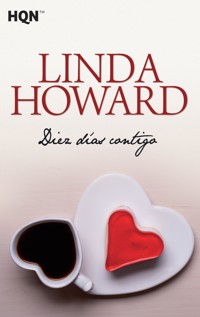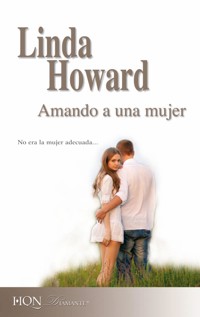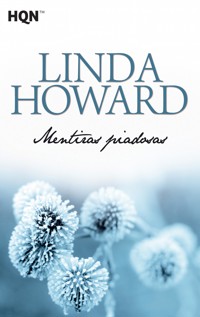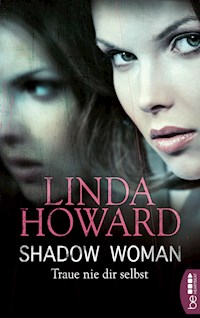
5,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 5,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 5,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: beHEARTBEAT
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Romance trifft Spannung - Die besten Romane von Linda Howard bei beHEARTBEAT
- Sprache: Deutsch
Lizette Henry wacht eines Morgens auf und sieht ein fremdes Gesicht im Spiegel. Zwei Jahre ihres Lebens sind aus ihrer Erinnerung verschwunden. Ein geheimnisvoller Fremder namens Xavier behauptet, ihr helfen zu wollen. Doch Lizette hat Xavier noch nie zuvor gesehen - oder? Kann sie ihm und den Erinnerungen, die er in ihr hervorruft, wirklich vertrauen?
eBooks von beHEARTBEAT - Herzklopfen garantiert.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 526
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Inhalt
Weitere Titel der Autorin
Über dieses Buch
Über die Autorin
Titel
Impressum
Widmung
Prolog
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
Epilog
Feedback
Weitere Titel der Autorin:
Die Doppelgängerin
Mordgeflüster
Heiße Spur
Mitternachtsmorde
Ein gefährlicher Liebhaber
Ein tödlicher Verehrer
Auch Engel mögen’s heiß
Über dieses Buch
Lizette Henry wacht eines Morgens auf und sieht ein fremdes Gesicht im Spiegel. Zwei Jahre ihres Lebens sind aus ihrer Erinnerung verschwunden. Ein geheimnisvoller Fremder namens Xavier behauptet, ihr helfen zu wollen. Doch Lizette hat Xavier noch nie zuvor gesehen - oder? Kann sie ihm und den Erinnerungen, die er in ihr hervorruft, wirklich vertrauen?
Über die Autorin
Linda Howard gehört zu den erfolgreichsten Liebesromanautorinnen weltweit. Sie hat über 25 Romane geschrieben, die sich inzwischen millionenfach verkauft haben. Ihre Bücher wurden in zahlreiche Sprachen übersetzt und mit vielen Preisen ausgezeichnet. Sie wohnt mit ihrem Mann und fünf Kindern in Alabama.
Linda Howard
Shadow Woman – Traue nie dir selbst
Aus dem Amerikanischen von Michaela Link
beHEARTBEAT
Vollständige digitale Neuausgabe des 2014 bei LYX erschienenen Titels.
»be« - Das eBook-Imprint der Bastei Lübbe AG
Für die Originalausgabe:
Copyright © 2013 by Linda Howington
Titel der amerikanischen Originalausgabe: „Shadow Woman“
Originalverlag: Ballantine Books, New York
This translation published by arrangement with Ballantine Books, an Imprint of Random House, a division of Penguin Random House LLC
Für diese Ausgabe:
Copyright © by Bastei Lübbe AG, Köln
Textredaktion: Joern Rauser
Covergestaltung: Anke Koopmann Guter Punkt, unter Verwendung eines Motives von © Shutterstock
eBook-Erstellung: Greiner & Reichel, Köln
ISBN 978-3-7325-8595-3
www.be-ebooks.de
www.lesejury.de
Für meine Schwester Joyce. Ich liebe dich. Ich vermisse dich. Ruhe in Frieden.
Prolog
San Francisco. Vier Jahre zuvor.
Dreiundzwanzig Uhr. Der Präsident und die First Lady, Eli und Natalie Thorndike, hatten sich für den Abend in ihre Hotelsuite zurückgezogen. Es war ein langer Tag gewesen, der mit dem Flug des Präsidenten quer durchs Land begonnen hatte. Ohne Pause hatten sich eine Reihe von Wahlkampfansprachen angeschlossen – die man selbstverständlich nicht als solche bezeichnet hatte. Und der Höhepunkt war schließlich eine gewaltige Wohltätigkeitsveranstaltung gewesen (Eintritt: zehntausend Dollar). Die First Lady hatte das alles an der Seite des Präsidenten mitgemacht – auf acht Zentimeter hohen Absätzen.
Laurel Rose, dem Sonderkommando zum Schutz der First Lady zugeteilt und seit elf Jahren im Dienst, war so müde, dass sie kaum noch klar sehen konnte. Aber zumindest war ihre Schicht jetzt vorüber. Sie hatte zwar keine hohen Schuhe getragen, aber trotzdem brachten sie diese Füße schier um. Mit Mühe erreichte sie ohne zu humpeln das Zimmer, das man ihr zugewiesen hatte. Es lag nur wenige Türen von der Präsidentensuite entfernt, sodass sie nötigenfalls schnell zur Stelle sein konnte. Die diensthabenden Agenten belegten zwei Zimmer, eins davon direkt gegenüber der Präsidentensuite, das andere unmittelbar daneben und mit einer Verbindungstür zur Suite, die zurzeit präsidentenseitig verschlossen war. Sie beneidete ihre Kollegen nicht um die Nachtschicht, auch wenn sie jetzt, da POTUS und FLOTUS sich für die Nacht zurückgezogen hatten, ebenfalls ein wenig entspannen konnten.
Das Gefolge des Präsidenten belegte drei ganze Stockwerke des Hotels mit dem Präsidenten und der First Lady im mittleren Stock. Andere Hotelgäste waren umquartiert worden, man hatte Treppenhäuser und Aufzüge gesichert und Nachforschungen über das Personal des Hotels angestellt. Außerdem hatte man auch die Gebäude auf der anderen Straßenseite gesichert; alle Risikokandidaten in der Gegend waren kontaktiert worden, um sie wissen zu lassen, dass der Secret Service sie beobachtete. Dies war getan worden, obwohl man bei den meisten von ihnen davon ausging, dass sie außerstande waren, ihre Drohungen wahr zu machen. Das Präsidentenehepaar befand sich hier so sicher, wie es in der Macht des Secret Service stand.
Das hieß jedoch nicht, dass überhaupt nichts schiefgehen konnte; es bedeutete nur, einem höchst unerwünschten Ereignis möglichst viele Hindernisse in den Weg gelegt zu haben. Laurel hatte ständig ein mulmiges Gefühl, das ihr sagte, es könne jederzeit alles passieren, sodass ihre Alarmbereitschaft nie ganz nachließ.
»Sie humpeln«, bemerkte ihr Kollege Tyrone Ebert, als er sich ihr auf dem Weg zu seinem Zimmer anschloss. So viel zu dem Versuch zu verbergen, wie sehr die Füße schmerzen, dachte sie. Sie versuchte erst gar nicht, es abzustreiten, dann würde er sie nämlich auch noch mit einem seiner Ich-durchschaue-dich-wie-Glas-Blicke ansehen. Ihm haftete etwas leicht Unheimliches an; seine dunklen Augen schienen alles zu sehen, während er selbst nichts preisgab. Aber Laurel traute seinen rasiermesserscharfen Instinkten. Bisher zeigte er keinelei Anzeichen von Erschöpfung, etwas, das sie zutiefst zu schätzen wusste, weil sie sich selbst kaum noch auf den Beinen halten konnte.
»Ja, es war ein langer Tag.«
Das war nichts Neues. Die Tage waren alle lang. Seit das Ministerium für Heimatschutz dem Finanzministerium die Zuständigkeit für den Secret Service abgenommen hatte, war es ihrer Meinung nach ziemlich bergab gegangen. Nicht, dass die Verhältnisse jemals großartig gewesen wären. Aber jetzt machten sie noch mehr Überstunden, die Moral hatte ihren Tiefpunkt erreicht, ihre Ausrüstung war schlichtweg beschissen, und – ein ganz anderes Thema – ihre Mutter, die in Indianapolis lebte, wurde langsam alt und war immer weniger dazu in der Lage, sich selbst zu versorgen. Laurel hatte zwar um eine Versetzung in die Umgebung von Indianapolis gebeten, aber obwohl dort eine Stelle frei war, hatte sie nur wenig Hoffnung, dass ihrer Bitte entsprochen wurde. So funktionierte es eben nicht. Wenn man keine Beziehungen hatte und niemanden kannte, der seine Verbindungen für einen spielen ließ, bekam man kaum jemals das, worum man bat.
Und Laurel hatte die dafür erforderlichen Beziehungen nicht. Sie hasste Ministeriumspolitik und hatte nie dabei mitgemacht, und jetzt sah sie nur allzu deutlich, dass sich ihre Karriere beim Secret Service dem Ende näherte. Das war noch so ein großes Problem des Service. Wegen seiner dämlichen Politik konnte er gute Leute nicht halten. Und verdammt, Laurel wusste, dass sie eine gute Agentin war, trotz des Mangels an Geldern und Personal, trotz der veralteten Waffen und der immer längeren Arbeitstage. Sie konnte es einfach nicht mehr ertragen. Na ja, jedenfalls nicht mehr viel länger. Sie hatte sich nur noch nicht ganz dazu überwinden können zu kündigen.
Dabei war es eigentlich ein cooler Job. Zwar nicht großartig bezahlt, aber cool. Sie liebte ihre Arbeit und war in der Lage, ihre Gefühle herauszuhalten. Es spielte keine Rolle, wer im Oval Office saß; einzig der Job zählte. Sie brauchte die First Lady nicht zu mögen; sie musste sie nur beschützen. Es wäre zwar einfacher gewesen, wenn die Thorndikes sympathischer gewesen wären, aber zumindest waren sie nicht so grässlich wie manche der früheren Präsidentenfamilien, wenn man einige der Geschichten glauben konnte, die sie gehört hatte. Natalie Thorndike war weder unhöflich noch eine Säuferin oder gehässig. Allerdings schien sie die Agenten, die sie beschützten, nicht wirklich als Menschen zu betrachten; sie war stolz und kühl und eher unnahbar. Manchmal wünschte sich Laurel, Mrs Thorndike wäre tatsächlich eine Säuferin, was zumindest die Arbeit im Sonderkommando ein wenig interessanter machen würde.
Der Präsident war ihr ziemlich ähnlich, er wirkte kühl und unnahbar und an allem unbeteiligt – außer an der Politik. Vor der Kamera oder wenn er sich im Wahlkampfmodus befand, verströmte er Wärme und Liebenswürdigkeit, aber er war ein hervorragender Schauspieler. Privat machte er eher einen berechnenden und manipulativen Eindruck – womit Mrs Thorndike allerdings kein Problem zu haben schien. Gelegentlich gab es Missstimmungen, was die Agenten immer daran merkten, dass die dem Präsidentenpaar ohnehin schon eigene Kühle dann geradezu gletscherhaft wurde. Aber davon abgesehen gab es keine äußeren Anzeichen von Zwistigkeiten, keine lauten Streitereien, auch keine Wortgefechte, keine knallenden Türen. Das politische Powerpaar marschierte überwiegend im Gleichschritt. Ihre Einigkeit hatte sie bereits ins Weiße Haus gebracht, wo sie eine weitere Amtszeit zu verbringen planten. Mit den gnadenlosen Instinkten des Präsidenten und der mächtigen Familie der First Lady im Rücken würden sie noch auf Jahre Teil des innersten politischen Zirkels der Nation sein, würden Wohlstand und Macht anhäufen, selbst wenn er dann nicht mehr im Amt war.
»Bis morgen früh«, sagte Tyrone, als sie sein Zimmer erreichten.
»Gute Nacht«, antwortete sie automatisch, ein wenig überrascht, dass er überhaupt so viel gesprochen hatte. Er machte sich nichts aus Smalltalk oder Geselligkeit. Abgesehen davon, dass er seine Pflichten tadellos erfüllte, wusste sie tatsächlich nur sehr wenig über ihn. Sie arbeitete jetzt seit zwei Jahren mit ihm zusammen, seit er der First Lady zugeteilt war, und wenn sie darüber nachdachte, hatte sie noch nicht einmal eine Ahnung, ob er verheiratet war. Er trug keinen Ring, aber das musste nichts heißen. Wenn er tatsächlich verheiratet oder liiert war, so erwähnte er es jedenfalls nie. Andererseits hatte er weder ihr noch einer der anderen Agentinnen je Avancen gemacht. Tyrone war … ein Einzelgänger.
Während Laurel zu ihrem Zimmer ging, das zwei Türen von seinem entfernt auf der gegenüberliegenden Seite des Flurs lag, wurde ihr klar, dass irgendetwas an ihm ihren Magen zum Flattern brachte. Wegen des Jobs hatte sie es immer ausgeblendet, aber jetzt, da sie sich eingestand, dass sie wahrscheinlich nicht mehr sehr lange dabei sein würde, schien sie ihrem Unterbewusstsein die Erlaubnis zu geben, sich seine Wirkung auf sie einzugestehen.
Sie mochte ihn. Er war kein hübscher Junge, aber er war auf eine gefährliche Art – »Ich mache keine Gefangenen« – echt umwerfend. Tyrone konnte man nicht übersehen. Er war hochgewachsen und muskulös und bewegte sich mit der anmutigen Kraft eines Berufssportlers oder eines Soldaten einer Spezialeinheit. Sie fand ihn attraktiv und war gern mit ihm zusammen, obwohl er nicht viel sprach. Und sie vertraute ihm, was schon viel wert war.
Sie schob ihre Schlüsselkarte in den Schlitz, drehte, sobald das grüne Licht anging, den Türknauf und trat in die Kühle ihres Zimmers. Die Nachttischlampe und das Badezimmerlicht brannten, so wie sie sie hinterlassen hatte. Trotzdem nahm sie sich – wie immer – einen Moment Zeit, ihr Zimmer zu überprüfen. Alles war normal.
Als sie die Schuhe von den Füßen streifte, zuckte sie zusammen und stöhnte dann vor Erleichterung, während sie nacheinander beide Knöchel kreisen ließ, die Füße durchbog und die Sehnen dehnte. Ihre Sohlen brannten aber immer noch, und da half nichts anderes, als sich für die nächsten paar Stunden hinzulegen, was sie auch so schnell wie möglich zu tun gedachte.
Sie streifte ihre Jacke ab, warf sie aufs Bett und machte sich gerade daran, aus ihrem Schulterhalfter zu schlüpfen, als sie ein schwaches Popp-Popp-Popp hörte. Sie musste nicht erst abwarten und lauschen, brauchte nicht einmal nachzudenken, sondern wusste sofort, was das für ein Geräusch war. Adrenalin schoss durch ihre Adern. Sie war sich nicht bewusst, wie sie zur Tür gekommen war. Nur, dass sie in den Flur hinausstürzte, wo sie Tyrone direkt vor sich mit gezückter Waffe und in Höchstgeschwindigkeit zur Präsidentensuite rennen sah. Sie waren nicht die Einzigen. Die ganze Besetzung der Nachtschicht war aus den Zimmern geschossen, und der Leiter des Sonderkommandos zum Schutz des Präsidenten, Charlie Dankins, versuchte bereits, die Doppeltür zur Präsidentensuite einzutreten.
Oh mein Gott. Die Schüsse waren aus der Suite gekommen.
Die Türen und Schlösser waren stabil; Charlie hatte, bis Laurel, Tyrone und der Schwarm weiterer Agenten eintrafen, bereits mehrere Versuche unternommen. Nun bezog Tyrone neben Charlie Position, sagte: »Jetzt.« Und zusammen traten sie gegen das Holz. Ihre vereinte Kraft ließ die Türen endlich aufkrachen. Die Waffen im Anschlag, drangen die Agenten in die Suite ein und durchsuchten schnell den Salon nach der Bedrohung.
Der Raum war leer. Laurel hörte auch nichts – was noch entsetzlicher war. Aber ihr Puls hämmerte ihr derart in den Ohren, dass er vielleicht jedes Geräusch übertönte. Auf der rechten Seite stand die Tür zum Schlafzimmer der First Lady offen, aber Laurel unterdrückte den Impuls, darauf zuzurennen. Im Moment war der Präsident am wichtigsten, was bedeutete, dass Charlie das Kommando hatte.
Die Tür zum Schlafzimmer des Präsidenten auf der linken Seite war geschlossen. Blitzschnell versuchte Charlie die Lage einzuschätzen; bis sie wussten, wo sich der Präsident befand, konnten sie nichts als gegeben voraussetzen. Er zeigte auf Laurel und Tyrone und den Rest des Sonderkommandos der First Lady und signalisierte ihnen, dass sie ihre Hälfte der Suite durchsuchen sollten, während er und die anderen die Räume des Präsidenten inspizierten.
Er ging in bewährter Taktik vor. Das Sonderkommando nahm sich in einer bestimmten Prozedur, die sie unendliche Male geübt hatten, das Schlafzimmer der First Lady vor.
Im Schlafzimmer waren die Lampen ausgeschaltet, aber das Licht aus der offenen Badezimmertür fiel auf den polierten Marmorboden und den edlen Orientteppich. Geordnet drangen die Agenten in den Raum ein und hielten erst inne, als sie Natalie Thorndike, die ihnen die linke Seite zuwandte, reglos am Sofa stehen sahen.
Laurel hatte die linke Seite übernommen, als sie hineingestürmt waren, Adam Heyes, der Leiter des Sonderkommandos, sicherte die Mitte und Tyrone die rechte Seite. Adam sagte: »Ma’am, sind Sie …?«
Dann sahen sie, dass jemand vor der First Lady auf dem Boden lag, jemand mit dickem grau meliertem Haar: der Präsident.
In den nächsten zwei Sekunden wurde die Zeit wie von einem Stroboskoplicht zerteilt.
Blitz.
Mrs Thorndike fuhr herum, und im selben Moment sahen sie die Waffe in ihrer Hand.
Blitz.
Laurel hatte nur einen Sekundenbruchteil, einen erstarrten Augenblick, um die entsetzliche Leere im Gesicht der First Lady wahrzunehmen; dann blitzte ein Lichtstrahl aus der Mündung der Waffe auf. Und was vorhin durch mehrere Wände hindurch nur wie ein »Popp« geklungen hatte, krachte nun in der Enge des Hotelzimmers geradezu ohrenbetäubend, gewaltig … es war der erste in einer scheinbar endlosen Folge von Schüssen, die die First Lady mit zuckendem Finger am Abzug abfeuerte.
Blitz.
Ein gewaltiger Schlag traf Laurel und warf sie rücklings zu Boden. Wie aus weiter Ferne nahm sie wahr, dass sie angeschossen worden war, verstand sogar, dass sie im Sterben lag.
Blitz.
Ein weiterer Sekundenbruchteil scharfen Bewusstseins: Adam lag auf dem Boden ausgestreckt neben ihr. Mit einem Blick, der sich trübte, sah sie noch Tyrones Gesichtsausdruck. Er feuerte mit erstarrter und grimmiger Miene seine eigene Waffe ab.
Und tat, was er tun musste.
Großer Gott, dachte Laurel.
Vielleicht war es ein Gebet, vielleicht auch der Ausdruck eines Entsetzens, das sie selbst nicht erfasste. Weitere Blitze gab es nicht mehr. Sie atmete noch einmal leise aus und … starb.
Der Präsident der Vereinigten Staaten, ermordet von seiner eigenen Ehefrau, die Präsidentengattin danach vom Secret Service erschossen, nachdem sie eine Agentin des eigens zu ihrem Schutz bestellten Sonderkommandos getötet und einen weiteren Agenten schwer verletzt hatte – das war ein beinahe zu massiver und kaum zu verarbeitender Schlag für die nationale Psyche. Das ganze Land stand unter Schock, aber die Maschinerie der Regierung arbeitete automatisch weiter. Am anderen Ende des Landes wurde William Berry, der Vizepräsident, vereidigt, kaum dass die Nachricht vom Tod des Präsidenten die Nachrichtenagenturen erreicht hatte. Für den Fall, dass dies der Auftakt zu einem größeren Angriff war, wurde das Militär in die höchste Alarmbereitschaft versetzt. Stück für Stück setzte man die einzelnen Teile zusammen, worauf sich ein schäbiges Gesamtbild ergab.
Und zwar buchstäblich. Denn es war ein Foto, das man im Gepäck der First Lady fand und das den Präsidenten in intimer Nähe zu ihrer eigenen Schwester zeigte. Whitney Porter Leightman, vier Jahre jünger als die First Lady und mit großem Einfluss in Washington, zog sich sofort aus der Öffentlichkeit zurück. Ihr Ehemann, Senator David Leightman, gab als Kommentar lediglich ab: »Der Tod des Präsidenten ist eine Tragödie für die Nation.« Er reichte nicht die Scheidung ein, aber das erwartete auch keiner der Insider aus dem Kapitol; ungeachtet der Situation gehörte seine Frau immer noch der mächtigen Familie Porter an, und er hatte gewiss nicht die Absicht, politisch Harakiri zu begehen, nur weil der Präsident seine Frau gebumst hatte.
Einige fragten sich, was die First Lady dazu getrieben haben mochte, derart auszurasten. Denn die Affäre war nicht unbedingt ein Geheimnis gewesen, und so hatte sie schon seit einiger Zeit davon gewusst. Aber am Ende kam man zu dem Schluss, dass man das wohl nie erfahren würde.
Die Secret-Service-Agentin Laurel Rose wurde mit allen Ehren beerdigt und ihr Name für alle Ewigkeiten jenen hinzugefügt, die ihr Leben in Erfüllung ihrer Pflicht geopfert hatten. Die Genesung des schwer verletzten Adam Heyes dauerte Monate, und er musste seinen Job beim Secret Service aufgeben. Nach einigen Monaten reichte Tyrone Ebert, der Agent, der die First Lady erschossen hatte, in aller Stille die Kündigung ein.
Ansonsten aber drehten sich die Räder weiter, wurden Papiere herumgeschoben, während die Computer summten.
1
Es war ein ganz normaler Morgen. Lizette Henry – für Familie und Kindheitsfreunde früher einmal Zette-the-Jet – schwang sich zu ihrer gewohnten Zeit aus dem Bett, um fünf Uhr neunundfünfzig, eine Minute bevor ihr Wecker klingeln würde. In der Küche hatte der automatische Timer gerade die Kaffeemaschine in Gang gesetzt. Gähnend ging Lizette ins Badezimmer und drehte das Wasser in der Dusche auf, und während es heiß wurde, benutzte sie die Toilette. In der Zwischenzeit hatte das Duschwasser genau die richtige Temperatur erreicht.
Sie begann ihren Morgen gern mit einer schönen entspannenden Dusche. Dabei sang sie nicht, machte keine Pläne für den Tag und sorgte sich auch nicht um Politik oder Wirtschaft oder um sonst irgendetwas. Während sie unter der Dusche stand, chillte sie einfach nur – oder besser gesagt, sie ließ sich wärmen.
Sie hielt ihren Programmablauf so genau ein, dass sie nicht einmal auf die Uhr zu sehen brauchte, um jederzeit zu wissen, wie spät es war. An diesem Julimorgen duschte sie fast genauso lange, wie die Kaffeemaschine brauchte. Dann wickelte sie sich ein Handtuch um ihr nasses Haar und trocknete sich mit einem zweiten Handtuch ab.
Durch die offene Tür des Badezimmers stieg ihr das verlockende Aroma des Kaffees in die Nase. Der Badezimmerspiegel war beschlagen. Bis sie sich ihre erste Tasse Kaffee an diesem Morgen geholt hatte, würde er klarer sein. Sie wickelte sich in ihren Bademantel, tappte barfuß in die Küche und nahm einen Becher aus dem Schrank. Sie mochte ihren Kaffee gern süß und mit viel Milch, also gab sie Zucker und Milch hinein, bevor sie den heißen Kaffee hinzufügte. Es war so, als gönnte sie sich gleich als Erstes am Morgen ein Dessert – ihrer Meinung nach eine hübsche Art, den Tag zu beginnen.
Sie nahm den Kaffee mit ins Badezimmer, um daran zu nippen, während sie sich die Haare föhnte und das bisschen Make-up auflegte, das sie zur Arbeit trug.
Sie stellte die Tasse auf dem Waschtisch ab, nahm das Handtuch vom Kopf und beugte sich aus der Taille vor, um sich das schulterlange dunkelbraune Haar energisch trocken zu rubbeln. Beim Aufrichten warf sie die Haare dann zurück, drehte sich zum Spiegel um …
… und starrte in das Gesicht einer Fremden.
Das feuchte Handtuch glitt ihr aus den plötzlich gefühllosen Fingern und fiel auf den Boden.
Wer ist diese Frau?
Das war nicht sie. Lizette wusste doch, wie sie aussah, und dies dort war nicht ihr Spiegelbild. Wild fuhr sie herum und suchte nach der Frau, die sie im Spiegel gesehen hatte, dazu bereit, sich zu ducken, auch bereit wegzurennen, bereit, um ihr Leben zu kämpfen, aber da war niemand. Sie war ganz allein im Badezimmer, allein im Haus, allein …
Allein.
Das Wort ging ihr durch den Kopf, lautlos – und ohne dass es ihr bewusst wurde. Sie drehte sich wieder zum Spiegel um, und während sie noch mit Verwirrung und Entsetzen kämpfte, musterte sie diese andere Person, als sei sie ein Gegner und nicht … was? Oder wer?
Das ergab keinen Sinn. Ihr Atem ging in schnellen, flachen Stößen. Was zum Teufel war hier los? Sie litt nicht an Gedächtnisverlust. Sie wusste doch, wer sie war und wo sie war, erinnerte sich an ihre Kindheit, ihre Freundin Diana und ihre anderen Arbeitskollegen. Sie wusste, welche Kleider in ihrem Schrank hingen und was sie heute anzuziehen gedachte. Sie erinnerte sich daran, was sie am gestrigen Abend gegessen hatte. Sie erinnerte sich an alles, so schien es – bis auf dieses Gesicht.
Es war nicht ihres.
Im Geist sah sie ihre eigenen Züge vor sich, die weicher, runder, vielleicht sogar hübscher waren, obwohl ihr das Gesicht, das sie im Spiegel sah, zwar etwas kantig, aber durchaus attraktiv erschien. Die Augen unterschieden sich nicht: blau, gleich weit voneinander entfernt, vielleicht ein wenig tiefer in den Höhlen liegend. Wie war das möglich? Wie konnten Augen plötzlich tiefer liegen?
Was war sonst noch gleich? Sie beugte sich dichter zum Spiegel vor und suchte nach der blassen Sommersprosse auf der linken Seite ihres Kinns. Ja, sie war immer noch da; zwar beinahe unsichtbar, aber immer noch zu sehen.
Alles andere stimmte irgendwie nicht. Die Nase wirkte schmaler und gebogener; ihre Wangenknochen ausgeprägter und höher, als sie sein sollten, die Kieferpartie eckiger, das Kinn konturierter.
Vollkommen verwirrt und verängstigt stand sie wie gelähmt da, außerstande, irgendetwas zu tun, selbst wenn ihr etwas eingefallen wäre. Sie starrte nur immer weiter in den Spiegel, während ihre Gedanken hilflos nach irgendeiner vernünftigen Erklärung suchten.
Sie fand keine. Was konnte diese Veränderung bewirkt haben? An einen Unfall, der eine derart umfangreiche Gesichtsrekonstruktion nötig gemacht hätte, würde sie sich doch erinnern. Vielleicht nicht an den Unfall selbst, so etwas kam ja vor, aber bestimmt an die Zeit danach; sie würde es wissen, wenn sie im Krankenhaus gewesen wäre und sich mehreren Operationen unterzogen hätte. Sie würde sich auch an eine Reha erinnern; irgendjemand würde ihr mit Sicherheit alles erzählt haben, selbst wenn sie während ihrer Genesung im Koma gelegen hätte. Aber sie hatte nicht im Koma gelegen. Nie und nimmer.
Sie erinnerte sich an ihr Leben. Es hatte nur einmal einen Unfall gegeben, als sie achtzehn Jahre alt gewesen war. Da waren ihre Eltern gestorben, was ihre Welt völlig auf den Kopf gestellt hatte. Aber damals hatte sie nicht einmal mit im Wagen gesessen. Die Folgen des Unfalls waren es gewesen, mit denen sie hatte fertigwerden müssen, mit der grausamen Trauer, dem Gefühl, ohne Halt in der schwarzen Leere ihres Lebens zu treiben, während sich all ihre frühere Sicherheit mit einem einzigen Wimpernschlag in nichts aufgelöst hatte.
Das gleiche Gefühl überkam sie jetzt wieder. Hier war etwas so unergründlich verkehrt, dass sie nicht wusste, was sie tun sollte. Es war einfach unbegreiflich, und sie konnte noch gar nicht überblicken, wie umfassend alles, was sie zu wissen glaubte, davon betroffen war.
Vielleicht war sie verrückt geworden. Vielleicht hatte sie in der Nacht einen Schlaganfall gehabt. Ja. Ein Schlaganfall würde den Verlust des Erinnerungsvermögens erklären. Um sich selbst zu testen, lächelte sie, und im Spiegel beobachtete sie, wie sich beide Mundwinkel gleichmäßig nach oben zogen. Dann zwinkerte sie mit den Augen, hielt beide Arme hoch. Das funktionierte. Außerdem würde sie es doch auch schon beim Duschen und Haarewaschen gemerkt haben, wenn irgendetwas nicht gestimmt hätte.
»Zehn, zwölf, eins, zweiundvierzig, achtzehn«, flüsterte sie. Nach dreißig Sekunden sagte sie die Zahlen noch einmal auf. »Zehn, zwölf, eins, zweiundvierzig, achtzehn.« Sie war sich sicher, dieselben Zahlen in derselben Reihenfolge wiederholt zu haben, aber hätte sie einen Schlaganfall gehabt, wäre sie dann überhaupt in der Verfassung, das zu beurteilen?
Trotzdem, Gehirn und Körper schienen gleichermaßen funktionstüchtig, was doch wahrscheinlich einen Schlaganfall ausschloss.
Und jetzt?
Ruf jemanden an. Wen?
Diana. Natürlich. Ihre beste Freundin könnte ihr die Frage beantworten, obwohl Lizette sich nicht sicher war, wie sie sie formulieren sollte. Hey, Di, wenn ich heute früh zur Arbeit komme, kannst du dann mal nachsehen, ob ich das gleiche Gesicht habe wie gestern?
Die Idee war zwar lächerlich, aber der Drang übermächtig. Lizette war bereits auf dem Weg zum Telefon, als sie plötzlich voller Panik erstarrte.
Nein.
Sie konnte niemanden anrufen.
Wenn sie es nämlich täte, würden sie Bescheid wissen.
Sie? Wer waren »sie«?
Unmittelbar nach diesem Gedanken war sie plötzlich schweißüberströmt, und Übelkeit krampfte ihr den Magen zusammen. Sie taumelte zurück ins Bad und schaffte es gerade noch rechtzeitig zur Toilette. Dort erbrach sie das bisschen Kaffee, das sie getrunken hatte, und hielt sich den Bauch, während ein Würgen ihren Körper schüttelte und nicht loslassen wollte. Sie spürte einen schneidenden Schmerz hinter den Augen, der so intensiv war, dass Tränen ihr die Sicht trübten und ihr über die Wangen rannen.
Als das krampfhafte Erbrechen aufgehört hatte, setzte sie sich geschwächt auf den kühlen Badezimmerboden und griff nach dem Toilettenpapier, um sich die Augen abzutupfen und die Nase zu putzen. Der schreckliche Schmerz hinter den Augen verebbte, als würde von innen ein Schraubstock gelockert. Keuchend schloss sie die Augen und ließ den Kopf an die Wand sinken. Sie war so müde, als hätte sie gerade einen Dreißig-Kilometer-Lauf absolviert.
Dreißig Kilometer? Woher sollte sie wissen, wie es sich anfühlte, dreißig Kilometer zu laufen? Sie war keine Läuferin, war es nie gewesen. Gelegentlich ging sie walken, und als Kind war sie ein wenig geritten, aber sie war auf keinen Fall ein Fitnessfreak.
Der stechende Schmerz hinter den Augen kam zurück, und ihr Magen rebellierte erneut. Sie schnappte nach Luft und zwang sich, nicht wieder zu würgen. Dann legte sie die Finger an die Innenseiten ihrer Augen und drückte kräftig, als könne sie so den Schmerz hinauszwingen. Das schien zu funktionieren, denn das Stechen ließ nach, genau wie zuvor.
Doch die Übelkeit und die Kopfschmerzen waren auch irgendwie tröstlich. Vielleicht war sie einfach krank. Vielleicht hatte sie einen merkwürdigen Virus, der sie halluzinieren ließ, und was sie im Spiegel gesehen zu haben glaubte, war nichts als das: eine Halluzination.
Aber sie fühlte sich nicht krank. Und das war seltsam, denn sie hatte sich gerade so heftig übergeben, dass ihre Bauchmuskeln schmerzten, und dann hatte sie auch noch diese stechenden Kopfschmerzen gehabt. Aber sie fühlte sich nicht krank. Jetzt, wo das vorbei war, schien sie wieder vollkommen gesund zu sein.
Außerdem ärgerte sie sich. Ihr Zeitplan, der vorsah, dass ihr Haar inzwischen geföhnt und sie geschminkt sein sollte, war völlig zum Teufel. Sie hasste es, wenn irgendetwas ihren selbst aufgestellten Tagesablauf durcheinanderbrachte; üblicherweise war sie so straff organisiert, dass neben ihr eine Schweizer Uhr ungenau wirkte …
Moment mal. Straff organisiert? Sie? Wann war das denn gewesen? Es fühlte sich falsch an, als denke sie an eine vollkommen andere Person.
Abrupt würgte es sie wieder; sie kam auf die Knie und beugte sich keuchend über die Toilette. Speichel rann ihr aus dem offenen Mund. Diesmal raubte ihr der messerscharfe Schmerz hinter den Augen schier das Sehvermögen. Sie griff nach dem Rand des Waschbeckens und hielt sich daran fest, um nicht zusammenzubrechen – oder kopfüber in die Toilette zu stürzen. So schrecklich die Übelkeit und der Schmerz auch waren, irgendwo tief in sich spürte sie bei diesem Gedanken einen ziemlich unpassenden Anflug von Komik.
Die Krämpfe verebbten nach und nach, und jetzt brach sie tatsächlich zusammen, aber zumindest landete sie auf dem Hintern. Sie lehnte sich gegen den Waschtisch, legte den Kopf in den Nacken, schloss die Augen und beobachtete im Geiste, wie sich der Schmerz zurückzog, so ähnlich wie das Wasser am Meer bei Ebbe.
Offensichtlich hatte sie sich irgendetwas eingefangen. Aber genauso offensichtlich konnte sie auf keinen Fall zur Arbeit gehen. Sie wollte kein Aufsehen erregen, indem sich ihr in aller Öffentlichkeit der längst leere – oder schlimmer noch: der doch nicht ganz leere – Magen umdrehte. Und außerdem wollte sie niemanden anstecken. Weil sie von den wieder genesenen Kollegen später nicht gelyncht werden wollte.
Das war verrückt. Das war doch überhaupt nicht ihre Art zu denken. Sie fand Toilettentauchen gar nicht witzig, dachte nicht an Lynchmobs. Dagegen war sie jemand, der sich Gedanken über die Arbeit und ihre Freunde, den Haushalt und die Wäsche machte. Normale Dinge eben.
Wieder meldete sich der Schmerz hinter den Augen, wenn auch diesmal nicht ganz so scharf und stechend. Erstarrt wartete sie darauf, dass die Bestie sie packte. Ihr Magen geriet ins Schlingern, aber dann beruhigte er sich wieder, und der Schmerz verblasste.
Sie musste sich krankmelden, das erste Mal, seit sie bei Becker Investments arbeitete. Ihre Abteilungsleiterin, Maryjo Winchell, hatte für solche Fälle ein Firmenhandy, und – gewissenhaft, wie sie war – Lizette hatte Maryjos Nummer in ihrem Handy gespeichert.
Sie würden es mitkriegen.
Unheimlich geisterten ihr die Worte durch den Kopf; Lizette verkrampfte sich, aber diesmal folgte ihnen weder ein lähmender Schmerz noch Übelkeit. Warum war jetzt nichts passiert?
Weil sie diesen Gedanken schon einmal gehabt hatte.
Ja. Die Antwort fühlte sich richtig an. Sie wusste nicht, warum, denn oberflächlich betrachtet war das sowohl dumm als auch paranoid, aber – ja.
Okay. Dann war es wohl das Beste, ihre Umgebung nicht merken zu lassen, dass sie ausgeflippt war, und sich einfach normal zu benehmen – zwar krank, aber normal.
Sie holte ihr Handy vom Tisch, wo sie es liegen gelassen hatte, und schaltete es ein. Abends schaltete sie es immer aus, weil … keine Ahnung, warum. Ihr fiel keine Antwort ein; sie tat es einfach.
Als das Telefon einsatzbereit war, ging sie ihre Kontakte durch, bis sie »Maryjo« fand, wählte die Nummer und drückte die grüne Anruftaste. Sie hörte beinahe sofort ein Klingeln, aber sie hatte irgendwo gelesen, dass die ersten beiden Klingelzeichen Schein-Klingelzeichen waren, nur eingerichtet, um den Anrufer glauben zu machen, dass etwas passierte, obwohl es in Wirklichkeit einige Sekunden dauerte, bis die Verbindung hergestellt war. Sie versuchte sich zu erinnern, wo sie das gelesen hatte und wann, aber es fiel ihr nicht ein. Vielleicht stimmte es ja gar nicht mehr; die Handytechnologie veränderte sich so schnell …
Ein Klicken, und »Maryjo am Apparat« drang an ihr Ohr. Lizette war so konzentriert darauf, über Handytechnologie nachzudenken, dass sie für einen Moment nicht weiter wusste und sich erst darauf besinnen musste, warum sie angerufen hatte. Krank. Richtig.
»Maryjo, hier ist Lizette.« Bis sie sprach, war ihr nicht bewusst gewesen, wie heiser sie klang; ihre Stimme musste vom Erbrechen belegt sein, ihr Atem ging immer noch zu schnell. »Es tut mir leid, aber ich kann heute nicht zur Arbeit kommen. Ich habe mir wahrscheinlich irgendeinen Bazillus eingefangen. Sie wollen bestimmt nicht, dass ich den verteile, glauben Sie mir.«
»Mussten Sie sich übergeben?«, fragte Maryjo mitfühlend.
»Ja. Und ich habe grässliche Kopfschmerzen.«
»Eine Magen-Darm-Grippe macht gerade die Runde. Meine Kinder hatten sie letzte Woche auch. Es dauert ungefähr vierundzwanzig Stunden, morgen geht es Ihnen also bestimmt schon wieder besser.«
»Mir ist es schrecklich unangenehm, so kurzfristig abzusagen.« Wie sie hätte voraussehen sollen, dass sie krank werden würde, war ihr allerdings schleierhaft.
»Ist doch nicht Ihre Schuld. Das ist der erste Krankentag, den Sie seit drei Jahren haben, also machen Sie sich deswegen nicht verrückt.«
»Danke«, brachte Lizette heraus. Etwas ließ tief in ihr die Alarmglocken läuten, so, als sei da noch was anderes … ihr Magen krampfte sich zusammen. »Tut mir leid, ich muss ins Bad …«
Und dahin trieb es sie auch, stolpernd und würgend. Sie hing über der Toilettenschüssel und würgte entsetzlich, aber es kam nichts mehr.
Als sie wieder atmen konnte, zitterte sie am ganzen Leib. Sie richtete sich auf, hielt sich für einen Moment am Waschtisch fest und drehte dann das kalte Wasser auf. Über das Waschbecken gebeugt spritzte sie sich wieder und wieder Wasser über das heiße Gesicht, bis sie ruhiger wurde und endlich atmen konnte, ohne dass es ihr im Hals kratzte.
Besser. Das war besser. Aber sie traute sich noch immer nicht, die Fremde im Spiegel zu betrachten. Stattdessen schloss sie die Augen und stand für einen Moment einfach da. Schließlich griff sie sich das Handtuch und wischte sich das Wasser aus den Augen, fuhr sich damit über Gesicht und Hals.
Ihr Herz hämmerte noch immer. Was um alles in der Welt hatte diesen letzten Anfall ausgelöst? War es etwas, das Maryjo gesagt hatte? Ihr fiel spontan nichts ein, doch sie erinnerte sich deutlich an dieses Gefühl von Bestürzung, als hätte sich Maryjo auf gefährliches Terrain begeben. Im Geiste ging sie das Gespräch noch einmal durch und versuchte, irgendetwas zu finden, das nicht stimmte, selbst wenn es etwas noch so Triviales sein mochte. Maryjos Kinder hatten eine Magen-Darm-Grippe gehabt, die ungefähr vierundzwanzig Stunden angehalten hatte. Da war buchstäblich weiter nichts, außer vielleicht noch die Bemerkung darüber, wie lange es her war, seit sie sich für einen Tag krankgemeldet hatte.
Wie ein Warnschuss durchzuckte der Schmerz ihren Kopf. Sie hielt sich am Rand des Waschbeckens fest und wartete ab, versuchte an gar nichts zu denken, bis der Schmerz verblasste.
Okay.
Etwas nagte an ihr, etwas, wovon sie das Gefühl hatte, dass sie sich daran erinnern sollte, das aber zum Verrücktwerden nicht zu …
Doch. Da war es. Und tatsächlich so trivial. Wann genau hatte sie sich das letzte Mal für einen Tag krankgemeldet?
Gar nicht, soweit sie sich erinnern konnte. In den gesamten fünf Jahren nicht, die sie bei Becker Investments arbeitete. Warum also hatte Maryjo gesagt, sie habe sich seit drei Jahren nicht krankgemeldet? Wann war sie denn krank gewesen? Bestimmt würde sie sich daran erinnern, denn sie war doch fast nie krank. Die wenigen Male waren ihr im Gedächtnis geblieben, zum Beispiel damals mit zwölf Jahren, als sie sich im Sommerlager einen ekelhaften, abscheulichen Bazillus eingefangen hatte, der sie buchstäblich umgehauen hatte. Sie zog sich nicht einmal die normalen Erkältungen zu, die jeden Winter im Büro die Runde machten.
Also, wann war es bis heute jemals passiert, dass sie nicht zur Arbeit erschienen war?
Sie dachte zurück an die Zeit, als sie bei Becker angefangen hatte.
Diesmal explodierte der Schmerz schier in ihrem Kopf, und Übelkeit drehte ihr den Magen um. Würgend und nach Luft ringend hing sie über der Toilette – und noch während sie das tat, ließ sie ihr Handy auf den Boden fallen und zertrat es.
Das war wahnsinnig. Und dennoch war der Impuls, ihr Handy zu zerstören, so stark gewesen, dass sie ihm einfach gefolgt war, ohne zu zögern, ohne zu fragen.
Als sie sich wieder unter Kontrolle hatte, putzte sie sich als Erstes die Nase, dann spritzte sie sich noch mehr kaltes Wasser ins Gesicht, während sie um eine logische Erklärung rang.
Es gab keine. Sie konnte sich nicht daran erinnern, jemals krank genug gewesen zu sein, nicht zur Arbeit zu gehen. Aber das war es jetzt nicht, was ihr die Eingeweide vor Angst zusammenzog. Sie fühlte sich, als kämpfe sie mit einer Fremden um die Kontrolle über ihren Körper, und manchmal siegte die Fremde.
Was auch immer im Gange war, ob sie einen kompletten Nervenzusammenbruch hatte oder ob irgendetwas wirklich ganz und gar aus dem Lot war, sie würde es herausfinden, und sie würde damit fertigwerden.
Bis dahin konnte sie nur ihren Instinkten folgen, wie zum Beispiel dem Impuls, das Handy kurz und klein zu trampeln. Sie kam sich beinahe schmerzhaft lächerlich vor, aber …
Vielleicht war sie das ganz und gar nicht.
Sie sah sich das zerstörte Handy an, sah auf das Handy herunter. »Oh, Mist«, sagte sie mit ihrer heiseren Stimme für den Fall, dass es immer noch funktionierte. Sie hob den kleinen Plastikkadaver auf. »Jetzt muss ich mir ein neues Handy kaufen.« Sie ließ den Akku herausspringen, um sicherzugehen, dass das Handy tot war, und warf dann sowohl das Telefon als auch den Akku in den Müll. Nach einer Sekunde fischte sie die Teile aber wieder heraus, legte sie ins Waschbecken und ließ Wasser darüberlaufen, bevor sie sie endgültig wegwarf.
Vor Angst wusste sie nicht, was sie als Nächstes tun sollte. Aber was sie am meisten erschreckte, war die Erkenntnis, dass sie sich nicht daran erinnern konnte, wann sie bei Becker Investments angefangen hatte.
2
Xavier stand vor Morgengrauen auf und lief seine üblichen fünf Meilen. Er lief gern in der vergleichsweise kühlen Dunkelheit, denn es war nicht nur angenehmer, sondern bot gelegentlich auch unvorhergesehene Unterhaltung: Einmal hatte irgendein Wichser den schweren Fehler begangen, ihn ausrauben zu wollen. Es war dem Bastard schließlich gelungen, mit nichts Schlimmerem als einigen angebrochenen Rippen und gequetschten Fingern sowie Xaviers Laufschuh Größe 43 im Arsch abzuhauen. Xavier hatte kurz erwogen, ihm einfach das Genick zu brechen, nur um die Sicherheit der Bürger von D. C. ein wenig zu erhöhen. Aber Leichen führten nur zu Komplikationen, deshalb hatte er sich zurückgehalten. Es hatte zwar noch andere interessante Momente gegeben, aber die meisten Wichser waren klug genug, sich zu beherrschen und ihn in Ruhe laufen zu lassen, nachdem sie sich ihn genauer angesehen hatten.
Er war groß, an die eins neunzig, und auf eine Art muskulös, die wenig mit dem Fitnessstudio zu tun hatte und viel damit, in brenzligen Situationen zu überleben. Er konnte zehn, fünfzehn Meilen schwimmen und doppelt so weit laufen, mit bis zu hundert Pfund Ausrüstung auf dem Rücken. Er konnte einen Hubschrauber fliegen, ein Boot steuern, und er hatte schon so viele Stunden am Schießstand trainiert, dass ihm fast jede Waffe in der Hand lag, als sei sie dort angewachsen. Es war jedoch nicht seine Größe, die die Möchtegernräuber stutzen ließ; es war vielmehr die Art, wie er sich bewegte, mit der äußersten Wachsamkeit eines Raubtiers – nicht, dass der gewöhnliche Straßenräuber in diesen Kategorien dachte. Sein Überlebensinstinkt würde ihm wohl eher so etwas wie »übler Bursche« zuflüstern und ihm eingeben, auf ein geeigneteres Opfer zu warten. Xavier war vieles, aber bestimmt kein Opfer.
Um halb sechs war er wieder zu Hause, und zwanzig Minuten später hatte er bereits geduscht und sich Jeans, Stiefel und ein schwarzes T-Shirt angezogen. Die Farbe des T-Shirts wechselte von Tag zu Tag, der Rest aber war Standard. »Angezogen« bedeutete außerdem, dass er seine Waffen kontrolliert und sein Pistolenhalfter so platziert hatte, dass es auf der rechten Niere saß. Die große Glock war nicht seine einzige Waffe, aber sie war die einzige, die sofort zu sehen war. Selbst in seinem neuen Zuhause – vielleicht sogar ganz besonders dort – war er immer mit zwei oder mehr Waffen ausgerüstet und niemals mehr als einen Schritt von seinem privaten Arsenal mit weiteren Waffen entfernt.
Er war nicht paranoid; die meisten ihm bekannten Leute, die in verdeckten Operationen tätig waren, machten es genauso. Zu Hause war er verwundbar, er und alle anderen in dem Geschäft, weil es ein Fixpunkt war. Menschen, die ständig umzogen, waren wesentlich schwerer zu erwischen. Die gute Nachricht war allerdings, dass es, soweit er wusste, niemand auf ihn abgesehen hatte … jedenfalls noch nicht. Das »noch nicht« blieb immer da, wenn auch unausgesprochen.
Deswegen hatte er Vorsichtsmaßnahmen ergriffen und gleich zwei nebeneinanderliegende Wohneinheiten gekauft. Eine lief auf seinen Namen, die andere auf einen J. P. Halston. Sollte jemand genauer nachforschen, würde er herausfinden, dass das »J. P.« für Joan Paulette stand. Viele ledige Frauen gaben nur ihre Initialen preis. Joan hatte eine Sozialversicherungsnummer und ein Bankkonto, bezahlte ihre Instandhaltungs- und Betriebskostenrechnungen pünktlich und kannte absolut kein Liebesleben. Er musste es wissen, denn Joan, das war schließlich er selbst. Sie existierte nur auf dem Papier. Gegenwärtig hatten sein Liebesleben und das von Joan eine Menge gemeinsam. Ziemlich ätzend zwar, aber so war es nun mal, und er kam schon damit klar.
Er schlief in der einen Wohnung und behielt sich die andere als Sicherheit vor. In zwei Rückwand an Rückwand stehenden Schränken hatte er eine versteckte Tür eingebaut, die beide Wohnungen miteinander verband und die nur mit dem Abdruck seines linken kleinen Fingers geöffnet werden konnte. Außerdem gab es noch weitere Sicherheitsmaßnahmen, denn jemand in seiner Branche konnte gar nicht vorsichtig genug sein. Er hoffte bei Gott, dass die meisten sich als überflüssig erweisen würden. Denn wenn er sie jemals wirklich brauchen sollte, bedeutete das, dass er bis zum Hals in der Scheiße steckte. Seine besonderen Qualitäten leisteten ihm hier gute Dienste, weil er sowohl unerschrocken als auch vorsichtig war – im Privatleben ebenso wie bei der Arbeit.
Die da oben wären verdammt dumm, wenn sie das nicht erwarteten, also operierte er unter der Prämisse, dass sie es erwarteten. Er fühlte sich wohler, wenn jeder – innerhalb eines begrenzten Kreises – wusste, was die anderen taten. Wahrscheinlich war das auch der Grund, warum er noch am Leben war; sie gingen davon aus, dass er einen Auslöser installiert hatte, um sie hochgehen zu lassen, falls sie jemals etwas gegen ihn unternehmen sollten. Und damit lagen sie absolut richtig. Das hieß zwar nicht, dass sie nicht eines Tages doch versuchen würden, einen Weg darum herum, darüber hinweg oder darunter durch zu finden; aber wenn das passierte, dann würde die politische Stinkbombe explodieren und alle würden nur noch ums Überleben kämpfen. Und genau darauf war er vorbereitet. Er hatte den Preis gekannt, sich darauf einzulassen, und sich ausgerechnet, dass das Endergebnis die Kosten wert war. Bedauerlicherweise hatten sich diese Kosten allerdings als höher entpuppt, als er erwartet hatte.
Wie jeden Morgen saß er in dem kleinen abgeschirmten Raum in der Sicherheitswohnung, im Nervenzentrum seiner verschiedenen Alarmanlagen, der elektronischen Stolperdrähte und Programme zur Informationsermittlung, und trank Kaffee, während er horchte, las und die Monitore überwachte. Er hatte sich auf ihre Systeme aufgeschaltet – wenn also Joans Haus gefilzt würde, dann fänden sie allenfalls ihre eigenen Wanzen, aber auch das wussten sie vermutlich. Wenn sie nicht klug gewesen wären, hätte er überhaupt nicht mit ihnen zusammengearbeitet. Nicht, dass er den eigenen Leuten nicht vertraute; bis zu einem gewissen Punkt tat er das. Jenseits dieses Punktes allerdings vertraute er nur sich selbst. Es überraschte ihn, dass sie ihn nach wie vor einweihten, aber andererseits war er recht eng in die Sache eingebunden, darum würden sie ihn wohl kaum verärgern wollen. Er hatte mächtige Freunde … und auch gefährliche Freunde mit gewissen Qualitäten; welche der beiden Gruppen größeren Einfluss auf die Entscheidung gehabt hatte, ihn auf dem Laufenden zu halten, wusste er nicht, aber solange es funktionierte, war ihm das scheißegal.
Trotzdem. Sie beschatteten sie und er beschattete diese Leute und stellte sicher, dass das, was sie berichteten, genau das war, was er bereits wusste. Und weil er es bereits wusste, waren sie auch darum bemüht, den Status quo zu halten. Sie konnten ihm keine Informationen vorenthalten oder ihm falsche geben. Nicht kontrollieren konnte er, ob sie auch ohne Anlass in Aktion treten würden, ob eines Tages jemand mit Macht einfach beschloss, dass das Risiko zu groß wurde, um die Situation so weiterlaufen zu lassen.
Hier verließ er sich auf sein Bauchgefühl, das nach allem, was er schon hinter sich hatte, zu einem messerscharfen Instrument geworden war. Der Tag, an dem ihm dieser Instinkt etwas zuflüsterte, war zugleich der Tag, an dem er in Aktion trat. Gegenseitig zugesicherte Zerstörung war lediglich eine hochtrabende Formulierung für Pattsituation – und ein gutes Konzept, um den Frieden zu erhalten.
Gerade las er etwas über den Zustand des Euro – nicht, dass er einer dieser Finanzfritzen gewesen wäre, aber er suchte auch gar keine Investmentinformationen. Geld war der Motor der Politik, der nationalen Sicherheit – verdammt, einfach von allem, Punkt. Nationen in Bedrängnis neigten zu extremen Reaktionen, und eine kleine Erschütterung auf dem Finanzmarkt konnte ihn binnen einer Stunde in einen Jet katapultieren, in dem er Gott weiß wohin reiste, um zu tun, was immer getan werden musste. Weil er sie nicht zu jeder Zeit überwachen konnte, hatte er für Verstärkung gesorgt, die in Aktion trat, falls es notwendig wurde. Er versuchte, die Zeiten vorauszuberechnen oder vorherzusehen, zu denen seine Dienste vielleicht benötigt würden. Sogar während er las, horchte er noch auf alles, was auch nur im Mindesten ungewöhnlich war. Bisher hatte sie ihre gewohnte Routine anscheinend eingehalten. Alles Ungewöhnliche würde eine Flutwelle von Reaktionen auslösen.
»Zehn, zwölf, eins, zweiundvierzig, achtzehn.«
Die geflüsterten Zahlen erregten so abrupt und vollständig seine Aufmerksamkeit, als sei ein Schuss abgefeuert worden. Er stellte seine Tasse weg und drehte seinen Stuhl, den Kopf schräg gelegt – der ganze Körper befand sich in Alarmbereitschaft. Automatisch griff er nach einem Stift und notierte die Zahlen. Was zum Teufel …?
Sekunden später wiederholte sie die Zahlensequenz, wenn auch diesmal mit etwas kräftigerer Stimme.
Es folgte eine Pause. Dann hörte man Bewegung, zuerst ganz normal, dann hektisch, gefolgt von den unverkennbaren Geräuschen langen und heftigen Erbrechens.
Fuck! Er wünschte, er könnte sie sehen, aber das Überwachungsnetzwerk hatte ihr zumindest so viel Privatsphäre zugestanden. Nichts, was sie sagte, ob über ihren Festnetzanschluss, ihr Handy oder selbst über ihr Diensttelefon, geschweige denn das, was sie sich im Fernsehen anschaute oder auf ihrem Computer tat, war noch privat. Die Bewegungen ihres Wagens wurden ständig von einem GPS-Gerät verfolgt. Videoüberwachung allerdings hatte man weggelassen; nicht aus Sorge um ihre verfassungsmäßigen Rechte, die ohnehin so ziemlich aufgerieben und mit Füßen getreten worden waren, sondern weil man es für unnötig hielt. Sie brauchten nicht zu sehen, wie sie zur Toilette ging oder duschte, solange sie wussten, dass es das war, was sie gerade tat.
Bislang war die Überwachung einfach gewesen. Sie wich niemals von ihrer Routine ab. Sie blieb ruhig, berechenbar – und jetzt, so schien es, war sie krank geworden. Aber was zum Teufel bedeuteten diese Zahlen?
Er lauschte zwei weiteren Übelkeitsanfällen. Sie musste definitiv krank sein. Dann kam das Signal, dass sie ihr Handy eingeschaltet hatte. Der Name ihrer Abteilungsleiterin, Maryjo Winchell, tauchte auf seinem Bildschirm auf.
Er hatte ihr Handy geklont, daher konnte er den Anruf nun in Echtzeit mithören. Und was er hörte, beruhigte ihn. Sie glaubte, einen Bazillus zu haben, sie übergab sich – das wusste er bereits – und hatte schreckliche Kopfschmerzen. Maryjo bestätigte, dass eine Magen-Darm-Grippe die Runde machte, ihre Kinder hätten sie gehabt usw.
Seine Anspannung wollte sich gerade legen, als Maryjo ihm eine Granate ins Gesicht schleuderte. »Das ist der erste Krankentag, den Sie seit drei Jahren haben, also machen Sie sich deswegen nicht verrückt.«
Fuck! Fuck! Fuck! Fuck! Schon vor langer Zeit hatte er gelernt, sein Temperament zu zügeln – meistens jedenfalls –, aber jetzt hätte er zu gern seine Kaffeetasse in den Computerbildschirm gefeuert. Warum zum Teufel würde Maryjo Winchell darüber Buch führen, wie lange sich jemand nicht mehr krankgemeldet hatte?
Gott sei dank schien Lizette nichts bemerkt zu haben. Vielleicht war sie zu krank. Sie murmelte ein Danke, dann sagte sie: »Tut mir leid, ich muss ins Bad …« Er hörte Bewegung, lauschte auf schwallartiges Erbrechen, auf fließendes Wasser, nach einer langen Pause einen weiteren Schwall – dann war da ein Klappern, und die Handyverbindung war tot.
Gleichzeitig hörte er über die anderen Wanzen im Raum ein weiteres Klappern und dann einen schweren Aufprall. Nach einigen Minuten putzte sie sich die Nase. Das Geräusch von schwerem Atmen und noch mehr fließendem Wasser war zu hören. Dann murmelte sie mit der belegten Stimme eines Menschen, der sich gerade übergeben hatte und dessen Nase verstopft war: »Oh, Mist. Jetzt muss ich mir ein neues Handy kaufen.«
Weitere Geräusche, als spiele sie mit dem Telefon herum. Wieder fließendes Wasser. Dann ertönte der Föhn. Das ergab Sinn; sie wusch sich jeden Morgen unter der Dusche die Haare. Jetzt föhnte sie sie trocken, krank hin oder her. Das war ihre Routine, eine, von der sie in den drei Jahren, in denen er sie überwachte, nicht abgewichen war. Nicht zur Arbeit zu gehen, musste in ihrer wohlgeordneten Welt gleichbedeutend mit einem Erdbeben sein, selbst wenn sie krank war.
Nachdem sie den Föhn ausgeschaltet hatte, folgte er den Geräuschen, die anzeigten, dass sie in ihr Schlafzimmer zurückging; soweit er erkennen konnte, legte sie sich wieder ins Bett.
Alles schien in Ordnung. Die anderen, die mithörten, würden bemerkt haben, was Maryjo da für eine verbale Bombe gezündet hatte, aber wichtig war, ob Lizette es bemerkt hatte, und den Anschein hatte es nicht gehabt. Sie war krank, sie war drauf und dran, sich noch einmal zu übergeben, daher hatte sie vielleicht nicht allzu genau hingehört.
Konnten sie dieses Risiko eingehen?
Er kannte sie. Ihr größtes Talent war ihr rasches Auffassungsvermögen, sie war in der Lage, sich schnell auf eine Situation einzustellen, und ließ sich von ihrem Instinkt leiten. Zweifellos kotzte sie sich die Seele aus dem Leib, aber angesichts des Ausrutschers der Winchell war es ein zu großer Zufall, zumindest für ihn, dass Lizette ihr Handy fast unmittelbar nach dieser Enthüllung »versehentlich« fallen gelassen und zerstört hatte.
Eigentlich durfte so etwas nicht passieren. Sie war ausgeschaltet worden, und dieser Vorgang war unumkehrbar.
Wahrscheinlich. Es war noch nie zuvor in dem Ausmaß wie bei Lizette ausprobiert worden. Sie sollte eigentlich für immer verändert sein, so, wie ein amputierter Mensch verändert ist; sie würde weiterhin funktionieren, ihr Leben leben, aber sie würde nie wieder so sein wie vorher. Doch so extrem war die Behandlung auch noch nie angewendet worden, wie also sollte irgendjemand mit Bestimmtheit sagen können, wie sie reagieren würde?
Hier war der Punkt, wo sein eigenes Bauchgefühl auf den Plan trat. Er musste ihr flexibles Denken, das sie möglicherweise widerstandsfähiger machte, mitberücksichtigen. Wenn man das zerstörte Handy dazurechnete, sagte ihm sein Bauchgefühl: Sie ist wieder da.
Die Frage war also nicht, ob sie das Risiko eingehen konnten, die Alarmglocken zu ignorieren, die Winchells Ausrutscher ausgelöst hatte, sondern ob er es konnte.
3
Information war alles. Sie zu sammeln hörte niemals auf, Tag und Nacht nicht. Augen und Ohren in der einen oder anderen Form waren überall. Es gab Kameras, Abhörgeräte – die keineswegs alle genehmigt waren – und Keylogger; Handys wurden geklont oder Anrufe einfach abgefangen; Wärmebildkameras und GPS-Geräte lokalisierten die Position von Autos oder Handys, und sogar die gute alte Beschattung gab es noch. Diese monumentale Anhäufung von Informationen zu durchsieben und das Bedeutungsvolle vom Profanen zu trennen, war eine nicht enden wollende Aufgabe. Mit der Fertigstellung des Datenzentrums der NSA in Utah würde es noch mehr Informationen über jeden Anruf, jede SMS und jede E-Mail geben, die die Computer aufgrund bestimmter Schlüsselwörter, die einen genaueren Blick erforderten, durchforsten konnten.
Aber selbst mit all dem Hightech-Zeug war da immer noch die Echtzeit, also menschliche Augen und Ohren, die zusahen und zuhörten, vor allem bei sensiblen Fällen, die man keinem noch so fortschrittlichen oder geheimen Computerprogramm anvertrauen durfte. Was nicht in den Datenbanken war, konnte auch nicht heimlich ausgeforscht oder von Hackern geknackt werden. Dereon Ashe arbeitete an einem dieser sensiblen Fälle. Er wusste zwar nicht alles darüber, aber das, was er wusste, war genug, um den Wunsch in ihm zu wecken, er wüsste gar nichts. Er war sich verdammt sicher, dass dies genau die Art von Scheiße war, die einen das Leben kosten konnte. Wie dem auch sei: Er und mindestens fünf weitere Leute überwachten rund um die Uhr die Frau, die als Subjekt C bekannt war – was in ihm immer die Frage aufwarf, was wohl aus den Subjekten A und B geworden sein mochte. Jede ihrer Bewegungen, jeder Anruf, den sie tätigte oder empfing, jedes Detail ihres Lebens wurde eingehend untersucht. Dabei spielte es keine Rolle, dass ihr Leben sie, soweit er das erkennen konnte, verdammt langweilte.
Sollte heißen, bis jetzt verdammt langweilte.
Zunächst waren da diese merkwürdigen Zahlen, die ihn aufmerken ließen und ihn dazu trieben, sie schnell zu notieren, für den Fall, dass sie wichtig waren. Dann – »Oh, Scheiße!« Es war definitiv ein echter Scheißmoment. Dereon rieb sich die Augen, aber nicht, weil er müde war, sondern um sich ein wenig Zeit zum Nachdenken zu geben. Er konnte einfach nicht glauben, dass ihnen etwas so Banales wie eine Krankmeldung derart um die Ohren flog.
Schnell wählte er die Nummer, die ihn mit dem für diese Operation zuständigen Agenten verbinden würde.
»Forge.«
Die schroffe Stimme von Al Forge ließ Dereon in einer Kombination aus Beunruhigung und Besorgnis das Gesicht verziehen; er wollte nicht die Verantwortung für diese Entscheidung tragen, also musste er Forge verständigen. Aber gleichzeitig gefiel es ihm nicht, ins Fadenkreuz von Als Aufmerksamkeit zu geraten. Es machte ihm eine Gänsehaut, als kullerten ihm Eiswürfel den Rücken hinunter.
Rasch und ohne jede Ausschmückung berichtete er, was gerade mit Subjekt C passiert war. Obwohl sie natürlich ihren Namen kannten, wurde er bei Gesprächen unter keinen Umständen genannt. Subjekt C existierte nur für eine sehr ausgewählte Gruppe von Personen, zu der er selbst, wie das Unglück es wollte, gehörte. Er wusste nicht, was man mit Subjekt C gemacht hatte, und er wollte es auch nicht wissen. Er beobachtete sie lediglich, er meldete seine Entdeckungen und hielt seine Nase aus Angelegenheiten heraus, die ihn nichts angingen. Das war sicherer so, denn was auch immer vonstattengegangen war, es musste eine richtig große Sache sein.
»Ich bin gleich da«, sagte Forge, und absolute Stille erfüllte Dereons Headset, als der Anruf beendet wurde.
Er wählte sich wieder in die Audioüberwachung ein und machte da weiter, wo er aufgehört hatte: Subjekt C abzuhören. Als Al Forge eintraf, konnte ihn Dereon auf den neusten Stand über die Geschehnisse der Zwischenzeit bringen.
Al kratzte sich am Kinn und richtete seinen scharfen Blick nach innen, während er Ereignisse gegen Möglichkeiten abwog. Er ging auf die sechzig zu, sein kurzes Haar war größtenteils grau geworden, seine hellen Augen wirkten jetzt mit fortschreitendem Alter etwas weniger eisig, er war aber immer noch so hager und zäh wie damals, als er noch im praktischen Einsatz gearbeitet hatte. Sein Gesicht war zerfurcht, und zwar vom Gewicht der Entscheidungen, die er getroffen, von Taten, die er begangen hatte. Nicht um alles in der Welt wollte Dereon in Al Forges Position sein; nichtsdestoweniger hätte er sicher Schwierigkeiten, sich jemanden einfallen zu lassen, vor dem er mehr Respekt hatte.
Das Schweigen dauerte an, während Al in Gedanken versunken dastand und die Sekunden verstrichen.
»C hat es vielleicht nicht bemerkt.« Dereon fühlte sich schließlich gezwungen, auf das Offensichtliche hinzuweisen, nur um das Schweigen zu brechen.
Für diese Zeitverschwendung durchschnitt ihn Als scharfer Blick. Abrupt sagte er: »Verbinden Sie mich mit Xavier.«
Das war einer der verwirrendsten Aspekte an seinem Job. Alles, was mit Subjekt C zusammenhing, wurde diesem Xavier berichtet, der, soweit Dereon bislang hatte herausfinden können, lediglich irgendein Typ war, der in verdeckten Operationen tätig war – also kein Dienstvorgesetzter, niemand in besonderer Machtposition. Tatsächlich war nicht viel über diesen Mann bekannt, was schon signalisierte, dass mehr hinter ihm steckte, als dieses wenige offenbarte. Immer war es Al, der mit ihm sprach; und, noch bemerkenswerter: Keines dieser Gespräche wurde jemals aufgezeichnet. Allerdings wurde auch sonst nichts über diese Situation aufgezeichnet. Nach jeder Schicht wurden regelmäßig alle Daten über Subjekt C gelöscht.
Mit ein paar Eingaben auf der Computertastatur stellte Dereon die Verbindung her. Al setzte ein Headset auf. Kurz darauf meldete sich Xavier, seine tiefe Stimme klang vertraut und distanziert, als habe kein Gefühl ihn je berührt. »Ja.« Etwas an dieser distanzierten Art machte Dereon froh, dass er Xavier niemals würde persönlich kennenlernen müssen und Xavier nicht einmal von seiner Existenz wusste. Seine Welt und die der Leute von den verdeckten Operationen waren Lichtjahre voneinander entfernt, und man legte Wert darauf, dass es auch so blieb.
Al sagte: »Subjekt C ist möglicherweise auf eine Diskrepanz in der Zeitschiene aufmerksam gemacht worden.« Er machte eine kurze Pause. »Da Sie Ihr eigenes Überwachungssystem an unseres angeschlossen haben, wissen Sie das bereits. Ich baue darauf, dass Sie nichts Unbedachtes getan haben.«
Dereon drehte sich auf seinem Stuhl um und starrte seinen Vorgesetzten mit unverhohlener Überraschung an. Natürlich hatten sie gewusst, dass Xavier in ihrem System war, aber sie gaben niemals Informationen preis. Niemals. Das kleinste Detail konnte ihnen einen unschätzbaren Vorteil bringen – oder umgekehrt auch dem Feind. Wer genau der Feind in dieser Situation sein sollte, war zwar nicht klar, aber er kannte die Strategie. Wissen war Macht. Al hatte gerade ein wenig Macht abgegeben, indem er Xavier wissen ließ, dass sie sich über seine Aktivitäten im Klaren waren. Jetzt wusste er, dass sie wussten, dass er wusste – Gott, das klang wie eine alte Varieténummer.
»Sie wären ein Amateur, wenn Sie auch nur für eine Sekunde denken würden, dass ich nicht in Ihrem System hänge.« Die kühle, körperlose Stimme verriet schwache Erheiterung.
Okay, das war ein weiteres Problem, dachte Dereon. Xavier hatte bereits gewusst, dass sie von seiner Überwachung wussten. Varieté? Nein, dies war eher ein Schachspiel, gespielt von zwei Meistern, die einander offensichtlich gut kannten. Dereon für seinen Teil hasste Schach. Davon bekam er Kopfschmerzen. Er zog es deutlich vor, wenn die Dinge glatt, unkompliziert und eindeutig waren – ungünstig für jemanden in seiner Branche.
Er hätte lieber in die Buchhaltung gehen sollen.
Al machte eine ungeduldige Geste, dann zwang er sich sofort wieder zu Reglosigkeit, als sei Ungeduld ein Luxus, den er sich nicht leisten konnte. »Der Punkt ist, dass ich nicht so tun werde, als würde ich Sie über den aktuellen Stand informieren, wenn ich weiß, dass Sie bereits im Bilde sind. Sie wollen wissen, ob ich aufrichtig zu Ihnen war. Das bin ich gewesen, von Anfang bis Ende. Sie sollten außerdem wissen, dass ich hier nicht mit dem Finger am Abzug stehe. Es gibt keinen Hinweis darauf, dass sich an der Situation mit Subjekt C etwas verändert hat, und man kann davon ausgehen, dass das auch so bleiben wird.«
»Sie haben mich also angerufen, weil Sie – was eigentlich? – sich absichern wollen, dass ich keine voreiligen Schritte unternehme? Sie sollten es besser wissen. Es wäre gelogen, würde ich Ihnen das versprechen. Davon abgesehen würden Sie mir ohnehin nicht glauben, weil Sie in meiner Position sowieso hemmungslos lügen würden.«
Das verstand sich von selbst, daher machte sich Al gar nicht erst die Mühe es zu leugnen. In seinem Job, in ihren Jobs, tat man, was immer notwendig war. Manchmal war das Notwendige unschön; das machte es aber nicht weniger notwendig.
»Ich will nichts tun, das Subjekt C schadet«, sagte Al vorsichtig. »Die Situation ist im Gleichgewicht.«
Xavier stieß ein kurzes, freudloses Bellen von einem Lachen aus. »Ich habe vom ersten Tag an gewusst – ach verdammt, schon vorher –, dass die Situation nur so lange im Gleichgewicht sein wird, wie ich dafür sorge. Ihr Dilemma ist, dass Sie nicht wissen, wie viele Vorkehrungen ich getroffen oder wie viele Abhörgeräte ich eingerichtet habe. Anderenfalls wäre ich schon seit Jahren tot. Das wissen Sie genauso gut wie ich.«
»Mein Job besteht nicht darin, Patrioten zu töten«, erwiderte Al, dessen Stimme hier ruhiger wurde. Er war ein Mann, der den größten Teil seines Erwachsenenlebens auf verschiedenen Ebenen für sein Land gekämpft hatte, und sein Credo war das gleiche wie dasjenige Trumans: An mir bleibt es letztlich hängen. Er würde keinen der Leute aus den verdeckten Operationen den Wölfen zum Fraß vorwerfen; wenn es notwendig würde, würde er zuallererst seine eigene Karriere und Freiheit opfern. Die Menschen, die unter ihm arbeiteten, wussten das, und Dereon wusste es auch. Das weckte tiefste Loyalität – nur nicht, so schien es, in Xavier.
»Nein, Ihr Job ist es, das Land zu schützen, was immer das jeweils auch bedeuten mag.« Eine Spur von Zynismus schlich sich in Xaviers Worte. »Und normalerweise stehe ich in diesem Punkt auf Ihrer Seite.«
»Nur nicht in dieser Situation.«
»Sagen wir einfach, ich vertraue Ihnen so sehr, wie Sie mir vertrauen.«
»Wenn ich Ihnen nicht vertrauen würde, hätten Sie den Job nicht mehr.«
»Es sei denn, Ihr Motiv wäre, mich in Beschäftigung zu halten.«
»Ich würde annehmen, dass Ihre Stolperdrähte das abdecken.«
»Da würden Sie richtig annehmen.«
»Also befinden wir uns in einer Pattsituation.«
»Erinnern Sie sich an den Ausdruck aus dem Kalten Krieg? Gleichgewicht des Schreckens? In meinen Augen funktioniert das.«
»Sie machen sich Feinde«, sagte Al. »Mächtige Feinde, Leute, die sich fragen, warum sie Ihnen vertrauen sollten, wenn Sie Ihrerseits so gar kein Vertrauen zeigen. Sie zwingen sie dazu, Sie als Bedrohung zu betrachten.«
»Ich bin auch eine Bedrohung, es sei denn, die Leute benehmen sich. Ja, ich weiß, wir können alle zusammenhalten oder wir können unser eigenes Ding machen, aber ich kenne diese Leute. Irgendwann wird irgendein Arschloch meinen, dass er schlauer ist als ich und diese Sache aus der Welt schaffen kann. Das ist zwar ein Irrtum, aber die Kacke wird schon am Dampfen sein, bevor er das gemerkt hat. Also, ganz klar, egal was Sie mir versprechen, ich werde meine eigenen Entscheidungen treffen.«
Al schwieg für einen Moment vollkommen reglos. Dann sagte er: »Glauben Sie nicht, dass ich der Feind bin. Das sollten Sie nicht vergessen. Wenn ich Ihnen helfen kann, werde ich es tun.«
Dereon ließ sich das noch mal durch den Kopf gehen. Bei Al Forge konnte man nie wissen; er stellte sich entweder wirklich mit ihm auf eine Stufe, oder er spielte mit Xavier. Allein die Zeit würde das zeigen.
Das gleiche kurze Lachen erklang in ihren Headsets. »Es gibt noch ein Sprichwort aus dem Kalten Krieg: Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Wir sprechen uns, Forge.« Es folgte eine kurze Pause. »Wir uns auch, Ashe. Heute ist doch Dereons Schicht, nicht wahr? Oder habe ich den Überblick verloren?« Daraufhin wurde die Verbindung beendet.