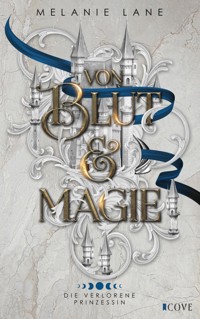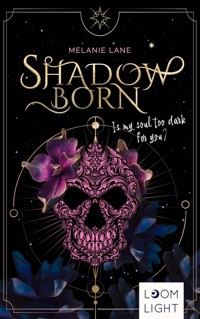
4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Planet! in der Thienemann-Esslinger Verlag GmbH
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Deutsch
»Gehe niemals einen Pakt mit dem Schattenkönig ein – das war die eine goldene Regel, und ich war dabei, sie zu brechen.« Jeden Monat eine unschuldige Seele an den König des Schattenreichs opfern – so sieht Jujus Leben als Mitglied und zukünftige Hohepriesterin des mächtigsten Voodoo-Clans in ganz New Orleans aus. Und sie hasst es! Schlimmer wird es nur noch, als sie erfährt, dass Dean – seines Zeichens sexy Barkeeper und Jujus bester Freund – einen Pakt mit ebenjenem Teufel geschlossen hat. Im Tausch gegen Deans Seelenheil macht sie sich auf die gefährliche Suche nach einem göttlichen Amulett, doch dabei geraten nicht nur ihre Gefühle für Dean außer Kontrolle, sondern auch ihre eigene dunkle Magie ... Gefährliche Schattenkreaturen, prickelnde Liebesszenen und hinterlistige Familienintrigen: Das alles verwebt Melanie Lane geschickt in ihrem neuen Romantasy-Roman, der einem Gänsehaut bereitet – sowohl vor Schauder als auch vor Verlangen. //»Shadowborn. Is my soul too dark for you?« ist ein in sich abgeschlossener Einzelband.//
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Das Buch
»Gehe niemals einen Pakt mit dem Schattenkönig ein – das war die eine goldene Regel, und ich war dabei, sie zu brechen..«
Jeden Monat eine unschuldige Seele an den König des Schattenreichs opfern – so sieht Jujus Leben als Mitglied und zukünftige Hohepriesterin des mächtigsten Voodoo-Clans in ganz New Orleans aus. Und sie hasst es! Schlimmer wird es nur noch, als sie erfährt, dass Dean – seines Zeichens sexy Barkeeper und Jujus bester Freund – einen Pakt mit ebenjenem Teufel geschlossen hat. Im Tausch gegen Deans Seelenheil macht sie sich auf die gefährliche Suche nach einem göttlichen Amulett, doch dabei geraten nicht nur ihre Gefühle für Dean außer Kontrolle, sondern auch ihre eigene dunkle Magie ...
Die Autorin
© Caroline Pitzke
Melanie Lane ist das Pseudonym einer 33 Jahre jungen Autorin, die in der schönen Stadt Hamburg lebt. Von Beruf Grafikdesignerin hat sie 2019 das Design Studio schockverliebt gegründet. Durch ihre Leseliebe zu Fantasy und Romance ist das Schreiben ihre absolute Leidenschaft geworden. Sie ist – laut eigenen Angaben – begeisterungsfähig, laut, trinkt gerne Vino und verabscheut Schubladendenken. Als bekennende Feministin lebt sie Themen wie Gleichberechtigung und Diversität, was sich auch stets in ihren Büchern wiederfindet. Sie liebt Sarkasmus, das Meer und ist eine absolute Tierliebhaberin.
Melanie Lane auf Instagram: www.instagram.com/melanielane_autorin/
Der Verlag
Du liebst Geschichten? Wir bei Loomlight auch!
Wir wählen unsere Geschichten sorgfältig aus, überarbeiten sie gründlich mit Autor*innen und Übersetzer*innen, gestalten sie gemeinsam mit Illustrator*innen und produzieren sie als Bücher in bester Qualität für euch.
Deshalb sind alle Inhalte dieses E-Books urheberrechtlich geschützt. Du als Käufer*in erwirbst eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf deinen Lesegeräten. Unsere E-Books haben eine nicht direkt sichtbare technische Markierung, die die Bestellnummer enthält (digitales Wasserzeichen). Im Falle einer illegalen Verwendung kann diese zurückverfolgt werden.
Mehr über unsere Bücher und Autor*innen auf: www.loomlight-books.de
Loomlight auf Instagram: www.instagram.com/loomlight_books/
Viel Spaß beim Lesen!
Melanie Lane
ShadowbornIs my soul too dark for you?
Für euch, meine Leser*innen. Für jede einzelne Seele da draußen, die einem Traum hinterherjagt. Gebt niemals auf!
»It is the possibility of having a dream come true that makes life interesting.«
Paulo Coelho
Prolog
Der Gott Voodoo erschuf die Welt aus dem Chaos. Dann trennte er sie in zwei Teile. Wie die zusammengehörigen Seiten eines Buches oder zwei Teile eines Puzzles. Eine Hälfte für die Geister- und Schattenwesen und eine Hälfte für die Menschen. Beide Hälften durchdringen sich seither ständig. Es gibt weder Oben noch Unten. Keine Schranke zwischen Leben und Tod.
Dies gilt ganz besonders für meine Stadt: New Orleans. Die Stadt des Genusses und der Sünde. Des leichten Lebens, aber auch der Naturkatastrophen. Eine Hochburg des Jazz, aber auch – und vor allem – die Hauptstadt des Voodoo-Kults.
Handlesen, okkulte Riten, Liebeszauber und dunkle Magie. Das alles sagte man New Orleans nach. Und es stimmt.
Voodoo-Shops an jeder Ecke, Quacksalber, Möchtegern-Priesterinnen und Priester und Touristenfallen en masse.
Sie alle waren Betrüger. Alle, bis auf einige wenige. Die wahren Familien des Voodoo. Jene, die mithilfe der Loas in den drei Kulten des Voodoo praktizierten.
Die vom Voodoo-Gott erschaffenen Geisterwesen, die Loas, waren jedoch mit Vorsicht zu genießen. Nur allzu oft passierte es, dass Touristen in ihre Falle gerieten und sich unwissentlich der ewigen Dunkelheit verschrieben. Der Voodoo-Kult war wie jede Religion in seinem Ursprung unschuldig und rein. Die Menschen waren es, die ihn entweder zu etwas Gutem nutzten, oder aber ihn missbrauchten. Was leider häufig vorkam, denn Unwissenheit führte zu Fehlern, und Fehler konnten tödlich enden.
Auch die Familien des Voodoo waren vor diesen Fehlern nicht immer gefeit.
Von diesen Familien war meine mit Abstand die bekannteste.
Jeder in New Orleans kannte den Clan der Benoits und jeder kannte mich. Juliette Agatha Benoit. Nachfahrin der berühmt berüchtigten Voodoo-Königin Adelaide Benoit. Angebliche Legenden der Menschen erzählten von Marie Lavreau, der Voodoo-Königin des Bayou, aber die Lavreaus waren ein Witz gegen uns. Eine Mischung aus Scharlatanen und niederen Hexen. Niemand interessierte sich für die Lavreaus. Jeder aber interessierte sich für die Benoits. Sie fürchteten uns, sie fürchteten mich.
Und das zu Recht.
Bei den meisten Familien und Häusern des Kults war das Praktizieren von schwarzer Magie verpönt. Angeblich widersprach es dem Ursprung des Voodoo.
Die Benoits hatten mit diesem Vorurteil schon längst gebrochen. Wir hatten verstanden, dass schwarze Magie sich nicht auf Magie bezog, die von Natur aus böse oder zwingend auf irgendeine Weise schlecht war. Wenn wir von Schwarz und Weiß, Dunkelheit und Licht sprachen, sprachen wir in Wahrheit von Zerstörung und Schöpfung. Manchmal zerstörte man, und manchmal erschuf man. Beides konnte sowohl gut als auch böse sein. Magie war Magie, aber je dunkler die Magie, desto höher ihr Preis. Und desto größer das Opfer.
Ein Opfer, welches Adelaide bereit gewesen war zu erbringen. Zu ihrer Zeit, als New Orleans noch keine Touristenmeile, sondern eine Stadt voller finsterer Kreaturen und Intrigen gewesen war, war meine Ahnin einen Pakt mit dem Schattenreich eingegangen. Nicht mit irgendeinem niederen Geschöpf, oh nein, Adelaide hatte einen Pakt mit Veles, dem Schattenkönig höchstpersönlich, geschlossen. Mehr Macht, mehr Magie, mehr alles für die Frauen unseres Clans, im Austausch für die Seelen Unschuldiger. Während die anderen Clans und die Zirkel der Hexen daran arbeiteten, die Schattenwesen fernzuhalten, versorgten wir Veles und seine Wesen mit genau der Essenz, die sie nährte und es ihnen ermöglichte, das Schattenreich zu verlassen. Grandma pflegte stets zu sagen: Einen Tod muss man sterben. Und was waren schon ein paar Seelen, wenn man dadurch zur mächtigsten Voodoo-Familie von ganz New Orleans wurde? Nichts. Zumindest nicht für die Frauen meiner Familie. Bei Vollmond musste jedes weibliche Mitglied eine Seele an den Schattenkönig übermitteln, ansonsten wurden wir vertragsbrüchig und verloren unsere wertvolle Extramagie und mit ihr unseren einzigartigen Status.
Eine Seele pro Monat, für jede der Benoit-Frauen in zwei Generationen. Dabei hatte ich – mit Erreichen meiner Teenagertage – den Platz meiner Grandma eingenommen. Das machte sechs Seelen im Monat, zweiundsiebzig Seelen im Jahr – nicht dass ich mitzählte. Zumindest nicht offiziell, denn im Gegensatz zu mir hatte niemand aus meiner skrupellosen, etwas verrückten und definitiv blutrünstigen Familie ein Problem damit, unschuldige Seelen ans Schattenreich auszuliefern. Weder meine Mutter Sandria noch meine Tanten Eugenia und Eloise.
Meine Cousinen hatten sogar eine Art Sport daraus gemacht. Prudence und Priscilla duellierten sich jeden Monat, wer die wertvollere Seele über unsere Loa an Veles übermittelte.
Ich war gerade mal vierzehn Jahre alt gewesen, als meine Mutter mich gezwungen hatte, ein Leben zu beenden.
Du bist jetzt eine Frau, hatte sie mir mit Einsetzen meiner Periode nüchtern erklärt. Zeit, Verantwortung zu übernehmen, Juliette. Immerhin wirst du es sein, die unseren Clan eines Tages anführen wird.
Und das war mein zweites Problem.
Problem Nummer eins: Ich musste unschuldige Seelen an irgendeinen Schatten-Psychopathen in einer Parallelwelt, die unsere überkreuzte, ausliefern.
Problem Nummer zwei: Ich war genau wie Mom eine direkte Nachfahrin von Adelaide Benoit und damit würde ich den Clan nach ihrem Abdanken eines Tages anführen. Man würde von mir erwarten, mir einen geeigneten Mann zu suchen – um unsere Blutlinie stark zu halten – und mindestens eine Erbin zu produzieren. Wir Benoits hielten nicht viel vom Heiraten und ganz bestimmt taten wir es nicht aus Liebe, oh nein, unsere Vereinigungen waren strategisch klug. Männer hatten in unserer Welt nur einen Zweck, einen sehr simplen, sie waren Samenspender. Mehr nicht. Meine Mom hatte mir früh eingebläut, dass ich so viel Spaß haben konnte, wie ich nur wollte, aber mein Uterus gehörte der Familie.
Seit meinen Teenagertagen wurde ich darauf vorbereitet, die fieseste und fähigste Priesterin in ganz New Orleans zu werden. Das Wort ›Hexe‹ mochten wir nicht. Hexen brauten Tränke, schnürten Beutelchen und wohnten mit mindestens zehn Katzen, die allesamt genauso schrullig wie sie selbst waren, in ihren verstaubten Zirkel-WGs. Wir waren Priesterinnen. Und wir besaßen einen direkten Draht zur Schattenwelt – zumindest meine Familie –, wenn wir einmal im Monat durch unsere Loa Kontakt zu Veles aufnahmen und ihm unser Opfer übergaben. Sie war unser Sprachrohr. Quasi eine sichere Leitung direkt zum Schattenkönig. Aber nicht nur zu ihm. Missbrauchte man die Macht der Loas, konnte man durch sie so ziemlich jedes Geisterwesen der Schattenwelt beschwören und in unsere Welt ziehen. Dabei lungerten trotz all der Bemühungen der anderen Clans bereits zu viele von ihnen in den düsteren Ecken unserer Welt. Incubi, Poltergeister, Parasiten, Skinner oder Banshees, die Liste war lang und furchterregend.
Also hatte ich es mir zur Aufgabe gemacht, die anderen Clans zu unterstützen, und so viele der Schattenwesen, wie ich nur konnte, zu pulverisieren und zurück ins Schattenreich zu schicken. Wenn's nach mir ginge, dann sollten die Bastarde ruhig dort bleiben, wo sie hingehörten. Anstatt Menschen zu töten, wie der Rest meiner Familie es mit Freude tat, beschränkte ich mich auf Schattenwesen. Für alles andere hatte ich meine eigene Methode. Eine Methode, die ich nach meinem zwanzigsten Geburtstag angefangen und seither perfektioniert hatte. Vor fünf Jahren hatte ich mich gefragt, wer ich eigentlich sein wollte. Eine mörderische Irre, die Unschuldige für Magie abschlachtete? Oder eine relativ normale Mitzwanzigerin, die die Gesetze der Magie und die unseres Paktes mit dem Schattenkönig ein wenig verbog, um nicht ganz ihren Verstand zu verlieren. Mit zwanzig hatte ich bereits so viele Menschen getötet, dass es für den Rest meines Lebens reichte. Herzlichen Dank.
Also hatte ich in der Bar meines mittlerweile besten Freundes angeheuert. Deans Bar lag inmitten des French Quarter und war beliebt bei Einheimischen und Touristen. Nette Menschen, nicht ganz so nette Menschen und der Abschaum von New Orleans gaben sich im Magic Pit die Klinke in die Hand. Und danach landeten sie am Tresen, bei mir. Ich servierte ihnen einen Drink, hörte mir ihre Sorgen an und nebenbei, ganz unauffällig, zapfte ich ihnen etwas von ihrer Seelenessenz ab. Nur ganz wenig. So viel, dass es im kosmischen Gleichgewicht gar keinen Unterschied machen würde. Das tat ich so gut wie jeden Abend bei drei bis vier Menschen, sechs Tage die Woche, und am Ende des Monats, wenn der Mond voll am Nachthimmel stand, hatte ich genug Essenz zusammen, um eine komplette Seele an unsere Loa Maman Brigitte zu übergeben. So musste ich nicht draußen herumlaufen, auf der Suche nach geeigneten Opfern, oder gar töten, hielt mich aber an den Pakt und alle waren glücklich. Okay, glücklich war vielleicht übertrieben, doch es rettete mir den Arsch, von Monat zu Monat. Längerfristig konnte man in einer Stadt wie New Orleans sowieso nicht denken.
Und das war okay. Ich hatte mich mit meinem Schicksal arrangiert. Dennoch konnte ein Mädchen träumen. In meinen Träumen war ich keine Benoit. Ich war frei und konnte tun und lassen, was ich wollte. Leider entsprach das nicht der Realität. Einer Realität, in der ich noch genau sechs Tage hatte, um meine Aufgabe zu erledigen, bevor der Schleier sich erneut heben und meine Patchwork-Seele ihren Weg zu Veles finden würde. Danach begann der Albtraum von Neuem. Und jedes Mal fragte ich mich, wie lange ich diese Art zu leben noch ertragen würde. Aber so war es nun mal. Wie meine Freundin Dawn immer zu sagen pflegte: Willkommen in New Orleans, Bitch.
Willkommen in der Welt des Voodoo.
1
»Haben wir schon ein Opfer?«
»Was ist mit dem da?«, fragte Dawn und lehnte sich dichter zu mir. »Der sieht doch aus, als könne er ein wenig was abgeben, findest du nicht?«
Die dunklen, heute mit blauen Spitzen verzierten Haare meiner Freundin glänzten im schummerigen Licht der Bar so schwarz wie die Nacht. Das Amulett, das für ihren heutigen Gothic-Look verantwortlich war, baumelte friedlich zwischen ihren Brüsten und wurde dank des tief ausgeschnittenen Oberteils hübsch präsentiert.
Seit unseren Kindertagen waren Dawn und ich beste Freundinnen. Sehr zum Leidwesen unserer Familien. Nicht nur einmal hatte ihre Familie versucht, Dawn von mir fernzuhalten. Sie waren jedes Mal gescheitert. Und jedes Mal erhielten sowohl ihre Familie als auch ich dieselbe Antwort: Was das Schicksal zusammengebracht hat, kann niemand trennen. Dawn war überzeugt davon, dass wir Seelenverwandte waren. Nach allem, was wir bereits zusammen erlebt hatten, stimmte ich ihr zu.
»Juju.« Sie klopfte mit ihren scharlachrot lackierten Nägeln auf den Tresen zwischen uns. »Schau ihn dir doch an«, wisperte sie. »Der schreit doch regelrecht nach Opfer. Findest du nicht?«, wiederholte sie ihre Frage von zuvor.
Dawn gehörte dem Clan der Thideauxs an und wusste somit ganz genau, warum ich in der Bar arbeitete. Beinahe jeden Abend kam sie her und half mir, eine geeignete Seele zu finden. Die Thideauxs waren weitaus weniger mächtig und weitaus weniger blutrünstig als meine eigene Familie. In der Tiefe ihres Herzens war meine Freundin ein Softie, auch wenn sie es verbergen wollte. Vor der Außenwelt, nicht vor mir.
»Welcher von denen?« Ich lehnte mich dichter zu Dawn und folgte ihrem Blick. Die Bar war gerade dabei, sich zu füllen. Die ersten Touristen saßen an den gusseisernen runden Tischen auf der Straße oder standen in kleinen Grüppchen dicht gedrängelt an den großen Buntglasfenstern und diskutierten darüber, ob sie sich trauen sollten, Billard zu spielen. Oder wer von ihnen mutig genug war, einen Drink bei mir zu bestellen. Für die meisten Touristen wirkte ich zunächst einschüchternd, zumindest laut Dawn. Dean hatte mit meiner Erscheinung kein Problem, im Gegenteil. Er bezeichnete mich als Publikumsmagneten. Außerdem hielt ich jegliche Schattenwesen und Mitglieder anderer Voodoo-Clans aus seiner Bar fern. Durch meine bloße Anwesenheit. Sie alle, außer Dawn.
»Der Blonde da hinten im Anzug.«
»Der After-Work-Typ?« Ich musterte den Mann genauer. Maßgeschneiderter Anzug, blitzeblank polierte Schuhe und eine goldene Rolex am Handgelenk. Definitiv niemand aus dem Bayou.
Der Mann legte den Kopf in den Nacken und lachte herzhaft über eine Anekdote seines Begleiters. Ebenfalls ein Anzugträger mit gestärktem Hemd und Seitenscheitel.
»Ich weiß nicht, Dawn ...«
»Haben wir schon ein Opfer?«
Dean lehnte sich an den Tresen. Die stark tätowierten Arme vor der Brust verschränkt, hatte er sich ein Geschirrhandtuch lässig über die Schulter geworfen. Seine Haare waren schon wieder zu lang und ein paar der dunklen Strähnen fielen ihm über die Augen. Er zwinkerte mir zu, ehe auch er Dawns Blick folgte. Wie immer, wenn Dean Brywood in meinem Umfeld erschien, setzte mein Herz für einen winzig kleinen Moment aus. Kaum nennenswert. Seine große muskulöse Gestalt, der verschmitzte Cajun-Charme, und auch der kreolische Südstaaten-Akzent in seiner tiefen Bariton-Stimme, all das ließ mich vollkommen kalt. Hmm.
»Der Blonde da«, informierte ihn Dawn verschwörerisch, während ich mit den Augen rollte.
Dean schaute mich fragend an. »Hast du ihn schon ausgecheckt?«
Ich schüttelte verneinend den Kopf. Mit ausgecheckt meinte er, ob ich mithilfe meiner Magie die Aura des Mannes überprüft hatte. Auren waren wie ein Echo, ein Widerhall, wenn man so wollte. Sie besaßen keine Farben. Kein Klischee-Bullshit von wegen Rot ist wütend, Schwarz ist böse und Weiß bedeutet ein reines Herz.
Auren zu lesen, hieß einem Gefühl zu folgen und seinen Instinkten zu vertrauen. Sie erzählten eine Geschichte. Setzte ich dann noch meine Gabe ein, meine Verbindung zum Schattenreich, konnte ich jeden Menschen ziemlich schnell, ziemlich genau einschätzen. Fast jeden. Auch nach fünf Jahren war Dean noch immer ein Buch mit sieben Siegeln für mich. Ich hätte seine mentalen Schutzmauern brechen können, aber wir waren Freunde und ich war jeden Tag dankbar für ihn und Dawn, die mir in meinem verkorksten Leben zur Seite standen. Auf keinen Fall würde ich Deans Freundschaft und diesen Job riskieren, nur um seine Gefühle lesen zu können.
Also konzentrierte ich mich auf den blonden Mann am anderen Ende des Tresens. Dawn, selbst eine Priesterin, ignorierte mich. Sie musste die Veränderung meiner Augen oder meiner eigenen Aura nicht sehen, um zu spüren, was ich tat. Dean schon. Er scannte jeden Zentimeter meines Gesichts. Das tat er immer, wenn ich meine Kräfte benutzte, und es war … beunruhigend.
Unbewusst griff ich nach der Kette um meinem Hals, rieb die schmalen goldenen Glieder zwischen Daumen und Mittelfinger, fuhr die Kette herab und umklammerte den roten Edelstein daran krampfhaft. Ein zeigefingergroßer Jaspis. Wie immer beruhigte mich der Stein augenblicklich. Meine Cousinen hatten mich ausgelacht, als ich mich für diesen Edelstein als Begleitstein entschieden hatte und nicht für einen Donnerstein, so wie der Rest meiner Familie. Im Gegensatz zu ihnen bewahrte ich meinen Donnerstein zu Hause in meiner Nachttischschublade auf und holte ihn nur heraus, wenn wir mit unserer Loa kommunizierten. Der Jaspis beruhigte mich. Er verhalf mir zu mehr Ausgeglichenheit. Etwas, was ich im Hause Benoit dringend nötig hatte. Auch wenn meine Wahl meine Mutter dazu veranlasst hatte, die Nase zu rümpfen. Wenn Sandria Benoit eines hasste, dann war es Schwäche. Dafür war ich der beste Beweis.
»Und?«
Verdutzt sah ich auf. Dean beobachtete mich und auch Dawn schenkte mir jetzt ihre volle Aufmerksamkeit. Die helle Haut und die – normalerweise – blonden Haare meiner Freundin waren das genaue Gegenteil von mir. Dawn war das Licht, hell und strahlend, und ich war wie die Schatten, die sie umgaben – düster und voller Geheimnisse.
Obwohl sie sich heute für einen eher provozierenden Look aus Lack und Leder sowie dunkle Haare und viel Kajal entschieden hatte, konnte sie ihre Umwelt nicht täuschen. Dawn umgab eine Aura purer Güte und Freundlichkeit. Es war ein Wunder, dass ich sie noch nicht verdorben hatte.
Ich schüttelte meine selbstauferlegte Trance ab und konzentrierte mich wieder auf den Mann vor mir. Mit geschlossenen Augen lauschte ich auf sein Echo und auf das, was die Schatten mir über ihn zu sagen hatten.
»Kurz vor seinem dreißigsten Geburtstag«, murmelte ich leise. »Verheiratet.«
»Kein Südstaatler«, flüsterte Dawn wissend.
»Chicago«, bestätigte ich ihren Verdacht. »Er ist auf Geschäftsreise und … oh.«
Aufgeregt trommelte Dawn vor sich auf den Tresen. Diesmal mit beiden Händen und nicht mit den Nägeln. Fast klang es wie ein Trommelwirbel. »Jetzt wird es spannend. Ich liebe es, wenn du etwas findest!«
Dawns Magie fiel wesentlich schwächer aus als meine. Sie war gut in Amuletten aller Art und Tränken, aber die richtige Kunst des Voodoo beherrschten die Thideauxs schon lange nicht mehr. Außerdem verachteten sie das Einsetzen von schwarzer Magie und alles, was mit dem Schattenreich zu tun hatte, ergo, sie verachteten mich.
»Er ist hier, um sich ein Mädchen für die Nacht zu suchen.«
»Das macht ihn zu einem Arschloch, aber nicht zwangsweise zu einem schlechten Menschen.«
Ich öffnete die Lider und sah zu Dean. »Ein sehr junges Mädchen. Je jünger, desto besser.«
Seine Augen verdunkelten sich schlagartig und auch Dawn stieß einen leisen Fluch aus.
»Das«, betonte sie, »macht ihn zu einem Perversen.«
»Und zu Opfer Nummer eins.«
Die Tür schwang auf und eine kichernde Frauengruppe trat ein. Für einen Moment schauten sie sich um, unsicher, ob sie wirklich richtig waren, wo es doch so viele weitaus schickere Lokalitäten im Quarter gab, dann aber fiel ihr Blick auf die Bar. Sobald sie Dean erspähten, wurde das alberne Giggeln lauter, und sie stürmten in Richtung Tresen.
»Wenn ihr mich entschuldigen wollt …«, murmelte Dean und schlenderte lässig auf die jungen Frauen zu. »Hallo, Ladies.«
Ich packte den Stein in meiner Hand fester, als ich beobachtete, wie eine der Frauen sich quer über den Tresen lehnte und Dean dabei ihre äußerst beachtliche Oberweite unter die Nase hielt.
»Juju, Honey.« Dawn griff nach meinen Fingern und löste sie gewaltsam von der Kette. »Du machst das noch kaputt und dann nützt es dir auch nichts mehr.« Ihre Augen funkelten und ihr Blick machte deutlich, was sie von meiner Reaktion hielt. »Du könntest dem Ganzen ein Ende setzen. Nur ein Wort von dir und …«
»Nicht schon wieder, Dawn«, unterbrach ich sie, drehte mich um und stellte zwei Schnapsgläser vor mir auf den Tresen. »Dean und ich sind Freunde. Ich werde dieses Thema nicht schon wieder mit dir diskutieren, aber«, ich lehnte mich zurück, griff nach einer Whiskyflasche unterm Tresen und warf sie geübt durch die Luft, nur um sie kurz vorm Aufprall aufzufangen, »du kannst mit mir trinken. Die letzten Tage sind immer die beschissensten.«
Sechs Tage noch, dann wäre es wieder so weit. Und nur ein Tag Pause zwischen der Übergabe und dem erneuten Sammeln der Seelenessenz.
Dieser verfluchte Pakt.
Wir exten unsere Shots und ich füllte die Gläser erneut.
»Weißt du, wenn du dich mal ein wenig … ich weiß nicht«, Dawn zuckte mit den schmalen Schultern und brachte so die Nieten und Ketten an ihrem Oberteil zum Klirren, »farbenfroher anziehen würdest, etwas auffälliger, vielleicht würde Dean seine Zurückhaltung dann endlich über Bord werfen und über dich herfallen.«
Innerlich seufzend stürzte ich auch mein zweites Glas hinunter. Der Whisky rann brennend meine Kehle herab und wärmte mich von innen. Es war das gute Zeug, jene Flasche, die Dean und ich für ein paar der Einheimischen und für uns zur Seite gestellt hatten, nicht für die Touristen. Die meisten von ihnen kannten nicht einmal den Unterschied zwischen einem Bourbon und einem Scotch.
»Erstens«, erklärte ich Dawn, als ich unsere Gläser für später unter der Theke verstaute, »spiele ich nicht Barbiepuppe für irgendwelche Männer und verbiege mich – auch nicht für Dean. Und zweitens, was ist verkehrt daran, wie ich aussehe?«
Ich hatte mein übliches Barkeeper-Outfit an. Flache, bequeme Boots, dunkle Skinny Jeans und ein hautenges, schwarzes Shirt mit Dreiviertelärmeln und einem Rundhalsausschnitt. Meine Kette und die großen goldenen Creolen an meinen Ohrläppchen waren der einzige Schmuck, den ich trug. Zur Arbeit legte ich meine zahlreichen Ringe sowie das Armband aus Kaurimuscheln und Knochen stets ab. Die Ärmel verdeckten den Großteil meines linken Sleeve-Tattoos, das für alle Menschen nach einem normalen Tattoo aussah, für alle Schattenwesen und Magiepraktizierenden aber eine deutliche Warnung darstellte, mit wem sie es hier zu tun hatten.
»Ich weiß, dass auch andere Farben in deinem Kleiderschrank hängen«, beharrte Dawn. Sie zeigte mit einem Finger auf mich. »Also lüg mich gar nicht erst an! Trotzdem trägst du immer nur Schwarz.«
»Und sehr, sehr dunkles Grau oder Blau.«
»Haha.« Dawn hieb mit der flachen Hand auf den Tresen, und nicht nur mein erstes Opfer des Abends, sondern auch Dean und ein paar der Frauen, die ihn noch immer umschwärmten, schauten zu uns herüber. »Mit deiner Haut und deinen Haaren kannst du alles tragen, Juju. Alles. Sogar Gelb! Niemand kann Gelb tragen. Niemand! Weißt du, was ich dafür geben würde?«
Das wusste ich, ja. Aber es hatte auch eine Zeit gegeben, in der ich meine dunkle Haut, die hohen Wangenknochen und den damals noch widerspenstigen Afro sofort gegen Dawns klassische Südstaaten-Schönheit eingetauscht hätte. Heute nicht mehr. Heute war ich dankbar für und stolz auf meine haitianischen Wurzeln, die mir einen Teint verliehen, für den viele Frauen morden würden. Dawn eingeschlossen.
Mit meinen fast ein Meter achtzig überragte ich meine Freundin um gut einen Kopf. Ich war athletisch gebaut, trainiert und ich wusste meinen Körper sowohl im Kampf als auch privat einzusetzen. Alle Frauen der Benoit-Familie waren kurvig, und sosehr es mein emanzipiertes Herz auch manchmal schmerzte, dank meines Aussehens war es wesentlich einfacher, meinen Job zu erledigen. Und damit meinte ich nicht Drinks ausschenken.
»Schwarz ist nun mal meine Lieblingsfarbe.«
»Früher nicht.«
»Unser Früher ist eine lange Zeit her, Dawni. Vieles hat sich seitdem verändert.«
Ein Mann drängte sich neben Dawn an den Tresen und musterte erst meine Freundin, dann mich ungeniert.
»Hallo, ihr Hübschen. Wen muss man hier bestechen, um etwas zu trinken zu bekommen?«
Die Augen des Fremden blieben auf Höhe von Dawns Brüsten hängen und wir tauschten einen wissenden Blick miteinander.
Opfer Nummer zwei.
Dawn rutschte dezent zur Seite und der Fremde schenkte nun mir seine ganze Aufmerksamkeit.
»Was darf's denn sein?«
»Was trinkt man denn hier so?« Er grinste mich an. Die leuchtenden Orangetöne seines Hawaiihemds taten mir in den Augen weh. Wahrscheinlich hielt er sich für charmant und schlagfertig, ich hielt ihn für armselig, aber nützlich.
Mit einem lasziven Lächeln auf den dunkelrot geschminkten Lippen lehnte ich mich vor.
»Kommt ganz drauf an, ob du es sanft … oder hart willst.«
Sein Adamsapfel hüpfte aufgeregt und ich musste mir nicht einmal die Mühe machen, seine Aura zu prüfen. Er war bereits alkoholisiert und die Mauern um sein Bewusstsein, wenn er überhaupt welche gehabt hatte, waren verschwunden. Er war leichte Beute, fast schon zu leicht. Wie in Trance lehnte er sich vor, dabei fixierte er starr meine Lippen. Dawn richtete sich neben ihm zu ihrer vollen Größe auf, um uns in der noch überschaubar gefüllten Bar etwas Privatsphäre zu verschaffen. Das Tattoo an meinem Arm prickelte, als ich den Zauber sprach, der es mir ermöglichte, dem Fremden vor mir ein wenig seiner Seelenessenz zu stehlen. Leise und kaum hörbar. Mein Mund formte ein zartes O und ich inhalierte. Nicht zu kräftig, immerhin wollte ich keinen bleibenden Schaden anrichten, sondern langsam und vorsichtig. Die Augen des Fremden schlossen sich vor Verzückung, als ich allerhand verführerische Bilder in seinem Kopf platzierte. Ein Lächeln breitete sich auf seinem Gesicht aus. Wie in Zeitlupe öffnete sich sein Mund und ein für niemanden außer Dawn und mich erkennbarer dünner und silbrig schimmernder Faden züngelte auf mich zu. Ohne zu zögern atmete ich tief ein und verschluckte die Essenz des Mannes. Sofort breitete sich ein bitterer Geschmack in meinem Mund aus. Heute Nacht würde ich sie wieder extrahieren müssen, aber für den Moment war sie sicher verwahrt, in mir. Er schwankte leicht und Dawn war da, um ihn zu stützen.
»Aber, aber, mein Großer. Das war etwas zu viel Whisky, hm?«
»So schön«, murmelte er benommen und sah von mir zu der eiskalten Cola, die ich soeben auf den Tresen gestellt hatte. Wenn ich ihn schon bestahl, dann konnte ich ihm wenigstens eine Cola spendieren.
»Hier.« Ich schob das Glas in seine Richtung und löste den Bann, unter den ich ihn gestellt hatte, wieder auf. Die Tinte auf meinem Arm kribbelte ein letztes Mal, ehe das Summen in meinen Adern nachließ und dann ganz verschwand. Irritiert schüttelte der Mann mit dem Kopf und blickte von Dawn zu mir.
»Was zur Hölle.« Fluchend hielt er sich den Kopf. »Was ist passiert?«
»Du hast versucht meine Freundin anzubaggern«, erwiderte Dawn fröhlich. »Die, nebenbei bemerkt, nicht ganz in deiner Liga spielt, Kumpel. Aber wir wollen mal nicht so sein. Hier hast du deine Cola und jetzt husch, husch, such deine Freunde.«
Als er noch immer keine Anstalten machte zu gehen, gab ich ihm einen mentalen Schubs in die richtige Richtung. Erst zu seinen Freunden, und dann, sobald er seine Cola geleert hatte, raus aus dieser Bar und raus aus dem Quarter.
Kaum dass er sich umgedreht hatte, klatsche Dawn begeistert in die Hände.
»Essenz Numero Uno.«
Ich wünschte wirklich, ich könnte meiner Bürde mit dem gleichen Enthusiasmus begegnen wie meine Freundin. Allerdings konnte sie aufstehen und gehen, ich nicht. Wenn ich bis Vollmond nicht genug Essenzen zusammenhatte, um eine komplette Seele an unsere Loa zu übergeben, würde ich den Pakt missachten und meine gesamte Familie damit in Gefahr bringen. Bevor meine Mutter das jedoch zuließe, würde sie eine meiner Cousinen damit beauftragen, eine weitere Seele zu besorgen. Ich wollte nicht für noch mehr Tode verantwortlich sein, auf keinen Fall.
Ein lautes Kichern erregte unsere Aufmerksamkeit. Die Blondine, die seit ihrer Ankunft in der Bar schamlos mit Dean flirtete, lehnte sich noch ein wenig weiter vor.
»Wenn sie so weitermacht«, murmelte Dawn, »dann liegt sie bald auf dem Tresen. Brüste voraus.«
Leise schnaubend beobachtete ich das Schauspiel. Dean mochte der fleischgewordene Traum für die meisten Frauen sein, insbesondere die braven, weißen Mädchen, die nicht aus dem Bayou kamen, aber er war ein guter Kerl. Seit wir uns kannten, hatte ich nie miterlebt, dass er eine der Frauen, die ihn anbaggerten, mit nach Hause nahm. Mit Sicherheit hatte er seinen Spaß, ich meine, man musste sich den Kerl und sein schiefes Grinsen nur mal ansehen, aber er war diskret. Und er trennte den Job und Privates strikt.
Nicht immer, flüsterte eine leise Stimme in meinem Kopf. Innerlich fluchend brachte ich das Miststück zum Schweigen.
»Wir waren heut im Haus von Marie Lavreau.« Die Blondine erschauderte. Dank der Magie in meinen Adern konnte ich sie laut und deutlich hören. »Es war soooo gruselig.« Marie Lavreau? Beinahe hätte ich laut aufgelacht. Sie hatte ja keine Ahnung, was es hieß, sich tatsächlich zu gruseln. Das Lavreau-Haus war eine Touristenattraktion voller Voodoo-Puppen, Schrumpfköpfe, Räucherstäbchen und kleinen Beutelchen, in denen sich nichts anderes als Lavendel oder Weihrauch befand.
»Du siehst aus, als würdest du sie in eine Kröte verwandeln wollen.« Dawn grinste. Auch sie hatte kein Problem damit, das Gespräch zu belauschen. »Ich wäre dabei.«
»Lieber nicht. Dean würde ausflippen.«
»Der Zauber würde doch nur vierundzwanzig Stunden halten und sie wäre eine so niedliche kleine Kröte, findest du nicht auch?«
Das wäre sie wirklich. Vor allem würde sie dann ihre gierigen Finger von Deans Arm nehmen, weil sie keine Finger mehr hätte. Auch keine langen blonden Haare oder einen Vorbau, der nicht echt sein konnte.
Es wäre ja nur für vierundzwanzig Stunden …
Als Dean sich abwandte, um ein weiteres Bier zu zapfen, schaute die Blondine auf und direkt zu mir. Offenbar war ihr trotz all der Flirterei nicht entgangen, dass wir sie beobachteten. Ein berechnendes Lächeln breitete sich auf ihren pinkglänzenden Lippen aus. Das perfekte All American Dreamgirl.
Nicht mit mir.
Sie fand das Lavreau-Haus gruselig? Ich würde ihr zeigen, was es bedeutete, sich wahrhaftig zu fürchten.
Kurz vergewisserte ich mich, dass Dean noch immer beschäftigt war und auch sonst niemand der Gäste in meine Richtung blickte, dann ließ ich meine menschliche Hülle los und zeigte ihr mein wahres Gesicht. Juju war verschwunden. Vor ihr stand Juliette Benoit, Nachfahrin der einzig wahren Voodoo-Königin von New Orleans. Die Augen der jungen Frau weiteten sich schockiert, als sie sich eine Hand vor den Mund schlug. Ein erschrockenes Keuchen entfuhr ihr. Es ging runter wie Öl. Ich wusste genau, was sie sah. Weißglühende Augen, ein skelettartiges Gesicht mit messerscharfen Wangenknochen und glatte weiße Haare, die um mein Gesicht flogen, als würden sie von einer leichten Brise erfasst. Einer Brise aus dem Schattenreich, die es tatsächlich gab, niemand außer mir jedoch spüren konnte. Mein Tattoo pulsierte. Wärme breitete sich von den mit schwarzer Tinte festgehaltenen okkulten Symbolen, den Sigillen und Veves, auf meinem Oberarm aus, und ich genoss das vertraute Gefühl von Magie in meinen Adern.
Meine Mundwinkel zuckten und ich schenkte Blondie ein diabolisches Grinsen. Verschwunden waren nicht nur ihre sorgfältig erarbeitete Sonnenbräune und ihr Lächeln, sondern auch ihr Interesse an Dean. Ruckartig drehte sie sich um, redete hektisch auf ihre Freundinnen ein und verließ dann panisch die Bar. Und das alles in weniger als einer Minute.
»So genial«, lachte Dawn, als ich zurück in meine menschliche Gestalt schlüpfte. Gerade rechtzeitig, denn genau in diesem Moment drehte Dean sich um. Zwei Bier in der Hand musterte er den leeren Platz an der Bar. Dann schaute er zu mir. Mit zusammengekniffenen Augen kam er auf uns zu.
»Was habt ihr angestellt?«
»Gar nichts!«
Hatten wir nicht. Nicht wirklich. Immerhin hatten wir Blondie nicht in eine Kröte verwandelt.
»Sind die für uns?«, fragte Dawn unschuldig.
Kopfschüttelnd stellte er die Biere vor uns auf den Tresen. »Ich will's gar nicht wissen …« Murmelnd wandte er sich ab, um die nächsten Kunden zu bedienen.
»Es ist immer so unterhaltsam mit dir.« Dawn griff nach ihrem Bier. »Das war viel besser, als sie in eine Kröte zu verwandeln.«
»Kröten sind dein Spezialgebiet«, erwiderte ich ihr Lächeln. »Ich mache ihnen Angst.« Das war es, was ich am besten konnte. Insbesondere, wenn aufdringliche Blondinen Dean anschmachteten. Nur weil ich niemanden mehr auf dem Gewissen haben wollte, hieß das noch lange nicht, dass ich meiner Magie gegenüber abgeneigt war. Im Gegenteil. Ich liebte es, eine Priesterin zu sein. Auch die schwarze Magie störte mich nicht, solange sie keine Menschenopfer forderte. Da unser Clan jedoch noch immer von Sandria angeführt wurde, hatte ich nicht die Autorität, meinen Cousinen oder meinen Tanten ihre kranken Spielchen zu verbieten, und meine Mutter wusste genau, dass es das war, was ich anstrebte. Es war ein ständig wiederkehrender Streitpunkt zwischen uns. Ich war bereit, den schwereren Weg zu gehen. Sie nicht.
»Apropos Kröten.« Dawn nickte in Richtung des blonden After-Work-Typen. »Bereit für die zweite Runde?«
2
»Seelenessenz und Whisky auf leeren Magen waren eine beschissene Idee.«
In den nächsten zwei Stunden füllte sich die Bar rapide. In New Orleans war immer irgendwie und irgendwo etwas los, seitdem ich jedoch für Dean arbeitete, musste ich dieses »etwas« nicht suchen, es kam zu mir. Insbesondere an Abenden wie diesem.
Ich mixte zahlreiche Drinks, plauderte mit ein paar Gästen und sammelte ganz nebenbei vier weitere Essenzen ein. Das machte insgesamt fünf! Damit hatte ich mein Soll des Abends nicht nur erfüllt, sondern übertroffen. Leider war mein sterblicher Körper trotz der Magie in meinen Adern nicht in der Lage, mehr als fünf Essenzen zu beherbergen, ich fühlte mich bereits jetzt ausgelaugt und etwas schwindelig. In Gestalt der Priesterin hätte ich noch mindestens zwei oder drei Essenzen sammeln können, da wir jedoch keinen Mardi Gras hatten, würde ich damit bloß alle Gäste verschrecken und wahrscheinlich für immer verstören. So wie Blondie. Unwillkürlich begann ich zu lächeln.
»Was ist so komisch, hm?« Dean stellte ein neues Bier vor mir auf den Tresen. »Hast du noch mehr meiner Gäste vergrault?«
»Ich habe gar nichts getan«, protestierte ich schwach. Wir wussten beide, dass ich log.
»Hmm.« Er musterte den freien Platz vor der Bar. »Ist Dawn schon weg?«
»Eben gegangen. Ein Notfall im Hause Thideaux.«
Wahrscheinlich hatten Dawns Eltern herausgefunden, wo und vor allem mit wem ihre Tochter sich rumtrieb, und einen Riesenaufstand gemacht. Anders als bei den Benoits gab es in ihrem Clan nicht nur Frauen. Dawn kannte ihren Vater und sie liebte ihn.
Wie sich das anfühlen musste?
Als ich alt genug gewesen war, um solche Dinge im Ansatz zu verstehen, hatte meine Mutter mir erklärt, dass mein Vater zwar noch lebte, wir aber keinerlei Interesse daran hatten, ihn in mein Leben zu inkludieren. Wir. Nicht ich. Meine Mutter hatte entschieden und damit war die Sache erledigt gewesen. Wahrscheinlich sollte ich einfach dankbar sein, dass mein Vater nicht als Kröte in einen von Tante Eugenias Aquarien lebte so wie der Vater von Prudence und Priscilla und ein, zwei alte Flammen meiner Tante Eloise.
»Ein Notfall?« Dean wusste genau, was das hieß. Mitfühlend stupse er mit seiner Schulter gegen meine.
»Nimm's dir nicht so zu Herzen, Juju. Du weißt, dass Dawn dich liebt, und das ist alles, was zählt.«
»Wir drei gegen den Rest der Welt, hm?«
Ein eindeutiges Funkeln trat in seine dunklen Augen, und der Ausdruck auf seinem Gesicht wurde ernst. »Immer und gegen jeden.«
Momente wie diese waren es, in denen ich mir all die Gründe ins Gedächtnis rief, warum das mit Dean und mir keine gute Idee wäre. Und gleichzeitig versuchte ich nicht nur die Anziehungskraft zwischen uns zu ignorieren, sondern auch seine starke, liebevolle Art und den leichten Bad-Boy-Charme, der überhaupt erst dafür gesorgt hatte, dass wir uns angefreundet hatten. Dabei wollte ich so gerne nachgeben. Nur ein einziges Mal. Als Dean und ich uns kennengelernt hatten, war ich für einen Abend schwach und egoistisch gewesen und hatte mir genommen, was ich haben wollte. Beinahe. Obwohl wir nicht bis zum Äußersten gegangen waren, hatten wir eine absolut fantastische Nacht miteinander verbracht. Danach waren wir Freunde geworden. Weil ich es so gewollt hatte. Wenn meine Mutter oder gar meine Cousinen herausfanden, was Dean mir wirklich bedeutete, würden sie ihn kurzerhand aus meinem Leben entfernen. Dieses Risiko war ich nicht bereit einzugehen, also hatte ich ihn davon überzeugt, dass wir als Freunde besser zueinander passten. Seine Hände auf meinem Körper und sein Mund auf meinem würde ich allerdings nie vergessen. Es war damals mehr als eine kleine Liebelei und ein wenig wildes Rumknutschen gewesen, das hatten wir beide gespürt, aber Dean respektierte meine Entscheidung. Seitdem versuchte ich die Tatsache zu ignorieren, dass er sich nicht nur in meinen Gedanken, sondern auch in meinem Herzen tief verankert hatte.
Ich hatte es nie direkt ausgesprochen, aber Dean wusste, wer und was ich war. Er hatte den Namen Benoit gehört und ein wissender Ausdruck war auf seinem Gesicht erschienen. Im Bayou aufgewachsen, hatten Begriffe wie ›Voodoo‹, ›Priesterin‹ oder ›Magie‹ für ihn zum Alltag gehört. Die Symbole auf meinem Arm, vor allem das Veve, das Zeichen meiner Loa, hatten ihm den Rest der Geschichte erzählt. Er hatte ein paar Bemerkungen gemacht, ich hatte sie weder von mir gewiesen noch bestätigt, und wir waren zu der stillschweigenden Übereinkunft gekommen, dass wir uns in einer Win-win-Situation befanden. Ich bekam meine Seelen, er meinen Schutz. In den letzten Jahren waren wir zu Freunden geworden.
Das hinderte ihn jedoch nicht daran, mir an Abenden wie diesem den einen oder anderen heißen Blick zuzuwerfen. Mit Augen, die mein Blut in Wallung und meine Entscheidung ins Wanken brachten. Genau so hatte er mich damals dazu gebracht, den ganzen Abend flirtend mit ihm an der Bar zu verbringen, nur um dann prompt auf den Bartresen zu hüpfen, nachdem der letzte Gast gegangen war.
Dean sah mich ein letztes Mal durchdringend an, dann wandte er sich ab. Erleichtert lehnte ich mich gegen den Tresen. Das würde ein langer Abend werden.
Drei Stunden später hatten wir den Ansturm des Abends überstanden und die Bar begann sich zu leeren. Viele der Touristen, die über das Wochenende blieben, zogen sich in ihre Hotels zurück, damit sie den morgigen Tag bei einigermaßen vollem Bewusstsein erleben konnten. Jean-Pierre, ein gut aussehender dunkelhäutiger Kerl im Anzug und mit verlockend französischem Akzent, hatte seine Annäherungsversuche vor einer Stunde eingestellt. Er war gemeinsam mit ein paar Kumpels in die Bar gekommen und direkt auf mich zugesteuert. Ich schien ihm keine Angst zu machen, im Gegenteil, es war recht eindeutig, was er von mir wollte. Er würde es jedoch nicht bekommen. Ich wischte über den Tresen und musterte die Männergruppe. Sie würden nicht mehr lange durchhalten. Einer von Jean-Pierres Kumpels musste bereits gestützt werden und auch die anderen Männer hatten rote Wangen und glasige Augen. Jean-Pierre sah zu mir herüber und hob fragend eine Augenbraue.
Sicher, dass du nicht mit mir kommen willst?
Ich schenkte ihm ein Lächeln und schüttelte den Kopf. Normalerweise hatte ich nichts einzuwenden gegen eine Runde heißen, schnellen Sex, aber heute war ich nicht in der Stimmung. Ich musste die Seelen loswerden. Ihre Essenzen flossen durch meine Adern und so langsam sorgten sie für eine leichte Übelkeit. Seelenessenz und Whisky auf leeren Magen waren eine beschissene Idee.
Aber selbst wenn ich nicht randvoll mit gestohlener Essenz wäre, die Blicke, die Dean mir mit guter Regelmäßigkeit zuwarf, seitdem Jean-Pierre mich in Beschlag genommen hatte, sprachen Bände. Scheiße noch mal. Gegen eine Runde heißen Sex mit ihm hätte ich definitiv nichts einzuwenden. Wir waren so kurz davor gewesen … Hitze durchströmte mich bei dem Gedanken daran und ich wischte den Tresen vor mir aggressiver. An jenem Abend hatte er seine Hände unter meinen Po geschoben und mich kurzerhand auf den Tresen gehoben, ehe er meinem Körper von Kopf bis Fuß gehuldigt hatte. Noch nie hatte ich solch eine Leidenschaft in den Armen eines Mannes – oder einer Frau – gespürt. Und ich war bisher mit Sicherheit kein Kind von Traurigkeit gewesen. Aber mit Dean war es anders. Als seine Finger über meine Haut gefahren waren … als seine Lippen und seine Zunge mich liebkost hatten … da war etwas mit mir passiert. Wie ein emotionaler Kurzschluss hatte es sich angefühlt. Damals war ich kurz davor gewesen, jegliche Kontrolle aufzugeben und mir ein einziges Mal im Leben das zu nehmen, was ich haben wollte. Ich hatte nicht Juliette Benoit sein wollen, sondern Juju. Einfach nur Juju. Eine normale junge Frau, die das Erreichen ihres legalen Trinkalters begoss, auch wenn sie bereits seit Jahren regelmäßig feiern ging. So wie fast jede Einundzwanzigjährige in dieser Stadt. Und genau das war der Augenblick gewesen, in dem ich ihn von mir geschoben hatte und vom Tresen gehüpft war. Mein BH hatte sich irgendwo auf dem Boden befunden. Meine Jeans war weit geöffnet gewesen, und auch jetzt noch bekam ich eine Gänsehaut, wenn ich daran dachte, wie Dean mich mit unverhohlenem Verlangen angeblickt hatte. Angst, Frustration und Leidenschaft hatten mich in diesem Moment viel zu viel fühlen lassen.
Es war eine Erinnerung daran gewesen, wer ich war. Ich hatte nicht den Luxus, frei zu entscheiden. Also war ich gegangen. Ganz hatte ich mich jedoch weder von Dean noch der Bar fernhalten können. Nach zwei Wochen, die ich mit Dawn vor oder in der Bar herumgelungert hatte, hatte er mir einen Job angeboten. In dem Wissen, dass ich nachts nicht mehr durch die Straßen ziehen musste, um Seelen zu finden, und in dem Wissen, dass ich fast alle meine Abende fortan in seiner Nähe verbringen würde, hatte ich angenommen. Als Freundin.
Meine unerwarteten Gefühle für Dean machten ihn gefährlich für unseren Clan, und das war etwas, was keine der Benoit-Frauen hinnehmen würde. Die Magie und unsere damit verbundene Macht und Stellung in New Orleans waren alles, was zählte.
Ein Ziehen ging durch meinen Magen. Ich sollte wirklich langsam nach Hause. Als spürte er, in welche Richtung meine Gedanken gewandert waren, trat Dean neben mich.
»Was geht in deinem Kopf vor, Benoit?«
Ich warf den Lappen zwischen uns auf den Tresen. Ein paar weitere Gäste verabschiedeten sich, bis nur noch der Junggesellenabschied anwesend war.
»Nicht viel«, schwindelte ich und verschränkte die Arme vor der Brust. Dean folgte meinem Blick. Seine dunklen Augen blieben an Jean-Pierre hängen.
»Ein gut aussehender Typ.«
»Das sind viele Typen in New Orleans.«
»Ist das so?« Er ahmte meine abweisende Haltung nach.
Hast du zuletzt mal in den Spiegel geguckt? Das war es, was ich hatte sagen wollen. »Wie lange brauchst du mich noch?«
Das war es, was mir über die Lippen kam, während ich die kleine, helle Narbe an seiner linken Augenbraue fixierte. Allerdings war meine alternative Wortwahl kein Stück besser. Bei dem Wort brauchen blitze es in Deans Augen auf.
»Das kommt ganz darauf an …«, murmelte er und das tiefe Timbre seiner Stimme, gepaart mit dem jetzt stärker hörbaren kreolischen Akzent, jagte mir einen kleinen Schauer den Rücken herab. Er sah von mir zurück zu Jean-Pierre.
»Hast du heute noch was vor?«
»Nein.«
Dean nickte. Er machte sich nicht einmal die Mühe, seine Erleichterung vor mir zu verbergen.
»Dann kannst du abhauen.« Er schaute nach links und rechts und vergewisserte sich, dass uns keiner hören konnte. »Welche Route nimmst du?«
Damit meinte er meinen Nachhauseweg. An Tagen, an denen ich mich müde und ausgelaugt fühlte, nahm ich den direkten und relativ kurzen Weg nach Hause. Ein kleiner Fußmarsch von nicht mal zwanzig Minuten. Die lange Route hingegen führte mich durch einen etwas düstereren Teil des Quarters und vorbei am Friedhof. Das war der Weg, den ich einschlug, wenn ich mich rastlos fühlte und voller Energie war. Wütend über mein Erbe und meine allgemeine Lebenssituation. Wütend darüber, dass ich Dean nicht einfach hinter mir die Treppe zu seinem Apartment hochziehen und all die Dinge mit ihm tun konnte, die ich mir seit Jahren ausmalte. Eigentlich keine Route für den heutigen Abend … dennoch …
»Die lange«, erwiderte ich. Mit Sicherheit war irgendwo eine Banshee oder ein Skinner ausgebrochen … Und ich würde den kleinen Scheißer direkt auf Veles' verdorbenen Schoß zurückbefördern – sozusagen als Ausgleich für die Seelen, die ich ihm übergab , und zwar in so vielen Einzelteilen wie möglich. Wenn sie noch so weit bei Bewusstsein waren, dass sie ihrem König berichten konnten, wer ihnen das angetan hatte? Umso besser. Unwillkürlich begann ich zu lächeln. Definitiv die lange Route. Trotz der Essenzen in mir würde ich es immer noch mit einem Schattenwesen aufnehmen können.
Dean musterte mich aufmerksam. »Dieses Lächeln kenne ich und in der Regel bedeutet es Ärger.«
»Nicht für mich.«
»Sei dennoch vorsichtig.«
»Das bin ich immer«, beruhigte ich ihn. Sosehr mich manche Aspekte meines Lebens auch ankotzten, ich mochte es. Es war mein Leben. Und ich gab die Hoffnung nicht auf, dass ich eines Tages eine Möglichkeit finden würde, es tatsächlich zu meinem Leben zu machen.
»Juliette, ich ...« Dean brach ab, als es im hinteren Teil der Bar laut schepperte. Unsere Köpfe fuhren herum. Er seufzte laut, als er den halb zerbrochenen Billardtisch betrachtete. Ein Bein war eingeknickt, dort, wo der Bräutigam offenbar mit voller Wucht auf den Tisch gefallen war.
»Es war eine Frage der Zeit …«
»Willst du, dass ich sie zum Gehen animiere?«
Wir wussten beide, was ich damit meinte. Sollte ich meine Magie dazu benutzen, sie aus der Bar zu jagen?
Dean schüttelte den Kopf. »Ich erledige das schon. Du kannst ruhig Feierabend machen, wenn du willst.« Er zögerte kurz und ein Ausdruck huschte über sein Gesicht, den ich nicht oft an ihm entdeckte. Unsicherheit.
»Wir sehen uns dann morgen, okay?«
Ich nickte. In einer flüssigen Bewegung sprang er über den Tresen und schlenderte in Richtung der Männer. »Meine Herren …«
Ich beobachtete seine lässige Haltung. Die lockeren Gesten und Handbewegungen, als er einem der Männer kameradschaftlich auf die Schulter klopfte. Dennoch wirkte er seltsam angespannt.
Wieso benahm er sich heute Abend so sonderbar? Und seit wann nannte er mich Juliette? Ich beschloss, dass es tatsächlich an der Zeit war, abzuhauen, (bevor ich noch etwas Dummes tat – so was, wie mit Dean über Gefühle zu reden) und kramte meine Tasche unter dem Tresen hervor. Dawn hatte mir den schwarzen rucksackähnlichen Beutel mit der Aufschrift ›magic inside‹ als Scherz für den Mardi Gras-Umzug geschenkt. Allerdings hatte ich schnell festgestellt, dass es auch beim Kämpfen relativ praktisch war, beide Hände frei zu haben. Also war der Beutel Teil meines Standardoutfits geworden.
Ich winkte Dean ein letztes Mal flüchtig zu und verließ die Bar durch die Küche und den Hintereingang. Sobald ich draußen war, sog ich die kühle Nachtluft gierig in meine Lungenflügel. Die Essenzen flatterten rastlos durch meinen Körper und verursachten mir eine Gänsehaut. Ich streifte ein Zopfband von meinem Handgelenk und band mir einen hohen Dutt auf dem Kopf. Dann nahm ich die Creolen ab und zog die beiden kleinen schwarzen Messer aus dem Beutel. Ich stopfte sie in meinen Gürtel und krempelte mein Shirt bis zu den Ellenbogen hoch. Das Tattoo an meinem Arm, insbesondere das Wappen der Benoits (eine Schlange, die aus einem mit einem Blumenkranz geschmückten Totenschädel kroch) auf Höhe meines Ellenbogens, nun gut sichtbar für alle, die mir in die Quere kommen wollten. Mit routinierten Bewegungen schwang ich den Beutel auf meinen Rücken und verstaute die Kette mit dem Jaspis unter meinem Top. Dann war ich fertig. Und bereit, etwas zu töten.
Ich hielt mich in den Schatten und lief ein paar der kleinen Gassen entlang, bis die bunten Lichter und der sanfte Klang von Jazzmusik, der immer irgendwo durch das Viertel zu wehen schien, zunehmend weniger wurden und schließlich ganz verblassten. Dunkelheit umgab mich, und zum ersten Mal an diesem Abend gönnte ich mir einen befreiten, tiefen Atemzug. Mir war durchaus bewusst, dass es eine gewisse Ironie beinhaltete, dass ich mich in der Anonymität der Nacht und den Schatten, die sie barg, am wohlsten fühlte. Der Geruch von Blumen und Frittiertem wurde Stück für Stück ersetzt durch den frischen Duft von Wald. Moos. Kiefer. Pinie. Ein paar vereinzelte Jasminbüsche, die dem bodenständigen, erdigen Geruch etwas unleugbar Exotisches und Verführerisches verliehen. Das war das New Orleans, das ich liebte. Auch wenn wir nicht im Bayou wohnten, wie einige andere Clans es bevorzugten, liebte ich den Geruch der Natur, des Waldes und der Sümpfe. Hier war ich meiner Magie so viel näher als direkt in der Stadt. Ich bog um ein paar weitere Ecken, bis ich ihn erreicht hatte: den Friedhof. Oder eher – einen der zahlreichen Friedhöfe in New Orleans. Der St. Louis Cemetery No. 2.
In den letzten Jahren hatten Dawn und ich so ziemlich jeden der Friedhöfe in New Orleans unter die Lupe genommen. Dieser aber lag leicht erhöht direkt hinter dem French Quarter, und auch wenn der St. Louis Cemetery No. 1 rein topografisch vor ihm lag, gab es hier auf No. 2 mehr Schattenwesen-Bewegung als auf allen anderen zusammen. Warum auch immer, aber hier war der Schleier zwischen dem Schattenreich und unserer Welt extrem dünn. Ohne jegliche Furcht betrat ich das stockfinstere Friedhofsgelände. Seit meiner Kindheit kannte ich jeden der Friedhöfe wie meine Westentasche. So auch diesen. 1823 angelegt, war er die letzte Ruhestätte vieler bekannter Jazzgrößen aus dem Bayou. Die meisten der Gräber, die ich hier vor mir hatte, befanden sich überirdisch in Mausoleen, da der oftmals stark ansteigende Meeresspiegel und die zahlreichen Naturkatastrophen Erdbestattungen schwierig machten. Das hatte uns Hurricane Katrina vor ein paar Jahren einmal mehr bewiesen. Anders als bei vielen weitläufigen Friedhöfen waren die Wege und Gänge eng, nahezu beengend. Naturstein, Sandstein und Marmor säumten die Schotterwege. Tagsüber war der Friedhof ein beliebtes Ziel bei Touristen. Ebenso bei Scharlatanen, die den wild umherlaufenden und fotografierenden Besuchern Schrumpfköpfe und Amulette für ein langes Leben andrehten.
Einige der Schaulustigen trauten sich auch in der Dunkelheit hierher. Kamen sie mit einem Guide und waren Teil einer geführten Gruppe, verließen sie den Friedhof so, wie sie gekommen waren: in einem Stück. Diejenigen aber, die meinten, sie müssten mitten in der Nacht mit einem selbst gebastelten EMF-Gerät umherlaufen, da sie zu viele Mystery-Serien gesehen hatten, ereilte oftmals ein schneller und grausamer Tod. Ich versuchte so viele wie möglich von ihnen zu retten. Einige Menschen waren jedoch nicht nur beratungsresistent, sie waren auch rettungsresistent. Sollten sie einem Schattenwesen ins Schattenreich folgen oder sich vor meiner Ankunft auf einen Handel einlassen, dann konnte auch ich ihnen nicht mehr helfen. Niemand konnte das. Band man seine Seele ans Schattenreich und damit an Veles, war man so gut wie verloren. In den wenigstens Fällen ließ Veles die Menschen mit einem Schrecken davonkommen. Er fand stets einen Weg, sich zu nehmen, was er haben wollte.
Ich für meinen Teil hatte den König des Schattenreichs noch nie persönlich getroffen. Aber ich kannte die Geschichten über ihn. Die, die meine Familie mir erzählte. Die, die Dawn mir erzählte, und ich erkannte die Vorsicht in den Augen unserer Loa, wenn sie jeden Monat unseren Tribut an den Schattenkönig lieferte. Keiner der Clans kannte seinen Ursprung. Hatte unser Gott Bondye ihn zum König ernannt? Hatte Veles die Macht im Schattenreich einfach an sich gerissen? Es gab viele Theorien. Einige von ihnen behaupteten sogar, dass er einst ein Priester gewesen war. In einem waren sich die Geschichten jedoch immer einig: Veles war das personifizierte Böse. Sogar Prudence und Priscilla fürchteten sich und erzitterten bei seinem Namen – und das sollte was heißen.
Tatsächlich konnte ich gut darauf verzichten, Veles kennenzulernen. Wenn's nach mir ginge, würde ich einen Weg finden, um mich für immer von ihm und diesem Pakt zu lösen. Allerdings ging das nicht, ohne unsere Extraportion Magie zu verlieren. Instinktiv griff ich nach den Messern an meinem Rücken und nutzte mein Zweites Gesicht. Von außen würde man mir die Verwandlung zur Priesterin noch nicht ansehen. Nicht auf den ersten Blick. Lediglich meine Augen leuchteten hellblau bis weiß. Ebenso mein Tattoo. Die zweite Sicht ermöglichte es mir, das wahrzunehmen, was sich im Schleier zwischen den Welten abspielte. Auren, Fußabdrücke, Risse in der Atmosphäre. So fand ich die nötigen Anhaltspunkte, um Schattenwesen aufzuspüren und auszulöschen. Es half mir, das ganze Spektrum des Schattenreich-Abfalls zu erfassen. Alles, was danach kam, verbuchte ich unter: den Müll rausbringen.
3
»Grüß Veles von mir, Arschloch.«
Für eine Weile wanderte ich über das dunkle Friedhofsgelände. Meine Sinne warnten mich, sobald ich einer menschlichen Seele zu nahe kam, und ließen mich ausweichen. Nahezu lautlos schlich ich durch die engen Gänge, bis ich endlich fand, wonach ich Ausschau gehalten hatte. Eine zittrige Spur, wie ein zerrissener glühender Faden, hing in der Luft vor mir und verschwand im Inneren eines großen, von zwei Engelstatuen flankierten Mausoleums. Grinsend griff ich meine Messer fester. Die Schwingung, die ich daraufhin auffing, war leicht zu deuten: ein Skinner.
Die klapprigen Wesen, deren Haut nur noch in Fetzen an ihren halb verwesten Körpern hing, waren fiese Kreaturen. Schafften sie es, einen Menschen zu besitzen, agierten sie ähnlich wie ein Parasit. Sie gruben sich in Fleisch und Knochen, bis der Mensch von innen heraus verdarb. Der Prozess war langwierig und ekelerregend und alles andere als schön.
Meine Magie erwachte nun gänzlich und rekelte sich in freudiger Erwartung eines Kampfes wie eine geschmeidige, tödliche Raubkatze. Glatte weiße Haare wehten mir um das jetzt scharfkantige, knöcherige Gesicht. Meine Lippen verzogen sich zu einem erwartungsvollen Grinsen, als ich die Mausoleums-Tür lediglich mit der Kraft meiner Gedanken öffnete.
»Und unser Monster der Woche ist …«, rief ich und sprang in einem Satz die drei Stufen in die Gruft hinab. Der modrige Geruch nach nassem, altem Stein und Erde wehte mir entgegen. Typischer Gruftgeruch. Ich rümpfte die Nase.
»Hierher, Skinner, Skinner, Skinner …«, sang ich leise und sah mich aufmerksam in dem kleinen Raum um.
Nackte Wände starrten mir entgegen. Am Ende der Gruft stand ein großer steinerner Sarg auf einem Podest. Der Deckel war staubbedeckt und ein paar verwelkte Blumen sowie eine zerbrochene Vase befanden sich auf einem kleinen Altar daneben. Es wirkte alles völlig unauffällig. Was jedoch nicht in die gruselige Idylle dieser letzten Ruhestätte passte, war der blutige Handabdruck am Ende des Sargdeckels.
»Wir haben einen Gewinner«, murmelte ich und trat vor. Ich sammelte meine Magie und konzentrierte sie, bis ich sie in meinem Kopf als pulsierenden, leuchtenden Energieball vor mir wahrnahm. Als mein ganzer Körper vor unterdrückter Magie zu kribbeln begann, öffnete ich ihr die Pforten und ließ meine Magie ausbrechen. Laut brüllend stürmte sie los und stürzte sich auf den Sarg vor mir. Mit einem ohrendbetäubenden Knall flog der Deckel zurück und zerbarst an einer der Gruftwände. Der Skinner hatte mich offenbar erwartet. Mit einem unmenschlichen, schrillen Schrei kam er in aller Dracula-Manier aus dem Sarg geschossen und stürzte sich zähnefletschend auf mich. So wie es aussah, steckte der Parasit schon ein wenig länger im Körper des armen Menschen. Die Augenhöhlen waren eingefallen. Hautfetzen hingen ihm von den hervorstehenden Wagenknochen und die Kleidung, einst ein dunkelgrauer, dreiteiliger Anzug, starrte vor Dreck und war halb zerrissen. Kratzspuren zogen sich über jeden freien Zentimeter Haut, den ich erkennen konnte. Als hätte das Wesen versucht, sich selbst das Fleisch von den Knochen zu pulen. Der Körper des Mannes war schon lange tot. Alles, was ich jetzt noch für ihn tun konnte, war, seine Seele zu befreien und diese Missgeburt zurück zu Veles zu befördern.
Mit einem gezielten Tritt gegen den Brustkorb wehrte ich seine erste Attacke ab. Es knirschte laut. Früher wäre mir wahrscheinlich schlecht geworden, mittlerweile war das Geräusch zerbrechender Knochen wie Musik in meinen Ohren.
Insbesondere wenn es von einem Schattenwesen kam. Gelangten Schattenwesen durch den Schleier in unsere Welt, waren sie zunächst ohne Körper und bestanden aus nichts weiter als Schatten und einer Aura. Sie fühlten nichts. Und genau das war der Grund, warum sie Menschen befielen und ihre Körper übernahmen. Sie wollten fühlen, essen, trinken … leben. Aber zum Leben gehörten auch Schmerz und der Tod. Etwas, was ich ihnen nur allzu gern klarmachte.
»Ich schicke dich zurück zu deinem Meister«, keuchte ich und ließ beide Messer durch die Luft fliegen. Der Skinner kreischte. Unfähig zu sprechen, war alles, was er von sich geben konnte, dieses nervtötende Geräusch. Eine Klinge verfehlte ihr Ziel, die andere aber bohrte sich tief in seine Augenhöhle. Er kreischte erneut. Dann machte er kehrt und stürzte sich Kopf voran durch eines der beiden Buntglasfenster der Gruft. Scheiße, das hatte ich nicht kommen sehen.
So schnell ich konnte, nahm ich die Verfolgung auf. Der Skinner bog um die Ecke und lief humpelnd vor mir davon. Ein panischer Schrei ertönte, und als ich die beiden Menschen passierte, die mich mit offenem Mund und ängstlich geweiteten Augen anstarrten, rief ich ihnen zu: »Alles gut. Wir proben nur für Mardi Gras.« Ob sie mir glaubten, war ihnen überlassen. Den Skinner einzuholen dauerte nur wenige Sekunden. Ich sprang auf seinen Rücken und zog das humpelnde Schattenwesen mit mir auf den Boden. Energisch drehte ich ihn herum und legte meine Handflächen links und rechts gegen seine Schläfen.
»Es tut mir leid«, murmelte ich und fixierte das strampelnde Wesen unter mir mit meinen Knien und meinem Oberkörper.
»Bon voyage, pauvre âme«, flüsterte ich. Die Worte waren nicht für den Skinner bestimmt, sondern für die arme Seele, die noch immer in dem langsam verwesenden Körper stecke. Dann entfesselte ich das ganze Ausmaß meiner Magie und jagte sie durch den Körper unter mir. Weiße Magie, schwarze Magie … man konnte es nennen, wie man wollte. Es war Magie und sie war überall um uns herum. In jedem Grashalm, in jedem Windhauch und in jedem neckischen Jazzklang, der aus dem Quarter drang. Für diese Art von Austreibung brauchte ich keinen speziellen Zauber. Das hier war Zerstörungsmagie in ihrer reinsten Form. Ich sammelte alles, was ich hatte, und ließ es los. Mit aller Macht brannte ich den Skinner aus dem Menschen heraus und jagte ihn zurück durch den Schleier in sein eigenes Reich.
»Grüß Veles von mir, Arschloch.«
Meine Hände leuchteten ein letztes Mal auf, dann war der Skinner verschwunden und der Mensch unter mir sackte in sich zusammen und wurde zu dem, was er wahrscheinlich schon seit Tagen war. Einer Leiche.
Ich rappelte mich auf und wischte mir den leichten Schweißfilm von der Stirn. Dann griff ich nach einem der knöcherig aussehenden Äste neben mir und malte das Veve, das Zeichen von Baron Samedi, in den Sand neben den Leichnam. Für die meisten Menschen mochten die Veves der Loa kompliziert anmuten, ich hingegen brauchte nicht mal eine Minute, um die filigrane Zeichnung fertigzustellen.
Schon von klein auf hatte meine Mutter mir die verschiedenen Symbole eingetrichtert. Ich hatte sie so lange üben müssen, bis ich sie im Schlaf konnte. Dabei war es meiner Mutter egal gewesen, ob sie mich bis spät in die Nacht wach hielt oder ob meine Hände sich vor Schmerz verkrampften und meine Augen tränten. Eine Loa zu rufen, konnte überlebenswichtig werden. Je präziser das Veve, desto stärker der Ruf. Baron Samedi war nicht nur der Mann von Maman Brigitte, er war auch der Beschützer der verstorbenen und verlorenen Seelen. Er würde sein Zeichen erkennen und die arme Seele des Mannes friedlich ins Reich der Toten begleiten, so wie es seither seine Aufgabe war. Man nannte ihn schließlich nicht umsonst den »Totenherrscher«.
Nachdem ich meine Messer eingesammelt und sie an meinem Rücken verstaut hatte, machte ich mich auf den Heimweg. Durch meine Begegnung mit dem Skinner und dem Einsatz meiner Magie hatte ich es für einen Moment geschafft, die Seelenessenzen in meinem Inneren zum Schweigen zu bringen. Bevor ich den Friedhof verließ, gestattete ich mir, die einzigartige Atmosphäre zu genießen. Rote Grabkerzen leuchteten vor den Mausoleen. Frische Blumen waren arrangiert worden und hier und da erkannte ich die Farbe Lila in Kerzen, Tüchern und Blumen. Baron Samedis Farbe. Grillen zirpten miteinander um die Wette, ansonsten jedoch war es still. Totenstill. Kein Wunder, dass nicht nur New Orleans, sondern auch ihre Friedhöfe bereits des Öfteren Schauplatz diverser Filme gewesen waren. Und ja, für mich war New Orleans eine Frau. Denn nur eine Frau konnte gleichzeitig so schön, verführerisch und tödlich wie diese Stadt sein.
Kurz nach drei trat ich durch das gusseiserne Tor des Benoit-Anwesens. Der Schutzzauber, der über der viktorianischen Villa und den Gärten lag, stürzte sich mit voller Macht auf mich. Dann erkannte er mich und zog sich entschuldigend wabernd zurück. Ganz so, als besäße der voilé, der Nebel, der uns vor Eindringlingen und fremder Magie schützte, ein Bewusstsein. Genährt durch unser Blut gingen wir eine Verbindung mit ihm ein. Diese sorgte dafür, dass er mich passieren ließ.
In normalen Haushalten wäre um kurz nach drei sicherlich niemand mehr wach. Wir waren kein normaler Haushalt. Als ich mich der hellblauen, mit Stuck und Malereien verzierten Villa näherte, öffnete sich die schwere Holztür leise knarzend. Man hatte mich also bereits erwartet. Wie reizend.