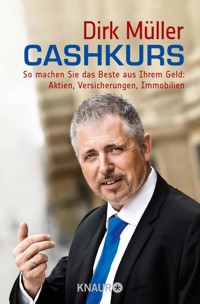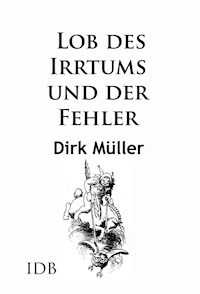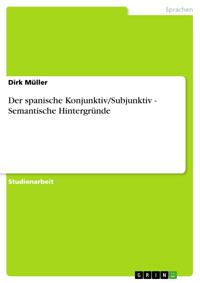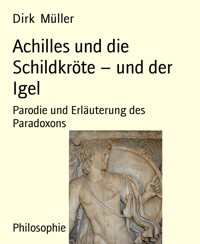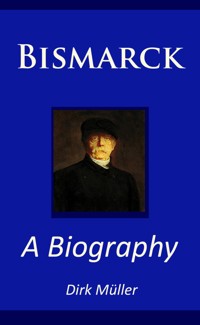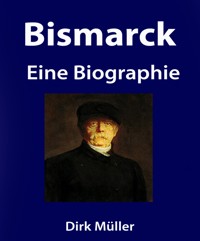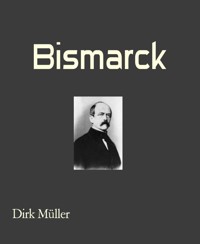7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Droemer eBook
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Dirk Müller – »Mr. Dax«, Bestsellerautor, Deutschlands populärster Wirtschaftserklärer – schildert den zweiten Akt des Währungs- und Wirtschaftsdramas, das seinen Schauplatz längst von den USA nach Europa verlagert hat. Er rekapituliert die fundamentalen Fehlentscheidungen bei der Konstruktion des Euro, zeigt auf, welche Triebkräfte am Werk waren, wer Profit daraus zog und wer heute ein massives Interesse am Zerfall eines starken europäischen Währungs- und Wirtschaftsraumes hat. Denn die aktuelle Krise ist nicht nur das Ergebnis maßloser Staatsschulden, sie ist auch Ausdruck eines amerikanisch-europäischen Wirtschaftskrieges, der hinter den Kulissen tobt. Müller zeigt, welche Möglichkeiten Europa und Deutschland offenstehen, er benennt Chancen und Gefahren. Für die Taschenbuchausgabe hat Dirk Müller seinen "Spiegel"-Bestseller erweitert und aktualisiert um ein grundlegendes Kapitel zum Konflikt zwischen den USA, Europa und Russland um die Ukraine. Ein Buch, dessen Brisanz täglich neu bestätigt wird.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 378
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
Dirk Müller
Showdown
Der Kampf um Europa und unser Geld
Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.
Über dieses Buch
Dirk Müller - Mr. Dax, Bestsellerautor, Deutschlands populärster Wirtschaftserklärer - schreibt seinen großen Erfolg »Crashkurs« fort. In »Showdown« schildert er den zweiten Akt des Dramas der Währungs- und Wirtschaftskrise, die ihren Krisenherd von den USA nach Europa verlagert hat. Müller rekapituliert die fundamentalen Fehlentscheidungen beim Bau der gemeinsamen Währung, des Euro, zeigt auf, welche Interessen am Werk waren, wer Profit daraus zog und wer heute ein massives Interesse am Zerfall der europäischen Währungsunion, am Zerfall eines starken, einigen, europäischen Währungs- und Wirtschaftsraumes hat. Denn die europäische Krise ist nicht nur das Ergebnis maßloser Staatsschulden, sie ist auch Ausdruck eines amerikanisch-europäischen Wirtschaftskrieges, der hinter den Kulissen tobt.
Dirk Müller zeigt, welche Möglichkeiten Deutschland, Österreich und Europa offen stehen, er benennt Chancen und Gefahren der unterschiedlichen Szenarien und er gibt Hinweise, wie man sein Geld, seine Altersvorsorge, seine Anlagen bestmöglich durch die zweifellos sich zu einem dramatischen Höhepunkt hinaufschraubenden Krise bringen kann. Ein Buch mit hohem Erkenntnis- und Nutzwert.
Inhaltsübersicht
Widmung
Vorwort
1. Am Scheideweg
Die Machtachsen verschieben sich
Europa am Scheideweg
Der griechische Patient und die Wiege der Demokratie
Griechisches Gas und die Folgen
Eine Frage der Währung
Euro-Mythen
Weimarer Verhältnisse
Die Rolle des IWF
Die Zukunft Europas
Ausstieg aus dem Euro?
Europäische Werte
2. Chancen für Europa
Strukturfehler: Unser Schuldgeldsystem
Reindustrialisierung, Fracking und Energieautarkie der USA
Der Weg in die Zukunft
Die Lösung des Schuldenproblems
Eine gemeinsame Vision
Europa und die Lobbyisten
Demokratisierung durch Dezentralisierung
Nachwort zur Taschenbuchausgabe
Nachwort
Dank
Abkürzungen
Für Susanne und Felix
Vorwort
Liebe Leserin, lieber Leser,
herzlichen Dank, dass Sie sich dieses Buch antun. Wir brauchen Menschen, die die Dinge hinterfragen, die neugierig und kritisch sind. Menschen, die sich nicht alles gefallen lassen wollen und die dazu bereit sind, sich einzumischen. Da Sie dieses Buch, wie ich hoffe, freiwillig in Händen halten, scheinen Sie genau zu diesen Menschen zu gehören, und dafür danke ich Ihnen. Nur wenn wir eine Sauerei nicht als selbstverständlich hinnehmen, sondern immer wieder aufs Neue bereit sind, uns zu empören und dieser Empörung Ausdruck zu verleihen, sind wir auch in der Lage, die Dinge zu verbessern. Viel zu oft hört man in diesen Tagen den Satz: »Was soll’s, das machen alle so, die sind eh alle korrupt. Was soll man da machen, ich halte mich raus, ändert ja doch nichts!« Falsch!
Die Welt war nie besser, als sie heute ist. Stellen Sie sich irgendein Zeitalter vom Anbeginn der Menschheit bis heute vor. Stellen Sie es sich nun realistisch vor und nicht wie im Kino romantisch verklärt. Mit all der Rechtlosigkeit, den Krankheiten, den Hungerwintern, den Erziehungsmethoden, der kaum vorhandenen medizinischen Versorgung, der fehlenden sozialen Absicherung und allen anderen Facetten. Gab es wirklich je eine Zeit, in der es objektiv besser war als heute?
Die Welt hat sich immer weiter zum Besseren verändert, obgleich sie noch viele Jahrhunderte von einem Idealzustand, wenn es diesen überhaupt geben kann, entfernt ist. Aber sind diese Veränderungen hin zum Positiven ganz von alleine entstanden? Kamen sie als himmlisches Geschenk über Nacht oder aufgrund der Einsicht von Herrschern und Mächtigen, die, von Weisheit durchdrungen, Segnungen für ihre Bürger eingeführt haben? In seltenen Fällen war das wohl so. Aber die meisten Veränderungen kamen durch die Menschen selbst. Durch Menschen wie Sie und mich, die nicht bereit waren, Ungerechtigkeiten als unveränderliches Schicksal hinzunehmen. Oft war es nur ein Einzelner, der aufgestanden ist und ausgerufen hat: »Der Kaiser hat keine Kleider an!« Worauf die anderen ebenfalls darauf aufmerksam wurden und wiederum ihre Nachbarn darüber informiert haben. Am Ende waren es die vielen einzelnen Menschen, die sich jeweils nur kurzfristig und nur zu einem einzigen Zweck zusammengetan haben. Nämlich diese eine Ungerechtigkeit zu beseitigen. »Wir sind das Volk!« Nach erfolgreichem Einsatz ist jeder wieder in sein Leben und an seinen Arbeitsplatz zurückgekehrt. Bis zum nächsten Anlass der Empörung. Es muss nicht immer die große Weltpolitik sein. Oft sind es ganz kleine Dinge. Die Unverschämtheit eines Teenagers im Bus, die Ungerechtigkeit des Chefs gegenüber dem Kollegen, die kleinen Sauereien im eigenen Betrieb zu Lasten der Lieferanten oder Kunden, die alle für ein bisschen mehr kurzfristigen Profit hinnehmen. Aber eben auch die großen Themen unserer Gesellschaft.
Mischen wir uns ein. Wo stünde diese Welt heute, hätte es nicht zu allen Zeiten Millionen Menschen gegeben, die so wie wir bereit waren, sich gegen Ungerechtigkeit und Missstände aufzulehnen und die Welt ein klein wenig besser zu machen? Sie waren es, denen wir heute unsere vergleichsweise paradiesischen Lebensumstände verdanken. Bedanken wir uns in Respekt vor diesen Menschen, indem wir ihr Engagement weitertragen.
Das soll auch uns dazu inspirieren, eben nicht aufzugeben und zu resignieren, sondern uns zu empören und einzumischen. Jeder dort, wo er die Möglichkeit hat. Der eine in der Familie beim Abendbrot, der andere mit Freunden im Sportverein, der Nächste in seiner Zeitungskolumne. Andere haben die Möglichkeit, sich im Fernsehen vor Millionen zu empören, wieder andere können das in den Parlamenten, Abgeordnetenfluren oder ihren eigenen Konzernzentralen tun. Ich versuche meinen bescheidenen Beitrag vielleicht auch hier mit diesem Buch zu leisten. Ich will nicht wegschauen und resignieren. Ich will mich aufregen, empören und einmischen. Ich will die Dinge da zum Besseren bewegen, wo ich die Möglichkeit dazu habe, und wenn es nur dadurch ist, laut auszurufen: »Der Kaiser ist nackt!« Je mehr daraufhin den Kaiser ansehen, je mehr zur selben Erkenntnis kommen, desto eher haben wir die Chance, etwas zu verändern.
Ich möchte Sie daher nun einladen, sich mit mir gemeinsam zu empören, über unglaubliche Zusammenhänge zu staunen und ungehemmt hinter die Kulissen der ach so Mächtigen zu schauen. Aber wer hindert uns daran, das alles mit einem Lächeln im Gesicht zu tun? Die Welt war nie besser, darüber dürfen wir uns freuen und diese Welt dankbar genießen, während wir neben der Empörung nach Lösungen suchen, um die Dinge für uns, unsere Kinder und die nächsten Generationen noch ein klein wenig besser zu machen.
Begleiten Sie mich nun auf eine spannende und, wie ich hoffe, faszinierende Reise durch unser Europa und weit darüber hinaus.
Ihr
Dirk Müller
1. Am Scheideweg
Die Machtachsen verschieben sich
Showdown – der entscheidende Machtkampf. Einen besseren Titel für das Buch hätten wir in diesen Tagen kaum finden können. Er beschreibt exakt die aktuelle Entwicklung nicht nur in Europa. Da wir so sehr mit unseren hauseigenen Problemen rund um die Eurozone beschäftigt sind, übersehen wir gelegentlich, in welchem großen Gesamtzusammenhang sich diese Ereignisse abspielen. Die ganze Welt befindet sich in einer entscheidenden Phase. Die wirtschaftlichen Achsen und mit ihnen die Machtachsen verschieben sich, und niemand weiß zuverlässig vorherzusagen, wo sie sich am Ende auspendeln werden. Viele glauben zu beobachten, dass sich diese Achsen vom Westen um das große Zentrum USA nach Osten in Richtung des Kristallisationskerns China verschieben werden. Aber ist wirklich anzunehmen, dass Amerika da einfach zusieht, wie die Macht nach China wechselt? Ist es nicht naiv, anzunehmen, dass die USA sich auf den Standpunkt zurückziehen: »Wir haben hundert Jahre Spaß gehabt, jetzt sind die Chinesen auch mal dran, das ist nur fair!«?
Die Welt wird neu sortiert. Wir befinden uns mitten im Qualifying um die Poleposition. Jetzt entscheidet sich, wer in den nächsten Jahrzehnten die Welt dominieren wird. Und dieses Qualifikationsrennen wird mit allen Mitteln und maximaler Härte gefahren. Wer beim Überholvorgang im Weg steht, wird gnadenlos an die Bande gedrückt.
Seit Anbeginn der Zivilisation versucht jede Großmacht alles in ihrer Macht Stehende, um ihre Dominanz zu erweitern oder zumindest zu erhalten. Hierzu wird jede militärische, politische, mediale und geheimdienstliche Option ausgeschöpft. Wie realistisch ist es, anzunehmen, dass in einer solchen heißen Phase der Bereich Wirtschaft – das Herz-Kreislauf-System unserer Welt – ausgeklammert bliebe? Die Armeen werden auf diesem Schlachtfeld »Finanzhäuser« genannt. Statt einer Flotte kommen Ratingagenturen, Notenbanken und Währungsorganisationen zum Einsatz. Die realen Armeen sind jedoch auch heute noch das letzte Mittel, wenn die anderen Einheiten in ihrer Wirkung versagt haben.
Fällt Ihnen auf, dass »epochale Ereignisse« rund um den Globus sich häufen, und zwar in atemberaubender Geschwindigkeit? In Nordafrika wurden binnen Monaten reihenweise Regime hinweggefegt, die seit Jahrzehnten stabil im Sattel saßen. Der Nahe Osten entwickelt sich vom Pulverfass zum Inferno, Japan und China stehen sich feindselig gegenüber wie seit dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr, und Europa rauscht im Höllentempo in eine Situation, die wir noch vor zwei Jahren für unvorstellbar hielten. Ist es nicht schon ein deutliches Signal, dass die Schweizer Armee im Herbst 2012 militärische Übungen zur Abwehr von Flüchtlingsströmen aus Europa abhält?
Wir stehen vor jenem Showdown, an dessen Ende die Entscheidung fällt, wer künftig die Welt anführt und wer auf den Plätzen landet. Vor diesem Hintergrund müssen wir alle größeren Entwicklungen dieser Zeit betrachten. Machen wir nicht den Fehler, alle Themen rund um Euro, Europa, China und Amerika nur durch die Brille der Wirtschaft zu sehen. Es geht in dieser Phase der Weltgeschichte um grundlegende geostrategische Interessen der verschiedensten Spieler. Der große Croupier greift in dieser Zeit wesentlich häufiger als sonst in die Rouletteschale und schubst die Kugel, wenn ihm das zu erwartende Ergebnis nicht gefällt. Diese Erkenntnis und der stete Blick auf die geostrategischen Interessen gilt es zwingend im Auge zu behalten, wenn wir die aktuellen und anstehenden Entwicklungen verstehen wollen.
Stellen Sie sich bei allen neuen Entwicklungen stets die Frage: Cui bono? – Wem nutzt es?
Europa am Scheideweg
Doch beginnen wir unsere Betrachtung rund um die Welt vor der eigenen Haustür.
Europa steht am Scheideweg und wir, seine Bürger, mit beiden Beinen im Morast. Wenn Sie auf einen Sumpf zukommen, haben Sie in der Regel die Möglichkeit, rechts oder links um den Sumpf herumzugehen. Die dümmste Idee wäre es, aus Bequemlichkeit den vermeintlich kürzesten Weg geradeaus durch ebenjenen Sumpf einzuschlagen. Europa steht vor derselben Entscheidung, doch leider können wir uns bislang weder für rechts noch für links entscheiden und marschieren, lautstark debattierend, weiter geradeaus. Dass dies in einer Tragödie enden muss, ist jedem objektiven Beobachter klar, aber das Rufen und Mahnen bleibt ungehört in der lautstarken Diskussion. Internationale Banken und Spekulanten, aber auch Großmächte mit eigener Interessenlage sitzen bereits wie die Geier auf den umstehenden Bäumen und wetzen die Schnäbel. Sie alle freuen sich auf die leckere Mahlzeit, die ihnen hier angerichtet wird.
Der größte Hemmschuh und somit auch das umstrittenste Thema im europäischen Einigungsprozess ist der Euro. Sein Sinn oder Unsinn wird allerorten heiß diskutiert, und fragt man die Menschen auf der Straße, so sind sie hin- und hergerissen. Die einen sind strikte Euro-Gegner, die anderen finden ihn eigentlich ganz gut, die richtigen Hintergründe des Euro versteht niemand so recht, und das macht es schwer, eine klare Position zu beziehen. Folglich ranken sich viele Mythen und Behauptungen um jenen Euro. Wenn man die aktuellen Entwicklungen in Europa verstehen möchte, ist es ungeheuer wichtig, die Zusammenhänge des Euro zu kennen.
Aber der Reihe nach, und dazu beginnen wir am besten ganz vorne.
Als vor 13,7 Milliarden Jahren der Urknall … Stopp! Ganz so weit vorne zu beginnen würde dann doch die Kapazitäten dieses Buches sprengen, obwohl wir uns ja eigentlich schon an diese astronomischen Zahlen gewöhnt haben. Also spulen wir vor auf das Jahr 1989 nach Christus. Eine sensationelle Situation hatte sich ergeben. Der Kalte Krieg war gewonnen, das sowjetische Imperium zog sich immer weiter auf sein Kerngebiet zurück, und als Nebenprodukt ergab sich die historische Chance, einen dunklen Fleck vom ach so schmuddeligen Kleid der deutschen Geschichte zu entfernen. Für einen kurzen Moment öffnete sich ein Zeitfenster, und es bestand die einmalige Gelegenheit, die jahrzehntelange gewaltsame und künstliche Aufteilung eines Volkes rückgängig zu machen. Die deutsche Teilung konnte aufgehoben werden. Die Wiedervereinigung war zum Greifen nahe. Die Sowjets, die diese Teilung zu verantworten hatten, waren einverstanden. Wir lagen uns am Brandenburger Tor in den Armen, begrüßten hupend und winkend jeden Trabi, der uns auf der westdeutschen Autobahn begegnete, und waren davon überzeugt, dass die westlichen Alliierten mit ebenso großer Begeisterung und wehenden Fahnen mit uns diese Wiedervereinigung feiern würden. Doch da erlebten wir plötzlich eine schockierende Ernüchterung. Nicht die Sowjets waren der große Hemmschuh, sondern ausgerechnet diejenigen, von denen wir die ganze Zeit annahmen, dass sie in allen Belangen unsere Freunde und Waffenbrüder seien. Die Franzosen stellten sich als der größte Felsblock auf dem Weg zur ersten gesamtdeutschen Fanmeile am Brandenburger Tor heraus. Was mag wohl im Kopf des französischen Präsidenten Mitterrand vorgegangen sein, als der amerikanische Präsident Ronald Reagan am 12. Juni 1987 in seiner legendären Rede vor dem Brandenburger Tor rief: »Mr. Gorbachev, come here to this gate! Mr. Gorbachev, open this gate! Mr. Gorbachev, tear down this wall!«
Mag er gedacht haben: Um Gottes willen! Nur das nicht!? – Wir werden es wohl nie erfahren. Was sich aber dann in den Verhandlungstagen um die deutsche Wiedervereinigung abspielte, das erfahren wir inzwischen durch Zeitzeugen, die damals dabei waren und heute – mit entsprechendem zeitlichem Abstand – freier reden können.
Die Regierungen Frankreichs und Großbritanniens waren keineswegs begeistert von einer deutschen Wiedervereinigung. Die damalige britische Regierungschefin Margaret Thatcher, die »Eiserne Lady«, erklärte, dass Deutschland seit den Zeiten Bismarcks ein unberechenbarer Faktor in Europa sei und ein wiedervereinigtes Deutschland erneute Risiken für ein friedliches Europa mit sich brächte. Sie wird zitiert mit den Worten: »Wir haben Deutschland zweimal besiegt, und jetzt sind sie schon wieder da!« Erst das klare Bekenntnis der USA zu einem einzigen Deutschland hat Großbritannien am Ende einlenken lassen, um es sich mit dem großen Bruder nicht zu verscherzen. Für die USA war eine Erweiterung der NATO und der eigenen Einflusssphäre in Richtung Moskau eine zu verlockende Aussicht, als dass man all das innereuropäischen Bedenkenträgern hätte überlassen dürfen. Zu diesen Bedenkenträgern gehörten in vorderster Front eben auch unsere direkten Nachbarn, die Franzosen. Wenige Jahrzehnte nach Ende des Zweiten Weltkriegs war das Misstrauen gegen den einstigen Erzfeind trotz aller Waldspaziergänge und Saumagenessen mit dem »großen und bekennenden Europäer« Helmut Kohl längst noch nicht ausgeräumt. Es wird der lange zuvor vom französischen Literaturnobelpreisträgers François Mauriac geprägte Satz überliefert, der die Befindlichkeit vieler Franzosen und anderer Europäer in jenen Tagen nur zu gut wiedergibt: »Ich liebe Deutschland. Ich liebe es so sehr, dass ich zufrieden bin, dass es zwei davon gibt.«
Nach den dramatischen und sich überschlagenden Ereignissen um den Mauerfall 1989, von dem jeder gleichermaßen überrascht war, folgten in den kommenden Monaten die Gespräche und Verhandlungen über die weitere politische Entwicklung Deutschlands. Da hier viele internationale Interessen eingebunden waren, liefen die wichtigsten Verhandlungen in den sogenannten Zwei-plus-Vier-Gesprächen ab. Hier saßen die beiden deutschen Staaten (Bundesrepublik Deutschland + Deutsche Demokratische Republik) und die vier Siegermächte des Zweiten Weltkriegs (Sowjetunion, USA, Frankreich und Großbritannien) mit am Tisch. Als sich auch noch Italien und die Niederlande mit einmischen wollten, soll der heute legendäre Außenminister Hans-Dietrich Genscher (genau, der mit dem gelben Pullunder) seinen niederländischen Amtskollegen mit den Worten »You are not part of the game« (ihr seid nicht Teil des Spiels) aus den Gesprächen ausgeschlossen haben.
Die Franzosen bestanden am Ende darauf, einer Wiedervereinigung der beiden deutschen Staaten nur zuzustimmen, wenn Deutschland sich für alle Zeiten und unwiderruflich in das europäische Haus integrieren würde. Dazu fand Kohl sich bereit. Er war schon früh ein Verfechter einer echten europäischen Union: eines Verbunds mit gemeinsamer Außen- und Finanzpolitik und in vielen Punkten aneinander angepassten Systemen. Doch das war den Franzosen wieder zu viel Gekuschel. Schließlich sollte sich ja niemand über Gebühr in die inneren Angelegenheiten der Grande Nation einmischen. Für Frankreich gab es nur eine Lösung: eine gemeinsame Währung, den Euro – aber das bitte ohne politische Mitsprache. Dass so etwas von vornherein zum Scheitern verurteilt sein muss, dürfte jedem klar sein, der sich ein wenig mit den wirtschaftlichen Zusammenhängen beschäftigt, zu denen wir im Laufe der nächsten Seiten noch kommen werden. Man muss schon Traumtänzer oder Politiker sein, um ein solches Konstrukt für sinnvoll zu erachten. Vermutlich genügt auch das noch nicht, und man braucht einen politischen Traumtänzer dafür. Es gab nämlich sehr wohl Politiker, die diese drohenden Konsequenzen realistisch heraufziehen sahen. Ebenjener Helmut Kohl war gezwungen, sehenden Auges eine Entscheidung mit langfristig katastrophalen Folgen zu treffen. Dass er sich über die Folgen einer zu frühen Währungsunion im Klaren war, zeigt noch Monate nach Inkrafttreten des Zwei-plus-Vier-Vertrags seine Rede im Deutschen Bundestag vom 6. November 1991:
»Man kann dies nicht oft genug sagen. Die Politische Union ist das unerlässliche Gegenstück zur Wirtschafts- und Währungsunion. Die jüngere Geschichte, und zwar nicht nur die Deutschlands, lehrt uns, dass die Vorstellung, man könne eine Wirtschafts- und Währungsunion ohne Politische Union auf Dauer erhalten, abwegig ist.«
Doch Kohl fand damit kaum Gehör. Mitterrand bestand auf seinen Bedingungen: »Ihr bekommt die Wiedervereinigung nur, wenn ihr auf die D-Mark verzichtet.«
Kohl befand sich nun vor der schweren Entscheidung: Wiedervereinigung und dafür die Deutsche Mark aufgeben oder auf die Mark bestehen und die Wiedervereinigung gefährden.
Wir alle wissen, wie er sich entschieden hat.
Vermutlich hätten wir weit höhere Preise für diese Wiedervereinigung bezahlt, weswegen es auch müßig ist, über diesen Konstruktionsfehler aus längst vergangenen Tagen zu streiten. Umso mehr verwundert es aber, dass immer wieder der eine oder andere Politiker diesen Zusammenhang zwischen Euro und Wiedervereinigung bestreitet – aus welchen Gründen auch immer.
Wer aber noch auf eine endgültige Bestätigung dieser Verkettung von offizieller Seite wartete, der bekam sie im August 2011, als sich Robert Zoellick während einer öffentlichen Rede im australischen Sydney in bis dato so noch nicht gehörter Klarheit dazu äußerte. Robert Zoellick war von 2007 bis 2012 Präsident der Weltbank. Viel interessanter für uns ist jedoch seine Rolle als Chefunterhändler der USA während der Zwei-plus-Vier-Gespräche, in denen die deutsche Wiedervereinigung ausgehandelt wurde. 1992 wurde er dafür von Bundespräsident Richard von Weizsäcker mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet. Der Mann sollte also wissen, was damals wirklich gesprochen wurde, er war ja schließlich dabei.
Zoellick erklärte, es gebe keinen Zweifel daran, dass der Euro das Ergebnis der deutsch-französischen Spannungen im Vorfeld der Wiedervereinigung war mit dem Ziel, Mitterrands Sorgen vor einem allzu mächtigen Deutschland zu zerstreuen. Nach Zoellicks Worten war der Euro ganz offenkundig ein Beiprodukt der deutschen Wiedervereinigung. »Es war sehr klar, dass die europäische Einheitswährung aus den französisch-deutschen Spannungen vor der Wiedervereinigung resultierte und dazu gedacht war, Mitterrands Angst vor einem allzu mächtigen Deutschland zu beruhigen.« Im persönlichen Gespräch bestätigte mir ein damals beteiligter Minister, dass es genau so war. »Sie werden darüber jedoch niemals ein Dokument finden, denn es gab keines. Es war ein Versprechen zweier Staatsmänner, auf dessen Einhaltung auf diplomatischer Ebene Verlass ist.«
Natürlich hatte Helmut Kohl gehofft, dass in den folgenden Jahren noch die so dringend notwendige politische Union folgen würde, bevor die Zerreißkräfte durchschlügen, die eine falsche Währung erzeugt. Dass also die Menschen und ihre Staaten enger zusammenrücken würden, wenn sie erst einmal eine gemeinsame Währung hätten. Aber hier hegte Kohl eine falsche Hoffnung, und es zeigte sich einmal mehr, dass die Politik, solange es irgend geht, den bequemsten Weg wählt. Und diesen bequemen Weg haben die europäischen Politiker mit Wonne gewählt.
Der Euro an sich ist gar nicht das Problem, das Problem bestand von Anfang an in einer völlig falschen Reihenfolge in der Konstruktion »Gemeinsames Europa«. Erst hätte die politische und steuerliche Einigung erfolgen müssen und dann, als Schlussstein im europäischen Haus, der Euro als gemeinsame Währung und Symbol eines einigen Europa. Der Schlussstein im Torbogen hält die gesamte zuvor gebaute Konstruktion zusammen. Setzt man diesen gewölbten Schlussstein jedoch in das Fundament des Bogens ein, wird das ganze Bauwerk misslingen und einstürzen.
Es war nicht nur Helmut Kohl, der diesen großen Konstruktionsfehler erkannte. Viele namhafte Ökonomen haben in jenen Gründungsjahren des Euro eindringlich vor den langfristigen Folgen einer verfrühten Währungsunion gewarnt. Hans-Werner Sinn führt in seinem Buch »Die Target-Falle« hierzu den damaligen Bundesbankpräsidenten Hans Tietmeyer, aber auch Ökonomen wie Milton Friedman, Martin Feldstein und Joachim Starbatty an. Sinn zitiert den Soziologen Ralf Dahrendorf mit den Worten: »Die Währungsunion ist ein großer Irrtum, ein abenteuerliches, waghalsiges und verfehltes Ziel, das Europa nicht eint, sondern spaltet.« Das war 1995. Welch hellsichtige Einschätzung. 1998 gab es einen öffentlichen Aufruf von 155 Ökonomen gegen diese viel zu frühe Einführung des Euro. Sie wurden von den Politikern ebenso arrogant beiseitegewischt wie ein Vorstoß im Sommer 2012, als sich Sinn im Verbund mit weiteren 160 Wirtschaftswissenschaftlern gegen die aktuelle Eurokrisen-Politik aussprach. Möglicherweise wird man auch ihnen in zehn Jahren recht geben, und dann wird ebenfalls wieder jeder von sich behaupten, es gewusst zu haben. Eine Entschuldigung bei den Geschmähten und der Lächerlichkeit preisgegebenen Männern, die nichts anderes taten, als die Situation richtig einzuschätzen und dies kundzutun, erwartet man bis heute vergebens.
Man mag sagen, dass es am Ende doch gar keine Rolle spielt, wo dieser Euro seinen geschichtlichen Ursprung hat. Wir haben ihn jetzt nun mal an der Backe kleben und müssen sehen, wie wir damit klarkommen. Ich denke jedoch, dass es sehr wichtig ist, zu erkennen, dass die Gemeinschaftswährung keine kluge Entscheidung von Wirtschaftsexperten oder Finanzwissenschaftlern war, sondern das genaue Gegenteil. Die Politik hat sich über den wirtschaftlichen Sachverstand hinweggesetzt. Wie immer, wenn so etwas geschieht, führt das über kurz oder lang zu wirtschaftlichen Verwerfungen und Schmerzen für die Gesellschaft.
Doch wenn eine politische Entscheidung einmal gefällt ist, dann genügen aller Sachverstand und alle Logik nicht, um diesen falschen Weg zu beenden. Erst die offensichtliche und nicht mehr zu verdrängende Katastrophe führt zu überraschtem Entsetzen und hektischer Aktivität, wobei die Politik so lange wie möglich versucht, keine Fehler einzugestehen und sich irgendwie aus dieser Misere herauszuwurschteln. Manch ein Vertreter der Zunft nimmt sich da sogar gerne die Kinder auf dem Spielplatz als Vorbild, hält sich die Augen zu und ruft: »Wenn ich dich nicht sehe, siehst du mich auch nicht!« In Politikersprache übersetzt heißt das dann: »Eurokrise? Welche Eurokrise? Es gibt keine Eurokrise!« So geäußert von Italiens Ex-Präsident Mario Monti, Bundeskanzlerin Angela Merkel, EZB-Direktoriumsmitglied Jörg Asmussen und so weiter.
Bei einer solchen Herangehensweise ist klar, dass man von den Entwicklungen völlig überrascht wird. Das führt zu so ulkigen Einschätzungen wie: »Der Euro hat zehn Jahre toll funktioniert, und so plötzlich wie unerwartet kommen hier Probleme auf, an denen nur die Banken und die Ratingagenturen schuld sind.« Aber schauen wir doch mal, wo das Kernproblem der gemeinsamen Währung liegt.
Jede Wirtschaftsregion (Region mit gemeinschaftlichen Regeln und Zusammenarbeit) braucht die Währung, die zu seiner Leistungsfähigkeit passt. Ansonsten führt es zu schweren Problemen. Was in diesen beiden Sätzen so schrecklich abstrakt klingt, ließ sich wunderbar in einem kleinen realen Experiment an unserer deutschen Südgrenze beobachten. Im Jahr 2008 stand der Euro bei 1,60 Schweizer Franken. Das bedeutet, man musste für einen Euro genau einen Franken und 60 Rappen berappen. In den zehn Jahren zuvor pendelte dieser Wechselkurs gemächlich zwischen 1,45 und 1,70. Die Schweizer Wirtschaft entwickelte sich prächtig, und der Export (vornehmlich in die Eurozone) lief glänzend. Doch Ende 2008, Anfang 2009 fingen die Menschen in der Eurozone an, ihrer Währung zu misstrauen. Wie immer in solchen Zeiten sucht man nach Sicherheit, und dann fällt einem sogleich die Trutzburg in den Alpen ein. Die politisch stabile Schweiz mit den sicheren Banken und den vertrauenerweckenden Fränkli, seit vielen Jahrzehnten Inbegriff der Stabilität. In der Folge kauften viele EUROpäer jene Franken und gaben dafür nur allzu gerne ihre Euros her. Wie immer, wenn viele das Gleiche wollen, steigt der Preis. Der Franken wurde immer beliebter und somit immer teurer. Man bekam für einen Euro nur noch 1,40 SFr. (Schweizer Franken), im Jahr 2010 noch 1,30 SFr.
2011 brachen schließlich alle Dämme. Die Flucht in den Schweizer Franken wurde zur Massenbewegung. Inzwischen verschoben die Griechen riesige Summen in die Alpen, um sich vor einer möglichen Zwangsumstellung auf die Griechische Drachme zu schützen. Auch hier bemühen wir wieder ein Bild vom Kinderspielplatz. Sie kennen diese Wippbalken, die wie eine große Waage funktionieren. Geht es mit dem einen Balkenende nach oben, geht es für den anderen nach unten. Der Euro stürzte ab, und der Schweizer Franken schoss durch die Decke. Diese Decke erreichte er für wenige Tage im August 2011, als es für einen Euro nur noch einen Schweizer Franken gab. An der Börse nennt man diese Situation Parität – Gleichstand. Was aber beim Fußball für eine versöhnliche Feier beider Mannschaften führt, hatte für die Schweizer Wirtschaft schwerwiegende Folgen.
Dazu wechseln wir kurz auf die andere Seite des Bodensees und versetzen uns in die Lage eines Eidgenossen. Vor einem Jahr hätte er für einen BMW in Deutschland noch 75000 SFr. bezahlt. Plötzlich erzählt ihm sein Nachbar, dass es durch den günstigen Wechselkurs in Deutschland jetzt den gleichen Wagen für 50000 SFr. gibt. Die Hausfrau erfährt beim Kaffeeklatsch, es gebe wenige Kilometer entfernt das Toastbrot für einen Franken statt für 1,50 SFr. wie bisher, und überhaupt seien alle Einkäufe um ein Drittel billiger geworden, wenn man nur über die Grenze zu den Deutschen fahre. Nicht nur die schwäbische Hausfrau wird hier schwach, sondern auch der Eidgenosse, und so war im beschaulichen Städtchen Konstanz am Bodensee plötzlich der Wahnsinn ausgebrochen. Die Schweizer kamen in Horden über die Grenze, so dass sich manch einer an die Szenen bei der Maueröffnung in Berlin erinnert fühlte. Aber die Schweizer wollten kein Begrüßungsgeld, sie brachten jede Menge Geld mit und wollten Waren. In Konstanz waren plötzlich nicht nur Parkplätze knapp, sondern auch Windeln. Das Einkaufszentrum Lago berichtet, dass die 700 Parkplätze längst nicht mehr ausreichen, man habe Extra-Parkflächen eröffnet. An den leeren Regalen hängen Schilder mit der Aufschrift: »Liebe Kunden, leider haben wir heute keine Pampers mehr für Sie auf Lager«. Autohäuser stellen zusätzliches Personal ein, um die Schweizer Kunden zu bedienen. Ob Fremdsprachenkenntnisse in Schwyzerdütsch vorausgesetzt wurden, ist nicht überliefert.
Hier konnten wir sehr anschaulich ein volkswirtschaftliches Phänomen beobachten, das zum Verständnis der Eurokrise (ja, es gibt eine! ;-) ) sehr hilfreich ist. Wenn sich die Währungsverhältnisse verschieben, verschieben sich sofort auch die Warenströme. Hier konnten wir diese Warenströme live vor der Kamera beobachten. Wir sahen, wie sich die Karawane an Autos mit Schweizer Kennzeichen und dem Handschuhfach voller Fränkli nach Deutschland schob. Wir sahen Hausfrauen, bepackt mit Einkaufstüten, die ihre erworbenen Schätze über den Grenzübergang Konstanz nach Hause in die Schweiz bewegten, während die Schweizer Franken aus der Alpenrepublik nach Deutschland wanderten. Im wahrsten Sinne des Wortes eine Krötenwanderung der ganz besonderen Art. Denn auf der anderen Seite des Schlagbaums sah man die Kehrseite der Medaille. Dem Jubel der deutschen Einzelhändler stand hier das Wehklagen der Schweizer Gewerbetreibenden gegenüber. Bei Aldi Suisse herrscht gähnende Leere, nur eine Kasse ist besetzt, und über den Parkplatz bewegen sich bestenfalls die Eichhörnchen.
So etwas passiert überall dort auf der Welt, wo sich die Währungen auf unnatürliche Weise stark verändern. Denn die Aufwertung des Schweizer Frankens war ja keine Folge einer explodierenden Wirtschaftskraft des Alpenstaates, sondern passierte durch die künstliche Nachfrage nach Franken durch die Europäer, die ihrer eigenen Währung nicht mehr vertrauten. Normalerweise kann man derlei Verschiebungen der Warenströme nicht so herrlich anschaulich beobachten. Sie geschehen viel mehr still und heimlich per Mausklick oder telefonischem Großauftrag zwischen Unternehmen, die plötzlich ihre Bestellung in einem anderen Land tätigen. Erst am Jahresende erkennen die Wirtschaftsfachleute an den langweiligen Handelsbilanzen, welche Auswirkungen die veränderten Währungen hatten.
Der Aufschwung beim deutschen Einzelhandel hatte, wie beobachtet, katastrophale Auswirkungen auf die Schweizer Einzelhändler. Aber nicht nur auf die. Auch die Schweizer Exportindustrie hatte plötzlich größte Probleme mit ihren Absätzen. Für einen Deutschen oder Franzosen kostete die Schweizer Nobeluhr jetzt schlagartig 10000 Euro statt bis eben noch 6700 Euro. Ähnliche Preissprünge trafen die Schweizer Taschenmesser, die Schoggi und viele andere Produkte im Hightech-Bereich. Die Exporte der Schweiz gingen dramatisch zurück. Der Tourismus hatte größte Umsatzeinbußen. Die EUROpäer konnten sich die Schweiz einfach nicht mehr leisten. Ein Abendessen für zwei Erwachsene und zwei Kinder kam ohne überschwenglichen Luxus bei 300 bis 400 Euro zum Stehen. Selbst die Schweizer bevorzugten das Skifahren in Österreich, weil es dort aufgrund des Wechselkurses so schön billig war.
Doch auf deutscher Seite herrschte nicht nur Freude über diese Entwicklung. Etliche Hausbesitzer und auch Industrieunternehmen hatten in den Jahren zuvor ein lukratives, aber gefährliches Spiel gespielt. Sie hatten zur Finanzierung ihres Betriebs oder des Einfamilienhauses ein Darlehen in Schweizer Franken aufgenommen. Sie fragen sich, warum? Ich mich auch! Die Rechnung war wohl folgende: Die Zinsen in der Schweiz sind seit vielen Jahren deutlich niedriger als in Deutschland. Das liegt unter anderem daran, dass wegen des Bankgeheimnisses schon immer viel Geld – ob schwarz, ob weiß – in die Schweiz geflossen ist. Und so hatten die Schweizer Banken keine Notwendigkeit, hohe Zinsen zu zahlen, um Geld anzulocken. Es wurde ihnen ja aufgedrängt. Also konnten sie wiederum zu niedrigen Zinssätzen Kredite vergeben. Das hat mancher risikofreudige deutsche Häuslebauer gerne genutzt. Er hat einen Kredit in Schweizer Franken aufgenommen, das Geld in Euro getauscht und sein Traumhaus gebaut. Die 1,5 Prozent Zinsen haben ein besonders prächtiges Häuschen ermöglicht. Aber wehe, wehe, wenn ich auf das Ende sehe. Denn natürlich muss der Häuslebauer der Bank ja Schweizer Franken zurückgeben. Sowohl für die Zinsen als auch für die Rückzahlung seines Kredits. Sein Gehalt erhält er aber in aller Regel in Euro ausbezahlt. Durch die Turbulenzen in der Eurozone verschlechtert sich nun der Wechselkurs, und der Schweizer Franken gewinnt rapide an Wert. Und plötzlich beträgt des Kreditnehmers monatliche Rate nicht mehr 1500, sondern 2250 Euro. Seine Schulden für das Haus liegen zwar immer noch bei 700000 Franken, aber mittlerweile sind das 700000 Euro und nicht, wie noch vor einem Jahr, 476000 Euro. Das Haus wird in dieser Zeit kaum an Wert in entsprechender Größenordnung zugelegt haben, und auch das Euro-Gehalt des Häuslebauers dürfte noch das alte sein. Manch ein Hausbesitzer ward um seinen guten Schlaf gebracht, und auch der eine oder andere Bankvorstand konnte mit sorgenvoller Miene angetroffen werden.
Doch zurück in die Schweiz. Durch eine kurzfristige künstliche Verschiebung der Währungsverhältnisse kam die bislang wirtschaftlich starke Schweiz in große Bedrängnis. Die Schweizerische Nationalbank (SNB) musste auf diese Entwicklung reagieren, und das tat sie mit einem verzweifelten Schritt: Im September 2011 band die Schweiz ihre Währung fix an den Euro. Sie legte den Wechselkurs mit 1,20 SFr. fest. Für einen Euro sollte es ab sofort mindestens 1,20 Franken geben. Wenn der Markt dazu nicht bereit sei, würde eben die SNB jederzeit alle Euros, die ihr angeboten würden, zum Preis von 1,20 Franken kaufen. Wie gesagt, ein extrem gewagter und verzweifelter Schritt der Schweizerischen Nationalbank, mit dem sie bis heute ein sehr großes Risiko eingeht.
Bis zum Herbst 2012 hat die SNB Hunderte Milliarden Euro gekauft und zur Finanzierung Schweizer Franken gedruckt. Die Devisenreserven der Schweiz explodieren auf umgerechnet 418 Milliarden Franken, was 70 Prozent der Schweizer Wirtschaftsleistung entspricht. Wenn der Euro zerbricht, hat die SNB ein massives Bilanzproblem, und die dann ins Blaue hinein erzeugten Schweizer Franken würden zu einer starken Inflation in der Schweiz führen. Ein vergleichbares Phänomen war übrigens bereits 1978 zu beobachten, als die Schweiz für einige Zeit den Franken an die D-Mark koppelte und massiv Franken druckte. Drei Jahre später explodierte daraufhin die Schweizer Inflationsrate, und die Notenbank musste die Zinsen massiv anziehen, um diese Inflation wieder einzufangen. Das hatte zur Folge, dass viele Schweizer ihre Hauskredite nicht mehr bezahlen konnten. Heute macht die SNB den gleichen verzweifelten Schritt, diesmal aber in der Größenordnung XXL.
Und obwohl der Schweizer Staat nur eine vergleichsweise geringe Staatsverschuldung von etwa 40 Prozent des Bruttoinlandsproduktes aufweist, sind seine Bürger wegen spezieller steuerlicher Fehlanreize über beide Ohren verschuldet. Sollte also aufgrund der oben beschriebenen Notmaßnahmen der SNB die Schweiz in zwei Jahren dazu gezwungen sein, die Zinsen deutlich anzuheben, wird es in etlichen Schweizer Privathaushalten zu Heulen und Zähneklappern kommen, und der Schuldnerberater Peter Zwegat kann eine Schweizer Filiale eröffnen. Böse Zungen sprechen bereits vom drohenden Island der Alpen. So weit zur Frage, ob man sein Geld jetzt nicht lieber in der Schweiz anlegen sollte.
Im Übrigen war diese Aktion der SNB zu wesentlichen Teilen mitverantwortlich für die zeitweise negativen Zinsen, die die Bundesrepublik für neu ausgegebene Staatsanleihen »bezahlen« musste. Die Nachfrage nach Bundesanleihen war zeitweise so groß, dass die Zinsen negativ wurden. Wenn man Deutschland Geld geliehen hat, hat man dafür keine Zinsen bekommen, sondern musste sogar noch welche bezahlen. Klingt verrückt? War aber so. So sammelte die Bundesschuldenverwaltung im Januar 2012 3,9 Milliarden Euro durch Herausgabe von Staatsanleihen bei den Anlegern ein. Der Zins lag bei – 0,0122 Prozent. Das bedeutete, dass der deutsche Staat mit der Aufnahme dieses Kredits etwa 244000 Euro verdient hat.
Verrückte Welt! Wo kam diese enorme Nachfrage her? Zu großen Teilen von der Schweizer Nationalbank. Die hatte ja am freien Markt riesige Summen Euro gekauft und dagegen Franken ausgegeben, um den Kurs des Franken zu drücken. Was aber tun mit all den gekauften Euros? Irgendwo sicher anlegen. Die Zinsen waren egal, es musste nur sicher sein. Also kaufte die Schweizer Nationalbank für zig Milliarden Euro deutsche Staatsanleihen und war sogar bereit, eine Parkgebühr in Form von negativen Zinsen zu bezahlen. Sischer ist eben sischer.
Wir sehen also, wie unglaublich wichtig der richtige Wert einer Währung für einen Staat ist. Der Wert der Landeswährung muss unbedingt zur wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit des jeweiligen Landes passen, sonst führt das binnen kürzester Zeit zu großen Verwerfungen.
2012 erklärte der Schweizer Wirtschaftsminister, dass der faire Wert des Schweizer Franken etwa bei 1,30 SFr. pro Euro liege. In der Spitze war der Schweizer Franken also um 23 Prozent zu hoch im Vergleich zur Wirtschaftsleistung. Diese kurzfristige Überbewertung von 23 Prozent führte zu massiven Schwierigkeiten und Turbulenzen in der Schweizer Wirtschaft.
Der griechische Patient und die Wiege der Demokratie
Schwenken wir nun das Auge Saurons auf Griechenland. Die Währungsexperten erklären uns, dass, wenn Griechenland morgen aus dem Euro austreten und eine eigene Währung einführen würde, diese Neue Drachme sofort um etwa 50 Prozent abgewertet werden würde. Ist uns wirklich klar, was diese Aussage bedeutet? Sie besagt, dass die Griechen heute mit einer Währung operieren, die um etwa 100 Prozent über ihrer Leistungsfähigkeit liegt. 23 Prozent kurzfristige Überbewertung reichen aus, die wirtschaftlich starke Schweiz ins Trudeln zu bringen. Jetzt wird klar, was eine jahrelange Überbewertung von 100 Prozent mit der Wirtschaft eines ohnehin schwachbrüstigen Griechenland macht. Mit einer solchen viel zu hohen Währung kann kein Land dieser Erde, und sei es noch so gut aufgestellt, wirtschaftlich überleben. Und genau das ist in Griechenland geschehen. Wenn wir die wirtschaftlichen Entwicklungen Griechenlands und der Türkei übereinanderlegen, stellen wir fest, dass beide bis zur Euro-Einführung nahezu parallel verlaufen sind. Doch mit der Einführung des Euro in Griechenland geschieht etwas Faszinierendes. Die Wirtschaftsleistung der Türkei explodiert geradezu, die der Griechen hinkt dramatisch hinterher. Was war geschehen? Der für Griechenlands schwache Wirtschaftsleistung viel zu hohe Euro machte die griechischen Waren für das Ausland völlig unattraktiv. Es war viel zu teuer, in Griechenland Urlaub zu machen. Ein Espresso am Strand kostete 3 Euro, ein Fischgericht nicht unter 15 Euro. Der gleiche heiße Kaffee war in der Türkei für umgerechnet knapp 1 Euro zu haben, der Fischteller für 5 Euro. Die schwache türkische Lira machte es möglich.
In der Folge buchten viele Sonnenhungrige ihre nächsten Urlaube eben in der Türkei statt in Griechenland. Die gleiche Sonne, das gleiche Meer, der gleiche Strand, die gleichen Altertümer, leckeres Essen, anisbasierte Rachenputzer und gastfreundliche Menschen. Größter Unterschied für den Touristen: fürs gleiche Geld mehr auf dem Teller. Der industriellen Wirtschaft ging es nicht anders. Was in Griechenland über Nacht zu teuer war, hat man gerne in der Türkei eingekauft. Die griechische Währung wertete dramatisch auf, man konnte es ja nicht mehr beeinflussen, und die immer stärkere Produktivität der Deutschen zog den Euro weiter nach oben. Die türkische Lira wertete ab. Da die Türkei aber kein billiges Geld aufgrund niedriger Eurozinsen aufnehmen konnte, war die türkische Regierung weit stärker in der Pflicht, Wirtschaftsreformen voranzutreiben. Sie konnte kaum Wohltaten auf Kredit verschenken. So kam es, dass die türkische Wirtschaftsleistung in den Folgejahren explodierte, die griechische zunächst nur noch von der kreditfinanzierten Binnennachfrage getragen war und schließlich weitgehend zusammenbrach. Am Ende (2011) betrug der griechische Warenexport gerade noch 6,4 Prozent des BIP (Bruttoinlandsprodukt). Zum Vergleich: Der deutsche Warenexport trägt im selben Jahr 33,8 Prozent zum BIP bei. Die größten Unternehmen an der griechischen Börse waren ein Getränkeabfüller und ein Sportwetten-Anbieter. Der Getränkeabfüller hat sich 2012 aufgrund der verfahrenen und unklaren Situation verabschiedet und seinen Firmensitz in die Schweiz verlegt. Bleibt der Sportwetten-Anbieter. Wie nachhaltig ein solches Geschäftsmodell für einen Staat ist, entscheiden Sie bitte selbst.
Die griechischen Unternehmer verzweifelten an dem hohen Wechselkurs und strichen reihenweise die Segel. Der Staat sah keinerlei Veranlassung für Wirtschaftsreformen, um das Land möglicherweise wieder auf Kurs zu bringen. Das richtige Motto wäre gewesen: »Wenn wir schon eine zu schwache Produktivität für diese hohe Währung haben, dann lasst uns versuchen, diese Produktivität zu erhöhen. Wir machen die längst überfälligen Wirtschaftsreformen und flankieren diese mit Konjunkturpaketen, um sie wirksam werden zu lassen.« Das Geld dafür gab es ohnehin zu für griechische Verhältnisse sagenhaft günstigen Zinsbedingungen. Denn mit dem teuren Euro der Deutschen und Franzosen wurden auch deren niedrige Zinssätze ins Land gebracht. Während Griechenland früher völlig selbstverständlich mit Sätzen von 10 bis 15 Prozent leben musste, tauchte nun der Segen in Form von Vier-Prozent-Anleihen auf. Doch hier kommt wieder der – in Griechenland noch stärker ausgeprägte – politische Schlendrian ins Spiel. Statt sich mit unbequemen Reformen und Diskussionen den Tag zu versauen, hat man das billige Geld lieber dazu verwendet, politische Freunde, Verwandte, Bekannte und Wähler mit großzügigsten Wohltaten zu versehen. »Großzügige Wohltaten haben eine jahrtausendealte Tradition in Griechenland« (Running Gag im Radiosender SWR3).
Dass dieses Phänomen kein neues ist, zeigt eine Zustandsbeschreibung Griechenlands aus einer Zeit, in der die griechische Geschichte schon einmal aufs Engste mit der Deutschen verbunden war. So ist es doch faszinierend zu erfahren, dass die griechischen Nationalfarben Weiß-Blau aus Bayern stammen. Das ist kein Witz, sondern schlicht der Tatsache geschuldet, dass 1832 Prinz Otto von Bayern von der griechischen Nationalversammlung zum »König Otto I., von Gottes Gnaden, König von Griechenland« gewählt wurde. Und das war zu jener Zeit durchaus von anderer Bedeutung, als wenn heute Jürgen Drews zum König von Mallorca ernannt wird. Otto brachte seine Farben von der Isar mit, und den Griechen gefielen sie so gut, dass sie noch heute auf jeder Tsatsiki-befleckten Papierserviette zu finden sind.
Aus der Spätphase dieser deutsch-griechischen Liebesgeschichte stammt folgender Bericht, erschienen im »Schlei-Boten« vom 17. Mai 1897:
»Der griechische Staat ist arm, das ist nicht seine Schuld, aber schlimmer als seine Armut ist die schlechte Finanzwirtschaft, die im Land herrscht. Wie die Ministerien auch zusammengesetzt sein mochten, im Geldpunkt haperte es stets. Millionen und Abermillionen, die zur Verwirklichung von großen, dem ganzen Land nützenden Unternehmungen verwendet werden sollten, sind in ganz andere Taschen geflossen als in die von Ingenieuren und Arbeitern, welche die Arbeiten ausführen sollten; so sind beispielsweise bei dem Bau des berüchtigten Kanals von Korinth 80 Millionen spurlos verschwunden … Nach der Abtretung von Thessalien an Griechenland durch die Türkei zum Beginn des vorigen Jahrzehnts bis zur Vermählung des Kronprinzen Konstantin mit der Prinzessin Sophie von Preußen haben die griechischen Finanzminister es verstanden, eine 100-Millionen-Anleihe nach der anderen einzuheimsen; große Bankfirmen im Deutschen Reich, in Frankreich und in England übernahmen bereitwilligst die Vermittlung, und alle diese schönen Beträge, die heute schon zu zwei Dritteln entwertet sind, gehen nun vielleicht ganz und gar verloren, wenn kein ernster Machtanspruch erfolgt.
Das Geld ist in Griechenland direkt verwirtschaftet, denn irgendwelche nennenswerte Verwendung im Landesinteresse ist nicht erfolgt. Auch für militärische Zwecke ist nicht viel übrig geblieben. Man hat die geliehenen Summen in der Hauptsache zur Bestreitung der laufenden Staatsausgaben verwendet, die doch von den Steuerzahlern gedeckt werden müssen. Im modernen Hellas besteht aber der allerliebste Brauch, dass die Anhänger des jeweiligen Ministerpräsidenten und seiner Leute es als ein schönes Vorrecht betrachten, so wenig wie möglich oder, besser noch, gar keine Staatssteuern zu bezahlen. Da Griechenland so ziemlich zwei Ministerien pro Jahr hat, kann man sich nun ausrechnen, wie viel eigentlich von den Steuern, die gezahlt werden sollen, wirklich gezahlt werden. Welche zarte Besorgnis die Minister für ihre Wähler hegen, ergibt die Tatsache, dass jedes Ministerium ohne Besinnen für die Kürzung der Zinsen der ausländischen Besitzer griechischer Staatspapiere gestimmt hat; während sie den inländischen Inhabern weiter gezahlt werden.
Griechenland hat damit renommiert, es würde allen seinen Gläubigern gerecht werden, wenn es Kreta behalten dürfte. Das ist eine Redensart; in einem Griechenland, in welchem der Bazillus des Größenwahns wütet, wird erst recht gestohlen auf Staatskosten. Um der liederlichen Wirtschaft ein Ende zu machen, kann nur eine strenge Finanzkontrolle helfen, denn wenn auch der griechische Staat bettelarm ist, die Griechen sind es weit weniger. Aber auf solche Reformen wird man in Athen schwer, sehr schwer eingehen, denn nur ein starker Druck könnte da helfen. Und wenn auch Deutschland wollte – ob die zunächst meistbeteiligten Mächte England und Frankreich mitmachen würden, ist recht sehr die Frage. Jedenfalls muss aber ernstlich die Angelegenheit im Auge behalten werden, sonst ist alles Geld, welches Griechenland erhalten hat, total verloren. Schonung solchem Staat gegenüber üben zu wollen, ist freilich Torheit, aber die Langmut mehrerer Großmächte gegenüber Griechenland hat tief, unendlich tief blicken lassen.«
Nur die geschwurbelte Ausdrucksweise und das Datum von 1897 erinnern daran, dass diese Zeilen nicht aus der »Süddeutschen Zeitung« vom letzten Montag stammen. Wie sich Geschichte doch wiederholt.
Es fühlt sich natürlich wohlig an – damals wie heute –, sich aus deutscher Sicht entspannt zurückzulehnen und über den Griechen zu schmunzeln. »Ja, ja, der Grieche – der ist nicht wie wir. Klar, den Grillteller beherrscht er wie kein Zweiter, aber mit dem Steuerzahlen hat er’s nicht so. Sind halt ausgekochte Schlitzohren. Den Kretateller zahle ich – wenn er mir noch einen Ouzo drauflegt –, aber dass ich diesen Schlawinern mein teuer Geld nach Athen überweise? So weit kommt’s noch!«
Wir können mit unserer preußischen Staatsergebenheit nicht ansatzweise verstehen, warum in Griechenland die Steueruhren anders ticken. Warum der Staat dort nicht als wichtiges Element des Gemeinwesens, sondern vielmehr als gemeines Wesen gesehen wird, das es an allen Fronten zu meiden gilt. Um hier das deutsch-griechische Verständnis auf eine etwas weitere Basis als nur die gastronomische zu stellen, ist mal wieder ein Blick in die Geschichte nötig. Hier gilt wie kaum woanders die alte Weisheit: »Nur wer die Geschichte kennt, versteht die Gegenwart.«
Es war einmal ein fernes Land in ferner Zeit, in dem eine Wiege stand. In dieser Wiege schrie die frischgeborene Demokratie nach Leibeskräften, wuchs und verbreitete sich über den ganzen europäischen Kontinent.
Das mit der Wiege der Demokratie ist schon ziemlich lange her – so etwa 2500 Jahre. In der Zwischenzeit sind Römer, Slawen, Osmanen, Italiener und Deutsche mehr oder weniger unfreundlich durchs Land gezogen und haben neben der Demokratie gleich noch alle anderen Schätze des Landes mitgenommen. Den Osmanen hat es spätestens seit der Eroberung Konstantinopels 1453 so gut in Griechenland gefallen, dass sie gleich 400 Jahre blieben und sich der vielgerühmten griechischen Gastfreundschaft erfreuten. Das wird selbst dem gutmütigsten Griechen irgendwann zu viel, und so nahmen sich die Osmanen das, was sie nicht freiwillig bekamen, mit der Macht des (Steuer-)Gesetzes von der griechischen Bevölkerung. Dass der Grieche dadurch keine liebevolle Beziehung zu seinem Staatswesen entwickelt, sondern »denen da oben« möglichst viel vorenthält, ihnen bei jeder sich bietenden Gelegenheit den blanken Allerwertesten zeigt und ansonsten zusieht, dass er sich mit seinen Nachbarn und seiner Familie selbst um seine Angelegenheiten kümmert, bevor er beim osmanischen Stadthalter anfragt, ist durchaus nachvollziehbar. Es dauerte mehrere kriegerische Jahrzehnte von 1821 bis 1919, bis man den ungebetenen osmanischen Gast aus dem letzten griechischen Nebenzimmer hinauskomplimentiert hatte. Doch von erholsamen Ruhetagen oder gar harmonievoller Herausbildung von Staatsbürgern konnte keine Rede sein, denn kurz darauf brach der Zweite Weltkrieg aus, und die Deutschen stürmten gemeinsam mit den Italienern die griechischen Theken und benahmen sich wie die Axt im Walde. Schon wieder nahmen sich diese ungebetenen Gäste, was sie kriegen konnten, und gerne noch ein wenig mehr. Statt zu zahlen, wurde auch noch die Kasse geplündert.
Doch weg von der launigen Erzählung hin zu den harten Fakten der griechischen Geschichte, deren Kenntnis unabdingbar ist, um die heutige verfahrene Situation Griechenlands zu verstehen. Nur wer die tragische Geschichte des griechischen Volkes kennt, kann ohne Arroganz nachvollziehen, warum Griechenland, seine Bürger und seine Verwaltung heute genau so sind, wie wir sie erleben, und warum hier Überheblichkeit fehl am Platze ist.
Tatsächlich war die griechische Antike (750 bis 176 v.Chr.) die Wiege der westlichen Kultur und Demokratie (»Herrschaft des Volkes«). In den griechischen Stadtstaaten entstanden besonders ab 500 v.Chr. Herrschaftsformen, in denen die (männlichen) Bürger große Mitsprachemöglichkeiten besaßen. Aristoteles hatte etwa 350 v.Chr. eine sehr bemerkenswerte wesentliche Grundlage der Demokratie definiert: die Freiheit. Die Bürger sollten nicht dauerhaft von anderen beherrscht werden, sondern selbst mal Herrscher, mal Beherrschte sein. Die Ämter, die nicht allzu großes Fachwissen erforderten, wurden nur für kurze Zeit vergeben, dann kam der nächste dran. Beamte wurden per Losverfahren ausgewählt – und das wäre heute in manch einem Land sicherlich auch kein Rückschritt. So sollte es erst gar nicht zur Bildung von Machteliten und Kungelei kommen. Ideen, über die man auch heute durchaus wieder mal nachdenken kann, ob da nicht das eine oder andere Element verlorengegangen ist? Insbesondere in Sachen Freiheit? – Ohne in den Details auf die genauen Entwicklungen und Ausprägungen einzugehen, bleibt festzustellen, dass Griechenland zu Recht als »Wiege der Demokratie« bezeichnet wird.
Doch etwa ab 146