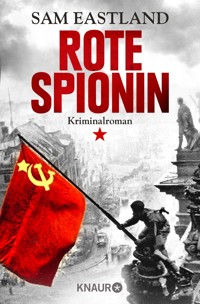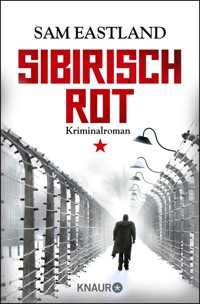
6,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 2,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Knaur eBook
- Kategorie: Krimi
- Serie: Die Inspektor-Pekkala-Serie
- Sprache: Deutsch
September 1939: Inspektor Pekkala bekommt von Stalin einen neuen, höchst unliebsamen Auftrag. Wieder soll er einen Mord aufklären. Doch es ist kein gewöhnliches Verbrechen. Der Mord hat sich in dem gefürchteten sibirischen Straflager Borodok ereignet – wo Pekkala selbst zehn lange Jahre eingesperrt war und Zwangsarbeit verrichten musste. Nun soll er, als Häftling getarnt, dorthin zurück. Ein persönlicher Alptraum, doch ihm bleibt keine Wahl.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 370
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
Sam Eastland
Sibirisch Rot
Kriminalroman
Aus dem Englischen von Karl-Heinz Ebnet
Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.
Über dieses Buch
September 1939: Inspektor Pekkala bekommt von Stalin einen neuen, höchst unliebsamen Auftrag. Wieder soll er einen Mord aufklären. Doch es ist kein gewöhnliches Verbrechen. Der Mord hat sich in dem gefürchteten sibirischen Straflager Borodok ereignet – wo Pekkala selbst zehn lange Jahre eingesperrt war und Zwangsarbeit verrichten musste. Nun soll er, als Häftling getarnt, dorthin zurück. Ein persönlicher Alptraum, doch ihm bleibt keine Wahl.
Inhaltsübersicht
Arbeitslager Borodok
In einer Höhle tief [...]
Poskrjobyschew!« Josef Stalins Stimme [...]
Er wurde von Pferdegetrappel [...]
Und Sie wissen noch, [...]
Nach monatelanger Folter und [...]
Es war Dschugaschwili, der [...]
Klenowkin sah nicht auf, [...]
Pekkala schob sich Ryabows [...]
Pekkala hatte bereits seit [...]
Kirow schloss die Hand [...]
Wassilejew hatte Pekkala rigoros [...]
Ich hätte nicht gedacht, [...]
Die Tür zu seinem [...]
Vier-sieben-vier-fünf!«
Pekkala saß an einem [...]
Nach Tarnowski kamen keine [...]
An einen klaren Wintertag [...]
Jetzt fragte sich Pekkala, [...]
Pekkala und der Zar [...]
Am nächsten Tag tauchte [...]
Es war ein Sonntagnachmittag [...]
Vielleicht hatte Klenowkin doch [...]
Es war Abend.
Draußen im Schacht waren [...]
Tief verborgen unter dem [...]
Leise hörte Pekkala in [...]
Was wirklich in Sibirien geschah
Arbeitslager Borodok
Krasnagoljana-Tal Sibirien September 1939
In einer Höhle tief in der Erde, beleuchtet von der rußenden Flamme einer Kerosinlampe, kniete ein Mann in einer Pfütze. Er hatte die Hände von sich gestreckt, als wollte er die Wassertropfen auffangen, die von den Rissen in der Decke fielen. Er war schwer verwundet, tiefe Schnitte bedeckten Brust und Arme. Das selbstgefertigte Messer, mit dem er sich zu verteidigen versucht hatte, lag hinter ihm, außerhalb seiner Reichweite. Er hatte den Kopf geneigt und starrte verwirrt auf das eigene Spiegelbild in der Pfütze, wie jemand, der sich selbst nicht mehr erkannte.
Vor ihm erstreckte sich der Schatten seines Mörders, der ihn hierhergebracht hatte. »Ich bin gekommen, um dir einen Grund zum Weiterleben zu geben«, sagte der Mörder. »Und so dankst du es mir?«
Mit blutverschmierten Fingern löste der Mann den Knopf seiner Brusttasche und zog eine zerknitterte Fotografie heraus, auf der berittene Soldaten vor einem Waldstück zu sehen waren. Die Männer hatten sich in ihren Sätteln nach vorn gebeugt, sie lächelten in die Kamera.
»Sie waren für mich der Grund, am Leben zu bleiben«, sagte er.
»Und jetzt sind sie der Grund, warum du stirbst.«
Langsam, so, wie sich manche in ihren Träumen bewegen, stellte sich der Mörder hinter den Mann. Und mit einer fast sanften Bewegung griff er nach dessen kurzem, verdrecktem Haar und zwang seinen Kopf in den Nacken, bis die Sehnen am Hals hervortraten. Aus den Falten seiner Kleidung zog er ein Messer, schnitt dem Mann die Kehle durch und hielt ihn dabei wie einen Geliebten im Arm, bis das Herz ausgeblutet war.
Poskrjobyschew!« Josef Stalins Stimme dröhnte durch die Wand.
Im Zimmer nebenan zuckte Stalins Sekretär zusammen. Poskrjobyschew war ein kleiner, rundgesichtiger Mann, kahl bis auf einen grauen Haarkranz. Wie sein Vorgesetzter stopfte er sich die Hosenbeine in die schwarzen Kalbslederstiefel, dazu trug er einen einfachen, bräunlich grünen Waffenrock in genau der Farbe der verfaulenden Äpfel, mit denen er in seiner Kindheit auf dem Weg zur Schule von Ermakow und Schwartz, zwei Rabauken aus der Nachbarschaft, in schöner Regelmäßigkeit beworfen worden war.
Seit dem einen Monat zurückliegenden Kriegsausbruch hatte es viele solcher Wutanfälle des Woschd gegeben, des Führers, wie Poskrjobyschew seinen Vorgesetzten bezeichnete.
Am 1. September 1939 war das Deutsche Reich in Polen eingefallen, wie es im geheimen Zusatzprotokoll zum deutsch-sowjetischen Nichtangriffspakt niedergelegt worden war.
Als Rechtfertigung für den Angriff diente eine Reihe von inszenierten Überfällen auf deutsche Grenzposten, unter anderem auf das deutsche Zollhaus in Hochlinden und den Sender Gleiwitz. Dreizehn Häftlinge aus dem Konzentrationslager Oranienburg waren in der Nacht nach Hochlinden gefahren worden. Dies geschah unter dem Vorwand, an Dreharbeiten für einen Propagandafilm mitzuwirken, der der Verbesserung der deutsch-polnischen Beziehungen dienen sollte. Alle trugen polnische Armeeuniformen, und ihre Aufgabe sollte es sein, irgendwo in den Wäldern an der Grenze ein Treffen zwischen deutschen und polnischen Soldaten nachzustellen.
Die Filmhandlung war simpel. Die beiden einander misstrauisch beäugenden Seiten würden zunächst die Waffen zücken, und einen quälenden Augenblick lang hätte es den Anschein, als würde es zu einem Schusswechsel kommen. Dann aber würde sich die Erkenntnis durchsetzen, dass sie alle doch nur Menschen wären. Sie würden die Waffen wegstecken, sich gegenseitig Zigaretten anbieten, die beiden Patrouillen würden sich verabschieden und schließlich wieder in den Wäldern verschwinden. Den Häftlingen war versprochen worden, dass sie nach Abschluss der Dreharbeiten in die Freiheit entlassen würden.
Vor Hochlinden hielten die Lastwagen an, die Häftlinge teilten sich mit der begleitenden SS-Mannschaft die Essensrationen, dabei wurde auch jedem Häftling, reine Routinemaßnahme, eine Tetanus-Spritze verpasst. Die Spritzen waren aber nicht mit Tetanus-Impfstoff gefüllt, sondern mit Blausäure. Minuten später waren die Häftlinge tot.
Die Leichen wurden wieder auf die Lastwagen geladen, der Konvoi fuhr weiter, schließlich wurden die Leichen im Wald abgeladen, und die SS-Männer gaben Schüsse auf sie ab. Später dienten die Toten als Beweis für einen Angriff polnischer Soldaten auf deutsches Reichsgebiet.
Gleichzeitig drangen unter Führung von SS-Sturmbannführer Naujocks polnischsprachige SS-Leute in das Gebäude des Rundfunksenders Gleiwitz ein, unterbrachen das reguläre Programm und verlasen eine Durchsage, in der sie verkündeten, dass Gleiwitz in polnischer Hand sei.
Am Tag darauf überquerten deutsche Panzereinheiten die polnische Grenze. Stunden später flogen deutsche Flugzeuge erste Luftangriffe.
Zwei Wochen später begann die russische Armee, gemäß dem Molotow-Ribbentrop-Pakt, mit dem Einmarsch in Ostpolen.
Obwohl sich der Zusammenbruch der polnischen Streitkräfte bereits abzeichnete, führten schon kleinste Rückschläge – ein taktisches Ausweichmanöver, ein zeitlich schlecht gewählter Angriff, Nachschubgüter, die den falschen Empfänger erreichten – zu einem Zornesausbruch bei Stalin.
Und Poskrjobyschew war derjenige, der diesen Zorn als Erster abbekam.
»Wo steckt er?«, war Stalins gedämpfte Stimme hinter den geschlossenen Türen zu seinem Arbeitszimmer zu hören. »Poskrjobyschew!«
»Heilige Mutter Gottes!«, murmelte Poskrjobyschew, während ihm Schweißperlen auf die Stirn traten. »Was hab ich jetzt wieder getan?«
Dabei wusste Poskrjobyschew ganz genau, was er getan hatte. Er hatte diesen Augenblick seit langem gefürchtet, und jetzt waren seine Vergehen anscheinend ans Licht gekommen.
Als Poskrjobyschew zu Stalins Privatsekretär ernannt wurde, die höchste Auszeichnung, die sich einer wie er erhoffen konnte, hatte er als Erstes Dokumente zur Deportation der Genossen Schwartz und Ermakow gefälscht, seiner beiden Feinde aus Kindertagen, denen er Rache geschworen hatte. Aufgrund der mit Stalins Faksimileunterschrift unterzeichneten Dokumente wurde die Deportation der beiden Männer, der eine war Elektriker, der andere Dachdecker, nach Archangelsk angeordnet. Dort, am Polarmeer, war mit dem Ausbau des Hafens zu einer modernen Militärbasis für die sowjetische Marine begonnen worden. Bei den auf mehrere Jahre angelegten Bauarbeiten waren die Arbeitskräfte den extremsten Bedingungen ausgesetzt.
Warum solche Dokumente direkt aus Stalins Büro kamen, wagte niemand zu hinterfragen. Darin lag die vollkommene Perfidie von Poskrjobyschews Rache, auf die er dreißig Jahre lang hatte warten müssen.
In den Wochen und Monaten nach der Deportation von Schwartz und Ermakow suchte Poskrjobyschew häufiger das meteorologische Büro im Kreml auf und erkundigte sich nach dem Wetter in Archangelsk. Dreißig Grad unter null. Vierzig Grad unter null. Einmal sogar minus fünfzig Grad. Je schlimmer die Bedingungen, umso überzeugter war Poskrjobyschew, dass es Gerechtigkeit gäbe für Menschen wie ihn, was er damals, als die matschigen, gärenden Äpfel im Dutzend auf ihn niedergeprasselt waren, kaum für möglich gehalten hätte.
Sein Plan war ihm zunächst als narrensicher erschienen, mit der Zeit musste Poskrjobyschew aber einsehen, dass es so etwas wie Sicherheit nicht gab. Schließlich fand er sich mit der Tatsache ab, dass man ihm früher oder später dahinterkommen würde.
Die Doppeltüren flogen auf, und Stalin stürmte ins Vorzimmer.
In seinem alphaften Tagtraum kam es Poskrjobyschew vor, als hätte sich Stalin, der ebenfalls einen bräunlich grünen Waffenrock trug, selbst in einen der fauligen Äpfel verwandelt, mit denen die Genossen Schwartz und Ermakow ihn so zielsicher beworfen hatten.
»Wo steckt er?«, brüllte Stalin. »Wo steckt die boshafte Kanaille?«
»Hier, Genosse Stalin!«, erwiderte Poskrjobyschew mit angstvollem Blick.
Stalin kniff die Augen zusammen. »Was?«
»Ich bin hier, Genosse Stalin!«, schrie Poskrjobyschew in blindem Gehorsam.
»Haben Sie komplett den Verstand verloren?«, entgegnete Stalin, stützte sich mit den Knöcheln auf Poskrjobyschews Schreibtisch und beugte sich so weit vor, dass ihre Gesichter nur noch eine Handbreit auseinander waren. »Ich suche Pekkala!«
»Dann haben Sie ihn gefunden!«, war eine Stimme zu hören.
Poskrjobyschew drehte sich um. In der Vorzimmertür stand ein Mann. Weder er noch Stalin hatten ihn eintreten hören.
Pekkala war groß, breitschultrig, hatte eine gerade Nase und kräftige, weiße Zähne. In seinen kurzen dunklen Haaren waren erste graue Strähnen zu sehen. Er trug einen knielangen, linksgeknöpften Mantel aus schwarzer Wolle mit kurzem Kragen und verdeckter Knopfleiste. Seine ebenso schwarzen, knöchelhohen Stiefel waren doppelt besohlt und auf Hochglanz gewienert. Die Hände hatte er hinter dem Rücken verschränkt, unter dem schweren Mantelstoff zeichnete sich leicht das Schulterhalfter für seinen Revolver ab.
Stalins Zorn verflog ebenso schnell, wie er über ihn gekommen war. Ein Lächeln legte sich auf sein Gesicht, und er kniff die Augen zu schmalen Schlitzen zusammen. »Pekkala!«, knurrte er. »Ich habe Arbeit für Sie.«
Als die beiden Männer in Stalins Büro verschwanden und sich hinter ihnen leise die Tür schloss, hatte die Angst Poskrjobyschew noch so fest im Griff, dass er keinerlei Erleichterung verspürte. Später vielleicht, im Moment aber war er einfach nur froh, tief durchatmen zu können. Dann überkam ihn der überwältigende Wunsch, die Wettervorhersage für Archangelsk zu erfahren.
Stalin saß in seinem lederbezogenen Sessel am Schreibtisch und stopfte sich sorgfältig seine Pfeife mit honigfarbenem Balkantabak.
Es gab keine Sitzgelegenheit auf der anderen Seite des Schreibtisches, weshalb Pekkala im Stehen warten musste, bis der Genosse sein Ritual beendet hatte.
Das einzige Geräusch im Raum war das Ratschen des Streichholzes, dann Stalins rasselnder Atem, als er die Flamme über den Pfeifenkopf hielt und den Tabak anzündete. Nachdem dies vollbracht war, schüttelte er das Streichholz aus und warf es in einen Messingaschenbecher. Süßer Tabakgeruch erfüllte den Raum. Schließlich ergriff Stalin das Wort. »Ich schicke Sie wieder nach Sibirien.«
Pekkala meinte, sich verhört zu haben. Er war so entsetzt, dass er im ersten Moment nichts darauf erwidern konnte.
»Aber nicht als Gefangenen«, fuhr Stalin fort. »Nicht offiziell. In Ihrem alten Arbeitslager, in Borodok, ist ein Mord geschehen.«
»Mit Verlaub, Genosse Stalin, dort geschieht wahrscheinlich jeden Tag ein Mord.«
»Aber dieser hat meine Aufmerksamkeit erregt.« Stalin schien mit dem Aschenbecher beschäftigt und schob ihn von der einen zur anderen Seite des Schreibtisches und dann wieder zurück. »Sie erinnern sich an Oberst Koltschak?«
»Natürlich erinnere ich mich an ihn!«
Stalins Worte trugen Pekkala zurück zu einem trübseligen, verregneten Märzabend im Jahr 1917, kurz vor der Abdankung des Zaren.
Er wurde von Pferdegetrappel auf dem Schotterweg vor seinem Schlafzimmerfenster geweckt. In all den Jahren als Sonderermittler des Zaren hatte Pekkala in einem kleinen Holzhaus in Zarskoje Selo, dem kaiserlichen Dorf außerhalb von Petrograd, gleich in der Nähe der Stallungen gewohnt. Er war an das Geräusch von Pferdehufen gewohnt, wenngleich nicht unbedingt zu dieser Nachtzeit.
Pekkala spähte durch die Vorhänge. Insgesamt drei Fuhrwerke zogen im Dämmerlicht vorbei, jedes davon schwer beladen mit Holzkisten, die mit ihren Griffschlaufen aussahen wie Munitionskisten. Pekkala zählte fünfundzwanzig Kisten auf jedem Wagen.
Bei einem der Fuhrwerke war ein Rad gebrochen, die Ladung war heruntergerutscht. Soldaten waren damit beschäftigt, die Kisten am Wegrand zu stapeln, während andere sich daranmachten, das gebrochene Rad zu entfernen und ein Ersatzrad zu montieren.
Pekkala trat durch die Tür hinaus in die Morgendämmerung.
»Ah, da sind Sie ja!«, hörte er eine Stimme. »Entschuldigen Sie, wenn wir Sie geweckt haben.«
Pekkala drehte sich um. Vor ihm stand ein Mann in maßgeschneiderter Uniform und mit dem leicht o-beinigen Gang eines Kavallerieoffiziers. Er hatte ein hageres, scharfgeschnittenes Gesicht mit gewichstem Schnurrbart.
Pekkala erkannte ihn sofort als Oberst Koltschak, der sowohl aufgrund seiner gesellschaftlichen Stellung im russischen Adel als auch wegen seiner ausgesprochenen Kaltblütigkeit das Wohlwollen des Zaren genoss.
Beim Anblick von Koltschak und den Kisten war Pekkala sofort klar, was hier vor sich ging: Die Revolution hatte begonnen, und das Zarengold wurde an einen sicheren Ort gebracht. Mit der Aufgabe war Oberst Koltschak betraut worden, der in Begleitung von fünfzig eigens dafür ausgewählten Männern den Schatz nach Sibirien schaffen sollte.
Koltschak, wusste Pekkala, hatte den Befehl, der Route der Transsibirischen Eisenbahn zu folgen und sich seinem Onkel Alexander Wassiljewitsch Koltschak anzuschließen, dem Oberbefehlshaber der russischen Schwarzmeerflotte, der die Verantwortung für das Gold übernehmen sollte. Der Admiral war dabei, eine Armee zum Kampf gegen die Bolschewiken aufzustellen. Gerüchten zufolge wollte er die Unabhängigkeit von ganz Sibirien ausrufen.
Der Befehl zum Abtransport des Goldes hätte schon vor Wochen, wenn nicht Monaten erteilt werden sollen. Trotz unübersehbarer Warnsignale hatte Pekkala selbst miterleben müssen, wie die Romanows vor der unmittelbar bevorstehenden Revolution die Augen verschlossen, sie einfach nicht für möglich hatten halten wollen. Jetzt wurde Petrograd von Revolutionsgarden kontrolliert, und es war nur eine Frage der Zeit, bis sie in Zarskoje Selo auftauchten.
»Sie hauen auch ab?«, fragte Koltschak, als er Pekkala die Hand gab.
»Bald«, erwiderte Pekkala. »Ich muss ja nur meine Tasche packen.«
»Sie reisen mit leichtem Gepäck«, sagte Koltschak. Er versuchte sich entspannt zu geben, sein Unmut über die Verzögerung aber war nicht zu überhören.
»Anders als Sie«, erwiderte Pekkala mit Blick auf die Fuhrwerke.
»In der Tat«, seufzte Koltschak. Mit einem scharfen Befehl schickte er die beiden unversehrten Wagen voraus und blieb selbst zurück, um die Reparatur des dritten zu beaufsichtigen.
Es dauerte eine ganze Stunde, bis das gebrochene Rad ausgetauscht war, und als zwei Soldaten die Kisten wieder auf den Wagen luden, riss eine der Griffschlaufen. Die Kiste entglitt ihnen, krachte zu Boden, und die Goldbarren purzelten heraus.
»Verflucht noch mal!«, brüllte Koltschak die Soldaten an. Dann wandte er sich an Pekkala. »Das alles soll ich ans andere Ende des Landes bringen. Aber wie soll ich das schaffen, wenn ich mit den Karren noch nicht mal vom kaiserlichen Anwesen komme?«
»Sie haben noch einiges vor sich«, pflichtete Pekkala ihm bei.
»Was Sie hier sehen, ist der Beweis, dass die Welt, wie wir sie kennen, untergehen wird«, sagte Koltschak unvermittelt. »Männer wie wir müssen jetzt sehen, wie sie überleben.«
Koltschak saß auf, während sich das Fuhrwerk langsam in Bewegung setzte. »Wir müssen uns in Geduld üben«, sagte er zu Pekkala. »Eines Tages werden wir Rache nehmen für alles, was diese Verbrecher mit dem anrichten, was wir lieben. Der Kampf ist noch nicht vorbei, Pekkala.«
Und Sie wissen noch, was aus Koltschaks Unternehmung geworden ist?«, fragte Stalin.
»Ja«, antwortete Pekkala. »Kaum waren er und seine Männer unterwegs, musste Koltschak feststellen, dass ein Informant sie an die Bolschewiken verraten hatte. Die Bolschewiken vermuteten, dass Koltschak die Gebiete erreichen wollte, die unter der Kontrolle seines Onkels standen. Sie schickten daher ihre Kavallerie, um sie abzufangen. Als Koltschak bemerkte, dass er verfolgt wurde, und da die Fuhrwerke mit dem Gold seinen Vormarsch bremsten, beschloss er, das Gold in Kasan zurückzulassen – dort mussten sie auf ihrem Weg nach Sibirien durch. Und dort wurde das Gold später von der Tschechoslowakischen Legion geborgen, die ebenfalls auf dem Weg nach Wladiwostok war.«
Stalin nickte. »Fahren Sie fort.«
»Im Winter 1918 hatte sich die Tschechoslowakische Legion unter dem Kommando von General Gajda mit der Weißen Armee des Admirals vereint. Im Frühjahr 1919 traten sie zur Offensive gegen die roten Streitkräfte an.«
»Aber die Offensive kam zum Erliegen, nicht wahr?«
»Ja«, bestätigte Pekkala, »und im November jenes Jahres musste der Admiral seine Hauptstadt Omsk aufgeben. Den gesamten Winter über waren die tschechoslowakischen und weißen Truppen auf dem Rückzug nach Osten in Richtung Wladiwostok. Dort hofften sie Schiffe zu erreichen, die sie in ihre Heimatländer zurückbrachten. Sie hatten Züge requiriert, unter anderem gepanzerte Waggons, und sind der Strecke der Transsibirischen Eisenbahn gefolgt. Im Januar 1920 waren sie aber immer noch weit von der Küste entfernt, und Admiral Koltschak, der die Ausweglosigkeit seiner Situation einsehen musste, legte sein Kommando nieder. Er stand von da an unter dem ›alliierten Schutz‹ des sechsten Schützenregiments der Tschechoslowakischen Legion, die von General Janin befehligt wurde. Die Tschechoslowaken waren für die Sicherheit des Admirals verantwortlich.«
»Und was geschah dann?«
»Sie wissen, was dann geschah, Genosse Stalin. Warum fragen Sie?«
Stalin hob langsam die Hand. »Tun Sie mir den Gefallen, Pekkala. Was geschah als Nächstes?«
»Gut«, seufzte Pekkala. »Als der tschechoslowakische Konvoi Irkutsk erreichte, wurde er von bewaffneten Mitgliedern der Sozialrevolutionäre gestoppt. Sie forderten die Auslieferung Koltschaks, im Gegenzug durfte die Legion passieren.«
»Und was wollten die Sozialrevolutionäre noch?«
»Gold«, erwiderte Pekkala. »Den Zarenschatz, der noch immer von den Tschechen bewacht wurde.«
»Und was haben sie dann gemacht, diese Tschechen vom sechsten Schützenregiment?«
»Sie haben das Gold und Admiral Koltschak ausgeliefert.«
»Warum?«
»Die Sozialrevolutionäre hatten die Tunnel am Baikalsee vermint. Hätten sie die Tunnel gesprengt, wären die Tschechen nicht mehr durchgekommen. Wenn sie Wladiwostok erreichen wollten, blieb ihnen gar nichts anderes übrig, als Koltschak und das Gold auszuliefern.«
»Und was ist aus Admiral Koltschak, dem Herrscher von Sibirien, geworden?«
»Am 30. Januar 1920 wurde der Admiral von den Bolschewiken exekutiert.«
»Und was ist aus seinem Neffen, dem Oberst, geworden?«
»Die rote Kavallerie hat ihn schließlich eingeholt. Nach dreitägigen Kämpfen haben die letzten Überlebenden, unter ihnen Oberst Koltschak, kapituliert.«
Zu diesem Zeitpunkt war auch Pekkala von den Revolutionsgarden verhaftet worden. Beide Männer landeten im Butyrka-Gefängnis, ohne zu wissen, wo der jeweils andere abgeblieben war.
»Und natürlich«, sagte Stalin, »wissen Sie noch, was in der Butyrka geschehen ist.«
»Ob ich das noch weiß?«, entgegnete Pekkala. »Meinen Sie, ich würde das jemals vergessen?«
Nach monatelanger Folter und Einzelhaft in der alten Festung Butyrka wurde Pekkala von Gefängniswärtern über die steinerne Wendeltreppe in den Keller geführt. Er wusste, dass in diesen Gewölben, in denen früher ein auserlesener Weinkeller untergebracht gewesen war, mittlerweile die Staatsfeinde exekutiert wurden. So rechnete er fest damit, ebenfalls getötet zu werden.
Er war erleichtert, dass seine Qualen damit ein Ende haben würden. Manche Verurteilte wurden sogar schon erschossen, bevor sie unten an der Treppe angelangt waren, um sie endlich zu erlösen – eine Geste, die fast schon an Mitgefühl grenzte. Pekkala hoffte, dass es bei ihm ebenfalls schnell gehen würde. Unten angekommen, wurde er aber von den Wachen in einen Raum gebracht, in dem bereits mehrere Männer waren. Alle trugen die Gymnastiorka und die dunkelblauen Hosen und knielangen Reitstiefel der Angehörigen der Staatssicherheit.
Dazu kam eine weitere Person, eine kaum mehr als Mensch erkennbare Gestalt, die nackt in einer Ecke kauerte. Sein Körper war nicht mehr als eine von elektrischen Verbrennungen und Schlägen traktierte, verunstaltete Masse.
Es war Oberst Koltschak.
Volkskommissar Dschugaschwili, der Mann, der Pekkala seit Wochen verhört hatte, las Koltschak das Urteil vor.
In den letzten Sekunden seines Lebens rief Koltschak Pekkala zu: »Sagen Sie Seiner Exzellenz, dass ich nichts verraten habe.«
Er hatte noch nicht ausgesprochen, als die NKWD-Leute das Feuer eröffneten. Die Schüsse verursachten einen ohrenbetäubenden Lärm in der engen Zelle. Als das Gewehrfeuer endlich eingestellt wurde, trat Dschugaschwili vor, legte auf Koltschaks rechtes Auge an und jagte ihm eine weitere Kugel in den Kopf.
Es war Dschugaschwili, der jetzt vor Pekkala saß. Josef Dschugaschwili, der seinen Namen in Stalin – der Stählerne – geändert hatte, wie es bei den Bolschewiken in den Anfangsjahren üblich gewesen war.
»Sie wissen, Pekkala, dass das Gedächtnis trügerisch sein kann. Sogar Ihres.«
»Was meinen Sie damit?«
Nachdenklich zog Stalin an seiner Pfeife. »Der Mann, den Sie für Oberst Koltschak gehalten haben, der Mann, den ich ebenfalls für Koltschak gehalten habe, war, wie sich herausstellte, ein Betrüger.«
Pekkala war zwar überrascht, das zu hören, aber er wusste, dass es nicht gänzlich abwegig war.
Der Zar selbst hatte ein Dutzend Doppelgänger, die, falls Gefahr drohte, seinen Platz eingenommen und in manchen Fällen dafür mit ihrem Leben bezahlt hatten. So war es nicht unwahrscheinlich, dass jemand, der für den Zaren so wichtig war wie Oberst Koltschak, ebenfalls einen Doppelgänger hatte.
»Was hat das mit dem Mord in Borodok zu tun?«
»Das Opfer heißt Isaak Ryabow, ehemaliger Rittmeister der zaristischen Kavallerie und einer der letzten Überlebenden von Koltschaks Männern, die in Borodok noch inhaftiert waren. Ryabow hat dem Lagerkommandanten den Vorschlag unterbreitet, ihm den Aufenthaltsort von Oberst Koltschak zu verraten, falls er dafür entlassen würde. Aber jemand ist uns zuvorgekommen.«
»Ryabow hat vielleicht gewusst, wo Koltschak sich vor zwanzig Jahren versteckt hat, aber seitdem kann der Oberst doch überall sein. Glauben Sie wirklich, Ryabows Informationen wären noch zutreffend gewesen?«
»Ich kann es mir nicht leisten, diese Möglichkeit grundsätzlich auszuschließen.« Stalin legte die Pfeife in den Aschenbecher auf dem Schreibtisch. Er lehnte sich zurück und faltete die Hände. »Meinen Sie, Oberst Koltschak hat es den Tschechen jemals verziehen, dass sie seinen Onkel ausgeliefert haben?«
»Das bezweifle ich. Soweit ich Koltschak kannte, gehörte Versöhnlichkeit nicht unbedingt zu seinen Tugenden. Im Grunde glaube ich aber, dass den Tschechen keine andere Wahl blieb.«
»Das sehe ich ebenso.« Stalin nickte. »Aber in Oberst Koltschaks Augen war es nun mal Aufgabe der Tschechoslowakischen Legion, seinen Onkel zu schützen – vom Gold ganz zu schweigen. Dass sie dann alle bei der Erfüllung ihrer Pflicht starben, war für jemanden wie Koltschak nebensächlich.«
»Und woher glauben Sie Koltschaks Gedanken zu kennen?«
»Ich kenne sie nicht. Ich sage Ihnen nur, was ich mir an Oberst Koltschaks Stelle gedacht hätte. Und ich sage Ihnen auch, wenn sich jemand wie Koltschak vorgenommen hat, Rache zu üben, dann ist er dafür bereit, die ganze Welt in Flammen aufgehen zu lassen.«
»Aber selbst wenn wir Koltschak finden sollten, dürfte er doch kaum mehr eine Gefahr sein. Er ist doch nur ein Einzelner.«
»Das ist mir kein Trost. Auch ein Einzelner kann sehr gefährlich sein. Ich weiß das, denn ich bin auch nur ein Einzelner, und ich bin sehr gefährlich. Und wenn ich in einem anderen Eigenschaften entdecke, die ich von mir kenne, weiß ich, dass ich das nicht ignorieren darf. Sie und ich, Pekkala, bilden einen seltsamen Bund. In unserem Denken sind wir so ziemlich das Gegenteil des jeweils anderen. Aber wenn es um den Überlebenskampf unseres Landes geht, überschneiden sich unsere Vorstellungen. Das ist der Grund, warum Sie an jenem Tag im Keller des Butyrka-Gefängnisses nicht gestorben sind. Koltschak aber ist nicht wie Sie. Deswegen habe ich ihn zum Tode verurteilt und exekutiert. Oder es jedenfalls versucht.«
»Wenn es nur um Rache an einem Mann geht, den Sie verurteilt haben, aber nicht töten konnten, dann schicken Sie doch Ihre Männer aus, um ihn aufzuspüren. Für mich gibt es andere Fälle, bei denen ich mich als nützlicher erweisen kann.«
»Vielleicht haben Sie recht, aber wenn mich mein Instinkt nicht trügt, stellt Koltschak eine Gefahr für dieses Land dar …«
»Dann werde ich ihn zur Rechenschaft ziehen«, unterbrach Pekkala.
»Und deswegen schicke ich Sie und nicht irgendeinen anderen.« Stalin schob Pekkala Ryabows Akte hin. »Sie führen Ihre Ermittlungen verdeckt durch. Sollte sich unter den Gefangenen in Borodok herumsprechen, dass Sie für das Büro für besondere Operationen arbeiten, werde ich nicht nur Ryabows Mörder, sondern auch Sie verlieren.«
»Möglicherweise ist es nötig, Major Kirow in die Ermittlungen miteinzubeziehen.«
Stalin breitete großmütig die Arme aus. »Verstanden. Auch der Lagerkommandant ist angewiesen worden, Ihnen in jeder erdenklichen Weise behilflich zu sein. Er erwartet Sie mit der Leiche und der Tatwaffe im Lager.«
»Wer hat dort das Sagen?«
»Es ist noch derselbe Lagerkommandant wie damals, als Sie dort waren.«
»Klenowkin?« Pekkala hatte das Bild eines hageren Mannes mit hängenden Schultern und raspelkurzen, schwarzen Haaren vor sich. Er war ihm nur einmal begegnet – bei seiner Einlieferung ins Lager.
Klenowkin sah nicht auf, als der von ihm einbestellte Pekkala sein Büro betrat. »Nimm in meiner Gegenwart die Mütze ab.« Mehr sagte er nicht, bevor er sich daranmachte, Pekkalas Gefangenenakte zu lesen, und dabei sorgfältig die großen gelben Seiten umblätterte, von denen jede in der oberen rechten Ecke mit einem roten diagonalen Streifen versehen war.
Schließlich klappte Klenowkin die Akte zu, hob den Kopf und blinzelte Pekkala durch seine randlose Brille an. »Wir sind alle auf die eine oder andere Art in Ungnade gefallen«, sagte er so laut, als spreche er zu einer ganzen Menschenmenge. »Ich habe deine Akte gelesen, Häftling Pekkala, und sehe, dass du tiefer gefallen bist als die meisten anderen.«
In den ersten Jahren unter der bolschewistischen Herrschaft waren viele nur aufgrund ihrer Treue zu Nikolaus II. in Borodok inhaftiert worden. Allein die Anwesenheit eines Mannes vom Ruf Pekkalas, der als der getreueste Diener des Zaren galt, hätte daher schon zu einem Aufstand im Lager führen können. Klenowkin löste das Problem, indem er Pekkala so weit wie möglich von den anderen Gefangenen fernhielt.
»Du bist wie eine Seuche«, sagte Klenowkin zu Pekkala. »Aber ich werde nicht zulassen, dass du meine Häftlinge ansteckst. Am einfachsten wäre es natürlich, dich erschießen zu lassen, leider ist mir das nicht erlaubt. Man glaubt, aus deiner Existenz noch einen Nutzen ziehen zu können, bevor wir dich in der Versenkung verschwinden lassen.«
Pekkala starrte ihn nur an. Selbst bei den strengen Verhören vor seiner Deportation nach Sibirien hatte er sich nicht so hilflos gefühlt wie in diesem Augenblick.
»Ich werde dich in die Wildnis schicken«, fuhr Klenowkin fort. »Du wirst Baummarkierer im Krasnagoljana-Tal. Das hat bislang noch keiner länger als ein halbes Jahr gemacht.«
»Warum nicht?«
»Weil keiner so lange überlebt hat.«
Baummarkierer arbeiteten allein, abgeschieden von jedem menschlichen Kontakt, ohne jede Hoffnung auf Flucht, und sie starben an Entkräftung, Hunger und Einsamkeit. Wer sich verirrte, wer stürzte und sich ein Bein brach, fiel den Wölfen zum Opfer. Bäume markieren war die einzige Aufgabe im Lager Borodok, die angeblich schlimmer war als die Todesstrafe.
Dreimal im Jahr wurde ihm am Ende eines Holzwegs Proviant geliefert. Kerosin. Dosenfleisch. Nägel. Alles andere musste er sich selbst besorgen. Neben dem Überleben bestand seine einzige Aufgabe darin, mit roter Farbe die Bäume zu markieren, die von den Lagerinsassen gefällt werden konnten. Da Pekkala keinen Pinsel hatte, tauchte er nur die Finger in die scharlachrote Farbe und hinterließ auf den Stämmen den Abdruck seiner Hand. Bis die Holzfäller eintrafen, war Pekkala längst wieder fort. Der rote Handabdruck war das Einzige, was die meisten Lagerinsassen von ihm zu sehen bekamen.
Nur selten wurde er von den Holzfällern gesichtet. Was dann vor ihnen stand, war ein Wesen, das kaum noch als Mensch zu erkennen war. Eine dicke rote Farbkruste bedeckte die Häftlingskleidung, die lange Zottelmähne hing ihm ins Gesicht; er sah aus wie ein gehäutetes wildes Tier, das man zum Sterben zurückgelassen hatte. Gerüchte rankten sich um ihn – er esse Menschenfleisch, er trage einen Brustpanzer aus den Schulterblättern derer, die in den Wäldern verschwunden waren, er habe eine Mütze aus Menschenhaar.
Sie nannten ihn den Mann mit den blutigen Händen.
Als sich im Lager seine wahre Identität allmählich herumsprach, nahm man an, dass er bereits tot war. Aber ein halbes Jahr später war Pekkala zu Klenowkins Überraschung immer noch am Leben. Und er blieb am Leben.
Und als der junge Leutnant Kirow auftauchte, um ihn zum Dienst im Büro für besondere Operationen zu überreden, hatte Pekkala schließlich neun Jahr in den Wäldern gelebt.
Pekkala schob sich Ryabows Akte in den Mantel und wandte sich zum Gehen.
»Eines noch!«
Pekkala drehte sich wieder um. Stalin hob eine kleine Einkaufstasche vom Boden auf und hielt sie Pekkala hin. »Ihre Kleidung für die Reise.«
Pekkala sah hinein und erkannte im ersten Moment nur verdreckte, rosa-graue Lumpen. Dann zog er ein fadenscheiniges pyjamaartiges Hemd heraus, das zur üblichen Häftlingsuniform gehörte. Ein Schauer lief ihm über den Rücken, während er an die Zeit denken musste, in der er solche Kleidung getragen hatte.
In diesem Moment ging die Tür auf, und Poskrjobyschew trat ein. Er machte zwei Schritte, blieb stehen und schlug die Hacken zusammen. »Genosse Stalin, bitte berichten zu dürfen, Polen hat kapituliert.«
Stalin nickte, sagte aber nichts.
»Bitte ebenfalls berichten zu dürfen, die Operation in Katyn hat begonnen«, fuhr Poskrjobyschew fort.
Stalins einzige Erwiderung bestand aus einem zornigen Blick.
»Sie haben mich gebeten …«
»Raus«, sagte Stalin leise.
Poskrjobyschew schlug erneut die Hacken zusammen, drehte sich um, verließ den Raum und schloss mit einem kaum hörbaren Klicken die Doppeltüren hinter sich.
»Operation in Katyn?«, fragte Pekkala.
»Es wäre besser für Sie, wenn Sie es nicht erfahren hätten«, erwiderte Stalin, »aber nachdem Sie es nun schon mal wissen, möchte ich Ihre Frage mit einer Gegenfrage beantworten. Angenommen, Sie wären Offizier in der polnischen Armee, Sie hätten kapituliert und wären gefangengenommen worden. Sagen wir, man behandelt Sie gut. Sie hätten ein Dach über dem Kopf, Sie hätten zu essen.«
»Was wollen Sie wissen, Genosse Stalin?«
»Sagen wir, ich mache Ihnen ein Angebot. Entweder einen Posten in der Roten Armee oder die Möglichkeit, als Zivilist nach Hause zu gehen.«
»Die polnischen Offiziere werden sich dafür entscheiden, nach Hause zurückzukehren«, sagte Pekkala.
»Ja«, erwiderte Stalin. »Die meisten haben das getan.«
»Aber sie werden dort nicht ankommen, nicht wahr?«
»Nein.«
Pekkala konnte die Offiziere in ihren braunen polnischen Armeeuniformen vor sich sehen. Die Hände mit Kupferdraht auf den Rücken gebunden, von NKWD-Leuten an den Rand einer riesigen, im ockerbraunen Waldboden ausgehobenen Grube getrieben, wurde ihnen mit den Gewehrläufen die Mütze vom Kopf gestoßen und ein Schuss in den Nacken verpasst.
Wie viele waren es?, fragte sich Pekkala. Hunderte? Tausende?
Bei Einbruch der Abenddämmerung würde man die Grube, in der die Toten lagen, zuschütten, und ein paar Wochen später würden die ersten zarten Grashalme aus der festgestampften Erde sprießen.
Aber eines wusste Pekkala: Nichts blieb für immer begraben.
»Sie haben meine Frage nicht beantwortet«, sagte Stalin. »Ich habe Sie gefragt, was Sie machen würden.«
»Ich würde erkennen, dass ich keine Wahl habe«, antwortete Pekkala.
Mit einer unwirschen Handbewegung wischte Stalin Pekkalas Worte fort. »Aber ich lasse ihnen doch die Wahl!«
»Nein, Genosse Stalin, das tun Sie nicht.«
Stalin lächelte. »Deshalb haben Sie überlebt, und deshalb werden andere nicht überleben.«
Sobald Pekkala gegangen war, drückte Stalin auf den Knopf der Gegensprechanlage. »Poskrjobyschew!«
»Ja, Genosse Stalin.«
»Alle Nachrichten zwischen Pekkala und Major Kirow werden abgefangen.«
»Natürlich.«
»Was immer Pekkala zu sagen hat, ich möchte es noch vor Kirow erfahren. Nichts bleibt vor mir verborgen!«
»Jawohl, Genosse Stalin«, antwortete Poskrjobyschew. Wieder bekam er feuchte Hände.
Die Gegensprechanlage blieb eingeschaltet, leises Knistern war zu hören. »Gibt’s noch etwas, Poskrjobyschew?«
»Warum gestatten Sie es, dass Pekkala so mit Ihnen redet? So respektlos?« Im Lauf der Jahre hatte sich Poskrjobyschew eine Stellung erarbeitet, die es ihm erlaubte, gegenüber dem Woschd hin und wieder unaufgefordert seine Meinung zu äußern, wenngleich im ehrerbietigsten Ton. Poskrjobyschew zuckte innerlich zusammen, wenn er Pekkala so mit Stalin reden hörte. Noch erstaunlicher war allerdings, dass Stalin Pekkala das durchgehen ließ. Poskrjobyschew war sich sehr wohl im Klaren, dass er durch eine solche Frage seine Grenzen weit überschritten hatte. Wenn er gleich mit einer Flut Unflätigkeiten überschüttet würde, hatte er es sich selbst zuzuschreiben. Aber er wollte es einfach wissen.
»Der Grund, warum ich mir diese Unverschämtheiten bieten lasse, anders als zum Beispiel von Ihnen, Poskrjobyschew, ist der, dass Pekkala der einzige mir bekannte Mensch ist, der mich nicht aus dem Weg räumen würde, um sich an die Spitze des Staates zu stellen.«
»Das, Genosse Stalin, ist keinesfalls wahr!«, entgegnete Poskrjobyschew, obwohl er natürlich ganz genau wusste, dass sein Protest vollkommen überflüssig war. Es zählte einzig und allein, was Stalin glaubte – ob das der Wahrheit entsprach oder nicht, spielte dabei nicht die geringste Rolle.
»Fragen Sie sich doch selbst, Poskrjobyschew. Was würden Sie tun, um an meine Stelle treten zu dürfen?«
Ein Bild huschte Poskrjobyschew durch den Kopf, er sah sich selbst an Stalins Schreibtisch, sah sich Stalins Zigaretten rauchen und seinen Sekretär schikanieren. Und in diesem Moment wusste Poskrjobyschew, dass er trotz aller Treueschwüre Stalin ohne mit der Wimper zu zucken töten würde, wenn sich ihm die Möglichkeit böte, seinen Platz einzunehmen.
Eine Stunde später, die letzten Sonnenstrahlen glitzerten auf den vereisten Telegrafendrähten, bog Pekkalas verbeulter und von seinem Assistenten Major Kirow gesteuerter Emka-Stabswagen bei Kilometer 17 auf der Moskauer Autobahn in einen Eisenbahnbetriebshof ab. Der Betriebshof hatte keinen Namen, er trug lediglich die Bezeichnung V-4, und die einzigen Züge, die von hier abfuhren, waren Gefangenentransporte in die Gulags.
Wie schlimm die Fahrt auch werden würde, Pekkala wusste, dass er als Häftling reisen musste, um seine Tarnung aufrechtzuerhalten. Offiziell hatte er Stalins Gunst verloren und war wegen nicht näher bezeichneter Verbrechen gegen den Staat zu zwanzig Jahren Arbeitslager verurteilt worden.
Major Kirow hielt hinter einigen leeren Güterwaggons, machte den Motor aus und ließ den Blick über den Betriebshof schweifen, wo Gefangene vor den Waggons kauerten, in die sie bald verladen würden.
»Sie können das immer noch abblasen, Inspektor.«
»Sie wissen, dass das nicht möglich ist.«
»Die haben kein Recht, Sie wieder dorthin zu schicken, und sei es auch nur für Ermittlungen.«
»›Die‹ gibt es nicht, Kirow. Der Befehl kam direkt von Stalin.«
»Dann hätte er Ihnen wenigstens noch so viel Zeit geben müssen, damit Sie die relevanten Akten studieren können.«
»Das würde keinen Unterschied machen«, antwortete Pekkala. »Das Dossier des Opfers ist unvollständig und besteht nur aus einer Seite. Alles andere muss irgendwo in den NKWD-Archiven verlorengegangen sein. Ich weiß so gut wie nichts über den Mann, dessen Tod ich untersuchen soll.«
Ein Pfiff der Lokomotive ertönte, die Gefangenen stiegen in die Waggons.
»Es ist so weit«, sagte Pekkala. »Und passen Sie mir auf das hier auf, solange ich fort bin.« Pekkala drückte Kirow eine schwere Goldscheibe in die Hand. Sie war so groß wie ein kleiner Finger, in ihr war eine ovale weiße Emaille-Einlage eingesetzt, die an ihrer breitesten Stelle etwa halb so groß war wie die Goldscheibe. Und in der Mitte des weißen Emaille-Ovals saß ein großer runder Smaragd. Zusammen bildeten sie die unverwechselbare Gestalt eines Auges.
Pekkala hatte bereits seit zwei Jahren als Sonderermittler gearbeitet, als der Zar ihn eines Abends zu sich in den Alexanderpalast beorderte, seiner Residenz in Zarskoje Selo.
Pekkala betrat das Arbeitszimmer des Zaren, der in einem Sessel am Fenster saß. Erleichtert nahm er zur Kenntnis, dass sich der Monarch nicht erhob. Blieb der Zar sitzen, würde das Treffen Pekkalas Erfahrung nach gut verlaufen. Stand der Zar jedoch auf, konnte Pekkala sicher sein, dass gleich ein Zornausbruch folgen würde.
Neben dem Zar stand ein kleiner Tisch, auf dem eine Kerze brannte. Sie war die einzige Lichtquelle im Raum, und in ihrem Schein schien er wie eine Fata Morgana zu schweben.
Der Zar richtete seine sanften blauen Augen auf Pekkala. »Ich habe beschlossen, dass der Titel eines Sonderermittlers der Bedeutung Ihrer Stellung nicht gerecht wird. Es gibt andere Sonderermittler in meiner Polizei, aber keiner davon hat jemals eine Position wie Ihre bekleidet. Mein Großvater hat die Gendarmerie ins Leben gerufen, mein Vater die Ochrana. Aber Sie sind meine Schöpfung, und dafür habe ich ein angemessenes Symbol in Auftrag gegeben.«
Damit präsentierte ihm der Zar das Medaillon, das Pekkala den Namen »Smaragdauge« eintragen sollte.
Der Zar erhob sich, nahm das Abzeichen von dem Samtkissen, auf dem es lag, und steckte es Pekkala unter den rechten Mantelaufschlag. »Als mein persönlicher Ermittler haben Sie bei der Ausübung Ihrer Pflicht absolute Befehlsgewalt. Man wird keinerlei Geheimnisse vor Ihnen haben. Es gibt keine Dokumente, deren Einsicht Ihnen verweigert werden kann. Keine Tür, durch die Sie nicht unangekündigt treten können. Sie können jedes beliebige Transportmittel requirieren, wenn es Ihnen notwendig erscheint. Es steht Ihnen frei, zu kommen und zu gehen, wann und wo es Ihnen beliebt. Sie können jeden verhaften, den Sie eines Verbrechens verdächtigen. Sogar mich.«
»Exzellenz …«
Der Zar brachte ihn mit erhobener Hand zum Schweigen. »Es kann keine Ausnahmen geben, Pekkala. Sonst wäre das alles sinnlos. Ich vertraue Ihnen die Sicherheit dieses Landes und auch mein Leben und das meiner Familie an.« Der Zar hielt inne. »Das bringt uns zu diesem Kästchen.«
Der Zar nahm aus einem großen Mahagonikästchen auf dem Tisch einen Webley-Revolver mit Messinggriff.
»Ein Geschenk meines Vetters George des Fünften.«
Pekkala kannte das Bild der beiden, das an einer Wand im Arbeitszimmer des Zaren hing – der englische König und der russische Zar, zwei der mächtigsten Männer der Welt. Sie sahen sich überaus ähnlich. Gesichtsausdruck, Kopfform, Bart, Mund, Nase und Ohren waren bei beiden auffällig gleich. Nur in den Augen unterschieden sie sich, die des Königs waren runder als die des Zaren.
»Nur zu.« Der Zar hielt ihm die Waffe hin. »Nehmen Sie!«
Der Revolver war schwer, aber gut ausbalanciert. Der Messinggriff lag kalt in Pekkalas Hand. »Eine sehr schöne Waffe, Exzellenz, aber Sie wissen, was ich von Geschenken halte.«
»Wer hat irgendwas von einem Geschenk gesagt? Der Revolver und das Abzeichen sind Ihr Handwerkszeug, Pekkala. Ich gebe sie Ihnen, so, wie ich jedem Soldaten in meiner Armee das gebe, was er zur Ausübung seiner Arbeit benötigt.«
Kirow schloss die Hand um das Abzeichen. »Ich werde bis zu Ihrer Rückkehr darauf aufpassen, Inspektor.«
»Der Webley ist in meiner Schreibtischschublade«, sagte Pekkala. »Obwohl ich weiß, dass Ihnen Ihre Tokarew lieber ist.«
»Sonst kann ich nichts für Sie tun, Inspektor?«
»Doch, vielleicht«, erwiderte er, »aber das werde ich erst wissen, wenn ich in Borodok bin.«
»Wie bleibe ich mit Ihnen in Kontakt?«
»Durch Telegramme über den Lagerkommandanten, Major Klenowkin. Er wird dafür sorgen, dass mich jede Nachricht erreicht.«
Die beiden Männer gaben sich die Hand.
»Dann sehen wir uns wieder auf der anderen Seite«, entrichtete Kirow den traditionellen Abschiedsgruß.
»Das werden wir, Major Kirow, das werden wir.«
Als Pekkala über den Betriebshof in Richtung der Gefangenen ging, wurde er vom Lokomotivführer entdeckt, einem Mann namens Filipp Demidow.
Demidow war der Bruder von Anna Demidowa, einer Hofdame der Zarin Alexandra, die im Juli 1918 zusammen mit der Zarenfamilien von Tscheka-Angehörigen ermordet worden war.
Einige Jahre vor ihrem Tod hatte Anna Demidowa ihrem Bruder eine Anstellung als Chauffeur des Zaren beschaffen können, eine Arbeit, die er bis März 1917 innehatte, als das Personal in Zarskoje Selo entlassen wurde. Unmittelbar darauf fand Demidow eine Stelle bei der staatlichen Eisenbahn, wo er seitdem arbeitete.
Als Chauffeur hatte Demidow Pekkala oft auf dessen Weg zu und von den Treffen mit dem Zaren gesehen, einmal hatte er ihn sogar im Hispano-Suiza Alfonso XIII. nach Petrograd gefahren. Zufällig hatte er einmal neben Pekkala in der Gastwirtschaft gesessen, in der der Inspektor meistens seine Mahlzeiten einnahm, einem einfachen Lokal, wo die Gäste an langen Holztischen aus Steingutschalen aßen.
Demidow mit seinem guten Gedächtnis für Gesichter hatte bei diesen Gelegenheiten den Inspektor eingehend betrachtet. Als er das Smaragdauge jetzt unter den gewöhnlichen Verbrechern erkannte, ignorierte er jedes Risiko, stieg von seiner Lokomotive und kam schnellen Schritts auf Pekkala zu.
»Demidow!«, entfuhr es Pekkala, als er den ehemaligen Chauffeur erkannte.
»Inspektor!«, erwiderte der Lokomotivführer. »Sie müssen sofort mitkommen.«
Pekkala hatte keine Ahnung, was Demidow damit zu erreichen hoffte, aber es war schon zu spät, die letzten Gefangenen waren bereits in die Waggons gestiegen. Er konnte sich nicht mehr unter sie mischen, ohne Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen und seine Tarnung zu gefährden. Also folgte Pekkala Demidow in den Schatten.
»Die Gefangenen in diesem Zug fahren ihrem Tod entgegen.« Demidows heiseres Flüstern schnitt durch die kalte Luft. »Ich kann nicht zulassen, dass mit Ihnen das Gleiche geschieht.«
»Ich kann Ihnen jetzt nicht erklären, warum«, antwortete Pekkala, »aber ich muss unter allen Umständen in diesen Zug.«
Durch Demidow ging ein Ruck, als ihm sein Fehler bewusst wurde. »Mein Gott, was habe ich getan?«
»Nichts, was man nicht wiedergutmachen kann.«
»Inspektor, was immer dazu nötig ist«, sagte Demidow, »betrachten Sie es als erledigt.«
Die Sonne war bereits untergegangen, als sich ETAP-1889 endlich in Bewegung setzte.
Pekkala stand mit Demidow im Führerstand, während das große Zyklopenauge der Lokomotive sich seinen Weg durch die Dunkelheit fräste.
Der Zug bestand aus mehr als fünfzig Waggons. Nach dem von der französischen Armee übernommenen Bauplan konnte jeder Waggon vierzig Männer oder acht Pferde aufnehmen. Die französischen Waggons hatten im Weltkrieg manchmal bis zu sechzig Männer transportiert, in den Waggons von ETAP-1889 aber waren achtzig zusammengepfercht, was bedeutete, dass jeder die zehntägige Fahrt nach Sibirien im Stehen zurücklegen musste.
»Wo ist der nächste Halt?« Pekkala musste schreien, um sich im Dröhnen der Lokomotive verständlich zu machen.
»Nach etwa zehn Kilometern kommt bei Schatura ein Stellwerk, da ist aber eigentlich kein Aufenthalt vorgesehen.«
»Gibt es eine Möglichkeit, trotzdem anzuhalten?«
Demidow dachte einen Augenblick nach. »Ich könnte melden, dass die Bremsen überhitzt sind. Das würde eine Sichtüberprüfung der Räder erforderlich machen, was an die zwanzig Minuten dauert.«
»Gut«, sagte Pekkala. »Mehr brauche ich nicht.«
Der Leiter des Betriebshofs V-4 Edvard Kasinec war über die Ankunft eines besonderen Gefangenen für den Konvoi ETAP-1889 in Kenntnis gesetzt worden. Der Konvoi würde Swerdlowsk, Petropawlowsk und Omsk passieren, sein Ziel war das Krasnagoljana-Tal in Sibirien.
Manchmal betrachtete Kasinec durch die frostbeschlagenen Scheiben seines Büros die Häftlinge, die mit dem Bajonett in die Waggons getrieben wurden und die nichts am Leib trugen als die fadenscheinigen Baumwollsachen, die in der Butyrka und der Lubjanka ausgegeben wurden. Kasinec versuchte manchmal jene herauszufinden, von denen er meinte, sie könnten das ihnen bevorstehende Martyrium überleben. Einige wenige würden sogar eines Tages nach Hause zurückkehren. Mit diesem kleinen Spiel vertrieb er sich hin und wieder die Zeit. Bei Gefangenentransporten zu so weit entfernten Zielen wie dem Krasnagoljana-Tal unterließ er das aber. Diese Männer waren für Lager bestimmt, deren Namen nur hinter vorgehaltener Hand geflüstert wurden. Von ihnen würde keiner zurückkommen.
Es hatte ihn betrübt, als er erfuhr, dass der Sondergefangene kein anderer als Inspektor Pekkala vom Büro für besondere Operationen war. Kasinec konnte sich noch an die Zeiten erinnern, als Pekkala als Privatermittler des Zaren gedient hatte. Die Vorstellung, der berühmte Inspektor würde wie ein gemeiner Verbrecher in einen eiskalten Viehwaggon gepfercht, war für Kasinec nur schwer zu ertragen.
Zigtausende waren auf dem Weg nach Osten hier durchgekommen, und glücklicherweise waren sie für Kasinec nie mehr als eine Nummer gewesen. Hätte er ihre Namen gekannt, hätte er sich an sie erinnern können, und hätte er sich an sie erinnert, wäre er darüber wahrscheinlich wahnsinnig geworden. Den Namen Pekkala würde er allerdings nicht vergessen.
Kasinec hatte Befehl, zu warten, bis Pekkala zugestiegen war, um dann Poskrjobyschew im Kreml per Telegramm zu bestätigen, dass der Gefangene seinen Weg angetreten hatte.
Als Kasinec diese Anweisungen von Poskrjobyschew erhielt, hatte er eingewandt, er sei dem Smaragdauge nie zuvor begegnet. Nur wenige wussten, wie er aussah, da sein Bild nie veröffentlicht worden war.
»Woher soll ich wissen, dass er es ist?«, hatte er gefragt.
Knisternd war Poskrjobyschews Stimme über die Telefonleitung gekommen. »Seine Gefangenennummer lautet 4745.«
Kasinec holte Luft und wollte schon erklären, dass die Nummern auf der dünnen Kleidung oft so verwaschen waren, dass man sie kaum entziffern konnte, aber Stalins Sekretär hatte bereits aufgelegt. Gemäß seinen Befehlen hatte Kasinec daraufhin die Wachen angewiesen, nach dem Gefangenen 4745 Ausschau zu halten und dafür zu sorgen, dass er im sechsten Waggon zustieg.
Kasinec stand selbst auf dem Bahnsteig und ließ den Blick über die Häftlinge schweifen. Keiner von ihnen war Pekkala. Er hielt den Transport so lange zurück, bis das Stellwerk in Schatura anrief und sich nach dem Verbleib des Transports ETAP-1889 erkundigte.
Schließlich gab er den Befehl zur Abfahrt. Und mit stiller Befriedigung teilte er daraufhin Poskrjobyschew in einem Telegramm mit, dass der Gefangene 4745 nicht an Bord des Zuges sei.
Kasinec mutmaßte, dass dafür einige büßen würden, nicht zuletzt er selbst, aber er tröstete sich mit dem Wissen, dass es dem Inspektor erneut geglückt war, dem Schicksal ein Schnippchen zu schlagen.
Vielleicht waren die Geschichten, die er über Pekkala gehört hatte, ja doch wahr – vielleicht war er kein Mensch, sondern eine Art Phantom, das von Grigori Rasputin, einem weiteren übernatürlichen Wesen im Dienst des Zaren, aus der Geisterwelt heraufbeschworen worden war.
Erneut flog die Doppeltür zu Stalins Büro auf, und ein vor Wut bebender Stalin erschien, in der Hand das hauchdünne Papier eines Telegramms. »Diese Meldung ist gerade vom V-4-Betriebshofleiter eingetroffen. Pekkala ist nicht im Zug!«
»Soll ich versuchen, ihn zu finden?« Poskrjobyschew erhob sich zackig.
»Nein! Ich werde mich selbst darum kümmern. Lassen Sie den Wagen vorfahren. Ich muss sofort los. Bringen Sie mir meinen Mantel!«
Poskrjobyschew schlug die Hacken zusammen. »Sofort, Genosse Stalin!«
Kasinec stand auf den Stufen des klapprigen Holzgebäudes, das den hochtrabenden Namen Zentralverwaltung für Gefangenentransporte trug, und paffte an einer Zigarette, als eine Packard-Limousine US-amerikanischer Bauart vorfuhr. Der Schlamm auf der unbefestigten Moskauer Autobahn war in grauschwarzen Bögen über die Motorhaube gespritzt. Für den Betriebshofleiter bekam der Wagen dadurch das Aussehen eines riesigen Raubvogels, der aus den abendlichen Schatten niedergestoßen war, um ihn nun in Stücke zu reißen.