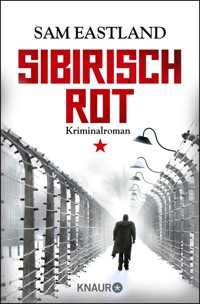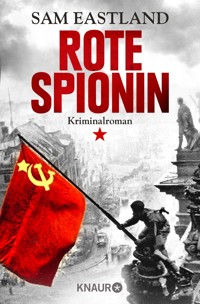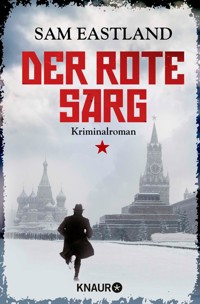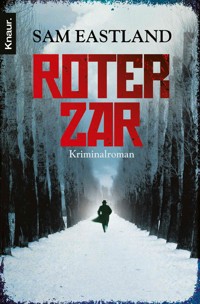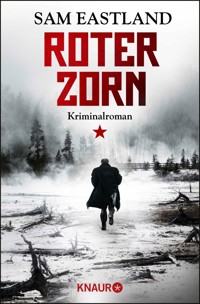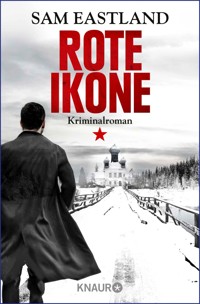
6,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Knaur eBook
- Kategorie: Krimi
- Serie: Die Inspektor-Pekkala-Serie
- Sprache: Deutsch
Der sechste Fall für Inspektor Pekkala – den »James Bond in Diensten Stalins« (Die Welt) – im stalinistischen Russland: ein fesselnder historischer Kriminal-Roman um das Geheimnis des wertvollsten Heiligen-Bildes der russisch-orthodoxen Kirche 1944 machen zwei russische Soldaten im Frontgebiet an der Westgrenze des Reiches einen brisanten Fund. In der Krypta einer Kirche hält das Skelett eines Priesters ein Gemälde in den Händen, das lange Jahre als zerstört galt: den berühmten »Hirten«, religiöses Symbol Russlands. Die Romanows hatten es ihrem Vertrauten Rasputin zur Aufbewahrung übergeben, dem es angeblich gestohlen worden war. Doch was ist damals wirklich mit der Ikone geschehen? Stalin weiß um die Symbolkraft dieses Fundes und beauftragt seinen besten Ermittler, Inspektor Pekkala, dem Geheimnis ohne großes Aufsehen auf den Grund zu gehen. Pekkala kann nicht ahnen, dass bereits ein alter Bekannter auf der Spur des »Hirten« ist, dessen fanatischer Glaube ihn über Leichen gehen lässt. Sam Eastlands Krimi-Reihe um den russischen Inspektor Pekkala bietet hochspannende Unterhaltung für alle historisch interessierten Krimi-Fans. Die Fälle von Inspektor Pekkala sind in folgender Reihenfolge erschienen: • »Roter Zar« • »Der rote Sarg« • »Sibirisch Rot« • »Roter Schmetterling« • »Roter Zorn« • »Rote Ikone«
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 426
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Sam Eastland
Rote Ikone
Kriminalroman
Aus dem Englischen von Karl-Heinz Ebnet
Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.
Über dieses Buch
1944 machen zwei russische Soldaten im Frontgebiet an der Westgrenze des Reiches einen brisanten Fund. In der Krypta einer Kirche hält das Skelett eines Priesters ein Gemälde in den Händen, das lange Jahre als zerstört galt: den berühmten »Hirten«, religiöses Symbol Russlands. Die Romanows hatten es ihrem Vertrauten Rasputin zur Aufbewahrung übergeben, dem es angeblich gestohlen worden war. Doch was ist damals wirklich mit der Ikone geschehen?
Stalin weiß um die Symbolkraft dieses Fundes und beauftragt seinen besten Ermittler, Inspektor Pekkala, dem Geheimnis ohne großes Aufsehen auf den Grund zu gehen. Pekkala kann nicht ahnen, dass bereits ein alter Bekannter auf der Spur des »Hirten« ist, dessen fanatischer Glaube ihn über Leichen gehen lässt.
Inhaltsübersicht
Widmung
2. Februar 1945
2. August 1914
1. Juni 1915
5. Juni 1915
6. Juni 1915
5. Juli 1915
2. Februar 1945
9. Februar 1945
10. Februar 1945
2. Januar 1922
25. Februar 1945
15. Mai 1944
28. Februar 1945
8. März 1945
16. Mai 1944
8. März 1945
11. März 1945
12. März 1945
17. Juni 1921
2. Januar 1922
18. März 1945
24. März 1945
26. März 1945
28. März 1945
23. April 1945
Danksagung
Für Deb
2. Februar 1945
Ahlborn, Deutschland, in der Nähe der Oder, 70 km vor Berlin
Man sieht es den Leuten an, wenn sie vom Glück verlassen werden.«
Hauptmann Antonin Proskurjakow von der 4. Garde-Panzerdivision »Kantemirowskaja« gefiel dieser Spruch. Besonders gern brachte er ihn an, wenn junge Offiziere an der Front eintrafen und er sich daran weiden durfte, wie die Grünschnäbel darauf reagierten. Als dienstältestem Panzerkommandanten der Division, der immer noch am Leben war, haftete seiner Aussage durchaus etwas Prophetisches an.
»Man sieht es an ihrem Blick«, erzählte Proskurjakow also den frischgebackenen Leutnants, die sich nervös ansahen und sich unweigerlich fragten, ob sie jetzt schon vom Pech verfolgt würden.
Jetzt aber, als Hauptmann Proskurjakow das lodernde Wrack seines T-34 betrachtete, musste er sich eingestehen, dass es möglicherweise mit seinem eigenen Glück vorbei war.
Sein Vater, ein ehemaliger zaristischer Offizier im Nischegorodskischen Dragonerregiment, hatte ihm erklärt, dass aller guten und aller schlechten Dinge drei seien. Drei jedenfalls war im Nischegorodskischen Regiment die Zahl der Pferde, die einem Soldaten unterm Hintern weggeschossen werden durften, bevor ihm ein anderer Posten zugewiesen wurde, der nichts mehr mit Pferden zu tun hatte. Dabei spielte es keine Rolle, ob der Soldat selbst etwas für den Tod seine drei Tiere konnte. Es zählte einzig und allein, dass es passiert war.
So war jetzt also der dritte T-34 unter Proskurjakows Kommando zerstört worden, und mit hoher Wahrscheinlichkeit dürfte es auch sein letzter gewesen sein.
Der erste, ein frühes A-Modell, war im Winter 1941 auf einem See in der Nähe von Tscheropowez durchs Eis gebrochen. Obwohl er erwartet hatte, wegen grober Fahrlässigkeit exekutiert oder, im besten Fall, in ein Strafbataillon versetzt zu werden, erfuhr er bald darauf, dass ihm ein neuer Panzer zugewiesen und keinerlei Disziplinarverfahren gegen ihn angestrengt würde. Ihm wurde sogar die Ehrenspange für ausgezeichnete Panzersoldaten und die silberne Medaille »Für Verdienste im Kampf« verliehen, die er sich natürlich sofort an die Uniform heftete.
Sein zweiter Panzer, ein C-Modell, hielt fast ein Jahr lang durch, bevor er in den Außenbezirken von Stalingrad von einem Stuka getroffen wurde. Proskurjakow hatte in einem Schützenloch ganz in der Nähe geschlafen, als er das Sirenengejaule des Sturzkampfbombers hörte, der bereits sein Ziel ansteuerte. Er duckte sich noch mehr in seinen primitiven Unterstand, zog den Kopf ein und biss die Zähne zusammen. Mehr konnte er nicht tun. Und dann, als das Heulen seinen Höhepunkt erreichte, spürte er die gewaltige Detonation der Bombe, die keine zwanzig Meter entfernt genau den Turm des Panzers getroffen hatte. Als er vorsichtig aus seinem Unterstand herausspähte, sah er, wie das Gras am Rand des Schützenlochs Feuer fing.
Als sich Proskurjakow aufrappelte, war der Stuka nur noch ein schwarzer, eine Rauchfahne hinter sich herziehender Punkt am Horizont.
Er und die übrigen Besatzungsmitglieder, die sich während des Angriffs in ihre Löcher gekauert hatten, starrten nur verwundert auf das Wrack ihres 26 Tonnen schweren Gefährts. Der Turm, der allein schon mehr als vier Tonnen wog, war von der Wanne weggesprengt worden und lag umgedreht neben dem Panzer. Bei näherer Betrachtung erkannte Proskurjakow, dass die Bombe nicht nur den Turm ausgehebelt, sondern auch ein badewannengroßes Loch in den Boden des Fahrerplatzes gerissen hatte.
Trotz der finsteren Vorhersagen, die Proskurjakow bezüglich seiner Zukunft ausstieß – so laut, dass es jeder hören konnte –, wurde er keineswegs gemaßregelt. Stattdessen erhielt er eine Belobigung für seine weise Voraussicht, die Besatzung nachts außerhalb des Panzers schlafen zu lassen. Dafür wurden ihm zwei weitere Auszeichnungen verliehen: der Ruhmesorden (zweiter Klasse) und der Rotbannerorden. Zudem wurde ihm das Kommando über einen neuen Panzer übertragen.
Neben der beeindruckenden Ordensreihe, mit der er jetzt in die Schlacht zog, legte sich Proskurjakow auch einige der Macken zu, mit der sich gern jene schmückten, deren Langlebigkeit ihnen eine höhere Stellung einräumte, als ihnen laut Dienstrang und Auszeichnungen eigentlich zustand. Zu diesen Verschrobenheiten gehörte eine schwere Lederjacke. Er hatte sie einem ungarischen Panzersoldaten vom Leib geschält, den er im Winter 1942 steifgefroren im Schneidersitz an einem Baum gelehnt gefunden hatte.
Da es unmöglich war, die starre Leiche zu entkleiden, band Proskurjakow sie kurzerhand hinten auf seinem Panzer fest. Dort verharrte der tote Ungar dann tagelang, ließ sich die tiefen Augenhöhlen zuschneien, hatte die Hände wie ein Buddha im Schoß verschränkt, bis ein Wetterumschwung ihn schließlich auftaute und Proskurjakow sich endlich seiner Trophäe bemächtigen konnte, die er seitdem trug – natürlich zusammen mit seinen Orden.
Am Abend, bevor er seinen dritten Panzer verlor, hatte er festgestellt, dass die Treibstoffpumpe leckte. Er hatte die Erlaubnis erhalten, die nächstgelegene Instandsetzungseinheit anzusteuern, die zehn Kilometer entfernt im Dorf Eberfelden stand.
»Sieht so aus, als müsstest du zu Fuß nach Berlin laufen«, spöttelte ein anderer Panzeroffizier.
»Ich werde erhobenen Hauptes durch die Straßen der Stadt fahren«, erwiderte Proskurjakow empört, »und zwar mit diesem wunderbaren Fahrzeug.«
Jetzt, da die mohnroten Flammen aus den offenen Luken seines T-34 schlugen, musste Proskurjakow wieder an seine großspurige Ankündigung denken.
Bei Tagesanbruch hatte er sich allein mit seinem Fahrer, Feldwebel Owtschinikow, auf den Weg gemacht. Proskurjakow wollte die Sache so schnell wie möglich hinter sich bringen, weil ihm nämlich Fronturlaub gewährt worden war, der erste seit über zwei Jahren. Also wollte er den Schaden reparieren lassen, das Kommando über das Fahrzeug dann Feldwebel Owtschinikow übertragen und selbst auf den ersten Laster aufspringen, der nach Osten in Richtung seiner Heimatstadt Noginsk außerhalb von Moskau bestimmt war.
»Bald«, sagte Proskurjakow seinem Feldwebel und legte die Hand fast liebevoll auf den mattgrünen Stahl des Panzers, »bald wird das alles dein sein.«
Owtschinikow drehte sich um und starrte ihn nur finster an. Sein wettergegerbtes Gesicht hob sich deutlich vom blassen, ungewaschenen Körper unter dem ölverschmierten Blaumann ab. »Das hat der Teufel zu Jesus auch gesagt!«
»Ich weiß«, erwiderte Proskurjakow.
Feldwebel Owtschinikow war ein tiefreligiöser Mensch und flehte bei jeder sich bietenden Gelegenheit um die Gnade Gottes.
Diese Gläubigkeit brachte Proskurjakow hin und wieder auf, manchmal so sehr, dass er das Gefühl hatte, er müsse wahnsinnig werden oder seinen Fahrer erschießen und es Owtschinikows Gott überlassen, was dann deswegen zu tun sei. Nach allem, was er im Krieg gesehen und erlebt hatte, erschien ihm die Vorstellung eines mitfühlenden Gottes aberwitzig. Seiner Meinung nach wurde das Universum nicht von einem launenhaften bärtigen Alten regiert, der sich die Hand an sein verschrumpeltes Ohr hielt, um das leise Gemurmel seiner ihn anbetenden Verehrer zu vernehmen, sondern von einem gewaltigen, gefühllosen Mechanismus, der so unfehlbar war wie eine mathematische Gleichung, deren knifflige Berechnungen dafür sorgten, dass die Welt im Gleichgewicht blieb. Diesen Mechanismus, der mit der unermüdlichen Präzision eines Metronoms ewig hin- und herschwang, hatte sein Vater als Glück bezeichnet, und an diesen Mechanismus schickte Feldwebel Owtschinikow mehrmals am Tag in ärgerlicher Lautstärke also seine lächerlichen Gebete. Der einzige Grund, warum Hauptmann Proskurjakow seinem Fahrer nicht den Hals umdrehte, war die verschwindend geringe Wahrscheinlichkeit, dass er vielleicht doch recht hatte.
Zwei Kilometer vor ihrem Ziel erreichten Proskurjakow und Owtschinikow die ersten Häuser eines Dorfes namens Ahlborn. Es hatte getaut, kurz nur, aber der Schnee war aufgeweicht, und die Straßen der kleinen Ansiedlung versanken im Schlamm. Kaum waren sie im Dorf, als Proskurjakow unter sich einen gewaltigen Knall hörte, gleichzeitig wurde der Panzer auf der rechten Seite wie von einem wütenden Riesen angehoben, um gleich darauf wieder auf den Boden geworfen zu werden. Sofort war ihm klar, dass sie über eine Mine gerollt waren.
Der T-34 wurde um die Längsachse gedreht und kam zum Stehen.
Proskurjakow öffnete die Turmluke, stieg aus und sprang zu Boden. Feldwebel Owtschinikow folgte.
Zusammen inspizierten sie den Schaden.
Es war keine der großen Tellerminen gewesen. Eine solche hätte wahrscheinlich die Wanne durchschlagen, den Innenraum verwüstet und jeden Insassen zerfetzt. Vermutlich also eine Schützenmine, die einem Menschen das Bein unterhalb des Knies abreißen konnte. Aber die Explosion hatte einen Kettenbolzen abgeschert, sodass sich zwei Kettenglieder gelöst hatten und der Panzer in seiner Vorwärtsbewegung von der Kette gefahren war.
Nun lag die Kette wie eine riesige tote Schlange im Straßengraben. Wäre sie auf der Straße liegen geblieben, hätten sie rückwärts auf sie hinauffahren und sie mit einem neuen Bolzen wieder verschließen können. Aber allein schon um die Kette aus dem Graben zu bringen, waren mehr als zwei Männer nötig.
»Wir müssen zu Fuß zur Instandsetzung«, sagte Owtschinikow. »Die können dann einen Panzer schicken, der uns abschleppt.«
Proskurjakow hoffte bloß, dass nicht jener Offizier mit seinem Panzer kam, dem gegenüber er von seiner Fahrt nach Berlin geprahlt hatte.
Also machten sie sich zu Fuß auf den Weg. Sie hatten gerade die Hauptstraße erreicht, die durch das Dorfzentrum führte, als Proskurjakow ein Geräusch hörte – einen Lärm, als würde jemand einen Teppich ausbeuteln. Er fuhr herum. Aus der offenen Luke seines Panzers schlugen Flammen. Sprachlos starrte er auf das Inferno.
Es gab mehrere Möglichkeiten für den Ausbruch des Feuers. Vielleicht hatte ein Schrapnell die Treibstoffleitung zerfetzt. Der Motor könnte sich infolge des Schadens, dessentwegen sie zur Instandsetzung unterwegs waren, überhitzt haben. Egal, jetzt konnten sie jedenfalls nichts mehr dagegen tun. Fing ein Panzer erst mal an zu brennen, hörte er nicht mehr auf, bis nur noch eine verrußte Stahlhülle übrig war.
Über dem Lärm der im Panzerinneren explodierenden MG-Munition – ein Geräusch wie das einer abbrennenden Kette chinesischer Feuerwerksknaller – hörten beide Männer das Rumoren eines sich nähernden Fahrzeugs.
»Wenigstens müssen wir jetzt nicht nach Eberfelden laufen«, sagte Owtschinikow. Er trat auf die Straße und winkte mit beiden Armen.
Bald darauf sahen sie einen Lastwagen in das Dorf fahren, gefolgt von einem kleinen Stabswagen. Wahrscheinlich einer der amerikanischen Jeeps aus dem Leih-und-pacht-Programm, dachte Proskurjakow.
Owtschinikow winkte immer noch, bis ihm das schwarz-weiße Kreuz an der Seitentür des Wagens auffiel. Es war kein Jeep, sondern ein deutscher Kübelwagen. Und der folgende Laster war ein Mercedes-Benz, ein 4,5-Tonner mit aufgesessenen Soldaten.
»Hau ab, du Idiot!«, brüllte Proskurjakow.
Die beiden Männer rannten um ihr Leben.
Nach einem kurzen Sprint in ihrer schweren Kleidung waren die beiden Männer so außer Atem, dass sie in einer kleinen Kirche am Dorfrand Zuflucht suchen mussten. Die Eingangstür war verriegelt, sodass sie über ein Fenster einstiegen. Das Kirchendach, wie sie drinnen feststellten, war eingestürzt, Deckenbalken und Geröll waren auf die Kirchenbänke heruntergestürzt. Seitlich vom Hauptaltar stießen sie auf eine schmale, nach unten führende Treppe. Unten, hinter einer unverschlossenen Eisentür, kamen die Männer in eine Krypta, in deren aus dem weichen, sandfarbenen Fels geschlagenen Nischen Kiefernsärge standen. Dort in der Kälte kauerten sich die Russen schweigend auf den Boden und warteten.
Eine Stunde verging.
»Sie sind bestimmt schon wieder weg«, flüsterte Owtschinikow.
Proskurjakow war das Gleiche durch den Kopf gegangen. Nur der durch den offenen Dachstuhl pfeifende Wind war noch zu hören und das Platschen des Regens, der sich über Ritzen im Holzboden seinen Weg nach unten bahnte und stetig auf den staubigen Kryptaboden tropfte.
Vielleicht haben sie uns gar nicht gesehen, dachte Proskurjakow, aber noch wollte er das Versteck nicht verlassen. »Ich werfe mal einen Blick durch die Ritzen«, sagte er, »aber ich brauche was, worauf ich mich stellen kann.«
Die beiden Männer hoben einen der Särge in den Nischen in die Mitte des Raums.
Proskurjakow zog seine Lederjacke aus und legte sie in der Ecke ab. Dann stieg er ganz vorsichtig auf den Sarg und spähte von unten durch eine der Ritzen im Boden. Alles, was er sehen konnte, waren die zertrümmerten Kirchenbänke und die verstreut liegenden Gebetbücher. »Keiner da«, sagte er mit einem Seufzen. Sogar einer wie Proskurjakow, der sich hartnäckig weigerte, an irgendetwas zu glauben, musste sich eingestehen, dass das Schicksal zu ihren Gunsten eingegriffen hatte.
Das Nächste geschah so schnell, dass es schon wieder vorbei war, bevor Proskurjakow überhaupt wusste, wie ihm geschah. Mit einem lauten, trockenen Knacken brach der Sargdeckel. Der Hauptmann krachte mit einem seiner schweren Stiefel durch das Holz, während er mit dem anderen vom Deckel abrutschte. Der gesamte Sarg kippte zur Seite, und Proskurjakow landete schwer auf dem Boden.
Die nächsten Sekunden lag er nur verdutzt da. Dann schlug er gegen die Holztrümmer, in denen er sich verfangen hatte, bis er Stoffbahnen zerriss und spürte, wie er mit den Fingernägeln über gefrorenes Menschenfleisch kratzte. Mit einem Schrei sprang er auf und wischte sich hektisch über Gesicht und Brust, als müsste er sich eines ihn umschwirrenden Bienenschwarms erwehren.
»Schon gut, Hauptmann«, beruhigte ihn Owtschinikow und versuchte, Proskurjakow den Staub aus den Haaren zu wischen. »Kein Grund zur Aufregung.«
»Ich reg mich doch gar nicht auf!«, blaffte der Hauptmann. »Und hör um Himmels willen auf, an mir rumzufummeln.«
Owtschinikow zündete den Kerzenstumpf an, den er in seiner Tasche immer bei sich hatte, und die beiden Männer richteten ihre Aufmerksamkeit auf den ausgebreiteten Inhalt des Sargs.
»Nur ein Toter«, bemerkte Proskurjakow, bemüht, seinem Gefährten zu zeigen, dass er die Fassung wiedergewonnen hatte. »Sieht so aus, als wäre er das schon eine ganze Weile.«
»Nein.« Feldwebel Owtschinikow deutete auf den Gegenstand, den der Leichnam zwischen seinen verschrumpelten, frostüberzogenen Fingern hatte. »Da ist noch was.«
»Was?«, fragte Proskurjakow und beugte sich blinzelnd näher heran.
Das Kerzenlicht flackerte in der zitternden Hand des Feldwebels. »Heilige Mutter Gottes«, flüsterte er.
2. August 1914
St.-Georg-Saal, Winterpalast, Sankt Petersburg, Russland
Ein Schweißtropfen lief Inspektor Pekkala über den Nacken. Er schlängelte sich langsam am Rückgrat entlang und blieb kurz an jedem Wirbel hängen, bevor er seinen Weg fortsetzte. Pekkala war davon so abgelenkt, dass er sich auf nichts anderes mehr konzentrieren konnte. Er streckte den Rücken durch und zog die Schultern zurück, als könnte er damit den Kontakt mit der Kleidung verhindern.
Pekkala war ein großer, breitschultriger Mann mit dunklen, glatt nach hinten gekämmten Haaren. Der leichte Silberblick seiner dunkelbraunen Augen fiel anderen nur auf, wenn er sie direkt ansah.
Der große St.-Georg-Saal war brechend voll. Aufgereiht entlang der Wände war der gesamte russische Hof versammelt. Manche saßen auf Stühlen, die meisten jedoch standen. Die Adeligen trugen in aller Förmlichkeit Frack und Hemden mit gestärkten weißen Kragen, die ihnen den Hals zuschnürten. Dazu kamen Vertreter sämtlicher Waffengattungen des russischen Militärs. Zwischen den langweilig schwarz gekleideten Politikern fanden sich, wie exotische Vögel, Husaren in skarabäusgrünen Uniformröcken, Artilleriegeneräle in Erdbeerrot und die Elitesoldaten der Chevaliergarde in ihren eng anliegenden taubengrauen Uniformen. Anwesend waren die Admiräle der zaristischen Marine in mitternachtsblauen Uniformen, die sich lediglich aufgrund der weißen Schärpen der in Wladiwostok stationierten Pazifikflotte, der hellblauen Schärpen der Ostseeflotte und der roten Schärpen der Schwarzmeerflotte unterschieden. Auf den Silberknöpfen der Uniformen der Staatspolizei glitzerte das Sonnenlicht, das durch die hohen Fenster fiel und die elfenbeinfarbenen Wände zum Schimmern brachte. Und dann gab es einige wenige wie Pekkala, die zwar keine Uniform trugen, aber trotzdem im Dienst des Zaren standen und für ihn Geheimaufträge ausführten. Das waren die Männer der Ochrana. Sie arbeiteten im Verborgenen und jagten die Feinde des Romanow’schen Imperiums, darunter Bombenbauer, Auftragsmörder, Anarchisten, Giftmischer und Geldfälscher. Für die Gefährlichsten unter ihnen wandte sich der Zar an Pekkala. Keiner sonst hatte sich ein so hohes Maß an Vertrauen erworben.
Seitdem der Zar ihn aus einer Gruppe von Militärkadetten ausgewählt hatte, die damals gerade frisch aus dem noch zum Russischen Reich gehörenden Finnland eingetroffen war, hatte man Pekkala ausschließlich für eine Aufgabe ausgebildet: Er sollte als persönlicher Ermittler des Zaren tätig werden. Zu diesem Zweck war er einzig und allein Nikolaus II. unterstellt, bekleidete keinen Dienstrang, sondern war nur mit einem Dienstabzeichen ausgestattet, einem Goldmedaillon von der Länge seines kleinen Fingers. Es war mit einer weißen, ovalen Emaille-Intarsie versehen, die sich durch das gesamte Medaillon zog und in der Mitte, an ihrer dicksten Stelle, den halben Durchmesser ausfüllte. Und in der Mitte dieses weißen Emaille-Ovals steckte ein großer, runder Smaragd. Zusammen bildeten diese Elemente die unverkennbare Gestalt eines Auges. Dieses Medaillon verlieh Pekkala seinen Namen, mit dem er in ganz Russland bekannt war: das Smaragdauge.
Pekkala wippte in seinen schweren Stiefeln vor und zurück. Das knarrende Leder erinnerte ihn an einen Holzkahn, der vom Wasser hin- und hergeschaukelt wurde. Obwohl die Fenster geöffnet waren, drang kein kühles Lüftchen in den Raum. Im Saal stand nur die von den schuppenförmigen Schindeln auf den Dächern von Sankt Petersburg abgestrahlte, aufgeheizte Luft, die sich anfühlte wie die Ausdünstungen eines Backofens. An der Decke hingen vergoldete Kronleuchter, von denen jeder mit mehr als hundert Kerzen bestückt war. Bei Versammlungen im Winter tauchten diese Kronleuchter den Raum in ein weiches Licht und erfüllten ihn mit ihrem milden Bienenwachsduft. Jetzt brannten keine Kerzen, und die über den gebeugten und ungeschützten Häuptern hängenden Kronleuchter strahlten eher etwas Bedrohliches aus.
Keiner sagte etwas. Nur das Räuspern trockener Kehlen war zu hören und das unwillkürliche Seufzen jener, die sich fragten, wie lange sie noch auf dem polierten Marmorboden auszuharren vermochten, ohne in Ohnmacht zu fallen.
Am fernen Ende des hohen, weiten Raums, auf einem hüfthohen und über breite, flache Stufen zu erreichenden Podium, kniete der Zar. Er trug einen weißen Uniformrock und eine dunkle, in die kniehohen Stiefel geschlagene Hose.
Normalerweise hätte er den versammelten Würdenträgern auf einem rot-goldenen Thron gegenübergesessen, der mit gelbem Brokat und dem aus Goldfäden gewirkten doppelköpfigen Adler der Romanows verziert war und über den sich ein roter Samtbaldachin wölbte. Nun aber war der Thron zur Seite geschoben, und an seiner Stelle stand eine mannshohe, mit mehreren Goldfarbschichten bedeckte Holzstaffelei, auf der eine kleine, aber sehr lebendig gemalte Ikone ruhte, die als Der Hirte bekannt war.
Die Holztafel zeigte einen Mann in einem langen weißen Gewand neben einem großen Felsen. Am Felsen lehnte ein stilisierter Schäferstab. Und gleich neben dem Mann lag das Ufer eines Sees, in dem sich viele kleine Inseln abzeichneten, auf denen sich überall zahllose Schafe tummelten.
Vor den verwirrenden Pfeilerreihen des großen Raums und den unzähligen Arabesken, die wie Moos an jeder Ecke wucherten, wirkte die Ikone fast zu plump, um sich diesen Ehrenplatz zu verdienen. Nur wer ihre Geschichte kannte, verstand, warum der Zar aller Russen jetzt vor ihr kniete.
Die Ikone war irgendwann im elften Jahrhundert von einem unbekannten Künstler in Konstantinopel geschaffen worden. Kreuzzügler brachten sie von dort nach Kasan und übergaben sie einem Kloster, wo das Bild in der Folgezeit aufbewahrt wurde. 1209 überrannten die Tataren Kasan und hatten die Stadt für die nächsten 350 Jahre unter ihrer Herrschaft. In dieser Zeit verschwand Der Hirte, und viele Generationen später nahm man an, dass das Bild zerstört worden sei. 1579 wütete eine Feuersbrunst in der Stadt, viele Bewohner mussten aufs umliegende Land fliehen. Der Legende nach hatte ein Junge namens Nestor, dessen Familie sich den Flüchtenden angeschlossen hatte, eine Vision. Ihm erschien Jesus in einem Schäferumhang und befahl ihm, zu dem eben erst verlassenen Haus zurückzukehren. Denn dort, wurde ihm gesagt, sei etwas von großem Wert versteckt. Er wandte sich an seine Eltern. Diese aber weigerten sich, ihm zu helfen, da sie wussten, dass von ihrem Haus außer einem Haufen Asche nichts mehr übrig geblieben war. In der darauffolgenden Nacht hatte Nestor erneut diese Vision. Erneut flehte er seine Eltern an, zu dem Haus zurückzukehren, und erneut weigerten sie sich. Als ihn die Vision zum dritten Mal heimsuchte, gaben die Eltern schließlich nach. Sie machten sich zu den schwelenden Überresten ihres Hauses auf, wo Nestor unter den verkohlten Dielen seines Zimmers die in Wachstuch gewickelte und von den Flammen verschont gebliebene Ikone entdeckte.
Im Jahr darauf vertraute die Familie die Ikone dem Zaren Iwan IV. an. Iwan der Schreckliche, wie er auch genannt wurde, gelobte, dass er und seine Nachfolger das Bild bis in alle Ewigkeit beschützen würden. Von da an galt die Ikone als spirituelle Schutzherrin der Zaren. Generationen von Herrschern wachten eifersüchtig über das Bild und brachten es schließlich in eine Geheimkammer in der Kirche der Auferstehung, der Kirche auf dem Gelände der Sommerresidenz des Zaren in Zarskoje Selo außerhalb von Sankt Petersburg. Nur zu äußerst bedeutsamen Anlässen wurde Der Hirte aus seinem Versteck geholt und dem russischen Volk gezeigt, als Beweis des göttlichen Segens, der dem Zaren zuteilwurde, und dessen Vermögens, das Land zu beschützen.
Langsam erhob sich jetzt der Zar. Sein Gesicht war gerötet, und zum ersten Mal sahen auch die Wartenden, dass er ebenfalls unter der drückenden Augusthitze zu leiden hatte.
Schwankend stieg er die Stufen zum Saal hinab, wo sich seine Frau zu ihm gesellte, Zarin Alexandra, die ehemalige großherzogliche Prinzessin von Hessen-Darmstadt, deren Heimatland das Russische Reich nun den Krieg erklären wollte. Sie trug ein bodenlanges Kleid aus dünnem gebrochen weißem Stoff mit Rüschenkragen, der ihren gesamten Hals bedeckte. Ihr breitkrempiger Hut war vorn mit Federn geschmückt, in der rechten Hand hielt sie einen weißen Sonnenschirm. Kurz berührten sich ihre Hände, seine rechte streifte ihre linke, dann langte der Zar in die Tasche seines Rocks und holte einen sorgsam gefalteten Zettel heraus.
Die Stille im Saal steigerte sich noch. Alle in der Menge beugten sich vor, damit ihnen kein Wort von dem entging, was gleich gesprochen würde. Sogar der gleich bleibende Rhythmus ihres Atems war zur Ruhe gekommen.
Das Papier zitterte in der Hand des Zaren. Dann begann er zu lesen.
Es war kein Geheimnis, was er zu sagen hatte. Wer zwei Stunden zuvor in den Saal gekommen war, um die Ankunft der Romanows abzuwarten, hatte es erraten können. Manche wussten sogar den exakten Wortlaut wiederzugeben, Silbe für Silbe, als der Zar bekannt gab, dass die russische Kriegsmaschinerie gegen das Deutsche Reich und das im Zerfall begriffene Habsburgerreich in Gang gesetzt würde.
Kaum einen Monat zuvor, am 28. Juni, war ein kränklich aussehender, schmalschultriger Mann namens Gavrilo Princip in Sarajevo an den Gräf-&-Stift-Doppelphaeton des österreichischen Erzherzogs Franz Ferdinand herangetreten und hatte zwei Schüsse abgegeben. Der erste traf die Frau des Thronfolgers, Sophie, Herzogin von Hohenberg, im Unterleib, worauf sie infolge schwerer innerer Blutungen nach kürzester Zeit starb. Erzherzog Ferdinand wandte sich noch an sie und flehte sie an, nicht zu sterben, als der zweite Schuss ihn am Hals traf und die Halsschlagader zerriss. Blut ergoss sich aus seinem Mund auf die graublaue Uniform, und der Erzherzog starb, noch bevor er ins Hospital eingeliefert werden konnte.
Princip hatte einer kleinen serbischen Anarchistengruppe angehört, die sich selbst als die Schwarze Hand bezeichnete und geschworen hatte, zugunsten des von Österreich-Ungarn annektierten Bosnien-Herzegowina gegen die Habsburger vorzugehen. Als Datum des Angriffs war der 28. Juni festgelegt worden, der zufällig auf den Veitstag fiel, den Jahrestag der Schlacht auf dem Amselfeld, einem für die Serben symbolischen Datum.
Ausgerüstet mit Handgranaten und Browning-Pistolen, die vom serbischen Geheimdienstchef Dragutin Dimitrijević, genannt Apis, besorgt worden waren, nahmen Mitglieder der Schwarzen Hand entlang der Route Aufstellung, auf der der Erzherzog durch Sarajevo fahren sollte.
Als sich die Wagenkolonne ihren Weg durch die Stadt bahnte, warf einer der Attentäter, Nedeljko Čabrinović, eine Handgranate in Richtung des Wagens, in dem der Thronfolger saß. Die Granate aber hatte einen Zeitzünder mit zehn Sekunden Verzögerung, sodass der Sprengsatz erst unter dem nachfolgenden Wagen detonierte und mehrere Insassen sowie eine Reihe von Passanten verletzte.
Čabrinović, von Polizisten und der aufgebrachten Zuschauermenge gejagt, rannte um sein Leben. Da er seinen Verfolgern nicht entkommen konnte, schluckte er eine Zyankalikapsel und sprang von einer Brücke in den Fluss Miljacka. Das Gift allerdings war bereits alt und wirkte nicht mehr. Čabrinović wurde, nachdem er sich erbrechen musste, aus dem zu dieser Jahreszeit noch nicht einmal einen halben Meter tiefen Fluss gezogen und von der Menge fast zu Tode geprügelt.
Obwohl ihm davon abgeraten wurde, beschloss der Erzherzog, die Fahrt durch die Stadt fortzusetzen. Die Wagenkolonne kam nun an mehreren Attentätern vorbei, die geschworen hatten, ihn umzubringen. Aber nachdem ihnen jetzt leibhaftig jener Mann und jene Frau gegenüberstanden, die bis zu diesem Zeitpunkt für sie nur Symbole der Macht gewesen waren, zögerten die Verschwörer, ihre Pläne in die Tat umzusetzen, und die Gelegenheit verstrich.
Eine Stunde später, nachdem die geplante Route zum größten Teil absolviert war, befahl der Erzherzog seinem Chauffeur Leopold Lojka, zum Krankenhaus zu fahren, wo die zuvor Verletzten behandelt wurden.
Princip, der von den anderen Mitgliedern der Schwarzen Hand als der unzuverlässigste Gefährte angesehen wurde, stand zu diesem Zeitpunkt vor dem Delikatessengeschäft Moritz Schiller, wo der Wagen des Erzherzogs auf dem Weg zum Krankenhaus vorbeikam.
Es war 10.55 Uhr.
Die Straße war voller Passanten, zwischen denen sich der Wagen kaum seinen Weg bahnen konnte, sodass der k.u.k. Statthalter von Bosnien-Herzegowina, Feldzeugmeister Oskar Potiorek, dem Chauffeur zurief, er solle doch einen anderen Weg nehmen.
Der verwirrte Chauffeur, der mit den Gegebenheiten der Stadt nicht vertraut war, versuchte zurückzustoßen und würgte, als er den Rückwärtsgang einlegte, den Motor ab, sodass der Wagen nahezu unmittelbar vor Princip zum Stehen kam.
Das war nun die Gelegenheit für Princip, der, entgegen den Erwartungen seiner Mitverschwörer, kurzerhand beschloss, seinen Plan in die Tat umzusetzen.
Weil er meinte, es fehle ihm an Mut, das herzogliche Paar im Wagen kaltblütig zu erschießen, wollte er zunächst eine Handgranate auf sie werfen. Auf dem Bürgersteig aber drängten sich so viele Menschen, dass er fürchtete, im allgemeinen Trubel vor der Detonation nicht mehr rechtzeitig fliehen zu können. So zog er also seine Pistole, trat auf die Straße, sprang auf das Trittbrett des Wagens und feuerte, ohne recht zu zielen. Manche wollen sogar gesehen haben, dass er die Augen geschlossen und den Kopf zur Seite gedreht hatte, als er zweimal den Abzug durchzog. Bevor er einen dritten Schuss abgeben konnte, wurde er von einem Gendarmen zu Boden gerissen.
Princip wurde sofort ins Gefängnis geschafft, wo er vier Jahre später an den Folgen einer Tuberkulose starb.
Das Attentat selbst wollte Österreich-Ungarn als Vorwand für einen lokal begrenzten Militärschlag gegen Serbien nehmen. Nachdem Österreich-Ungarn Rückendeckung beim Deutschen Reich eingeholt hatte, stellte es Serbien schließlich am 23. Juli ein scharfes Ultimatum, in dem vorerst nicht mit Krieg, sondern bloß mit dem Abbruch der diplomatischen Beziehungen gedroht wurde.
Das wiederum rief Russland auf den Plan, das Serbien als »Pufferstaat« zwischen sich und der potenziellen Gefahr eines Angriffs aus dem Westen sah. Russland kündigte die Mobilmachung seiner Truppen an und versicherte, im Fall eines Angriffs auf Serbien nicht untätig zu bleiben. Es war kein Geheimnis, weder für die Russen noch für die anderen, dass Russland mindestens sechs Wochen brauchte, um seine Armee in volle Kampfbereitschaft zu bringen. In dieser Zeitspanne aber konnten Deutschland und Österreich-Ungarn nicht nur die eigenen Truppen mobilisieren, sondern auf breiter Front zum Angriff übergehen. Für Russland war es daher von höchster Dringlichkeit, vor allen anderen die Mobilisierung einzuleiten, wenn das Land verteidigt werden sollte.
Das Deutsche Reich allerdings verfolgte eigene Pläne.
Im Fall einer russischen Mobilmachung verlangte die deutsche Militärdoktrin, die eigenen Truppen in Kampfbereitschaft zu versetzen.
Aufgrund solcher unflexiblen Strategien, die nur wenig Spielraum ließen, war der Ausbruch des Krieges nahezu unvermeidlich. Und die seit langer Zeit bestehenden Allianzen zwischen Großbritannien, Frankreich und Russland auf der einen Seite und dem Deutschen Reich, Österreich-Ungarn und dem Osmanischen Reich auf der anderen sorgten dafür, dass sich die Feindseligkeiten schnell über den gesamten Kontinent ausbreiten würden.
Zu spät wurde dem Zaren bewusst, dass sein Vetter, Kaiser Wilhelm II., den Krieg von Anfang an gewollt hatte. Umgeben von dem schwachen und in sich zerrissenen Staatengebilde der Habsburger und Osmanen und ohne die großen Kolonien, wie sie Großbritannien und Frankreich besaßen, glaubte Kaiser Wilhelm II., dass es für die Deutschen an der Zeit wäre, selbst ein weltumspannendes Imperium für sich zu reklamieren. Die Ermordung des Erzherzogs Ferdinand lieferte ihm den Anlass, den er brauchte, um den Schlieffen-Plan in die Tat umzusetzen. Dieser sah vor, dass das deutsche Heer erst in Frankreich und Westeuropa zuschlug, bevor es sich nach Osten und gegen die Armee des Zaren wandte. Der Zar appellierte an den Kaiser, als Vermittler zwischen Russland und Österreich-Ungarn zu fungieren, Wilhelm II. aber hatte nicht die geringste Absicht, sich für ein Friedensabkommen einzusetzen. Nikolaus’ Bemühungen, die Kampfhandlungen zu vermeiden, wurden ihm von seinem deutschen Vetter als Schwäche ausgelegt. Wilhelm II. verlangte, dass Russland seine Truppen demobilisierte, während im Deutschen Reich bereits die Generalmobilmachung angelaufen war. Darauf konnte sich der Zar nicht einlassen. In diesem Fall wären die Grenzen ungeschützt gegenüber zwei Staaten gewesen, die ihre Armeen bereits aufmarschieren ließen. Widerwillig instruierte der Zar daher seinen Außenminister Sergei Sasonow, dass Russland in den Krieg ziehen werde.
»Ich schwöre feierlich«, verkündete der Zar nun gegen Ende seiner Erklärung, »dass ich niemals Frieden schließen werde, solange auch nur einer unserer Feinde noch auf vaterländischem Boden steht.« Den gleichen Eid hatte Zar Alexander I. geleistet, als Napoleons Truppen 1812 das Land überfallen hatten und wenige Monate später, nur wenige Tagesmärsche von Moskau entfernt, in Borodino zum Stehen gekommen waren.
Sorgfältig faltete der Zar das Blatt zusammen und steckte es wieder in seine Tasche. Dann trat er, mit seiner Frau an seiner Seite, den langen Weg zum Ende des Saals an, wo ein Balkon den draußen liegenden Platz überblickte, auf dem sich bereits Tausende Russen versammelt und auf diesen Moment gewartet hatten.
Als Nikolaus und Alexandra die Reihen des Hofstaats abschritten, begannen jene in unmittelbarer Nähe zu applaudieren. Zunächst nur vereinzelt und verhalten. Keiner schien zu wissen, was er tun sollte. Aber dann wurde der Applaus stärker und breitete sich aus, bis er wie Donner durch den Saal hallte. Derart ermutigt, beschleunigte der Zar seine Schritte. Das Gewicht der gewaltigen Entscheidung, die tagelang auf ihm gelastet hatte, während er vergebens einen Frieden auszuhandeln versuchte, schien sich jetzt von ihm zu heben und zwischen den Kronleuchtern zu verflüchtigen.
Pekkala stand an der Wand gleich neben dem Balkon. Dort hatte er sich einen Platz gesucht in der Hoffnung, es würde dort erträglicher sein als im dichten Gedränge in der Saalmitte. Er mochte große Menschenansammlungen nicht und hätte gern auf diesen historischen Augenblick verzichtet, wenn der Zar seine Anwesenheit nicht ausdrücklich verlangt hätte.
Bevor der Zar auf den Balkon hinaustrat, wandte er sich kurz zur Seite und sah zu Pekkala. Sofort verschwanden die Falten auf seiner Stirn, seine Kiefermuskeln entspannten sich. Wirklich sicher fühlte er sich nur in Gegenwart des Smaragdauges.
Sobald der Zar den Balkon betrat, erhob sich vom Platz donnernder Jubel, der das Klatschen im Saal augenblicklich übertönte. Wenn der Zar vorgehabt hatte, einige Worte an die Versammelten zu richten, so nahm er jetzt davon Abstand. Jede Stimme wäre im Lärm untergegangen.
Der Zar stand neben der gewaltigen Steinsäule des Balkons und verschwand nahezu angesichts des riesigen Schilds mit dem kaiserlichen Wappen, das links von ihm am weißen Metallgeländer hing. Etwas nervös wegen der Höhe, auf der er sich über dem Steinpflaster des Platzes befand, klammerte er sich mit der einen Hand fest ans Geländer, während er mit der anderen die Menge grüßte. Der Jubel der Massen nahm noch zu, als sie seine blasse Hand sahen, und schwoll dermaßen an, dass es Pekkala durch und durch ging.
Dann rief der Zar seinen Namen.
Pekkala beugte sich nach draußen. »Exzellenz?«
Der Zar winkte ihn zu sich heran. »Kommen Sie. So was werden Sie Ihr Lebtag nicht mehr zu Gesicht bekommen.«
Die Zarin, die mit erhobenen Händen die Menge grüßte, nahm aus dem Augenwinkel wahr, wie Pekkala zögernd nach draußen trat. Sie fuhr herum. »Was haben Sie hier verloren?«, blaffte sie. »Gehen Sie rein zu den anderen. Dorthin, wo Sie hingehören!«
»Er ist keiner von den anderen«, sagte der Zar. »Und er ist hier, weil ich ihn darum gebeten habe.«
Wütend starrte die Zarin zu ihrem Gatten, bevor sie sich abrupt umdrehte und wieder den Massen zuwinkte. Pekkala sah zu den Abertausend Gesichtern inmitten der wogenden Menge und dem Gesprenkel ihrer braunen, roten, blauen und weißen Sommerkleidung. Dann schweifte sein Blick zur Zarin.
Wie musste sie sich fühlen, wenn sie gezwungen war, die Kriegserklärung an ihr eigenes Volk zu feiern, und dabei gleichzeitig wusste, dass ihre Loyalität zu Russland in den kommenden Monaten immer angezweifelt werden würde, egal, was sie tat?
Der Zar ging nun ganz im Hochgefühl des Augenblicks auf. »Sehen Sie das, Pekkala?«, rief er und hatte zu tun, sich im Tosen der Menge, die immer stärker gegen den Polizeikordon drückte, verständlich zu machen. »Das Feuer des russischen Volkes ist unbezwingbar! Wenn das Volk an mich glaubt und ich an das Volk, werden wir diesem Land einen Frieden schenken, der tausend Jahre Bestand haben wird! Nichts kann uns besiegen! Nicht, solange wir vom Hirten geleitet werden!« Er beugte sich vor und legte seine Hände auf die von Pekkala. »Und so wie die Ikone über Russland wacht, so werden Sie über mich wachen.«
Für Stefan Kohl, einen jungen Mann, der weit östlich von Sankt Petersburg in einem kleinen Dorf namens Rosenheim lebte, hatte der Krieg bereits begonnen.
Seine Familie stammte deutschen Bauern ab, die Katharina die Große, ebenso deutscher Abstammung, ursprünglich ins Land geholt hatte. Ab dem Ende des achtzehnten Jahrhunderts ließen sich viele solcher Familien in der Wolgaregion nieder und bauten dort auf dem fruchtbaren schwarzen Boden Weizen und Roggen an. Die Siedlungen gediehen, und obwohl die Wolgadeutschen russische Staatsbürger waren, hielten sie an ihrem kulturellen Erbe fest.
Aber nicht alle Bewohner Rosenheims befürworteten diesen kulturellen Starrsinn.
Stefans Vater Viktor Kohl, ein lutheranischer Pfarrer, schickte seine Söhne nicht in die örtliche Schule, wo nur Deutsch gesprochen wurde und die Klassen so klein waren, dass man die Schüler aller Altersstufen in einem Raum zusammenpferchte. Nein, er gab sie auf die russische Schule in der nahe gelegenen Stadt Krasnojar.
In Krasnojar waren die Kohl-Brüder bald den Anfeindungen und Hänseleien ihrer Klassenkameraden ausgesetzt. Das lag nicht nur an ihrer Weigerung, sich von ihrem kulturellen Erbe loszusagen, sondern auch an der Vorzugsbehandlung, die ihre Vorfahren bei der Umsiedlung nach Russland erhalten hatten – was die alteingesessene Bevölkerung bis zum heutigen Tag nicht vergessen hatte.
Stefans älterer Bruder Emil überstand die Schule, indem er sich so unauffällig wie möglich verhielt und sich ansonsten widerstandslos hänseln und quälen ließ, bis seine Peiniger mit der Zeit alle Lust daran verloren und ihn in Ruhe ließen. Stefan, dem es an einem so gearteten Selbsterhaltungstrieb mangelte, wurde dagegen so häufig verprügelt, dass es für die russischen Jungen an der Schule zum Erwachsenwerden gehörte, ihn zum Kampf zu fordern.
Die letzte Prügelei fand mit einem Jungen namens Wjatschislaw Konowalow statt. Er war ein schmächtiger und friedfertiger Junge, der niemals Streit gesucht hätte, schon gar nicht mit dem großen und kräftigen Deutschen, wäre er nicht von seinen Klassenkameraden dazu angestiftet worden. Bestrebt, sich zu beweisen, stapfte Konowalow also auf dem Pausenhof geradewegs auf Stefan zu und wollte ihm einen Schlag verpassen.
Stefan, der diese Angriffe mittlerweile so sehr gewohnt war, dass ihn nichts mehr überraschen konnte, machte einen Schritt zurück, sodass Konowalows Faust an seinem Gesicht vorbeistrich. Im gleichen Augenblick packte Stefan den Arm des Jungen, nutzte dessen Schwung, um ihn aus dem Gleichgewicht zu bringen, drehte ihn zur Seite und schlug selbst zu. Er hatte es auf das Kinn des Jungen abgesehen, aber Konowalow fuhr herum, Stefan verlor seinen sicheren Stand und traf Konowalow nicht am Kinn, sondern am Hals. Die Folge war eine innere Blutung der Halsschlagader. Konowalow sank zu Boden und hustete Blut. Er wurde sofort ins Krankenhaus gebracht, eine Weile lang schwebte er sogar in Lebensgefahr. Obwohl er sich in der Folge von der Verletzung erholte, war der Anblick des Blut spuckenden Jungen auf dem Pausenhof zu viel für die Schulleitung. Stefan wurde der Schule verwiesen.
Viktor Kohl, darauf bedacht, sich mit der russischen Gemeinde gutzustellen, schämte sich so sehr für die Relegierung seines Sohns, dass er sich weigerte, diesen auf die örtliche Schule in Rosenheim zu schicken. So gab er den damals fünfzehnjährigen Jungen in die Obhut des örtlichen Schlachters, eines Riesen von Mann namens Werner Krob, damit er ihn in die Grundzüge seines Gewerbes einführte, wo die dem Jungen von Natur aus gegebene Gewalttätigkeit ein, wie er meinte, angemessenes Betätigungsfeld finden sollte.
Emil schloss unterdessen die Schule in Krasnojar ab und erhielt ein Stipendium für das Studium an der Universität Kiew. Obwohl er sehr viel weniger Narben davongetragen hatte als sein Bruder, war er dennoch nicht ganz ungeschoren davongekommen. Als Folge der unablässigen Angst, unter der er in der Schule zu leiden gehabt hatte, war es für ihn schwierig bis nahezu unmöglich geworden, seine Zurückhaltung und sein Misstrauen gegenüber seinen Mitmenschen abzulegen. So gewann er nur wenige Freunde und zog sich mehr und mehr in die Welt seines Studiums zurück, in der Zahlen und Gleichungen die einzigen Dinge waren, denen er vorbehaltlos trauen konnte.
Seine Eltern verstanden sehr wenig von dem, womit er sich beschäftigte, und welchen Einfluss das auf ihn hatte. In ihren Augen war nichts Falsches daran, wenn er als Erster aus der Familie eine akademische Ausbildung absolvierte.
Stefan brachte unterdessen seine Lehrzeit beim Schlachter Werner Krob hinter sich. Krob, ein einfühlsamer, fachkundiger und einsilbiger Mann, war für den von der Familie verstoßenen Jungen ein guter Lehrmeister und Mentor.
Einmal in der Woche beluden Stefan und Krob ihren Metzgerkarren und fuhren zum Markt nach Krasnojar, wo Krob hohes Ansehen genoss.
Stefan hatte diesen Besuchen in der Stadt zunächst mit einiger Nervosität entgegengesehen, zu seiner Überraschung und großen Erleichterung aber hörte er weder die zornigen Stimmen noch das Gejohle, das ihn während seiner Schullaufbahn verfolgt hatte. Die Kunden sahen ihm kaum in die Augen, wenn er zwischen den aufgehängten Schweinehälften, Schafen und Hühnern stand und mit blutverschmierten Händen Herzen, Zungen und Nieren auf die Waage legte.
Was Stefan nicht wusste: Die Leute hatten Angst vor ihm. Er war nicht mehr der, den man straflos hänseln und drangsalieren konnte, nur weil einem der Sinn danach stand. Der Junge von einst war schnell zu einem Mann herangewachsen, der, wie die Bewohner von Krasnojar bald feststellten, die ihm zugefügten Grausamkeiten so schnell nicht vergessen würde.
In den folgenden Monaten, in denen Stefan sein Handwerk erlernte, freundete er sich mehr und mehr mit dem Gedanken an, dass der blutige Schurz des Schlachters wie für ihn gemacht war. Aber er fühlte sich auch einsam und darüber hinaus enttäuscht, welchen Weg sein Leben einzuschlagen schien. Manchmal, wenn er im Bett lag und dem Schnarchen seines Vaters lauschte, das über den Gang zu ihm herüberdröhnte, und er dabei wusste, dass er im Elternhaus nicht sehr gelitten war, öffnete sich in seinem Herzen eine große Leere.
Nach dem ersten Lehrjahr wurde Stefan hin und wieder erlaubt, allein zum Markt nach Krasnojar zu fahren. An dem heißen Augustnachmittag, an dem der Zar dem Deutschen Reich den Krieg erklärte – eine Tatsache, von der in Rosenheim noch keiner etwas wusste –, scheute auf dem Nachhauseweg Stefans Pferd. Etwas lag im Straßengraben. Stefan brachte den Wagen zum Stehen, zog die Bremse fest, saß ab und sah sich an, was das Pferd so nervös gemacht hatte. Er fand einen Mann im Graben liegen. Dessen Kleidung bestand aus kaum mehr als Lumpen, sein Gesicht war so zerschlagen, dass Stefan ihn im ersten Moment für tot hielt. Aber als er den vermeintlichen Leichnam aus dem Graben zerrte, schlug der Fremde die Augen auf.
»Nicht wieder schlagen«, flehte er im Delirium. Die Lippen waren aufgeplatzt, die Zähne rot vor Blut.
»Du musst keine Angst haben«, versicherte ihm Stefan und wischte ihm mit dem Taschentuch übers Gesicht. »Wer bist du? Wer hat dir das angetan?«
Er sagte, er heiße Anatoli Bolotow und sei ein Pilger aus dem Dorf Marcha nahe der sibirischen Stadt Irkutsk. Nach dem Zustand seiner Kleidung und der Tatsache zu schließen, dass sein einziger Besitz eine Bibel war, gab es für Stefan wenig Grund, dem Mann nicht zu glauben. Zwei Jahre lang war Bolotow durchs Land gewandert und hatte sich gerade eben auf dem Heimweg befunden, als er nach Krasnojar gekommen war.
Dort habe er um Essen gebettelt, als plötzlich Männer über ihn hergefallen seien und ihn bewusstlos geprügelt hätten. Wie Stefan Kohl schnell vermutete, waren es offensichtlich jene, die als Jungen auch ihn geschlagen hatten.
Stefan, der sich noch gut daran erinnern konnte, wie oft er sich selbst auf dieser Straße das Blut aus dem Gesicht hatte wischen müssen, hob Bolotow vorsichtig auf den Wagen, da dieser zu schwach war, um selbst aufzusteigen. Dann brachte er den erschöpften Pilger nach Rosenheim und stellte ihn seinem Vater vor.
Nachdem Viktor Kohl Bolotows Geschichte gehört und die Bibel gesehen hatte, die dieser sich gegen die Brust drückte, stimmte er widerstrebend zu, ihm zu essen und für die Nacht ein Dach über dem Kopf zu geben. »Aber nur für eine Nacht!«, verfügte er.
Am Tisch erzählte Bolotow von seinen Reisen durch Russland.
Zunächst schien sich Viktor Kohl für ihn erwärmen zu können. Er war beeindruckt, da der Gast ausgiebig aus der Heiligen Schrift zitierte, aber irgendwann kamen sie an einen Punkt, an dem Bolotow von seinem Glauben sprach, und Viktors Blick änderte sich.
»Unserem eigenen Fleisch«, sagte Bolotow, »ihm müssen wir unsere Hingabe an den Herrn einschreiben.«
»Und was soll das heißen?«, fragte Viktor Kohl.
»Das Ende ist nah«, erläuterte Bolotow, »wir müssen nicht nur den Tröstungen des Fleisches entsagen, sondern allem, was solche Tröstung überhaupt erst ermöglicht.«
Viktor Kohl legte Messer und Gabel zur Seite. Langsam schob er den Teller von sich und stand auf, unter den Blicken seiner Frau Christiana und seines Sohnes, die beide die Bedeutung dieser Worte nicht erfasst hatten.
»Jetzt weiß ich, wer du bist«, flüsterte Viktor Kohl. »Ich weiß, zu welchen Geächteten du gehörst, aber ich werde nicht die Luft in diesem Haus verpesten, indem ich ihren Namen ausspreche.«
»Einem Mann Gottes, wie ich einer bin, werde ich nicht widersprechen«, erwiderte Bolotow.
»Es gibt keine Gemeinsamkeit zwischen mir und dir«, sagte Viktor abschätzig. »Einem, der tut, was du im Namen Gottes getan hast.«
»Es sind die«, antwortete Bolotow trotzig, »die dem Lamm Gottes überallhin folgen. Sie allein werden erlöst.«
»Verschleiere deine Taten nicht mit heiligen Worten!«, brüllte Viktor und deutete zur Tür. »Raus!«
»Du hast versprochen, ihn aufzunehmen«, schaltete sich Stefan dazwischen. »Was hat er dir getan, außer dass er seine Meinung geäußert hat?«
Aber Bolotow hatte sich schon erhoben, er wirkte müde und resigniert und wandte sich an Christiana, die ihn bloß verängstigt anstarrte. »Ich danke Ihnen für das Essen«, sagte er leise.
»Du kannst ihn nicht mitten in der Nacht vor die Tür setzen«, protestierte Stefan.
»Die Dunkelheit ist ihm nicht fremd, das kann ich dir versichern«, erwiderte Viktor.
Bolotow verließ das Haus. Stefan folgte ihm.
Es regnete, die Luft war beißend kalt, aber Bolotow schien es kaum wahrzunehmen.
»Bitte verzeih meinem Vater«, sagte Stefan.
»Ich mache ihm keinen Vorwurf. Es war meine Schuld, weil ich dachte, ich könnte mit ihm reden, von einem Mann Gottes zum anderen.«
»Was hat ihn so aufgebracht?«
»Ich habe ihm die Wahrheit gesagt, die er nicht hören wollte.«
»Welche Wahrheit?«
Sie standen nebeneinander unter dem Dachvorsprung des Hauses, wo sie zumindest ein bisschen vor dem Regen geschützt waren. Jetzt aber drehte sich Bolotow mit flammendem Blick zu Stefan um. »Die Wahrheit ist: Du wirst nur das himmlische Königreich betreten, wenn du dich aller irdischen Fesseln entledigst.«
»Das geschieht, wenn wir sterben«, sagte Stefan, »und mir scheint, dessen ist sich mein Vater auch sehr wohl bewusst.«
»Aber was er nicht weiß oder nicht sehen will: Wir erweisen uns nur dann des Himmels würdig, wenn wir diese Fesseln durchtrennen, solange wir noch leben. Nur jene, die sich von der Herde lossagen, werden gerettet werden.«
»Und die anderen? Was geschieht mit den anderen?«
»Sie werden von einer Welle aus Blut fortgespült.« Sanft ergriff Bolotow Stefan am Arm. »Hab keine Angst vor dem, was ich sage. Uns ist die Möglichkeit gegeben zu beweisen, dass wir es wert sind. Aber das erfordert Mut. Mehr Mut, als die meisten Männer und Frauen aufbringen. Es reicht nicht, nur das Leiden Christi anzuerkennen. Das kann jeder. Wir müssen das Feuer unseres Glaubens auf die Probe stellen, indem wir zeigen, dass auch wir bereit sind, für unseren Glauben zu leiden. Dazu ist es nötig, einen neuen Weg zu beschreiten und nicht den, der uns von denen vorgegeben wird, die glauben, sie würden uns besser kennen als wir uns selbst.«
Stefan musste an den Tag denken, an dem sein Vater ihn zu Werner Krob gebracht hatte. Es hatte keine Diskussion darüber gegeben. Kein Wort der Ermutigung. Noch nicht einmal eine Trost spendende Hand auf der Schulter. »Ich habe gelernt, es hinzunehmen«, murmelte er ebenso sehr zu sich wie zu dem Pilger.
»Aber warum solltest du?«, rief Bolotow aus. »Warum dein Leben damit vergeuden, die Erwartungen jener zu erfüllen, die noch nicht mal ihren eigenen Erwartungen gerecht werden? Warum sich nicht auf eine Reise begeben, die nur die Mutigsten vollbringen? Kein Mensch ist frei, solange er es sich nicht selbst bewiesen hat.«
Zu nahezu jedem anderen Zeitpunkt hätten Bolotows Worte in Stefan Kohls Ohren hohl geklungen, in diesem Moment aber erschienen sie ihm so tiefgründig, dass er das Gefühl hatte, er hätte sein ganzes bisheriges Leben vergeudet und verschlafen und wäre erst jetzt eben aufgewacht.
Während sie so dastanden und dem Regen zusahen, der glitzernd wie Quecksilberkügelchen vom Dach tropfte, führte Bolotow aus, was er mit dem Durchtrennen der irdischen Fesseln im Einzelnen meinte. Stefan war entsetzt, als ihm die blutigen Rituale beschrieben wurden, aber auch fasziniert vom grausamen Gestus der Hingabe. Keiner hatte von ihm bislang verlangt, dass er etwas opferte, als wäre nichts von dem, was er besaß, es wert, seinem Glauben hingegeben zu werden. Zu seiner Überraschung stellte Stefan fest, dass er keine Angst hatte, selbst wenn er dieses Opfer in Form des eigenen Fleisches darbringen musste. Zum ersten Mal glaubte er ein mögliches Leben vor sich zu sehen, das erfüllt war von einem Zweck, der größer war als alles, womit er sich bislang zufriedengegeben hatte.
»Komm mit mir«, sagte Bolotow.
Bei diesen Worten wurde Stefan eng um die Brust. »Jetzt gleich?«, stieß er atemlos hervor.
»Jetzt oder nie!«, rief Bolotow. »Die Gelegenheit kommt vielleicht nie wieder. Überall, wo ich hinkomme, redet man vom Krieg gegen Deutschland. Vielleicht ist es schon zu spät. Das Erbe deiner Vorväter, das zu bewahren ihr euch so bemüht habt, wird der Untergang dieses Ortes sein. Die Russen werden euch bald von eurem Land vertreiben und euch dahin schicken, woher ihr gekommen seid.«
»Aber ich komme von hier«, entgegnete Stefan. »Ich habe nie etwas anderes gekannt.«
»Das kümmert sie nicht. In ihren Augen ist euch schon der Prozess gemacht und das Urteil über euch gesprochen. Ihnen bleibt nur noch, die Strafe zu vollstrecken. Aber du solltest dich glücklich schätzen.«
»Warum?«
»Anders als sie …«, Bolotow zeigte in die Dunkelheit, die von den dünnen Lichtfäden der Fensterläden durchbrochen wurde, »… hast du eine Wahl. So oder so, du musst in die Verbannung, aber zu welcher Art Verbanntem du wirst, liegt einzig und allein bei dir.«
Bolotow versprach, noch bis zum Sonnenaufgang zu warten, damit sich der junge Mann alles durch den Kopf gehen lassen konnte.
»Du wirst deine Antwort bis dahin kriegen«, versprach ihm Stefan.
Sobald er wieder im Haus war, wurde er von seinem Vater zur Rede gestellt. »Hast du mit ihm gesprochen?«
»Ja.«
»Glaube ihm kein Wort«, warnte Viktor. »Seine Leute sind Gift auf dieser Erde.«
»Was er mir gesagt hat, klang in meinen Ohren vernünftig.«
»Was?« Viktor brach in zorniges Gelächter aus. »Dann solltest du dich ihm vielleicht anschließen, wenn er aufbricht.«
»Vielleicht tue ich das auch«, entgegnete Stefan.
Viktor hatte ihm bloß Angst einjagen wollen, jetzt aber begriff er, dass sein Sohn es ernst meinte. »Ich kann dich nicht aufhalten«, sagte er. »Du bist alt genug, deine eigenen Entscheidungen zu treffen. Entscheide dich für diesen Bettler, oder entscheide dich für deine Familie, aber du sollst wissen, dass du nicht beides haben kannst.«
In diesem Moment kam Stefans Mutter ins Zimmer. Sie hatte dem Gespräch gelauscht und fürchtete den Zorn ihres Mannes ebenso wie die Unbeugsamkeit ihres Sohnes. »Warum musst du immer so grausam sein?«, schrie sie Viktor an.
Verblüfft, dass sich seine Frau gegen ihn stellte, starrte er sie bloß wortlos an.
Sie ballte die Fäuste und schlug auf seine Brust ein. »Du kannst deinen Sohn nicht im Stich lassen.«
»Schon gut«, sagte Stefan zu seiner Mutter. »Das hat er schon vor langer Zeit getan.«
»Bleib«, flehte sie ihn an.
Aber es war schon zu spät. Bis zu dem Augenblick, als sein Vater ihm ins Gesicht gelacht hatte, war Stefan voll der Zweifel gewesen. Aber der Spott seines Vaters rief ihm wieder jede Beleidigung ins Gedächtnis, die er in der Schule in Krasnojar erfahren hatte – alle Beleidigungen samt dem sie begleitenden Schmerz. Das Gelächter klärte seinen Verstand. Im Leben kommt es gelegentlich vor, dass man erst dann weiß, ob man sich richtig entschieden hat, wenn die Entscheidung bereits getroffen wurde. Und jetzt wusste er es.
»Bleib bei uns«, flehte seine Mutter. »Hier, wo du weißt, dass du in Sicherheit bist.«
Stefan schüttelte den Kopf. »Keiner ist mehr in Sicherheit.«
Am nächsten Tag rückten, wie von Bolotow vorhergesagt, russische Soldaten aus der Kaserne in Krasnojar an. Mit ihnen kam ein Haufen selbsternannter Milizionäre, die mit alten Flinten, Vorschlaghämmern und Küchenmessern bewaffnet waren.
Den Bewohnern von Rosenheim wurde eine Stunde Zeit gegeben, um jeweils einen Koffer zu packen. Dann wurden sie zu einem Lastkahn am Wolgaufer in Pokrowsk geführt. Nachdem sie über die Wolga zur Stadt Saratow übergesetzt hatten, wurden sie auf Viehwaggons verladen und zur deutschen Grenze gefahren, eine Reise, die mehrere Tage dauerte. An der Grenze wurde die Familie Kohl von ihrem ältesten Sohn Emil empfangen. Aufgrund eines kaiserlichen Erlasses war er mitsamt allen Studenten von deutscher oder österreich-ungarischer Abstammung von der Universität Kiew relegiert worden.
Als die Bewohner von Rosenheim in ein Land einreisten, das sie nie zuvor gesehen hatten, befand sich Stefan Kohl nicht unter ihnen. Noch vor der Ankunft der Soldaten in Rosenheim hatte er sich zusammen mit Bolotow auf den langen Marsch nach Sibirien begeben.
1. Juni 1915
Zarskoje Selo, Sommerresidenz der Zarenfamilie
Am Rand des weitläufigen Geländes lag ein kleines Landhaus mit flachem Dach. Es wurde zu beiden Seiten von einstöckigen Anbauten flankiert, deren hohe, schießschartenähnliche Fenster eher an einen Bunker denken ließen. Das Mauerwerk des Hauses war in einem warmen Gelbton gehalten und schimmerte in der Nachmittagssonne wie das Fruchtfleisch einer reifen Aprikose.
In einem der kleinen, mit einem Sammelsurium unterschiedlichster Möbel vollgestellten Zimmern saßen die Zarin Alexandra und ihre beste Freundin Anna Wyrubowa. Ihr war das Haus geschenkt worden, damit sie immer in der Nähe der Zarin sein konnte.