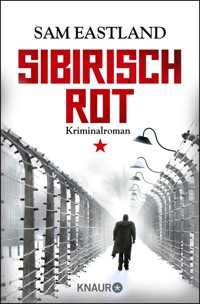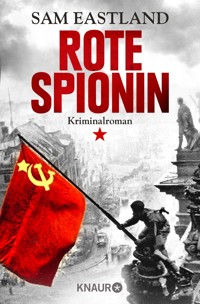6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Knaur eBook
- Kategorie: Krimi
- Serie: Die Inspektor-Pekkala-Serie
- Sprache: Deutsch
Der 5. historische Krimi mit dem »James Bond in Diensten Stalins« (Die Literarische Welt): Inspektor Pekkala ermittelt im stalinistischen Russland während des Zweiten Weltkriegs Ukraine, Anfang 1944: Der 2. Weltkrieg tobt immer brutaler, nach einem Massaker findet man eine verkohlte Leiche. Alle Indizien deuten darauf hin, dass es sich bei dem Toten um Inspektor Pekkala handelt, doch Stalin weigert sich, das zu glauben. Auf Befehl des Diktators muss Pekkalas Assistent Major Kirow an die Front, um Nachforschungen anzustellen. Tief in den Wäldern der Ukraine gerät Kirow in den gnadenlosen Partisanen-Krieg gegen die Deutschen – und bemerkt viel zu spät, dass er in eine Falle zu laufen droht ... Für Leser von Volker Kutscher, Harald Gilbers oder Tom Rob Smith und alle historisch interessierten Krimi-Fans bietet Sam Eastlands Krimi-Reihe um den russischen Inspektor Pekkala hochspannende Unterhaltung. Die Fälle von Inspektor Pekkala sind in folgender Reihenfolge erschienen: • Roter Zar • Der rote Sarg • Sibirisch Rot • Roter Schmetterling • Roter Zorn • Rote Ikone
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 378
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Sam Eastland
ROTER ZORN
Kriminalroman
Aus dem Englischen von Karl-Heinz Ebnet
Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.
Über dieses Buch
Ukraine, Anfang 1944: Der Krieg tobt immer brutaler. Nach einem Massaker findet man eine verkohlte Leiche. Alle Indizien deuten darauf hin, dass es sich bei dem Toten um Inspektor Pekkala handelt. Doch Stalin weigert sich, das zu glauben. Auf Befehl des Diktators muss Major Kirow, Pekkalas Assistent, an die Front, um Nachforschungen anzustellen. Tief in den Wäldern der Ukraine gerät er in den gnadenlosen Partisanenkrieg gegen die Deutschen – und bemerkt viel zu spät, dass er in eine Falle zu laufen droht …
Inhaltsübersicht
An: United Brotherhood of Steelworkers, Branch
Westukraine Februar 1944
Moskau Kreml
An: United Brotherhood of Steelworkers, Branch
Nach der Rückfahrt durch [...]
An: United Brotherhood of Steelworkers, Branch
Kirows verbeulter Emka rumpelte [...]
Persönlicher Brief an die Amerikanischen Botschaft
Nachdem Kirow Linskys Laden [...]
Brief, eingegangen in Gotland, 2. August 1937
Bevor Kirow das NKWD-Hauptquartier [...]
Brief, gefunden am 1. November 1937
Am folgenden Tag setzte [...]
Vermerk von Samuel Hayes, Sekretär der US-Botschaft, Moskau
Trotz der immensen Zerstörung [...]
Kurzmitteilung von Joseph Davies, US-Botschafter in Moskau
Als Kirow in den [...]
Büro des Genossen Josef Stalin, Kreml, an Botschafter Joseph Davies
Kirow versuchte mit Pekkala [...]
Brief von Samuel Hayes, Sekretär, US-Botschaft, Moskau
Kirow und Pekkala fiel [...]
Bericht über die Verhaftung von William Vasko
Pekkala blieb vor einer [...]
Mitteilung: Josef Stalin an Henrik Panasuk, Lubjanka, 11. Dezember 1937
Die Rasputiza wird dieses [...]
Notiz: Büro des Genossen Stalin, Kreml, an 3. Westliche Abteilung des Volkskommissariats für auswärtige Angelegenheiten
In der Nacht zuvor, [...]
Kurzmitteilung von Joseph Davies, US-Botschafter in Moskau
Nur wenige Minuten nach [...]
Internes Memorandum, Büro für Immigration und Einbürgerung, US-Botschaft, Moskau
Eine Stunde später standen [...]
An: Mrs. Frances Harper, Hague Rd., Monkton, Indiana
Nachdem Malaschenko das Mädchen [...]
Offizier Hiroo Nishikaichi, Kaiserlich-Japanische Küstenwache, Station Wakkanai, Hokkaido
Eine Woche nach dem [...]
Dank
(Poststempel: Elizabeth, New Jersey, 4. März 1936)
(Absenderadresse: keine)
An:
United Brotherhood of Steelworkers, Branch 11,
Jackson St.,
Newark, New Jersey, USA
Jungs, heute geht es los!
Die Koffer sind gepackt, und ich mache mich auf den Weg zu einem neuen Leben in Russland. Arbeitsstelle, Unterkunft, Schulausbildung für meine beiden Kinder sind mir zugesichert, sobald wir vom Schiff gehen. Hier in Amerika sind über 13 Millionen Menschen arbeitslos, aber dort drüben suchen sie händeringend nach Facharbeitern. Wie ihr wisst, wohnen im Moment Angehörige unserer New Yorker Ortsgruppe mit ihren Familien in leerstehenden Gebäuden in der Wall Street. Wir prügeln uns in der Schlange zur Essensausgabe. Letzten Monat habe ich für einen Dollar meine Orden verkauft, die mir im Großen Krieg für die Teilnahme an den Kämpfen im Argonner Wald verliehen wurden.
Leute, kommt nach Russland. Dort liegt die Zukunft. Ich weiß, es fällt schwer, die Heimat zu verlassen, und noch schwerer ist es, ein neues Leben zu beginnen. Aber ich weiß auch: Ihr seid es genauso leid wie ich, dass wir immer nur wie der letzte Dreck behandelt werden, dass wir immer um das betteln müssen, was uns eigentlich von Rechts wegen zusteht. Habt ihr nicht auch die Schnauze voll, dass ihr euch tagein, tagaus Sorgen machen müsst, ob ihr die Miete für diesen Monat zahlen könnt oder auf die Straße gesetzt werdet?
Die Sowjetische Handelsagentur betreibt ein Büro in Manhattan. Wer einen Neuanfang sucht, dem wird dort geholfen. Tag für Tag treffen Tausende Amerikaner in Russland ein und werden mit offenen Armen empfangen. Dort interessiert es niemanden, ob man schwarz oder weiß ist, solange man bereit ist zu arbeiten. Moskau hat englische Sprachschulen, englischsprachige Zeitungen und sogar eine Baseball-Mannschaft!
Ich hoffe, wir sehen uns alle bald in diesem großartigen neuen Land, das Mr. Josef Stalin mit Hilfe von Männern und Frauen wie uns aufbaut.
Mit den besten Grüßen,
William H. Vasko
Westukraine Februar 1944
Wie viele von den Skeletten noch die Rosenkränze um die Handgelenke gewickelt hatten, ging es Hauptmann Gregor Hudsik durch den Kopf, als er mit seiner Schaufel auf den gefrorenen Boden einhackte.
Südlich der Siedlung Zuman im Westen der Ukraine, an einem Feldweg zwischen den beiden Dörfern Olyka und Dowhoschji, lagen die Überreste der Ortschaft Misowitschi. Es hatten dort nie mehr als einige hundert Menschen gelebt. Sie waren Bauern, Gerber und Schnapsbrenner gewesen, die einen Hochprozentigen hergestellt hatten, Samahonka genannt, der es in der Gegend zu einiger Berühmtheit gebracht hatte. Mit ihrem geruhsamen Leben war es für immer vorbei, als Ende 1918 ein Soldat nach Misowitschi zurückkehrte, Kolja Jankewitsch, der in der Armee des Zaren gedient hatte. Bald nach seiner Heimkehr erkrankte Jankewitsch an der Spanischen Grippe, die in den Folgejahren weltweit mehr Opfer fordern sollte als der Große Krieg insgesamt. Das Virus breitete sich im Dorf aus, nur wenige wurden verschont. Die Toten wurden in den Wäldern bestattet, in Massengräbern, ausgehoben von Männern und Frauen, die bald darauf selbst in solche Gruben geworfen wurden.
Als die Epidemie abklang und so plötzlich verschwand, wie sie aufgetreten war, gab es niemanden mehr in Misowitschi.
Aus Angst, die Krankheit könnte noch in den Betten der Verstorbenen, in den ausgebleichten Porträts an der Wand und den Schubladen mit ihrem abgenutzten Besteck lauern, wurden die Gebäude und aller Hausrat sich selbst überlassen. Man ließ Regale mit Büchern verfallen, deren Seiten vor Feuchtigkeit aufgequollen, deren Deckel von grünem Schimmel überzogen waren. Bodendielen wölbten sich. Decken hingen durch und brachen ein, mit Honig verstopfte Bienenkörbe und Holztruhen mit Taufkelchen, Firmungsurkunden und Hochzeitskleidern krachten in die Zimmer darunter. In den Straßen und Gassen von Misowitschi wucherten Wildblumen.
Keiner sprach noch von dem Ort, als wäre er einfach aus dem Gedächtnis aller Bewohner der Nachbardörfer Borbin, Milostow und Klewan gelöscht worden.
Fast aller.
Ein Einheimischer nämlich, Gregor Hudsik, dachte durchaus noch an die Einwohner von Misowitschi und das Massengrab im Wald, wo sie alle zur Ruhe gebettet worden waren.
Hudsik war Hufschmied von Beruf. Sein Gewerbe hatte ihn zu einem der wohlhabenderen Bürger von Borbin gemacht. Er war mit seinem Wagen, mit Amboss, Blasebalg, Zange und Hammer von Ort zu Ort gezogen, bis nach Rowno und Luzk. Aber ein Hufschmied beschlug den lieben langen Tag nicht nur die Hufe der Pferde, er lauschte auch den Leuten. Mit einem, der nur einmal im Monat vorbeikam, redeten sie ganz anders als mit einem, den sie ständig sahen. Geduldig hörte er sich an, was sie von ihren Ängsten und Hoffnungen und Enttäuschungen berichteten. Von ihren Liebsten und ihren Geliebten. Ihren Lügen und Betrügereien. Nichts war zu gering, als dass ihm nicht doch einer davon erzählte. Stillschweigend ertrug Hudsik ihre manchmal vor selbstgerechter Eitelkeit nur so strotzenden Geschichten, wodurch er auch erfuhr, dass ein Großteil des Misowitschier Wohlstands in den Kieferknochen seiner Bewohner funkelte und glänzte.
Als 1939 der Krieg ausbrach, hatte Hudsik über zwanzig Jahre lang Pferde beschlagen. Zunächst hatte er geglaubt, der Krieg käme seiner Arbeit zugute, eines Tages im Sommer 1941 aber wurde er mitten auf der Straße von einer Kolonne der Roten Armee aufgehalten, die vor der deutschen Wehrmacht auf der Flucht war. Was ihm entgegenkam, waren klapprige, kaum noch fahrtüchtige Lastwagen, vor überladene Wagen gespannte Schindmähren sowie Männer, die barfuß vor sich hin schlurften, weil ihre billigen Stiefel längst zerschlissen waren.
Sie konfiszierten sofort seinen Wagen, seine Pferde und sämtliche Gerätschaften. Sogar seine Hufeisen nahmen sie ihm weg.
Als Hudsik, schluchzend vor wehrloser Wut, fragte, was er jetzt mit seinem Leben anfangen solle, bot ihm der Befehlshaber an, ihn mitzunehmen. Ansonsten, wurde Hudsik gesagt, könne er sein Glück ja bei den Deutschen versuchen, die nur ein paar Kilometer hinter ihnen seien.
Hudsik, der sich seiner misslichen Lage nur allzu bewusst war, stimmte zu. Ihm wurden die Stiefel, seine Pferde und der jetzt mit Verwundeten beladene Wagen zurückgegeben, und er schloss sich den fliehenden Rotarmisten an.
Eine Woche später trafen sie in Kiew ein. Hudsik wurde offiziell als Hufschmied in der Armee aufgenommen. Man verpasste ihm eine Uniform und den Dienstrang eines Feldwebels.
Zunächst kam Hudsik alles wie ein schlechter Scherz vor, allmählich aber dämmerte ihm, dass diese unvermutete Wendung des Schicksals ihm wahrscheinlich das Leben gerettet hatte.
Seine beiden Pferde starben im Winter jenes Jahres. Das erste trat auf eine russische Landmine, als es sich nachts losgerissen hatte und auf ein Feld hinausgetrottet war. Das zweite erfror in der Stadt Poshaists und wurde sofort in Stücke gehackt und verspeist. Der Wagen ging im Frühjahr 1942 kaputt. Die eisenbeschlagenen Räder eierten schon lange auf ihren Achsen, schließlich brach er unter dem Gewicht von tausend Hufeisen zusammen, die Hudsik von einer Gießerei in ein Nachschublager bringen sollte.
Hudsik starrte auf das Wrack und die über die Straße verstreuten Hufeisen, und ihm war, als wäre damit die letzte Verbindung zu seiner Heimat endgültig verloren.
Er nahm es als Zeichen, dass er nicht mehr lebend zurückkehren würde, hockte sich an den Straßenrand, legte den Kopf in die Hände und weinte.
Zeuge dieses Ereignisses wurde der berühmte Journalist Wassili Semjonowitsch Grossman, der einen Artikel für die Krasnaja Swesda schrieb, der Zeitung der Roten Armee. Darin erhob Grossman Hudsiks zerbrochenen Wagen zum Symbol für den heroischen Kampf der Roten Armee. Hudsik wurde sogar fotografiert, das Bild zeigte einen von jeglichem Glück verlassenen, schlamm- und rußverschmierten Mann mit verfilzten Haaren und stierem Blick, dessen Tränen Spuren über seine Wangen zogen.
Hätte es dieses Foto nicht gegeben, hätte sich Hudsiks unerbittlicher Blick in die Zukunft sogar bewahrheitet. Aber im Kreml blieb das kampfesmüde Gesicht nicht unbeachtet.
Bald darauf wurde Hudsik mit einem Orden ausgezeichnet, zum Hauptmann befördert und zum Stab des Hauptquartiers überstellt. Von jetzt an kutschierte er keine Pferdegespanne mehr und beschlug auch nicht mehr die Gäule an der Front. Diese Arbeit wurde anderen übertragen, die in großer Zahl starben und deren vermoderte Knochen zusammen mit den Gerippen der an ihrer Seite krepierten Pferde unbestattet in der russischen Steppe lagen.
1943, als Russland zur Offensive überging, war auch Hudsik wieder in Richtung seiner im Westen der Ukraine gelegenen Heimat unterwegs. Bald kannte er wieder die Ortschaften und deren Namen auf der Karte. Je näher er ihnen kam, desto mehr dachte er daran, was mit ihm selbst geschehen würde, wenn der Krieg vorbei war. Seine Pferde, sein Wagen und seine Werkzeuge waren längst fort, verstreut in den Weiten Russlands. Hudsik wusste, dass er von vorn beginnen musste, aber für einen Neuanfang war Kapital nötig, und wie um alles in der Welt sollte er an so viel Geld kommen?
Da fielen ihm die Gräber von Misowitschi ein.
An einem kalten, klaren Februarmorgen 1944 kam Hudsiks Einheit zwei Kilometer östlich von Rowno zu stehen, eine Stunde Fußmarsch von Misowitschi entfernt.
Es würde mehrere Stunden dauern, bis seine Abwesenheit auffiel, wusste Hudsik, als er sich mit seinem Gewehr und einer Schaufel davonschlich.
Das Massengrab war nicht schwer zu finden. Es lag zwischen mehreren Weiden, nur einen Steinwurf von der Straße entfernt.
Hudsik lehnte das Gewehr gegen einen Baum, hängte seinen Mantel an einen abgebrochenen Ast, nahm die Schaufel und begann zu graben. Unter dem Schnee kam eine etwa handbreit dicke Schicht gefrorenen Bodens zum Vorschein. Beinahe wäre ihm das Schaufelblatt gebrochen, als er hineinstach, aber darunter war die Erde nur leicht angefroren und ließ sich mühelos wegheben.
Gleich unter der Oberfläche stieß er auf die ersten Leichen. Es gab keine Särge. Manche der Skelette waren bekleidet, die meisten nur in Laken gehüllt. Die Toten waren tief in die Erde geschlichtet. Hudsik hatte sich schon bis zur Brust in den Boden gegraben, aber noch immer schienen darunter weitere Tote zu liegen.
Nach der ersten Stunde hatte er zwanzig Goldzähne aus den Kieferknochen gebrochen und in den kleinen Lederbeutel gesteckt, in dem er normalerweise seinen Tabak aufbewahrte. Wie viel von dem kostbaren Metall war noch in die Münder dieser Menschen getrieben, die, wenn es ans Begleichen von Rechnungen ging, Stein und Bein geschworen hatten, arm wie Kirchenmäuse zu sein. Etwas, was ihn immer mit stiller Verachtung erfüllt hatte.
Als er in die Augenhöhlen voller Erde starrte und die Schädel hin und her drehte, um nach dem Gold zu suchen, sah er wieder die Gesichter jener Männer und Frauen vor sich, die er aus Misowitschi gekannt hatte.
Dampf stieg von seinem schweißnassen Rücken auf, während er Rippenbögen und Schulterblätter und noch mit Knorpel versehene Beckenknochen zur Seite räumte. In der Luft hing der Modergeruch der Gebeine.
Einmal unterbrach er seine Arbeit und lauschte, für den Fall, dass sich jemand näherte. Aber nichts war zu hören, nur das harmlose Dröhnen eines Flugzeugs hoch über den Wolken. Hudsik hatte den größten Teil seines Lebens in diesen Wäldern verbracht, er hatte immer gespürt, wenn etwas nicht stimmte. Keiner konnte ihn überraschen. Nicht hier.
Hudsik machte sich wieder an die Arbeit und verbreiterte die Grube. Um ihn herum ragten die weißen Knochen aus dem Boden. Er kappte sie mit dem Schaufelblatt.
Plötzlich hielt er inne und hob den Kopf.
Jemand war da draußen.
Vorsichtig stellte er die Schaufel zur Seite und sah zu seinem Gewehr, das immer noch am Rand der Grube am Baumstamm lehnte. Er sah sich um, konnte aber niemanden entdecken. Auch war nichts Ungewöhnliches zu hören, nur der Wind in den Baumwipfeln und sein eigenes Schnaufen. Als er fast schon überzeugt war, dass ihm sein Gehirn etwas vorgaukelte, sah er zu seiner großen Verblüffung jemanden mitten auf dem Weg von Misowitschi entlangmarschieren.
Wer konnte das sein, in Misowitschi lebte doch keiner mehr? Niemand benutzte diesen Weg. Kurz streifte ihn der Gedanke, dass es sich um einen Geist handeln musste.
Der Fremde war ein Zivilist. Er hatte eine kurzkrempige Mütze auf dem Kopf, sein Gesicht war sauber rasiert. Er trug einen kurzen braunen Drillichmantel mit zwei großen aufgesetzten Taschen und zwei Knopfreihen. Unter dem offenen Mantel war ein Ledergürtel mit Holster zu erkennen. Über eine Schulter hatte er einen Leinwandbeutel mit Lederriemen geschlungen, an dem er, wie es schien, schwer zu tragen hatte.
Der Mann war ganz offensichtlich noch jung, sein Blick aber hatte nichts Jugendliches mehr an sich. Eine stumpfe Leere lag darin, in der Hudsik alle Alpträume zu erkennen glaubte, die diesen Mann je heimgesucht hatten.
Wahrscheinlich ein Partisan, dachte Hudsik. Es gab viele in der Gegend hier, und es ließ sich nicht immer gleich sagen, auf welcher Seite sie kämpften.
Hudsik duckte sich und erwartete insgeheim, dass der Fremde nur die Vorhut einer Patrouille bildete. Zu seiner Überraschung tauchte aber keiner mehr auf. Der Mann war allein und schien seine Umgebung überhaupt nicht zu beachten.
Was machte er hier?, fragte sich Hudsik. Wer in diesen Wäldern lebte, ging nie mitten auf dem Weg wie er hier, als hätte er Angst vor der Wildnis. Die Bewohner hielten sich immer in den Schatten am Wegesrand, weil sie wussten, dass die Wildnis sie beschützte. Wie konnte jemand, der allein war, so selbstsicher sein? Es beunruhigte Hudsik, dass er darauf keine Antwort fand.
Völlig reglos sah er zu, wie der Mann keine zwanzig Schritte von ihm entfernt vorbeiging. Hudsik war überzeugt, dass er unbemerkt geblieben war.
Doch dann, als der Fremde genau auf gleicher Höhe mit Hudsik war, blieb er plötzlich stehen und drehte sich zu ihm hin.
In diesem Augenblick wurde Hudsik bewusst, dass der andere ihn von Anfang an gesehen hatte. Er stand bis zur Brust in der Grube, um ihn herum lagen die Schädel und Rippenbögen und die verwachsenen Wirbelknochen, und er wusste, dass er sich mit keiner noch so ausgefallenen Erklärung mehr aus dieser Situation herausreden konnte. Ihm wurde eiskalt. Wieder sah er zu seinem am Baum lehnenden Gewehr.
Der Fremde folgte dem Blick.
Hudsik wartete. Er würde das Gewehr nie erreichen können, bevor der andere seine Waffe zog. Er konnte nur hilflos warten, bis der andere entschied, was er tun wollte.
Langsam, wortlos, wandte sich der Fremde ab und setzte seinen Weg fort. Bald war er nicht mehr zu sehen.
Erst als die Schritte des Fremden verklungen waren, fühlte sich Hudsik wieder sicher. Erleichtert atmete er aus und stützte sich schwer auf die Schaufel, als hätte ihn plötzlich jegliche Kraft verlassen. Sollte er weitergraben? Reichte die bisherige Ausbeute?, fragte er sich und umklammerte den Lederbeutel an seinem Hals. Ein wenig vielleicht noch. Nur noch etwas mehr Gold. Was nützte es denen denn noch? Und dann wollte er sie in Ruhe lassen und nie wiederkommen. Nie wieder. Ganz bestimmt. Fast ganz bestimmt.
Hudsik grub weiter und freute sich, als er im nächsten ausgehobenen Schädel zwei Goldzähne fand. Mit einem zufriedenen Grunzen drehte er sie heraus, was sich anhörte, als würde ein Selleriestengel brechen, und ließ sie in seinen Lederbeutel gleiten.
Da hörte er hinter sich den leisen Atem eines Menschen. Er erstarrte. »Wer ist da?«, flüsterte er. Er wagte es nicht, sich umzudrehen.
Keine Antwort. Immer noch hörte Hudsik den Atem.
Langsam wandte er sich um, hielt schützend das Schaufelblatt vors Gesicht, und dann sah er den Fremden vor sich.
Der andere stand am Rand der Grube mit einer Pistole in der Hand, deren Lauf direkt auf Hudsiks Gesicht gerichtet war.
»Hast du gefunden, wonach du gesucht hast?«, fragte er.
Vorsichtig lugte Hudsik hinter seiner Schaufel hervor. »Ja«, antwortete er heiser und klammerte sich an die leise Hoffnung, sich vielleicht freikaufen zu können. »Es ist genug für uns beide da.« Trotz seiner Todesangst gelang ihm ein breites Lächeln. »Mehr als genug«, bekräftigte er.
Mit einem dumpfen Knall durchbohrte das Geschoss das rostige Schaufelblatt, trat durch Hudsiks rechtes Auge ein und am Hinterkopf wieder aus.
Kurz betrachtete der Fremde den jetzt unten in der Grube liegenden Hudsik. Dann hievte er den Leichnam heraus, zog ihm die Uniform aus und schlüpfte selbst hinein. Dann rollte er den feisten blassen Leichnam zurück in die Grube, warf das Gewehr, seine eigene Kleidung und die Schaufel hinterher, bevor er Erde in das Loch schob, bis vom Hufschmied nichts mehr zu sehen war.
Sorgfältig klopfte er sich die Erde von den Ärmeln, verließ die Gräberstätte und marschierte mitten auf dem Weg weiter.
Moskau Kreml
Major Kirow stand in Habtachtstellung und hatte den Blick auf die blutrote Wand hinter Josef Stalins Schreibtisch gerichtet.
In den vergangenen Minuten hatte Stalin die Anwesenheit des Majors ignoriert und sich eingehend mit den vor ihm ausgebreiteten Papieren beschäftigt – wobei der Major nicht zu sagen wusste, ob Stalin sie wirklich las oder es nur genoss, Kirow zappeln zu lassen.
Als der Generalsektretär endlich die Dokumente beiseitelegte, war Kirows Hemd schweißgetränkt.
Stalin lehnte sich zurück, hob den Kopf und musterte mit seinen gelb-grünen Augen in aller Seelenruhe den Mann vor sich. »Major Kirow.«
»Genosse Stalin!«
»Irgendwas von Pekkala?«
»Nichts, Genosse Stalin.«
»Wie lange gilt er jetzt schon als vermisst? Zwei Jahre, nicht wahr?«
»Und drei Monate. Und fünf Tage.«
Pekkala war in Lappeenranta, Finnland, geboren, zu einer Zeit, als das Land noch zu Russland gehört hatte. Seine Mutter, eine Lappländerin, stammte aus Rovaniemi im Norden. Im Alter von achtzehn Jahren war Pekkala auf Wunsch seines Vaters nach Petrograd aufgebrochen, um sich zum Finnischen Garderegiment des Zaren zu melden. Dort war er zu Beginn der Ausbildung vom Zaren persönlich ausgewählt und zu dessen Sonderermittler bestimmt worden. Mit dieser Position, die es davor nicht gegeben hatte, erlangte Pekkala eine bis dahin unvorstellbare Machtfülle.
Im Lauf seiner Ausbildung war er zunächst der Polizei unterstellt, dann der Staatspolizei – der Gendarmerie – und schließlich der zaristischen Geheimpolizei, der Ochrana. In dieser Zeit öffneten sich ihm Türen, von denen nur die wenigsten wussten, dass es sie überhaupt gab. Nach Abschluss der Ausbildung überreichte der Zar ihm ein Abzeichen, das einzige Dienstemblem, das er jemals trug – eine schwere Goldscheibe, deren Durchmesser der Länge seines kleinen Fingers entsprach. Sie war mit einer weißen, ovalen Emailleintarsie versehen, die sich durch die gesamte Goldscheibe zog und in der Mitte, an ihrer dicksten Stelle, den halben Durchmesser ausfüllte. Und in der Mitte dieses weißen Emailleovals steckte ein großer, runder Smaragd. Zusammen bildeten diese Elemente die unverkennbare Gestalt eines Auges. Es dauerte nicht lange, da war Pekkala als »das Smaragdauge« bekannt. Sehr viel mehr wusste man über ihn nicht. Es gab keine Fotos von ihm. In Ermangelung von Fakten rankten sich um ihn bald Legenden sowie Gerüchte, denen zufolge er kein Mensch sei, sondern eine Art Dämon, der durch die schwarzen Künste eines arktischen Schamanen zum Leben erweckt worden war.
Dienstlich war Pekkala einzig und allein dem Zaren unterstellt. In dieser Zeit lernte er die Geheimnisse des Russischen Reichs kennen, und als dieses Reich unterging und jene, die seine Geheimnisse bewahrt hatten, diese mit ins Grab nahmen, war Pekkala zu seinem großen Erstaunen immer noch am Leben.
Während der Revolution wurde er verhaftet, wegen Verbrechen gegen den Staat zu einer dreißigjährigen Haftstrafe verurteilt und ins sibirische Arbeitslager Borodok verbannt. Es lag tief in den Wäldern von Krasnagoljana und galt als das berüchtigtste aller Gulag-Lager.
Dort nahmen sie ihm seinen Namen. Von da an war er nur noch Gefangener 4745.
Gleich nach seiner Ankunft in Borodok schickte der Lagerleiter ihn in die Wälder, weil er fürchtete, die anderen Insassen könnten seine wahre Identität herausfinden. Die durchschnittliche Lebenserwartung eines Baummarkierers betrug ein halbes Jahr. Diese Männer arbeiteten allein, fernab von anderen Menschen und ohne die geringste Fluchtmöglichkeit; sie erfroren oder verhungerten oder starben an Einsamkeit. Wer sich verirrte, wer stürzte und sich dabei ein Bein brach, fiel meistens den Wölfen zum Opfer. Bäumemarkieren war die einzige Tätigkeit in Borodok, die noch gefürchteter war als die Todesstrafe.
Jeder ging davon aus, dass der Gefangene 4745 vor Ablauf des Winters tot sein würde, aber nach neun Jahren hatte er länger durchgehalten als jeder andere im Gulag.
Dreimal im Jahr wurden ihm am Ende eines Waldwegs Nahrungsmittel und andere Güter abgestellt. Petroleum, Dosenfleisch, Nägel. Um alles andere musste sich Pekkala selbst kümmern.
Er war groß, breitschultrig, hatte eine gerade Nase und kräftige, weiße Zähne. Seine Augen waren grünlich braun, die Iris hatte etwas seltsam Silbriges an sich, was anderen nur auffiel, wenn er ihnen direkt in die Augen sah. Vorzeitig ergraute Strähnen zogen sich durch die langen, schwarzen Haare, auf den wettergegerbten Wangen wucherte ein Vollbart.
In den Wäldern stützte er sich auf einen kräftigen Knüppel, einen knorrigen Wurzelstock, aus dem Hufnägel mit Vierkantköpfen ragten. Sonst hatte er nur noch einen Eimer mit roter Farbe bei sich, mit der er die zu fällenden Bäume markierte. Er benutzte dafür keinen Pinsel, sondern hielt nur die Hand in die rote Farbe und hinterließ seinen Abdruck auf den Stämmen. Diese Abdrücke waren meist alles, was die anderen Häftlinge von ihm zu sehen bekamen.
Nur selten wurde er von den Holzfällern gesichtet. Was sie erhaschten, war ein Wesen, das mit einem Menschen kaum mehr etwas gemein hatte. In seiner mit roter Farbe verkrusteten Häftlingskleidung, mit seinen langen Zottelhaaren glich er eher einem wilden Tier, dem das Fell abgezogen worden war und das man zum Sterben hatte liegen lassen – und das es trotzdem irgendwie geschafft hatte, zu überleben. Wilde Gerüchte rankten sich um ihn: Er esse Menschenfleisch, er trage einen Brustpanzer aus den Knochen derer, die in den Wäldern verschwunden waren, er habe eine Mütze aus zusammengenähten Skalps.
Sie nannten ihn den Mann mit den blutigen Händen. Keiner außer dem Kommandanten von Borodok wusste, woher dieser Gefangene gekommen oder wer er früher gewesen war. Die gleichen Männer, die eine Heidenangst davor hatten, ihm über den Weg zu laufen, hatten nicht die geringste Ahnung, dass er Pekkala war – dessen Namen sie einst angerufen hatten wie ihre Vorfahren die Götter.
In den Wäldern von Krasnagoljana hatte Pekkala zu vergessen versucht, was er zurückgelassen hatte.
Aber die Welt hatte ihn nicht vergessen.
Auf Stalins persönlichen Befehl wurde er nach Moskau zurückgebracht, um als Ermittler für das Büro für Besondere Operationen zu arbeiten. Seitdem hatte zwischen dem Smaragdauge und dem Mann, der ihn einst zum Tod verurteilt hatte, ein brüchiger Waffenstillstand geherrscht. Nach seinem letzten Einsatz aber, der ihn hinter die deutschen Linien geführt hatte, war Pekkala verschwunden und galt seitdem als tot.
»Aber Sie, Major Kirow, sind davon überzeugt, dass er noch am Leben ist.«
»Jawohl, Genosse Stalin«, erwiderte Kirow. »Es sei denn, man legt mir Beweise vor, die mich vom Gegenteil überzeugen.«
»Es konnte Sie nicht überzeugen, dass seine persönlichen Habseligkeiten einem Leichnam auf dem Schlachtfeld abgenommen wurden? Für manche ist das ein ausreichender Beweis, dass Pekkala nicht mehr unter uns weilt.«
Zu diesen Habseligkeiten gehörten der Pass des Inspektors sowie sein Webley-Revolver mit Messinggriff, ein Geschenk des Zaren Nikolaus II. Geborgen wurde das alles vom Schützen Stefanow, dem letzten Überlebenden einer sowjetischen Flak-Abteilung, die bei den Kämpfen um Leningrad vollständig aufgerieben worden war. Nachdem Stefanow tagelang durch die von den Deutschen besetzten Gebiete geirrt war, erreichte er schließlich die sowjetischen Linien. Und dort befahl man ihm, sich sofort wieder als Pekkalas Führer nach Zarskoje Selo auf den Weg zu machen, der Sommerresidenz des Zaren und Schauplatz der Kämpfe, denen er eben erst entronnen war.
Ziel von Pekkalas Einsatz war es, herauszufinden, wo die unschätzbare, mit Bernstein ausgekleidete Wandvertäfelung abgeblieben war, die einst den Katharinenpalast geschmückt und zu den größten Schätzen der Romanows gehört hatte.
Alle Versuche, die Bernsteintafeln abzubauen und hinter dem Ural in Sicherheit zu bringen, waren gescheitert. Der Leim, der die Bernsteinfragmente zusammenhielt, war über zwei Jahrhunderte alt und so brüchig geworden, dass an einen Transport nicht mehr zu denken war. Angesichts der vorrückenden Deutschen beschlossen die verzweifelten Museumsleute daher, den Bernstein unter Baumwollbahnen und Tapeten zu verstecken, um den Deutschen vorzutäuschen, der Bernstein wäre fortgeschafft worden. Eine Radiomeldung im vom Feind abgehörten Staatsrundfunk, wonach der Bernstein sicher in Sibirien sei, sollte die Deutschen in diesem Glauben bestärken.
Aber die Bernsteintafeln aufzuspüren, war nur eine von Stalins Anweisungen. Sollte der Bernstein tatsächlich von den Deutschen entdeckt worden sein, lautete Pekkalas Befehl, die Tafeln mit Sprengstoff zu zerstören, damit sie keinesfalls ins Deutsche Reich abtransportiert werden konnten.
Doch als Pekkala und Stefanow in Zarskoje Selo anlangten, stellten sie fest, dass die Tafeln nicht nur entdeckt, sondern bereits auf einen Lastwagen verladen waren. Sie sollten zum Bahnhof von Wilna und von dort, wie Pekkala erfuhr, nach Königsberg geschickt und an sicherer Stelle eingelagert werden, bis der Bernstein als Teil eines neuen, in Linz geplanten Führermuseums nach Oberösterreich gebracht werden konnte.
Um den Abtransport zu verhindern, durchquerten die beiden Männer in der Nacht den Wald von Murom und brachten an einer Brücke eine Sprengladung an.
Im Morgengrauen tauchten zwei Fahrzeuge auf, ein Lastwagen sowie ein Panzerspähwagen, der bei der Detonation der Brücke zerstört wurde.
Schütze Stefanow berichtete Major Kirow, wie er und Pekkala von der bewaffneten Begleitmannschaft unter Beschuss genommen wurden. Im anschließenden Feuergefecht starben alle deutschen Soldaten, und Pekkala befahl Stefanow, zu den russischen Linien zurückzukehren, während er selbst Vorbereitungen traf, um die Bernsteintafeln zu vernichten.
Auf einem bewaldeten Hang wartete Stefanow anschließend, dass Pekkala nachkam. Dann, so berichtete er Kirow, sah er dort, wo der deutsche Konvoi mit den Bernsteintafeln zum Stehen gekommen war, eine gewaltige Explosion. Nachdem Pekkala auch nach längerer Zeit nicht auftauchte, kehrte Stefanow zur Brücke zurück.
Am Straßenrand fand er einen durch die gewaltige Explosion verstümmelten und versengten Leichnam. Aus den Überresten zog er Pekkalas persönliche Habseligkeiten, die er nach seinem Eintreffen in Moskau Kirow übergab.
»Genosse Stalin«, sagte Kirow, »der Leichnam war so stark verkohlt, dass er nicht mehr zu identifizieren war. Es ist durchaus möglich, dass es sich gar nicht um den Inspektor gehandelt hat.«
»Ja, aber wenn dem so wäre, dann wäre Pekkala seitdem doch bestimmt aufgetaucht. Sie haben alles getan, um ihn zu finden, und trotzdem ist er nach wie vor wie vom Erdboden verschluckt.«
»Vielleicht«, erwiderte Kirow zerknirscht, »hätte ich mehr Erfolg gehabt, wenn ich nicht durch jeden Fall, der mir seit seinem Verschwinden übertragen wurde, in Moskau festgehalten worden wäre – denn hier, wie ich mit Sicherheit sagen kann, hält er sich bestimmt nicht auf.«
»Woher nehmen Sie diese Gewissheit?«
»Warum sollte er nach Moskau kommen, wenn er sich damit bloß in Lebensgefahr begibt?«
»In Lebensgefahr? Aber durch wen denn?«
Kirow zögerte. »Durch Sie, Genosse Stalin.«
Eine Weile sagte Stalin nichts.
Kirows Worte schienen im roten Teppich, in den roten Samtvorhängen, in den Wänden zu versickern, hinter denen Geheimgänge von einem Raum zum nächsten führten.
In der anhaltenden Stille glaubte Kirow zu spüren, wie sich ihm eine unsichtbare Schlinge um den Hals zog und ihr strammer Knoten sich in seinen Nacken bohrte.
Schließlich räusperte sich Stalin. »Warum sagen Sie so etwas, Major Kirow? Pekkala hat seine Befehle ausgeführt, nur ist es ihm nicht mehr gelungen, nach Moskau zurückzukehren. Damit hätte er sich einen Orden verdient – falls ich ihn davon hätte überzeugen können, einen anzunehmen.«
»Sie haben eines vergessen, Genosse Stalin.«
»Und das wäre?«
»In der Rundfunkübertragung wurde gesagt, die Bernsteintafeln seien in Sibirien in Sicherheit, gleichzeitig haben Sie das Bernsteinzimmer zu einem unersetzlichen Staatsschatz erklärt.«
»Das stimmt. Und was ist damit?«
»Wie Sie sicherlich wissen, bedeutete dieser Erlass, dass das Bernsteinzimmer unter keinen Umständen zerstört werden darf. Und nachdem Sie, Genosse Stalin, das erlassen haben …«
Stalin beendete für ihn den Satz. »… würde ich keinesfalls wollen, dass die Welt erfährt, dass ich seine Zerstörung angeordnet habe.«
Kirow war viel zu weit gegangen, um jetzt noch einen Rückzieher zu machen. »Also würde Pekkala geopfert werden müssen. Er muss es von Anfang an gewusst haben, als Sie ihm den Befehl erteilt haben.«
Zu Kirows Überraschung folgte kein Wutausbruch, wie es sonst der Fall war, wenn man Stalin mit Unangenehmem konfrontierte. Stattdessen trommelte der Generalsekretär mit den Fingern auf die Schreibtischplatte und suchte nach Worten, die diesem offensichtlichen Widerspruch einen Sinn entlocken könnten. »Das alles mag ja durchaus so gewesen sein, als ich Pekkala 1941 mit dieser Aufgabe betraut habe. Aber seitdem haben sich die Dinge doch geändert. Nach der Niederlage der Deutschen in Stalingrad hat sich das Blatt gewendet. Die Alliierten haben Nordafrika erobert und rücken in Italien vor. Bald werden sie auch in Mitteleuropa landen. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis die deutschen Streitkräfte zwischen unseren unaufhaltsam vorrückenden Armeen aufgerieben werden. Was mit dem Bernsteinzimmer geschehen ist, interessiert niemanden mehr angesichts der Siege der Roten Armee. Aber das gilt nicht für Pekkala. Er ist es, der sich als unersetzlich erwiesen hat, nicht das Bernsteinzimmer, das er auf meinen Befehl hin zerstören sollte. Seitdem er fort ist, habe ich mit ansehen müssen, wie Verbrechensfälle nicht aufgeklärt wurden und Täter entkommen konnten, weil nur Pekkala sie hätte fassen können. Trotzdem …« Stalin beugte sich vor und strich leicht mit beiden Händen über den Schreibtisch. »Von Pekkala fehlt seitdem jede Spur, was jeden vernünftigen Menschen zu dem Schluss führt, dass er endgültig und für immer verschwunden ist.«
»Dann blasen Sie die Suche also ab?«
»Im Gegenteil. Ich habe nie behauptet, ein vernünftiger Mensch zu sein.«
»Wie lauten dann Ihre Befehle, Genosse Stalin?«
»Finden Sie Pekkala! Klappern Sie meinetwegen die ganze Welt nach ihm ab! Bringen Sie mir diesen vielgestaltigen Dämon! Von jetzt an bis zu dem Zeitpunkt, an dem der Inspektor hier vor mir steht oder seine Gebeine auf diesem Schreibtisch liegen, sind Sie von allen weiteren Verpflichtungen entbunden.«
Kirow schlug die Hacken zusammen und trat hinaus ins Vorzimmer, wo Stalins Sekretär Poskrjobyschew eifrig einem Stoß Dokumente mit einem Stempel Stalins Unterschrift aufdrückte.
»Major!«, rief Poskrjobyschew, als er Kirow erblickte.
Kirow, wegen Stalins Befehl tief in Gedanken versunken, nickte nur und ging einfach weiter. Er war schon am Ende des Flurs und wollte die Treppe hinunter, die zum Ausgang und zu seinem Wagen führte, als er hinter sich erneut seinen Namen rufen hörte.
Wieder war es Poskrjobyschew.
Der stämmige kleine Mann mit dem spärlichen Haarwuchs kam in seinen Lederpantoffeln – die er im Vorzimmer immer trug, um den Genossen Stalin nicht zu stören – eilig angelaufen.
»Warten Sie!«, schnaufte Poskrjobyschew, als er vor Kirow zu stehen kam. »Ich muss kurz mit Ihnen reden, Major.«
Kirow sah ihn fragend an. Er hatte Poskrjobyschew noch nie außerhalb seines Vorzimmers gesehen. Fast kam es ihm vor, als könnte der Sekretär – wie ein Goldfisch in seinem Wasserglas – in keiner anderen Umgebung existieren.
Zögernd machte Poskrjobyschew einen weiteren Schritt auf Kirow zu, bis sich die beiden Männer unangenehm nahe gegenüberstanden. Langsam hob Poskrjobyschew den Arm, ergriff die Lasche an Kirows Brusttasche und begann wie hypnotisiert den Stoff zwischen Daumen und Zeigefinger zu befühlen.
»Was ist denn los, Poskrjobyschew?«, platzte Kirow heraus und stieß ihn von sich.
Nervös sah sich Poskrjobyschew um, als wollte er sich vergewissern, dass niemand zuhörte. Aber im Flur war keiner zu sehen, auch die nächstgelegenen Türen waren alle geschlossen. Und dahinter hätte das Klappern der Schreibmaschinen jedes im Flur gesprochene Wort übertönt. Dennoch rückte Stalins Sekretär wieder näher, was Kirow dazu veranlasste, sich bedenklich nach hinten zu neigen. »Sie sollten Linsky mal einen Besuch abstatten«, flüsterte er.
»Linsky? Pekkalas altem Schneider?«
Poskrjobyschew nickte ernst. »Linsky kann Ihnen helfen, Major, so wie er auch Pekkala geholfen hat.«
»Ja, ich bin mit Pekkalas Garderobewünschen durchaus vertraut, und, Poskrjobyschew, glauben Sie mir, er hätte in dieser Hinsicht Hilfe bitter nötig. Wenn ich also eine neue Uniform brauchte, was aber nicht der Fall ist, dann darf ich Ihnen versichern, dass ich keinesfalls zu Linsky gehen würde!« Dabei drückte er die Lasche wieder zu, als hätte er Angst, dass seine Brieftasche verlorengehen könnte.
»Es ist nur ein freundlicher Rat.« Poskrjobyschew lächelte geduldig. »Auch das kleinste Detail sollte nicht außer Acht gelassen werden.«
Er war verrückt geworden, dachte Kirow und sah Poskrjobyschew hinterher, der mit huschigen Schritten in sein Büro zurückkehrte. Der Mann hatte komplett den Verstand verloren.
(Poststempel: Gorki, 14. Oktober 1936)
Zensur durchlaufen, Bezirksbüro 7, NKWD
Ford-Motorwerke
Arbeiterwohnblock 3, »Haus der Freiheit«
Gorki, UdSSR
An:
United Brotherhood of Steelworkers, Branch 11,
Jackson St.,
Newark, New Jersey, USA
Jungs, das solltet ihr mal sehen!
Ich arbeite jetzt für die Ford-Motorwerke, eine Fabrik genau wie zu Hause in Rouge River, und geleitet wird sie von einem Amerikaner, der auch dort gearbeitet hat – einem Mr. Victor Herman. Der einzige Unterschied ist der, ich muss mir in Russland keine Sorgen machen, dass ich gefeuert oder vom Schichtleiter von oben herab behandelt werde, ohne mich dagegen wehren zu können. Ich habe ein Haus, genau wie man es mir versprochen hat, mit fließend warmem Wasser und einem Dach, durch das nicht der Regen tropft. Meine Frau ist glücklich über unser neues Zuhause, für das wir keine Miete zahlen müssen, und meine Tochter und mein Sohn gehen auf die örtliche Schule, wo man Englisch spricht. Wir haben jetzt sogar unsere eigene Zeitung, die »Moscow News«.
Es ist alles so, wie ich es mir erhofft habe, und sogar noch besser. Ich arbeite hart, werde pünktlich bezahlt, und wenn ich krank werde, gibt es Ärzte, die mich kostenlos behandeln. An den Wochenenden spielen wir Baseball, daneben gibt es auch Clubs für uns, in denen wir Karten spielen und uns entspannen können.
Und falls ihr meint, alle guten Jobs wären schon vergeben, dann lasst euch gesagt sein: Hier gibt es noch eine Menge freier Stellen. Das ganze Land ist im Umbruch. Es werden Brücken gebaut, Flugzeuge, Eisenbahnen, Häuser, was auch immer man sich vorstellen kann, und dazu braucht man Facharbeiter wie uns. Also, kommt alle! Wartet keinen Tag länger. Armtorg, das russische Unternehmen in New York, kann euch bei den Einwanderungspapieren helfen, dann gibt es auch noch Intourist, die schaffen euch mit einem Touristenvisum herüber. Glaubt mir, wenn ihr erst mal hier seid in der Sowjetunion, wollt ihr nicht mehr zurück.
Eure neuen Freunde warten auf euch.
Und euer alter Kumpel,
Bill Vasko
Nach der Rückfahrt durch die Stadt stieg Kirow hinauf in sein Büro im vierten Stock. Er schloss die Tür auf – eine Bewegung, die ihm im Lauf der Jahre so in Fleisch und Blut übergegangen war, dass er sie kaum noch wahrnahm –, trat ins Zimmer und ließ sich auf den zerschlissenen Stuhl am Ofen fallen.
Die Stille bekam etwas Bedrückendes, während er auf Pekkalas leeren Schreibtisch starrte.
Stalins Befehl hatte Kirow in seiner Überzeugung keineswegs bestärkt. Sein halsstarriges Festhalten daran, dass Pekkala noch am Leben war, erschien ihm seit einiger Zeit selbst als eine reine Wunschvorstellung. Wenn Pekkala wirklich noch irgendwo da draußen war, hätte er sicherlich Mittel und Wege gefunden, ihm Bescheid zu geben.
Warum konnte er es nicht akzeptieren, dass Pekkala wirklich tot war?
Nun, ein kleines Detail gab es, an das sich Kirow klammerte, seitdem er von Pekkalas Tod erfahren hatte. Es ging nicht darum, was Schütze Stefanow am verkohlten Leichnam gefunden hatte, sondern um das, was er nicht gefunden hatte – nämlich das Smaragdauge.
Sollte man Pekkala zwingen, sich von all seinen weltlichen Gütern zu trennen, würde er das Smaragdauge trotzdem niemals hergeben, davon war Kirow überzeugt. Das goldene Abzeichen war das Kostbarste, was der Inspektor besaß; das Symbol für alles, was er erreicht hatte, seitdem der Zar es ihm ans Revers seines Mantels geheftet hatte.
Bei der Befragung hatte Schütze Stefanow darauf beharrt, dieses Abzeichen nirgends am Leichnam gesehen zu haben. Daher vermutete Kirow, dass Pekkala seinen eigenen Tod nur vorgetäuscht hatte und sich seitdem versteckt hielt.
Seit dem Tag, an dem Kirow die bröseligen Reste von Pekkalas Pass und den durch die Hitze verzogenen Webley-Revolver mit eigenen Augen gesehen hatte, geisterte ihm die Frage, wo das Abzeichen geblieben war, unaufhörlich durch den Kopf. Eine zufriedenstellende Antwort hatte er aber nach wie vor nicht parat.
Und wäre Elisaweta nicht gewesen, wäre er längst verrückt geworden.
Kirow hatte Elisaweta Kapanina kurz vor Pekkalas Aufbruch zu seinem letzten Einsatz kennengelernt. Sie arbeitete im Archiv der NKWD-Zentrale. Die Räumlichkeiten lagen im dritten Stock, was einen so mühseligen Aufstieg mit sich brachte, dass die meisten, die nach Dokumenten aus dem Archiv nachfragten, ihre Wünsche der Sekretärin im Erdgeschoss mitteilten und am nächsten Tag erneut vorbeikamen, um die bereitgelegten Unterlagen abzuholen. Aber die Treppenfluchten waren nicht der einzige Grund, warum Gäste den dritten Stock mieden. Die Leiterin des Archivs, Feldwebel Gatkina, war als fürchterlicher Drachen verschrien, so dass Kirow jahrelang den Rat seiner NKWD-Kollegen beherzigt und sich vom dritten Stock ferngehalten hatte.
Aber dann war der Tag gekommen, an dem Pekkala darauf bestand, dass gewisse Dokumente umgehend zu beschaffen seien. Da ihm nichts anderes übrigblieb, nahm Kirow den Aufstieg auf sich. Er hatte keine Ahnung, wie Feldwebel Gatkina aussah, aber als er das Schaltergitter erreichte, hinter dem Abertausende NKWD-Akten in staubiger Stille vor sich hin schlummerten, hatte in seiner Fantasie ein alptraumhaftes Wesen schaurige Gestalt angenommen.
Vorsichtig legte er die Hand auf den kleinen runden Buckel einer Klingel, die auf dem Schalter nur für diesen Zweck bereitzustehen schien. Allerdings berührte er die Klingel dabei so sacht, dass sie kaum einen Laut von sich gab. Der zweite Versuch sollte ihm besser gelingen, also schlug er mit der Faust darauf. Die Klingel gab ein schrilles Klirren von sich und sprang vom Schalter, als hätte der Hieb sie zum Leben erweckt, kullerte über den Boden und erklang noch lauter als zuvor.
Bevor Kirow sie zu fassen bekam, war sie bereits über den schmalen Gang gerollt, anschließend die Treppe zum Absatz der zweiten Etage hinuntergepoltert und hatte dabei ein wahnsinniges Geschepper von sich gegeben, das durch die gesamte NKWD-Zentrale zu gellen schien.
Bis Kirow die Klingel schließlich zu fassen bekommen hatte, war jemand am Schaltergitter erschienen.
Kirow sah nur das Gesicht einer Frau, aber er war überzeugt, dass es sich um den übellaunigen Feldwebel handeln musste. Nur, wurde Kirow bewusst, als er sich näherte, wenn diese lächelnde Person hinter den schwarzen Gitterstäben wirklich Feldwebel Gatkina war, dann konnten die Gerüchte über ihr fürchterliches Äußeres nicht stimmen. Denn das Wesen, das ihn ansah, war schlank, hatte sommersprossige Wangen, ein rundes Kinn und dunkle, durchdringende Augen.
»Genossin Gatkina?«, fragte er nervös.
»Oh, das bin ich nicht«, erwiderte die Frau. »Aber soll ich sie holen?«
»Nein!«, platzte Kirow heraus. »Schon in Ordnung. Danke. Ich bin hier, um ein Dokument abzuholen.« Er durchwühlte seine Tasche nach dem Zettel, auf den Pekkala die gewünschte Aktennummer notiert hatte. Unbeholfen schob er den zerknüllten Zettel unter dem Gitter hindurch.
»Es kommt nämlich nur ganz selten jemand hier hoch«, bemerkte die Frau, während sie Pekkalas Handschrift zu entziffern versuchte.
»Wirklich?« Kirow strengte sich sehr an, um sich überrascht zu geben. »Woran kann das bloß liegen?«
»Was ist mit der Klingel?«, fragte die Frau plötzlich, ohne auf seine Frage einzugehen. »Sie ist nicht da.«
»Ich hab sie hier.« Hastig stellte Kirow sie auf den Schalter.
»Das ist Feldwebel Gatkinas Klingel«, flüsterte die Frau.
»Sie hat ihre eigene Klingel?«
»Ja.« Die Frau nickte.
In den folgenden Augenblicken starrten sie beide auf die kleine silberne Kuppel, als könnten die Beulen, die sie nun verunzierten, unverhofft wie Quecksilberkügelchen zusammenfließen, damit die Oberfläche wieder gänzlich glatt und heil werden würde.
Schließlich unterbrach die Archivarin das Schweigen. »Ich hole Ihnen Ihre Dokumente, Major«, sagte sie und verschwand im Papierlabyrinth des Archivs.
Kirow schritt derweil zwischen den beiden geschlossenen Türen am jeweiligen Ende des Flurs auf und ab und wunderte sich, dass er diese Frau noch nie gesehen hatte, weder in der Kantine noch im Eingangsbereich noch auf der Treppe. Sie musste neu sein, dachte er. Sonst hätte er sich sicher an ihr Gesicht erinnert. Und er überlegte, wie er sie öfter treffen, wie er vielleicht sogar ihren Namen erfahren und sie hinter dem Gitter hervorlocken könnte.
Kurz darauf erschien jemand am Schalter.
»Das ging aber schnell!«, sagte Kirow fröhlich.
»Was ist mit meiner Klingel passiert?«, war eine kratzige Stimme zu hören.
Kirow fuhr der Schreck in die Glieder. Vor ihm stand eine stämmige Matrone mit aschgrauem Gesicht und grauer Stoppelfrisur. Der Kragen ihrer Uniformjacke war streng geschlossen, die Hautfalten am Hals quollen darüber wie der Zuckerguss eines Kulitsch-Osterbrots. Zwischen ihren Fingern steckte eine handgerollte Machorka, deren beißender Qualm sie so dicht umhüllte, dass ihr ganzer Arm zu schwelen schien. Das also, dachte er, war Gatkina.
»Meine Klingel«, wiederholte die Frau.
»Sie ist runtergefallen«, bemühte sich Kirow zu erklären. »Ich hab sie aufgehoben. Es ist gar nichts passiert.« Zur Bekräftigung seiner Aussage trat er an den Schalter und verpasste der Klingel einen vergnügten Schlag, aber statt ohrenbetäubend zu schrillen, war nur ein dumpfes, ersticktes Quäken zu vernehmen.
»Was wollen Sie hier?«, fragte Feldwebel Gatkina. Sie schien mit dieser Frage seine gesamte irdische Existenz in Zweifel zu ziehen.
In diesem Augenblick ging eine der Nebentüren auf, und die dunkeläugige junge Frau trat in den Gang. »Ich hab Ihre Dokumente, Major.«
»Danke!«, stammelte Kirow und beeilte sich, von ihr den mattgrauen Umschlag in Empfang zu nehmen.
»Stimmt etwas nicht?«, fragte sie.
Gatkina, mit einer Stimme, die röhrte wie ein Hochofen, schaltete sich dazwischen. »Er hat die Klingel kaputt gemacht.«
»Genossin Feldwebel!« Die junge Frau schnappte hörbar nach Luft. »Ich hab Sie gar nicht gesehen.«
»Offensichtlich nicht«, erwiderte Gatkina verächtlich und sog an der Zigarette, deren Spitze tiefrot aufleuchtete, als sie inhalierte.
»Ich muss jetzt los«, verkündete Kirow zu niemand Bestimmtem.
Die junge Frau lächelte schwach. »Bringen Sie die Dokumente einfach zurück, wenn Sie sie nicht mehr benötigen, Major …«
»Kirow. Major Kirow.«
Das war der Moment, an dem er sie eigentlich nach ihrem Namen hätte fragen wollen, woher sie kam und ob sie vielleicht zufällig nach der Arbeit mit ihm ein Glas Tee trinken wolle. Aber das mühelose Antwort-und-Frage-Spiel wurde schon unterbunden, bevor es überhaupt beginnen konnte. Denn die Genossin Feldwebel Gatkina drückte auf dem Schalter mit kurzen, vehementen Bewegungen ihre Zigarette aus, als wollte sie einem kleinen Tier das Genick brechen. Dazu blies sie mit einem lauten Pfeifen Rauch durch die Nasenlöcher.
»Wenn Sie wiederkommen …«, flüsterte die junge Frau ihm zu.
Kirow beugte sich zu ihr hin. »Ja?«
»Dann bringen Sie ihr unbedingt eine neue Klingel mit.«
Kirow kam wieder, und erst bei diesem zweiten Besuch erfuhr er den Namen der dunkeläugigen Frau. Seitdem stapfte er in mehr oder minder regelmäßigen Abständen die Treppe in den dritten Stock hinauf und war dabei manchmal sogar in einer offiziellen Mission unterwegs, meistens aber nicht. Ein Vorwand war schon lange nicht mehr nötig.
Er hatte ärgerlich lange suchen müssen, bis er eine Klingel gefunden hatte, die exakt der von ihm zerstörten glich. Und als er sie Feldwebel Gatkina überreichte, betrachtete diese sie auf ihrer ausgestreckten Hand, starrte sie so durchdringend und so lange an, dass Kirow schon glaubte, er hätte ein ganz entscheidendes Detail übersehen. Aber dann stellte Gatkina sie auf den Schalter und schlug mit harter Faust auf sie ein, und noch bevor das Klingeln verstummt war, folgte der nächste Schlag. Und ein weiterer. Ein Lächeln breitete sich auf ihrem Gesicht aus, während sie mit der Faust die neue Klingel bearbeitete, so dass jeder in der näheren und weiteren Umgebung taub zu werden drohte. Endlich war sie zufrieden und ließ die Klingel in Frieden. Zum Abschluss der Einweihungszeremonie wurde Major Kirow zum Zeichen seiner Ungeschicklichkeit die alte Klingel überreicht.
Dadurch wurde ihm zugleich zu verstehen gegeben, dass seine Anwesenheit von nun an toleriert würde, nicht nur von Feldwebel Gatkina, sondern auch von der dritten Beschäftigten im Archiv, Unteroffizier Fada Korolenko, deren kleiner Kopf so auf ihrem birnenförmigen Leib saß, dass sich Kirow an eine Matroschka-Puppe erinnert fühlte.
Zusammen bildeten Kirow und diese Frauen einen kleinen verschrobenen Zirkel, dessen Treffen in einem engen, fensterlosen Kabuff stattfanden, in dem – für den Fall eines Feuers – mit Sand gefüllte Eimer untergestellt waren. Die Eimer, in deren grauen Sand Feldwebel Gatkinas Zigarettenstummel steckten, säumten die Wände. Zwischen ihnen, in der Mitte des Raums, hockten Kirow und die Damen auf alten Holzkisten, tranken Tee aus dunkelgrünen Emailletassen, wie sie sich in jedem Verwaltungsgebäude, in jeder Schule, jedem Krankenhaus und in jeder Bahnhofsgaststätte des Landes fanden.