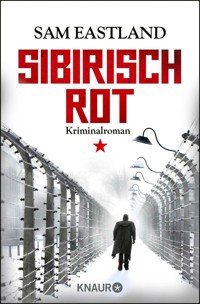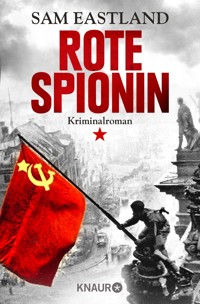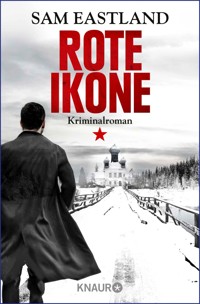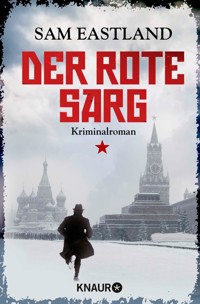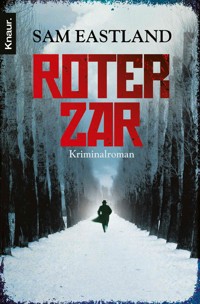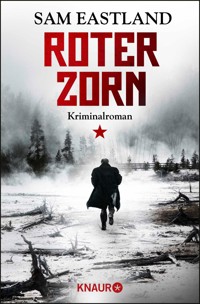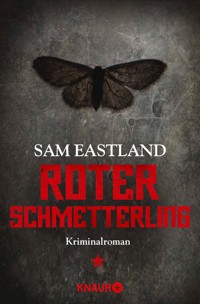
6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Knaur eBook
- Kategorie: Krimi
- Serie: Die Inspektor-Pekkala-Serie
- Sprache: Deutsch
Sommer 1941: Hitlers Truppen marschieren scheinbar unaufhaltsam voran, über Russland wird ein deutsches Aufklärungsflugzeug abgeschossen. Darin findet sich ein Gemälde, das auf den ersten Blick einen großen Nachtfalter darstellt. Doch Inspektor Pekkala erkennt in dem Gemälde einen getarnten Grundriss der Zarenresidenz im ehemaligen St. Petersburg. Daraufhin argwöhnt Stalin, dass es die Deutschen auf das legendäre Bernsteinzimmer abgesehen haben, und schickt Pekkala in die belagerte Stadt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 421
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Sam Eastland
Roter Schmetterling
Kriminalroman
Aus dem Englischen von Karl-Heinz Ebnet
Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.
Über dieses Buch
Sommer 1941: Hitlers Truppen marschieren scheinbar unaufhaltsam voran, über Russland wird ein deutsches Aufklärungsflugzeug abgeschossen. Darin findet sich ein Gemälde, das auf den ersten Blick einen großen Nachtfalter darstellt. Doch Inspektor Pekkala erkennt in dem Gemälde einen getarnten Grundriss der Zarenresidenz im ehemaligen St. Petersburg. Daraufhin argwöhnt Stalin, dass es die Deutschen auf das legendäre Bernsteinzimmer abgesehen haben, und schickt Pekkala in die belagerte Stadt.
Inhaltsübersicht
Russland
Dreihundert Meter über der [...]
Es war spätnachts.
Vor dem Gebäude stand [...]
Zwei Tage vorher war [...]
Der Emka rollte durch [...]
Obwohl das Kremlmuseum zu [...]
Wer ist dieser Mann, [...]
Pekkala war schon seit [...]
Wie haben Sie es [...]
Als sie auf dem [...]
Erschöpft kehrte Schütze Stefanow [...]
Die Tür zu Pekkalas [...]
Die Dunkelheit war bereits [...]
Mit quietschenden Reifen bog [...]
Schütze Stefanow atmete hastig [...]
Auf der Rückfahrt nach [...]
Pekkala ließ sich auf [...]
Das Mondlicht glitzerte auf [...]
Kirow und Pekkala saßen [...]
Die drei Männer hatten [...]
Kirow und Tschurikowa warteten [...]
Ach, Sie schon wieder«, [...]
An diesem späten Augustnachmittag [...]
Pekkala erstattete an diesem [...]
Pekkala und Kowalewski wurden [...]
Genosse Stalin«, sagte Pekkala, [...]
Bevor Pekkala Kowalewski aufsuchte, [...]
Im gleichen Moment schwang [...]
Trockener Kreidegeruch kam aus [...]
Als das Gesuch, vom [...]
Um 17.30 Uhr traf [...]
Im Verlauf ihrer Ochrana-Ausbildung [...]
Stefanow machte sich auf [...]
Es war mitten in [...]
Leutnant Tschurikowa war in [...]
Die Sonne war noch [...]
Statt in die Stille [...]
Nach dreistündigem Flug im [...]
Stefanow war am Morgen [...]
Stefanow!«, brüllte Gortschakow. »Bist [...]
Kirow lief vor dem [...]
Der Lastwagen mit Pekkala, [...]
Schweißüberströmt erreichte Kirow das [...]
Pekkala sah zu, wie [...]
Volkskommissar Bachturin saß an [...]
Tschurikowa und die beiden [...]
Kirow folgte den Anweisungen [...]
Unter dem Auge eines [...]
Kirow stand in Habtachtstellung [...]
Da ist Engel!« Tschurikowa [...]
Müde schleppte sich Kirow [...]
Wir kommen zu spät, [...]
Nicht schon wieder!«, murmelte [...]
Pekkala und Stefanow saßen [...]
Auf Stalins Schreibtisch lag [...]
Welche Schätze?«, fragte Stefanow. [...]
Eine Stunde später schlüpften [...]
In einem winzigen, fensterlosen [...]
Kirow saß in seinem [...]
Keine Stunde nach seiner [...]
Eine Woche später überquerte [...]
Das Bernsteinzimmer: Zeittafel
Russland
August 1941
Dreihundert Meter über der russischen Front kreiste zwischen den dichten Wolken ein deutsches Aufklärungsflugzeug und suchte nach einem Landeplatz. Bei der Maschine handelte es sich um eine Fieseler Fi 156, die wegen der breiten Tragflächen und ihres spindeligen Fahrwerks »Storch« genannt wurde. Der Pilot Hanno Kosch war Hauptmann der Luftwaffe. Hinter ihm saß der Leutnant der Waffen-SS Karl Hagen und klammerte sich nervös an seine Aktentasche.
Eine Stunde zuvor war der Storch auf einer vorgeschobenen Operationsbasis der Heeresgruppe Nord außerhalb der Stadt Luga gestartet, sein Ziel war eine Graspiste in der Nähe des nordöstlich gelegenen Dorfes Wyriza.
Kosch neigte die Maschine und hielt nach Landschaftsmerkmalen Ausschau, die mit der Karte auf seinen Knien übereinstimmten. »Ich seh sie nicht«, sagte er und drehte sich zu seinem Passagier um.
»Vielleicht sollten wir umkehren«, erwiderte Hagen. Er hatte sich nach vorn gebeugt und musste brüllen, um sich im Motorenlärm verständlich zu machen.
»Dafür ist es zu spät«, kam es vom Piloten. »Ich hab Sie vor einer halben Stunde gefragt, da haben Sie abgelehnt. Jetzt reicht der Treibstoff nicht mehr, wenn wir nach Luga zurückwollen. Wenn wir die Piste in Wyriza nicht finden, müssen wir irgendwo notlanden und uns zu Fuß durchschlagen.«
Der Storch wurde von Turbulenzen erfasst und hin und her geworfen. Hagen fasste die Aktentasche noch fester.
»Was haben Sie eigentlich da drin?«, fragte Kosch mit Blick nach hinten.
»Etwas, was ich abgeben muss.«
»Ja, aber was?«
»Wenn Sie es unbedingt wissen wollen. Ein Gemälde.«
»Ein Gemälde? Was Wertvolles? So was wie einen Rembrandt?«
»Was Wertvolles, ja. Aber einen Rembrandt, nein.«
»Kann ich es mal sehen?«
»Das kann ich nicht erlauben.«
»Na, kommen Sie schon! Damit ich wenigstens weiß, wofür ich hier mein Leben aufs Spiel setze.«
Hagen überlegte. »Gut, kann ja nicht schaden, wenn Sie einen Blick drauf werfen.« Er drückte auf die Messingschließe, zog eine kleine holzgerahmte Leinwand aus der Aktentasche und hielt sie nach vorn, damit Kosch sie sehen konnte.
»Verdammt«, sagte Kosch. »Was ist das? Ein Schmetterling?«
»Eigentlich ein Nachtfalter.«
»Sieht gar nicht nach was Besonderem aus.« Kosch zuckte mit den Schultern. »Aber mit der Kunst hab ich es ja nicht so.«
»Ich kann damit genauso wenig anfangen«, sagte Hagen, schob das Gemälde wieder in die Tasche und ließ die Schließe zuschnappen. »Ich will das Ding bloß loswerden, und dann hoffe ich, dass ich nie mehr in einen Flieger muss. Ich hasse das Fliegen. Ich hab mich doch nicht verpflichtet, weil ich mich unter die Vögel mischen wollte.«
»Sie werden auch nicht mehr lange in der Luft bleiben«, sagte ihm Kosch. »Und ich auch nicht, unser Treibstoff reicht nämlich nur noch für fünf Minuten.«
»Wie haben wir den Landeplatz bloß verpassen können?«, fragte Hagen.
»Bei der dichten Bewölkung wären wir sogar an der Reichshauptstadt vorbeigeflogen!«, antwortete Kosch. »Es hat keinen Sinn, Leutnant. Ich werde nach einer geeigneten Stelle Ausschau halten.« Mit diesen Worten leitete er den Sinkflug ein. Regentropfen platschten gegen das Plexiglas der Kabine. Unter ihnen glitten im trüben Sommerabendlicht die Strohdächer eines russischen Dorfes vorbei. Hinter den weißgetünchten Häusern erstreckten sich weite Felder mit Weizen, Gerste und Roggen, durch die sich rötlich braune, unbefestigte Wege zogen. Von den Menschen keine Spur. So war es auch bei den anderen Dörfern gewesen, über die sie in der vergangenen Stunde geflogen waren. Die gesamte Bevölkerung schien sich in Luft aufgelöst zu haben.
»Was ist das?«, rief Hagen plötzlich. »Dort unten! Schauen Sie!«
Kosch folgte Hagens ausgestrecktem Arm und entdeckte eine weite Rasenfläche mit Flanierwegen. Am Ende des Parks erhob sich ein stattliches blau-weißes Gebäude mit Hunderten von Fenstern, deren Goldrahmen zwischen dem satten Grün schimmerten. Seitlich davon befand sich ein weiteres großes, allerdings weniger prächtiges Gebäude. Über das gesamte Gelände waren kleinere Bauten verstreut, dazu mehrere große Teiche. Koschs Begeisterung für die architektonische Schönheit hielt aber nicht lange an, denn sofort wurde ihm klar, wie weit sie von ihrem geplanten Kurs abgekommen waren.
»Herrlich«, entfuhr es Hagen widerstrebend. »Ich wusste gar nicht, dass es in Russland so was überhaupt noch gibt. Sieht ja fast wie ein Palast aus.«
»Das ist ein Palast!«, erwiderte Kosch. »Das ist das alte Zarendorf, Zarskoje Selo. Die Sowjets haben es in Puschkin umbenannt. Das war die Sommerresidenz des Zaren Nikolaus II. Das da ist der Katharinenpalast, und dort drüben der Alexanderpalast, der Lamski-Teich und das Chinesische Theater. Das weiß ich alles, weil ich mal Architektur studiert habe.«
»So, dann wissen wir jetzt also, wo wir sind«, sagte Hagen, »und dann können Sie mir sicherlich auch sagen, wie weit wir von unserem Zielort entfernt sind.«
Kosch sah auf seine Karte. »Laut Karte befinden wir uns fast dreißig Kilometer hinter den russischen Linien.«
»Dreißig Kilometer!«, brüllte Hagen los. »Hauptmann, ist Ihnen klar, dieses Bild …«
Kosch ließ ihn gar nicht ausreden. »Auf Kurs Nord-Nordwest können wir unsere Linien vielleicht noch erreichen, bevor uns der Sprit ausgeht.« Kosch drehte scharf bei, richtete das kleine Aufklärungsflugzeug nach Westen aus und brachte es auf einen Kurs, der direkt über das gewaltige Dach des Katharinenpalasts hinwegführte.
»Sieht verlassen aus«, sagte Hagen und drückte die Stirn gegen das Plexiglas der Seitenscheibe. »Wo sind denn alle hin?«
Plötzlich bockte die Maschine, als wäre sie gegen eine unsichtbare Wand geflogen. Der Schlag wurde von einem Geräusch begleitet, das Hagen an die Kieselsteine erinnerte, die er als kleiner Junge gegen die verrostete Wellblechhütte im Garten seines Großvaters geworfen hatte. »Was war das?«, schrie er. »Was ist los?«
Gleißende Leuchtspurgeschosse rauschten an den Tragflächen vorbei, Kugeln fraßen sich in den Rumpf. Im gleichen Augenblick stob weißer Kühlmitteldampf aus der Motorabdeckung.
Das Feuer verstummte, sobald sie das Palastgelände hinter sich gelassen hatten.
»Wir müssen außerhalb ihrer Reichweite sein«, sagte Hagen.
»Zu spät«, erwiderte Kosch. »Die haben uns schon erwischt.«
»Was soll das heißen? Wir fliegen doch noch.«
»Wir müssen runter«, sagte Kosch, »bevor der Motor Feuer fängt. Halten Sie nach einem Feld oder einer Straße Ausschau, möglichst ohne Telegrafenleitungen.«
»Wir sind hinter den feindlichen Linien!«
»Auf dem Boden haben wir eine Chance. Hier oben haben wir keine mehr.«
Sekunden vergingen. Der Motor begann zu stottern, die Temperaturanzeige stieß in den roten Bereich vor.
»Wie wär’s damit?«, fragte Hagen und zeigte an der Steuerbord-Tragfläche vorbei. »Ist das eine Landebahn?«
Kosch starrte durch die mittlerweile verschmierte Scheibe. »Könnte gehen! Dort können wir es probieren.«
»Gott sei Dank!«, murmelte Hagen.
Kosch lachte. »Ich dachte, ihr von der SS glaubt nicht an Gott.«
»Ich glaube an alles, was mich wieder sicher auf die Erde bringt.«
Der Storch kreiste einmal über dem Flugplatz. Am Ende der Bahn stand ein Hangar, dessen matt olivgrünes Dach mit schwarzem Tarnmuster bemalt war.
Kosch richtete die Maschine für den Landeanflug aus, fuhr die Landeklappen nach unten, drosselte damit die Geschwindigkeit, nahm Gas weg und setzte zur Landung an.
Die Maschine hüpfte einmal auf ihren Stelzenbeinen, bevor sie endgültig aufsetzte. Silbrige Wassertropfen sprühten auf, als die Räder durch das Gras rollten.
Der Pilot würgte den Motor ab, und die Fieseler hielt am Ende der kurzen Landebahn. Der Propeller kam zum Halt, und Kosch drückte auf die Metallscheibe an seiner Brust, durch die die vier Sitzgurte miteinander verbunden waren, drehte sie nach links und löste die Gurte.
Hagen kämpfte noch mit seinen Gurten, von denen sich einer im Lederhalfter seiner P 38 verheddert hatte, der Handfeuerwaffe für SS-Offiziere.
Kosch fasste nach hinten und kam ihm zu Hilfe.
Dann klappte er die Kabine auf, kletterte hinaus und sprang auf den Boden. Hagen folgte.
Die beiden Männer sahen sich um. Die Hangartore waren verschlossen, frische Reifenspuren zeigten aber an, dass vor kurzem jemand da gewesen sein musste. Noch immer nieselte es leicht.
»Wenn wir uns beeilen«, sagte Kosch, »sollten wir in ein paar Stunden die eigenen Linien erreichen. Die Russen müssen gesehen haben, dass wir runtergegangen sind. Wenn wir Glück haben, sind sie aber so sehr mit ihrem Rückzug beschäftigt, dass sie sich gar nicht um uns kümmern.«
Ein metallisches Knarren ließ sie zusammenfahren. Beide drehten sich um. Die Hangartore glitten langsam auf. Ein Gesicht tauchte aus der Dunkelheit auf, dann trat der ganze Mann heraus. Er war ein Offizier der Roten Armee. Das Olivgrün seiner Gymnastiorka, der rote Stern an der Mütze und die Tokarew-Halbautomatik, die er in der rechten Hand hielt, ließen keinen anderen Schluss zu. Um die Brust hatte er einen breiten braunen Ledergurt geschlungen, an dem das Halfter für seine Pistole befestigt war.
Zwei weitere Männer kamen aus der Dunkelheit. Sie trugen Helme und waren mit Mosin-Nagant-Gewehren bewaffnet, auf denen Bajonette aufgepflanzt waren.
Hagen ließ seine Aktentasche fallen und zog seine P 38.
»Sind Sie verrückt?«, zischte Kosch, der beide Hände hob. »Sie sind zu dritt, wahrscheinlich sind noch mehr im Hangar. Wir schaffen es nicht mehr. Wir müssen uns ergeben.«
Als der russische Offizier sah, dass einer der Deutschen die Waffe gezückt hatte, blieb er abrupt stehen. Er hob seine Pistole und bellte einen Befehl. Die beiden Männer hinter ihm legten an.
»Sie haben recht«, flüsterte Hagen.
Kosch drehte sich mit schreckgeweiteten Augen zu ihm hin. »Womit hab ich recht?«
»Dass ich nicht an Gott glaube.« Damit setzte er Kosch die Pistole an die Schläfe und drückte ab.
Kosch sackte sofort zu Boden.
Und während die Russen das alles noch entgeistert beobachteten, steckte sich Hagen den Lauf der P 38 in den Mund, schloss die Augen und feuerte.
Es war spätnachts.
Pekkala lag in Stiefeln und Kleidung auf dem Boden seiner winzigen Moskauer Wohnung. An der Wand stand sein ordentlich gemachtes Bett mit einer zusätzlichen Decke, die zusammengelegt am Fußende lag. Er schlief nie darin. Er zog die Holzdielen vor. Er trug auch keinen Pyjama, weil ihn dieses Kleidungsstück an die Rubaschka erinnerte, die Gefängniskluft. Ein zusammengerollter Mantel diente ihm als Kopfkissen und war sein einziges Zugeständnis an die Bequemlichkeit.
Er war ein großer, breitschultriger Mann mit gerader Nase, kräftigen weißen Zähnen und grünlich braunen Augen, deren Iris etwas silbrig Schimmerndes an sich hatte, was anderen aber nur auffiel, wenn er sie direkt ansah. Graue Strähnen zogen sich durch die kurzgeschnittenen schwarzen Haare; die Wangenknochen, jahrelang Wind und Sonne ausgesetzt, waren rötlich verbrannt.
Er starrte an die Decke, als suchte er etwas in der mattweißen Farbe. In Gedanken aber war er weit weg und rekapitulierte den Fahrplan einer Eisenbahnreise von Kiew durch die gesamte Sowjetunion bis nach Wladiwostok an der Pazifikküste. Er kannte jeden Aufenthalt entlang der Strecke, wusste, wo die Lokomotiven gewechselt wurden, kannte die Zeiten der Anschlusszüge. Pekkala hatte nicht die geringste Absicht, die Fahrt jemals anzutreten, aber er hatte angefangen, Kursbücher auswendig zu lernen, um nachts besser einschlafen zu können. Nachdem er sich sämtliche vierundzwanzig Kursbücher der sowjetischen Eisenbahn besorgt hatte und sie jetzt im Regal in seinem Büro aufbewahrte, kannte er die Ankunfts- und Abfahrtszeiten von so ziemlich jedem Zug im Sowjetreich.
Er war in Gedanken gerade auf den Bahnsteig in Perm getreten, wo er eine Viertelstunde Aufenthalt zum Anschlusszug nach Omsk hatte, als die Klingel neben der Tür schellte. Jemand stand also unten auf der Straße und wollte eingelassen werden.
Unvermittelt setzte er sich auf. Die Reise war schon fast wieder vergessen.
Mit einem Grummeln griff er zum Revolver neben seinem Kopf. Die Waffe war ein englischer Webley .455, ein Geschenk des Zaren Nikolaus. Auf dem Weg vom vierten Stock nach unten steckte er den Revolver in das so beschaffene Halfter, dass die Waffe nahezu waagrecht seitlich am Rippenbogen anlag. Das Halfter war von Emilio Sagredi, dem Waffenschmied von Nikolaus II., nach Pekkalas persönlichen Vorstellungen angefertigt worden. Durch den flachen Winkel, in dem die Waffe darin saß, war es erforderlich, dass die Lederhülle perfekt passte. Dazu hatte Sagredi das Leder mit Salzwasser getränkt und es anschließend mit eingeschobener Waffe trocknen lassen. Das Ergebnis war ein so perfekter Sitz, dass weder Lasche noch Gurt nötig waren, um die Waffe im Halfter zu fixieren. Durch den ungewöhnlichen Winkel war es auch möglich, die Waffe in einer einzigen fließenden Bewegung zu ziehen, zu zielen und abzufeuern. Das hatte Pekkala mehr als einmal das Leben gerettet. Eine letzte Modifizierung hatte dann noch Sagredi vorgeschlagen. Sie bestand aus einem dünnen Loch auf der Laufoberseite gleich hinter dem Korn. Das große .455-Kaliber des Webley sorgte für einen gewaltigen Rückstoß, so dass der Schütze die Waffe nach jedem Schuss neu ausrichten und neu anvisieren musste. Durch Sagredis Anpassung konnte ein kleiner Teil des Drucks durch das winzige Loch nach oben entweichen, wodurch die Waffe durch den Schuss nach unten gedrückt wurde – genau in dem Moment, in dem der Lauf durch den Rückstoß eine Bewegung nach oben erfuhr. Die Waffe lag damit sehr viel ruhiger in der Hand, und der nächste Schuss konnte schneller und genauer abgegeben werden.
Waffe und Halfter wurden in einer kalten Winternacht 1917 an der russisch-finnischen Grenze von der bolschewistischen Miliz bei der Gefangennahme von Pekkala konfisziert. Nachdem seine Identität bestätigt war, wurde er sofort in ein Gefängnis nach Petrograd überstellt und dort wochenlang gefoltert, bevor er ins Arbeitslager Borodok im Krasnagoljana-Tal gebracht wurde.
Ohne dass Pekkala jemals davon erfuhr, hatte Stalin angeordnet, den Webley persönlich in Augenschein zu nehmen. Er hatte von der Waffe gehört. Der massive Messinggriff war auf Anweisung des englischen Königs George V. angebracht worden, der den Revolver seinem Vetter, dem Zaren, geschenkt hatte. Größe, Gewicht und Feuerkraft der Waffe aber waren für den eher feinsinnigen Zaren zu »sauvage« gewesen – jedenfalls in den Augen der Zarin. Also hatte der Zar den Webley Pekkala geschenkt. Stalin war sehr gespannt auf die Waffe und hatte sogar in Betracht gezogen, sie zu seinem persönlichen Gebrauch zu übernehmen.
Nur widerwillig rückten die Milizionäre die konfiszierte Waffe heraus. Nach Erhalt des Revolvers zog sich Stalin in seine Privatgemächer zurück und legte das Halfter an. Dem neuen Gespann aber war keine Zukunft beschieden. Stalin hegte eine starke Abneigung gegen schwere Kleidung und alle Kleidungsstücke, die ihn in seiner Bewegungsfreiheit einschränkten. Vor allem galt das für Stiefel. Sie wurden für ihn aus weichem, üblicherweise für Handschuhe gebräuchlichem Ziegenleder maßgefertigt. Diese Schuhe eigneten sich zwar kaum für einen Marsch durch die Moskauer Straßen, aber Stalin war sowieso nur äußerst selten zu Fuß unterwegs und musste sich wenig Sorgen machen, dass er sich im russischen Winter die Zehen abfrieren könnte. Schon nach wenigen Minuten aber ließen das Gewicht des Revolvers und die Einschnürung durch das Halfter Stalin von der Idee Abstand nehmen, die Waffe für sich zu behalten.
Statt den Webley fortzuschaffen, verfügte Stalin, ihn einzulagern. Pekkala war zwar zum anscheinend sicheren Tod im Gulag verurteilt, trotzdem war Stalin nicht unbedingt davon überzeugt, dass dieser Mann in Sibirien auch wirklich sterben würde. Er war sich nur einer Sache sicher: Das Wissen und die Fähigkeiten des zaristischen Sonderermittlers könnten sich auch für ihn als nützlich erweisen, falls Pekkala überredet werden konnte, sich in den Dienst der Revolution zu stellen.
Es dauerte neun Jahre, bis sich die Gelegenheit dazu bot. Der frischgebackene Leutnant Kirow war dazu nach Borodok geschickt worden und hatte Pekkala ein Angebot unterbreitet, das ihn aus dem Wald, der sein Gefängnis gewesen war, befreite. Kirow, seitdem Pekkalas Assistent im Büro für besondere Operationen, gab ihm nicht nur den Webley und das Halfter zurück, sondern auch das kaiserliche Dienstabzeichen.
Dieses Abzeichen bestand aus einer Massivgoldscheibe mit einem Durchmesser von etwa der Länge eines kleinen Fingers. In dieser Scheibe saß eine weiße ovale Emaille-Intarsie, die in der Mitte, an ihrer dicksten Stelle, etwa die Hälfte der Goldscheibe einnahm. Inmitten dieser Intarsie selbst befand sich ein großer, runder Smaragd. Zusammen ergaben der Golduntergrund, das weiße Emailleoval und der Smaragd die unverwechselbare Gestalt eines Auges. Als Ermittler des Zaren war Pekkala mit unumschränkter Befehlsgewalt ausgestattet gewesen. Selbst die zaristische Geheimpolizei, die Ochrana, hatte keinen Zugriff auf ihn gehabt. In seinem Dienst für die Romanows hatte sich Pekkala den Ruf eines Mannes erworben, der nicht bestochen werden konnte, der sich weder kaufen noch einschüchtern ließ – ganz egal, wie wohlhabend man war oder über welche Beziehungen man verfügte. Niemand stand über dem Smaragdauge, noch nicht einmal der Zar.
Nach seiner Entlassung aus dem Gulag hatte sich Pekkala daher auf ein angespanntes Bündnis mit dem Herrscher über die Sowjetunion eingelassen.
Stalin seinerseits hatte immer gewusst, dass Pekkala viel zu kostbar war, um wie Millionen andere einfach liquidiert zu werden.
Vor dem Gebäude stand Major Kirow mit hochgezogenen Schultern im Regen. Er war groß, dünn und hatte hohe Wangenknochen, die ihm das Aussehen permanenter Überraschung verliehen.
Ihr Wagen, ein Emka Baujahr 1939, wartete mit laufendem Motor am Randstein. Die Scheibenwischer zuckten wie die Fühler eines nervösen Insekts.
»Ihr Gürtel ist verkehrt herum«, sagte Pekkala, als er aus dem Gebäude kam.
Kirow sah auf seine Messing-Gürtelschnalle, deren mit Hammer und Sichel geschmückter fünfzackiger Stern tatsächlich auf dem Kopf stand. »Ich bin ja auch noch halb am Schlafen«, murmelte er, löste den Gürtel und führte ihn richtig in die Schlaufen ein.
»Zum Kreml?«, fragte Pekkala.
»Zu dieser Nachtzeit geht es immer zum Kreml.«
»Wann meint Stalin denn, dass wir auch mal schlafen sollen?«, grummelte Pekkala.
»Inspektor, Sie liegen doch sowieso nur in Ihren Kleidern auf dem Boden, werden hin und wieder vielleicht ohnmächtig, und ansonsten lernen Sie Zugfahrpläne auswendig. Das zählt nicht als Schlaf. Wo ging es diesmal hin? Nach Minsk? Tiflis? Waren alle Züge auch pünktlich?«
»Wladiwostok«, erwiderte Pekkala, stapfte zum Emka und knöpfte sich in der feuchten, kühlen Nachtluft den schweren Wollmantel zu. »Umsteigen in Rjasan und Omsk. Und meine Züge sind immer pünktlich.«
Kirow schüttelte den Kopf. »Ich kann mich nie entscheiden, ob das jetzt Genie oder Wahnsinn ist.«
»Dann lassen Sie es doch.«
»Was lassen?«
»Sich zu entscheiden«, antwortete Pekkala, stieg auf der Beifahrerseite ein und schloss die Tür. Der muffige Geruch der Ledersitze vermischte sich mit dem durchdringenden Gestank von Kirows Pfeifentabak.
Kirow glitt hinters Steuer, legte den Gang ein, und sie fuhren in der unbeleuchteten Straße los.
»Was will er diesmal?«, fragte Pekkala.
»Poskrjobyschew hat was von einem Schmetterling gefaselt.«
Poskrjobyschew, Stalins Privatsekretär, war ein kleiner Mann mit hängenden Schultern und schütterem Haar, das wie der Siegeskranz römischer Kaiser seine Glatze umflorte. Dazu trug er eine Nickelbrille, die seine Augen platt zu drücken schien. Poskrjobyschew ließ sich nur selten ohne seine olivbraune Uniform blicken, wobei er Wert darauf legte, den kurzen Kragen bis oben hin zuzuknöpfen, als könnte er nur so verhindern, dass ihm der Kopf abfiel. So unscheinbar sein Äußeres sein mochte, seine Stellung als Privatsekretär des obersten Führers der Sowjetunion hatte ihn mit einer außerordentlichen Machtfülle ausgestattet. Jeder, der zu Stalin wollte, bekam es zuerst mit Poskrjobyschew zu tun. Im Lauf der Jahre hatte er sich dadurch zahllose Feinde erworben, von denen es aber keiner wagte, sich gegen ihn zu stellen, aus Angst, damit den Zugang zu Stalin zu verlieren.
»Ein Schmetterling?«, flüsterte Pekkala.
»Ja, oder ein Falter. Muss jedenfalls wichtig sein. Er hat darum gebeten, sich mit Ihnen allein zu treffen.«
Eine Weile lang blieben beide still. Die Scheinwerferlichter des Emka schnitten eine blasse Schneise in die Nacht, aus deren Schwärze der Nieselregen wie ein Seidenschleier auf sie niederging.
»Ich hab im Radio gehört, dass Narwa heute an die Deutschen gefallen ist«, brach Kirow schließlich das Schweigen.
»Das ist die dritte Stadt in weniger als einer Woche.«
In der Ferne, über den wie Fischschuppen im blauschwarzen Himmel schimmernden Schieferdächern, konnte Pekkala die Kuppeln der Basilius-Kathedrale und des Kreml ausmachen. Überall in der Stadt tasteten die knochigen Finger der Suchscheinwerfer nach deutschen Bombern.
Zwei Tage vorher war den Überlebenden der 5. Flak-Abteilung der 35. Schützendivision der Roten Armee befohlen worden, Verteidigungsstellungen auf dem Gelände von Zarskoje Selo zu beziehen. Nach den zweimonatigen Kämpfen war die Einheit auf vier Mann mit einem Maxim-Maschinengewehr und einem von einem ZIS-5 Armeelaster gezogenen 25-mm-Flugabwehrgeschütz zusammengeschrumpft.
Seit Wochen marschierten sie durch eine Landschaft, die der Krieg wie einen zur Obduktion anstehenden Leichnam aufgerissen hatte. Überall begegnete man dem Tod, er lag zusammengekrümmt in den Gräben bei Osmino, trieb aufgebläht auf dem See bei Kikerino und wurde in den Gerstenfeldern bei Gattschina von Krähen beharkt. Ihre Fahrzeuge waren entlang dieser Strecke von den Maschinenkanonen der Messerschmitt-Jäger in rauchende Trümmer verwandelt worden.
Kommandeur der Abteilung war Kommissar Sirko, ein Berufsoffizier mit kleinen, feindselig funkelnden Augen, rasiertem Schädel und Stiernacken.
Sein Stellvertreter, Feldwebel Ragozin, hatte eine tiefe, sonore Stimme, die nicht zum knochigen, schmalgesichtigen Mann passte. Außerdem fehlte es ihm völlig an militärischer Haltung, weshalb die bauschige Reithose und ausgestellte Uniformjacke an ihm hingen wie an einer Vogelscheuche. Im Zivilleben war er Radiosprecher gewesen und hatte jeden Sonntagabend in Moskau eine Musiksendung moderiert. In den dreißiger Jahren, als die Liste der offiziell genehmigten Lieder in schöner Willkür immer mehr zusammengestrichen wurde, war ihm bald nichts anderes übriggeblieben, als tagtäglich die gleichen Lieder zu spielen, bis die Behörden ihn schließlich 1938 entließen. Überzeugt, bald wegen anti-sowjetischer Gesinnung denunziert zu werden, raffte er sich zu der einzigen patriotischen Tat auf, die ihm auf die Schnelle einfiel, und meldete sich kurz vor Kriegsausbruch zur Roten Armee.
Unteroffizier Barkat, Erdbeerbauer aus der Ukraine, zeichnete sich durch hängende Schultern, einen hervorstehenden Adamsapfel, nervöse Hände und ein abgehacktes Lachen aus, das klang, als wollte er eine verschluckte Fischgräte wieder hochwürgen.
Der letzte und rangniedrigste Angehörige der Abteilung war Schütze Stefanow. Er hatte die Aufgabe, sich um die Waffen zu kümmern, hin und wieder den Laster zu steuern und das Funkgerät zu bedienen, so dass für die anderen nicht viel mehr blieb, als sich zu beklagen und über ihre Essensrationen herzumachen.
Stefanow war ein kräftiger Mann mit den Schultern eines Ochsen. Seine sonst dichten, gewellten Haare waren wie bei allen Rotarmisten kahlrasiert, weshalb seine großen, runden Augen noch größer wirkten und ihm das empörte Aussehen einer jungen Eule verliehen, die aus dem Nest geworfen worden war. Wie Ragozin und Barkat war auch Stefanow kein Berufssoldat. Er war in der ersten Kriegswoche einberufen worden und fürchtete seitdem, dass diese Tätigkeit, die beileibe nicht seine erste war, unseligerweise die letzte werden konnte, die er in seinem Leben ausübte. Der sanfte, ruhige Schütze hatte wenig zu sagen, so wenig, dass die anderen in der Abteilung den Eindruck gewannen, er wäre etwas schwer von Begriff. Stefanow wusste genau, was sie von ihm hielten, hatte aber nicht die geringste Lust, ihnen von seiner Vergangenheit zu erzählen, die ihn dazu gezwungen hatte, im Schweigen Zuflucht vor ihrer Neugier zu suchen.
Stattdessen widmete er sich der engen Beziehung, die Männer manchmal zu Maschinen haben, in diesem Fall zum ZIS-5 mit seinem Holzlattenaufbau und den Scheinwerferlichtern auf den Kotflügeln, die dem Fahrzeug ein arrogantes, oberlehrerhaftes Aussehen verpassten. Die jeweils sechzehn Kühlerschlitze seitlich an der Motorhaube waren ihm mittlerweile so vertraut, als wären sie ihm in die Haut tätowiert.
Kaum hatten sie die ihnen zugewiesene Stellung auf dem Gelände von Zarskoje Selo bezogen, als sie den Motorenlärm eines leichten Flugzeugs hörten.
»Dort!«, schrie jemand. Kurz darauf kam Barkat angerannt, blieb schlitternd vor Stefanow stehen und fuchtelte in den Himmel über dem Katharinenpalast. »Eine Aufklärungsmaschine, dort! Dort!«
Jetzt entdeckte auch Stefanow das Flugzeug. Ein Fieseler Storch. Er kannte ihn nur von Bildern. Die Maschine drehte scharf bei und schien den Palast und den Alexanderpark überqueren zu wollen. Wenn sich Stefanow nicht täuschte, würde der Storch direkt über ihre Geschützstellung hinwegfliegen. »Geschütz fertig machen!«, schrie er Barkat zu.
Barkat lief zum 25-mm-Geschütz, riss die ölverschmierte, zur Tarnung darüber gebreitete Leinwandplane fort und klappte das große runde Visier hoch.
Während Barkat den Entfernungsmesser überprüfte, spurtete Stefanow zum Unterstand von Feldwebel Ragozin, der dort, eingemümmelt in seinen Regenumhang, schlief. »Feldwebel, aufstehen!«
»Ist schon Essenszeit?«, murmelte Ragozin nur, schob den Umhang zur Seite und kam taumelnd auf die Beine. Vom Boden hatte er ein Zickzackmuster auf der Wange.
»Wir haben ein deutsches Aufklärungsflugzeug gesichtet«, berichtete Stefanow.
»Mein Gott! Endlich was zu tun!« Ragozin wankte zum Geschütz und nahm seinen Platz neben der Munitionskiste ein, bereit, die Waffe nachzuladen, falls das nötig wurde. Schlaftrunken öffnete er eine der wasserdichten Kisten und hob einen Munitionsgürtel hoch. Die schweren Messingpatronen hingen ihm wie eine tote Schlange über dem Unterarm.
»Wo steckt Kommissar Sirko?«, fragte Ragozin.
»Er wollte was zum Trinken besorgen!«, schrie Barkat.
Stefanow hatte Erfahrung im Umgang mit dem Geschütz, allerdings war ihm bislang nicht geglückt, ein Flugzeug auch abzuschießen. Die monatelange Ausbildung an der auf einer vierrädrigen Lafette montierten Waffe hatte sich bisher als nutzlos erwiesen, und die insgeheim von ihm gehegte Vorstellung, für jedes abgeschossene Flugzeug den Lauf mit jeweils einem weißen Streifen zu schmücken, schien lächerlich weit hergeholt zu sein. Bislang hatte er sich nur in einer Sache zum Experten entwickelt, und das war im Ausheben von Schützenlöchern.
Jetzt aber, als er den Kurs der Maschine über das Palastgelände verfolgte, erkannte er, dass das möglicherweise die Gelegenheit war, seine miserable Bilanz zu verbessern. Gleich würde die Maschine genau über ihre Stellung fliegen. Mit pochendem Herzen lud er ein Geschoss in die Kammer und sah blinzelnd durch das Spinnennetz der Visiereinrichtung.
»Entfernung sechshundert Meter«, rief Barkat, der neben ihm auf einem Knie kauerte und das Geschützrohr hochkurbelte. »Sechshundert, näher kommend.«
Stefanow brach der Schweiß aus. Er wischte sich mit dem verdreckten Ärmel über die Stirn. »Stell auf zweihundert!«
»Das ist zu nah!«, erwiderte Barkat.
Das Flugzeug hatte das Dach des Katharinenpalasts überflogen und befand sich jetzt über dem Alexanderpark. Elegant neigte es die Tragflächen von der einen zur anderen Seite, damit die Insassen einen Blick auf das Gelände werfen konnten.
»Trotzdem, mach es!«
»Gut, zweihundert«, bestätigte Barkat.
Hinter sich hörte Stefanow Ragozin, der mit einem leisen metallischen Klirren am Munitionsgurt nachgriff.
Das Flugzeug tauchte in die Visierscheibe ein. Kurz war Stefanow erstaunt, wie sehr es den langbeinigen Insekten glich, die sich zu Hause im Holzschuppen immer in den Spinnennetzen verheddert hatten. Er zog den Abzug durch.
Stefanow wurde durchgerüttelt, als die ersten 25-mm-Geschosse aus dem Lauf jagten. Jede fünfte Patrone war ein Leuchtspurgeschoss, die nun einen Bogen in den Himmel schrieben. Aus dem Augenwinkel heraus nahm er die leeren Messinghülsen wahr, die aus dem Auswurfschacht schnellten. Auf der anderen Seite schlängelte sich der Munitionsgurt ins Geschütz.
»Treffer!«, schrie Barkat. »Treffer! Treffer!«
»Halt’s Maul!«, blaffte Stefanow, obwohl er im Geschützlärm kaum sein eigenes Wort verstand.
In diesem Augenblick tauchte das Flugzeug wie aus dem Nichts über ihnen auf. Der Schatten der Tragflächen raste über sie hinweg. Stefanow lehnte sich zurück, bis er fast nach hinten überkippte, erhaschte die schwarzen Kreuze an der Unterseite der Tragflächen, bevor die Maschine in nördliche Richtung weiterflog.
Erst jetzt ließ er den Abzug los.
Ragozin lud das Geschütz nach, darauf bedacht, sich nicht die Finger am heißen Verschluss zu verbrennen.
Stefanow drehte sich zu Barkat um. »Hab ich sie wirklich getroffen?«
»Ja!«, kam es aufgeregt von Barkat. »Genau in den Motor. Und in die Tragfläche auch, glaub ich.«
Im gleichen Augenblick trieb ein komischer Geruch auf sie herunter. Für Stefanow roch es wie verbrannter Zucker.
Ragozin blickte auf. »Glykol«, sagte er. »Kühlmittel. Sie wird nicht mehr weit kommen.«
»Hab ich doch gesagt, du hast den Motor getroffen!« Barkat klopfte Stefanow auf den Arm.
Stefanow sprang auf. Seine Hände zitterten. Wortlos drehte er sich um und lief in Richtung Wald, hinter dem die Maschine verschwunden war.
Barkat und Ragozin sahen ihm nur sprachlos hinterher, bis er mit seinen stämmigen Beinen ins Unterholz eingetaucht war.
»Was soll das denn?«, fragte Ragozin.
»Ich glaube«, antwortete Barkat, »er will jetzt auch zu Ende bringen, was er angefangen hat.«
Ragozin ging darauf nicht ein. Etwas hatte seine Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Er trat an den Rand der weiten Rasenfläche, stemmte die Hände in die Hüften und starrte in die Ferne.
»Was ist?«, fragte Barkat.
Überrascht drehte sich Ragozin um. »Ich hab gesehen, dass er zweimal das Flugzeug getroffen hat, aber ich hab mich gefragt, wo bloß die übrigen Geschosse hingegangen sind.«
»Was willst du damit sagen?«
»Stefanow hat die Fenster im Katharinenpalast herausgeschossen!«
Barkat stellte sich neben Ragozin. Auf der gegenüberliegenden Seite des Parks erkannte er die dunklen Höhlen der zerschmetterten Fenster mit ihren gezackten, noch im Rahmen verbliebenen Scherben, die ihm zuzwinkerten, als das Sonnenlicht auf sie fiel. »Na ja«, sagte Barkat, »er hat ja nicht alle erwischt.«
Stefanow hatte das Palastgelände mittlerweile schon hinter sich gelassen. Einige Soldaten der Batterie hatten in ihren getarnten Stellungen zwar beobachtet, wie das Flugzeug Feuer gefangen hatte, hatten sich aber aufgrund der Ausrichtung der Geschütze nicht am Angriff beteiligen können. Als sie jetzt ihren vorbeispurtenden Kameraden sahen, machten sie keinerlei Anstalten, ihn aufzuhalten – wer es so eilig hatte, musste in verdammt wichtiger Mission unterwegs sein.
Schütze Stefanow wusste noch nicht einmal, wohin er lief. Der einzige klare Gedanke im Trümmerfeld seines Gehirns lautete, das Flugzeug zu finden, das er soeben abgeschossen hatte. Dabei war er sich noch nicht einmal sicher, ob er es wirklich abgeschossen hatte. Vielleicht war es ja nur beschädigt, vielleicht konnte es ja noch die deutschen Linien erreichen. Konnte ein Flugzeug auch ohne Kühlflüssigkeit fliegen? Stefanow hatte keine Ahnung.
Nachdem er das Palastgelände hinter sich gelassen hatte, rannte er auf einer langen, nach Norden führenden Straße weiter. Er hatte das Tempo etwas gedrosselt, lief aber immer noch sehr schnell, ließ dabei den Blick über die sich zu beiden Seiten erstreckenden Felder schweifen und hielt Ausschau nach einer notgelandeten Maschine oder einer verräterischen Rauchfahne, falls das Flugzeug abgestürzt und in Flammen aufgegangen sein sollte.
Nach zwanzig Minuten entdeckte Stefanow den Storch. Er stand vor einem kleinen Hangar am Rand einer Graspiste.
Schwer keuchend verließ er die Straße, durchquerte einen mit Wildblumen zugewucherten Graben und kämpfte sich auf die Landebahn hinauf.
Mehrere Soldaten hatten sich in einem Kreis versammelt.
Stefanow ging auf sie zu. Zum ersten Mal überlegte er jetzt, was wohl aus dem Piloten geworden war, und plötzlich stellte er sich vor, wie er dem Mann begegnete, ihm vielleicht die Hand schüttelte und sich als derjenige vorstellte, der ihn abgeschossen hatte. Nein, ging es Stefanow durch den Kopf. Er konnte einem Faschisten nicht die Hand schütteln. Das könnte dem Kommissar zu Ohren kommen.
Stefanow ging am Storch vorbei, der zwischen ihm und den versammelten Männern stand. Er war beeindruckt, dass es dem Piloten gelungen war, ihn sicher zu landen. An der Motorhaube war das aufgerissene Metall zu sehen, wo die Geschosse eingeschlagen waren. Stefanow zählte nur drei Einschusslöcher. Kurz schämte er sich dafür, nachdem er dafür einen ganzen Gurt mit hundertzwanzig Patronen abgefeuert hatte. Aber das spielte jetzt keine Rolle mehr, tröstete er sich. Ein Treffer oder hundert Treffer, es spielte keine Rolle, solange er die Maschine vom Himmel geholt hatte.
Die Soldaten, bemerkte Stefanow jetzt, drehten sich alle zu ihm um.
Und erst jetzt fielen ihm die beiden toten Männer auf, die am Boden lagen.
Überrascht schnappte er nach Luft.
»Wo kommst du denn her?«, fragte einer der Soldaten.
Stefanow antwortete nicht. Er schob sich an den Soldaten vorbei, bis er unmittelbar vor den Toten stand. Beiden war in den Kopf geschossen worden. Ihre Gesichter waren so verunstaltet, dass Stefanow an zwei zerbrochene Steinguttöpfe denken musste. Er starrte auf die Uniformen der beiden Männer, das graublaue Tuch des Luftwaffenoffiziers und die feldgraue Uniform des Mannes, den Stefanow anhand der silbernen Runen als SS-Angehörigen erkannte. Auf der Brust des SS-Manns lag eine mit Blut bespritzte Lederaktentasche. »Warum habt ihr das gemacht?«, fragte Stefanow. Er sah zu den Männern. »Haben sie sich nicht ergeben wollen?«
»Wir waren das nicht«, sagte schließlich einer. »Der SS-Mann hat uns einmal angesehen, dann hat er den Piloten erschossen.«
»Er hat was?« Langsam kühlte der Schweiß auf Stefanows Rücken. Er fühlte sich wie betäubt, als wäre er geschlafwandelt und an einem ihm unbekannten Ort aufgewacht. »Warum hat er das gemacht?«
»Das würden wir auch gern wissen«, erwiderte einer der Soldaten. »Vor allem, weil er sich gleich danach selbst das Hirn weggepustet hat. Unser Offizier meint, es könnte vielleicht mit dem Inhalt der Aktentasche zu tun haben. Er hat sich auf die Suche nach einem Kommissar gemacht, der soll sich darum kümmern.«
Die Erwähnung des Kommissars schien Stefanow aus seiner Trance zu reißen.
»Wer bist du eigentlich?«, fragte der Soldat.
»Niemand«, entgegnete Stefanow. »Ich bin niemand.« Damit drehte er sich um und ging über das Rollfeld zurück. Er durchquerte wieder den Graben, stieg auf die Straße und schlug den Rückweg zum Katharinenpalast ein. Zunächst ging er nur, aber nach einer Minute fing er wieder an zu rennen.
Der Emka rollte durch das Spasski-Tor mit seinen Zierzinnen und dem gold-schwarzen Uhrenturm, der sich in der nebligen Nacht erhob. Kirow stellte am hinteren Ende des Iwanowski-Platzes den Wagen ab und wandte sich an Pekkala.
»Ich warte hier auf Sie, Inspektor.«
»Gönnen Sie sich eine Mütze voll Schlaf«, erwiderte Pekkala, stieg aus und ging auf eine von einem Soldaten bewachte Tür zu. Der Soldat schlug so zackig die Hacken zusammen, dass es von den hohen Ziegelmauern widerhallte. Pekkala musste sich nicht ausweisen.
Zur Zarenzeit hatte der schimmernde Smaragd Pekkalas Autorität bezeugt, im Sowjetstaat war dazu ein seinem Pass beigeheftetes Blatt Papier nötig. Der Pass selbst war ungefähr so groß wie eine ausgestreckte Männerhand, er war von mattroter Farbe und hatte einen Umschlag aus stoffbezogenem Karton, wie man ihn von alten Schulbüchern kannte. Vorn war das in zwei Weizengarben eingebettete sowjetische Staatswappen aufgedruckt. Innen, in der oberen linken Ecke, war mit einem Hitzesiegel Pekkalas Lichtbild angebracht, dessen Emulsion dadurch rissig geworden war. Darunter fand sich in bläulich grünen Lettern der Schriftzug NKWD sowie ein Stempel, der bestätigte, dass sich Pekkala auf einem Sondereinsatz für den Staat befand. Geburtsdatum, Blutgruppe und staatliche Identifikationsnummer füllten die rechte Seite.
Die meisten Regierungspässe enthielten nur diese beiden Seiten, in Pekkalas Fall aber war noch eine dritte Seite eingefügt. Auf kanariengelbem Papier, rot umrandet, war Folgendes zu lesen:
DIE DURCH DIESES DOKUMENT AUSGEWIESENE PERSON HANDELT AUF DIREKTEN BEFEHL DES GENOSSEN STALIN.
SIE IST UNTER KEINEN UMSTÄNDEN ZU BEFRAGEN ODER IN GEWAHRSAM ZU NEHMEN.
SIE IST ERMÄCHTIGT, ZIVILKLEIDUNG ZU TRAGEN, WAFFEN MIT SICH ZU FÜHREN, VERBOTENE GÜTER ZU TRANSPORTIEREN, U.A. GIFT- UND SPRENGSTOFFE SOWIE FREMDE WÄHRUNGEN. ES IST IHR ERLAUBT, SPERRGEBIETE ZU BETRETEN UND SÄMTLICHE AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄNDE ZU REQUIRIEREN, DARUNTER WAFFEN UND FAHRZEUGE.
IM FALL IHRES TODES IST UMGEHEND DAS BÜRO FÜR BESONDERE OPERATIONEN IN KENNTNIS ZU SETZEN.
Diese Sonderseite wurde offiziell als Erlaubnisschein für Geheimoperationen bezeichnet, inoffiziell sprach man nur vom Schattenpass. Damit konnte man im Dschungel der Gesetze und staatlichen Verordnungen nach Belieben verschwinden und wieder auftauchen. Von diesen Schattenpässen gab es kein Dutzend. Selbst in den Reihen des NKWD hatten die meisten einen solchen Pass noch nie zu Gesicht bekommen.
Pekkala trat durch die Tür, stieg eine enge Treppe in den ersten Stock hinauf und befand sich in einem langen und breiten Gang mit hoher Decke. Der Boden war mit rotbraunem Teppich ausgelegt, der seine Schritte dämpfte. Hohe Türen lagen zu beiden Seiten des Gangs. Tagsüber standen sie offen, dann herrschte ein reges Kommen und Gehen. Zu dieser Nachtzeit aber waren sie geschlossen. Pekkala ging auf die große Doppeltür am Ende des Korridors zu. Dahinter lag das Vorzimmer zu Stalins Büro, ein großer Raum mit eierschalenfarbenen Wänden, Holzdielen und drei Schreibtischen in der Mitte. An einem davon saß ein Mann in einer olivgrünen, kragenlosen Uniform, wie sie auch von Stalin getragen wurde. Er erhob sich, als Pekkala eintrat. »Inspektor.«
»Poskrjobyschew.«
Poskrjobyschew klopfte einmal an die Tür zu Stalins Büro. Ohne auf eine Antwort zu warten, schwang er die Tür auf und forderte den Inspektor mit einem Nicken zum Eintreten auf. Sobald Pekkala im Zimmer war, schloss der Sekretär hinter ihm die Tür.
Pekkala fand sich in dem großen Raum wieder. Vor den Fenstern hingen rote Samtvorhänge, das äußere Drittel des Bodens wurde von einem roten Teppich bedeckt, in der Mitte war der Holzboden zu sehen. Die Wände waren dunkelrot tapeziert, karamellfarbene Holzleisten trennten die einzelnen Abschnitte. An den Wänden hingen Porträts von Marx, Engels und Lenin. Die Bilder waren alle gleich groß und schienen vom selben Künstler zu stammen.
Nah an der Wand stand Stalins Schreibtisch mit den insgesamt acht Beinen, zwei an jeder Ecke. Darauf lagen, penibel ausgerichtet, mehrere Umschläge sowie eine Lederaktentasche, die Pekkala noch nie gesehen hatte. Stalins Schreibtischsessel hatte eine breite Rückenlehne aus burgunderrotem Leder.
Außer dem Schreibtisch und einem mit grünem Tuch bespannten Tisch war der Raum nur spärlich eingerichtet. In einer Ecke befand sich eine große und sehr alte Standuhr des englischen Uhrmachers John Ellicott, die schon lange nicht mehr aufgezogen worden war und keinen Ton von sich gab. Ihr an einen gelben Vollmond erinnerndes Pendel stand hinter der geriffelten Glasscheibe still.
Das Licht im Raum kam von einer Deckenleuchte mit drei Glühbirnen. Ein dünner Rauchfaden stieg von der Zigarette auf, die Stalin vor kurzem im Messingaschenbecher auf dem Schreibtisch nicht ganz ausgedrückt hatte.
Stalin selbst stand mit dem Rücken zu Pekkala in der Mitte des Raums und starrte an die Wand.
Es dauerte etwas, bis Pekkala bemerkte, worauf Stalins Blick gerichtet war.
Zwischen den Porträts von Lenin und Engels hing ein weiteres Gemälde. Es war sehr viel kleiner als die beiden Bilder links und rechts.
»Vielleicht würde es dort drüben besser zur Geltung kommen, Genosse Stalin.«
Stalin drehte sich um. Seine Augen waren vor Müdigkeit gerötet, blinzelnd musterte er Pekkala. »Was haben Sie gesagt?«
»Dort drüben«, wiederholte Pekkala und zeigte auf die leere Wand hinter Stalins Schreibtisch.
»Wissen Sie, was das ist?«, fragte Stalin und deutete auf das Gemälde.
Pekkala trat vor und betrachtete das Bild. »Eine Saturnia. Ein Nachtpfauenauge.«
Stalin schüttelte verwundert den Kopf. »Wie kommt es, Inspektor, dass Sie sich kaum anständig zu kleiden wissen und immer so altmodische Sachen tragen, dass die Leute Sie regelmäßig für ein Gespenst halten, mir aber den Namen dieses Insekts nennen können?«
»Ich hab sie oft gesehen, dort, wo ich aufgewachsen bin«, erklärte Pekkala.
Er musste an den langen Weg durch den Wald denken, der zum Krematoriumsofen seines Vaters geführt hatte, eines Leichenbestatters in Lappeenranta im östlichen Finnland. Eines Abends war Pekkala von seiner Mutter damit beauftragt worden, dem Vater, der die ganze Nacht über am Ofen beschäftigt sein würde, ein belegtes Brot und eine Thermoskanne mit warmer Milch zu bringen. Vier Leichname sollten in dieser Nacht kremiert werden, weshalb insgesamt acht Stunden lang das Feuer beaufsichtigt werden musste. Mit einer Laterne in der Hand machte sich Pekkala auf den Weg, starrte angespannt auf den Pfad und war überzeugt, dass die Kiefern zu beiden Seiten immer näher kamen. Schließlich erreichte er das Krematorium. Sein Vater saß mit nacktem Oberkörper auf einem Baumstumpf.
Im ersten Augenblick glaubte Pekkala, dass sein Vater ein Buch lese, erst dann wurde ihm klar, dass er bloß auf seine Hände schaute. Hinter ihm röhrte der Ofen wie ein ferner Donner. Die Eisentür zum Ofen war so heiß, dass sie mohnblumenrot glühte. Der hohe Kamin stieß schwarzen Rauch in den Himmel, wo er sich auftürmte und ausbreitete, als würde er die Nacht erst hervorbringen. Drei Nachtfalter, jeder etwa so groß wie die Handfläche eines Mannes, umkreisten den Kopf seines Vaters. Aber dieser achtete gar nicht auf sie, auch nicht, als sich einer von ihnen auf seiner nackten, schweißnassen Schulter niederließ. Schließlich blickte er auf.
»Du bist nicht allein«, sagte Pekkala.
Sein Vater lächelte. Sacht schob er die Finger unter den Nachtfalter, der auf seiner Schulter gelandet war, hob ihn hoch und blies gegen das Insekt, als wollte er eine Kerze ausblasen. Der Falter schwang sich wieder in die Lüfte und umkreiste ihn. »Saturnia pavonia«, sagte er zu Pekkala. »Das Kleine Nachtpfauenauge. Eine alte Schmetterlingsart, die sich seit Jahrtausenden nicht mehr verändert hat.«
»Warum haben sie sich nicht mehr verändert?«, fragte Pekkala.
»Weil sie schon perfekt an die Welt, in der sie leben, angepasst sind. Diese Nachtfalter leisten mir hier draußen Gesellschaft und erinnern mich an die Unzulänglichkeiten des Menschen.«
Obwohl seitdem viele Jahre vergangen waren, hatte Pekkala die charakteristische Zeichnung auf den Schwingen nie vergessen; den Augenfleck auf jedem Flügel, umgeben von einem weißen Feld, den weißen und dunkelgrauen Flügelaußenrand, die obere, rot-pinkfarbene Binde und die ebenfalls pinkfarbene Flügelspitze sowie den ebenso gemusterten, allerdings gelb-orangerot gefärbten Hinterflügel. Das Gemälde war keine exakte Darstellung. Der Künstler hatte sich vor allem bei der Wiedergabe der Farben und der Musterung einige Freiheiten genommen und alles rötlich eingefärbt, dennoch war das Nachtpfauenauge zweifelsfrei zu erkennen.
»Wenn Sie mich gerufen haben, um Ihr Bild zu bewundern, Genosse Stalin«, sagte Pekkala, »dann hätte es sicherlich welche gegeben, die dafür besser qualifiziert sind als ich.«
Stalin sah ihn finster an. »Wenn alles, was Sie mir bieten könnten, die Liebe zu den schöneren Dingen im Leben wäre, hätte ich Sie in Sibirien verrotten lassen.«
»Warum bin ich dann hier, Genosse Stalin?«
»Sie sind hier, weil ich glaube, dass die Bedeutung dieses Gemäldes nicht in seinem künstlerischen Wert liegt. Vor zwei Tagen hat sich ein deutsches Aufklärungsflugzeug verfranzt und ist auf einem Rollfeld hinter unseren Linien niedergegangen. Zwei Männer waren an Bord der Maschine, ein Pilot der Luftwaffe, dazu ein SS-Offizier. Der SS-Offizier hatte eine Aktentasche bei sich, in der dieses Bild gefunden wurde. Hätte er Geld oder Edelsteine oder Gold bei sich gehabt, würde ich keinen Gedanken an ihn verschwenden. Aber warum fliegt ein Offizier mit einem Gemälde in der Aktentasche durch die Gegend?«
»Sind die beiden verhört worden?«
»Dazu ist es nicht mehr gekommen. Der SS-Offizier hat erst den Piloten erschossen, dann sich selbst. Der Offizier der Roten Armee, der vor Ort war, ist aufgrund dessen zu dem Schluss gekommen, dass das Gemälde von einiger Bedeutung sein muss. Daher hat er es dem NKWD übergeben. Sie haben es als wertlos erachtet, trotzdem einen Bericht verfasst. Als mein Büro davon erfahren hat, habe ich mir das Bild umgehend schicken lassen. Es hat etwas, dieses Bild. Etwas, was mich beunruhigt. Ich komme nur nicht dahinter. Daher baue ich auf Sie, Pekkala.« Stalin ging zum Gemälde, nahm es von der Wand und legte es in die Aktentasche des deutschen Offiziers, in der es ihm zugestellt worden war. Er reichte Pekkala die Tasche. »Bringen Sie mir Antworten, Inspektor.«
Die Morgendämmerung zog bereits auf, als Pekkala und Kirow den Kreml verließen.
Pekkala betrachtete das Gemälde, das er auf dem Schoß liegen hatte. Seine Aufmerksamkeit galt dem Baum, auf dem der Falter saß. Es waren knorrige, blattlose Zweige wie die einer Magnolie im Winter. Er kannte sich mit Nachtfaltern nicht besonders aus, aber er bezweifelte, dass sie sich im Winter blicken ließen.
Er drehte das Bild um. Auf der Rückseite der Leinwand war etwas mit Bleistift geschrieben.
»Was steht da?«, fragte Kirow und sah herüber, während er den Emka durch die Kremltore steuerte.
»Ost-u-baf-engel«, erwiderte Pekkala, der mit einiger Mühe die ihm unvertrauten Silben entzifferte. »Ich gehe mal davon aus, das ist Deutsch, obwohl mir das Wort noch nie untergekommen ist. ›Ost‹ bezeichnet die Himmelsrichtung, ›Engel‹ könnte ein Name sein oder eben der Engel, aber das dazwischen ergibt keinen Sinn.« Erneut drehte er das Bild um und hielt sich die Leinwand nah ans Gesicht, als könnte ihm das zarte Insektenwesen etwas zuflüstern.
»Wo sollen wir da anfangen?«, überlegte Kirow laut.
»In der Lubjanka«, antwortete Pekkala.
»Im Gefängnis? Warum dort?«
»Weil wir dort mit einem Mann reden werden, der uns sagen kann, ob das Bild überhaupt irgendetwas wert ist.«
»Und wenn nicht?«
»Dann wird er uns sagen, warum.«
»Was macht dieser Mann im Gefängnis?«
»Er zahlt den Preis für sein Genie.«
»Hören Sie, Inspektor. Wie wäre es mit dem Kremlmuseum? Der Direktor ist Fabian Goljakowski, er gilt als der fähigste Museumsdirektor des ganzen Landes. Vielleicht sollten wir lieber mit dem reden.«
Pekkala schien sich Kirows Vorschlag durch den Kopf gehen zu lassen. »Gut!«, verkündete er. »Drehen Sie um. Das Museum ist unser erster Halt.«
»Aber das Museum hat noch nicht geöffnet«, protestierte Kirow. »Außerdem weiß ich nicht, wann mit Bombenalarm zu rechnen ist. Vielleicht ist es nötig, dass wir uns erst einen Termin geben lassen …«
»Wir kommen schon rein«, beschied Pekkala. »Ich weiß auch schon, was ich aus dem Museum brauche, und um das zu finden, ist kein Experte nötig. Also, zurück zum Kreml.«
»Jawohl, Inspektor«, seufzte Kirow, trat auf die Bremse und machte mit quietschenden Reifen kehrt.
Obwohl das Kremlmuseum zu dieser Stunde tatsächlich noch geschlossen hatte, bemühte sich Fabian Goljakowski persönlich an die Tür, um nachzusehen, wer dort so lautstark pochte.
Goljakowski war ein großer, nach vorn gebeugter Mann mit zerzausten rötlichen Locken. Er trug einen dunkelblauen Anzug, dazu ein cremefarbenes Hemd mit zerknittertem Kragen, keine Krawatte.
»Wer um alles in der Welt sind Sie?«, fragte er. »Haben Sie eine Ahnung, wie spät es ist?«
Pekkala hielt ihm seinen Schattenpass hin. »Wäre schön, wenn Sie ein paar Minuten für uns erübrigen könnten.«
Goljakowski las still den Pass. »Gut«, erwiderte er argwöhnisch. »Ich stehe dem Büro für besondere Operationen uneingeschränkt zur Verfügung. Wusste bislang nicht, dass sie so große Kunstliebhaber sind.«
»Warum sind Sie so früh hier?«, fragte Kirow.
»Ich war die ganze Nacht auf«, erklärte Goljakowski, wich zurück und ließ sie eintreten. »Ich habe die Gegenstände katalogisiert, die bald ausgelagert und weiter im Osten in Sicherheit gebracht werden müssen.«
Gefolgt vom nervösen Goljakowski, schlenderten Pekkala und Kirow durch die kalten, muffigen Räume und standen bald darauf in einem Saal mit russischen Ikonen.
Mit auf dem Rücken verschränkten Händen ging Pekkala an den Ikonen vorbei und betrachtete sie eingehend.
»Inspektor, was hat dieses Bild mit alten Ikonen zu tun?«, flüsterte Kirow.
»Nichts, soweit ich weiß«, antwortete Pekkala.
»Was suchen Sie dann hier, Inspektor?«
»Das weiß ich, wenn ich es sehe. Ah!« Pekkala war abrupt vor einer kleinen Holztafel stehen geblieben, auf der das Schulterporträt eines langhaarigen, bärtigen und finster dreinblickenden Mannes gemalt war. Der Dargestellte hatte eine rötlich gelbe Haut, als würde er von Kerzenlicht beleuchtet, der goldene Hintergrund war an zahlreichen Stellen abgeplatzt. »Das hier!«, flüsterte er und nahm die Ikone auch schon von der Wand.
»Inspektor!«, zischte Kirow. »Sie dürfen das nicht berühren.«
»Halt!«, rief Goljakowski. Seine Stimme hallte durch die Museumsräume. »Sind Sie von Sinnen?« Wild fuchtelnd stapfte er auf Pekkala zu. »Haben Sie denn keinerlei Respekt vor den Kunstschätzen dieses Landes?«
Es war Kirow, der ihm antwortete. »Glauben Sie mir, Genosse Goljakowski, er hat vor nichts und niemandem Respekt.«
»Bitte!« Goljakowski streckte Pekkala die Hand hin, er redete mit ihm, wie man sonst mit einem Lebensmüden redete, der auf einem hohen Gebäude oder einer Brücke stand, und entwand ihm ganz sacht die Ikone. Dann schlang er die Arme um die Tafel, als hätte Pekkala den zornigen Erlöser auf dem Gemälde geweckt, und als wäre es jetzt an ihm, Goljakowski, ihn wieder in seinen jahrhundertelangen Schlaf zu wiegen. »Haben Sie irgendeine Vorstellung, was das ist?«
»Nein«, gestand Pekkala.
»Das ist eine unschätzbare Ikone aus dem vierzehnten Jahrhundert. Sie stammt vom Balkan, hing ursprünglich in der Mariä-Himmelfahrts-Kathedrale und ist als Der Erlöser mit dem strengen Blick bekannt. Was wollen Sie damit?«
»Major Kirow mag schon recht haben, was meine Achtung gegenüber russischen Kunstschätzen anbelangt«, antwortete Pekkala. »Aber ich habe gesehen, was ihm anscheinend entgangen ist, nämlich, was aus den Menschen wird, die nach solchen Schätzen trachten. Ich brauche die Hilfe von jemandem, dessen Kenntnisse über diese Kunstwerke nur vom Hass übertroffen werden, den er diesem Land entgegenbringt. Ich werde ihn also überzeugen müssen, dass es auf dieser Welt noch Dinge gibt, die heilig sind …« Pekkala deutete auf die Ikone. »Und das Gesicht dieses Mannes wird ihn vielleicht davon überzeugen.«
»Können Sie ihn nicht einfach hierherbringen, damit er die Ikone sieht?«, flehte Goljakowski. »Ich werde ihn persönlich durch die Räume führen.«
»Ich bin überzeugt, dass ihm nichts lieber wäre«, erwiderte Pekkala. »Aber die Vorschriften in der Lubjanka lassen das nicht zu.«
»Lubjanka?«, flüsterte Goljakowski.
»Der Ikone wird nichts passieren«, versicherte ihm Pekkala. »In seinen Händen ist Ihre Ikone sicherer als in den Kellern Ihres Museums.«
Wer ist dieser Mann, Inspektor?«, fragte Kirow, als sie ein paar Minuten später das Gebäude verließen und Pekkala sich die in drei Lagen braunes Packpapier gewickelte Ikone unter den Arm geklemmt hatte.
»Er heißt Valeri Semykin und ist Kunstexperte. Vor allem wird er uns sagen können, ob es sich bei dem fraglichen Stück um ein Original oder um eine Fälschung handelt. Davor steht aber noch etwas anderes an. Semykin ist keiner, dem man mit leerem Magen gegenübertreten will, und das gilt auch für die Isolationszellen in der Lubjanka.«
»Das heißt, wir gehen ins Café Tilsit?«, fragte Kirow mit säuerlichem Ton.