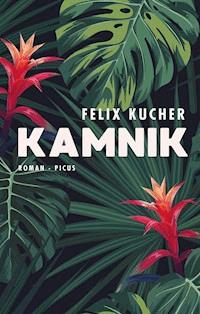Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Picus Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Eine Buchhändlerin wider Willen und eine Revolutionärin aus guten Gründen: zwei Frauen, deren Lebenswelten kaum unterschiedlicher sein könnten. Marie wächst behütet in Bayern auf und wird schon früh von ihrem Vater dazu bestimmt, eines Tages seine Buchhandlung zu übernehmen. Was sie zunächst als Zwang empfindet, entwickelt sich bald zu einer großen Leidenschaft und nach ihrer Flucht in die USA zur Lebensaufgabe. Tina wird als Arbeiterkind in bitterer Armut in Norditalien geboren und über den Umweg Hollywood zur Fotografin und kommunistischen Revolutionärin. Sie engagiert sich bis zur Erschöpfung, wo auch immer sie die Partei hinschickt: vom spanischen Bürgerkrieg bis ins revolutionäre Mexiko. Welcher Lebensentwurf ist geglückter? Die Revolution zwischen Buchdeckeln oder die mit dem Einsatz von Leib und Leben? Souverän verknüpft Felix Kucher die sehr unterschiedlichen Lebenswege zweier Frauen, die jede auf ihre Art dem Faschismus überzeugend entgegentreten.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 624
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Gefördert von der Stadt Wien Kultur.
Copyright © 2021 Picus Verlag Ges.m.b.H., Wien
Alle Rechte vorbehalten
Grafische Gestaltung: Dorothea Löcker, Wien
Umschlagabbildung: © Mark Owen/Trevillion Images
ISBN 978-3-7117-2104-4
eISBN 978-3-7117-5441-7
Informationen über das aktuelle Programm
des Picus Verlags und Veranstaltungen unter
www.picus.at
Felix Kucher, geboren 1965 in Klagenfurt, studierte Klassische Philologie, Theologie und Philosophie in Graz, Bologna und Klagenfurt. Er lebt und arbeitet in Klagenfurt und Wien. Im Picus Verlag erschienen seine Romane »Malcontenta« und »Kamnik« (2018).http://felix.kucher.at
FELIX KUCHER
SIE HABEN MICHNICHT GEKRIEGT
ROMAN
PICUS VERLAG WIEN
Inhalt
Über den Autor
PROLOG MÁLAGA, 1937
1902
1909
1911
1913
1915
1916
1918
1919
1920
1921
1924
1925
1926
1927
1929
1930
1933
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1949
1981
ANMERKUNGEN
DANKSAGUNG
PROLOGMÁLAGA, 1937
Ein Pfeifen, dann die Detonation, es kracht ohrenbetäubend. Erde spritzt, Körper fliegen durch die Luft, überall ist Rauch, Blut und Dreck. Verletzte schreien, aber es schreien auch die Wütenden, die Ohnmächtigen. Die Küstenstraße verläuft im Steilhang, es gibt keine Wiese, in die man laufen, keinen Wald, in dem man sich verstecken, keine Grube, in der man sich bergen könnte. Das Ziel der Bomben sind nicht Gebäude oder Brücken, nicht Soldaten oder Panzer. Das Ziel sind die Menschen auf der Flucht. Hundertfünfzigtausend Einwohner von Málaga, das seit Tagen bombardiert wird, mit Ziel Almería. Ein Treck aus Alten, Kindern, Ziegen, Schafen und Hühnern, Pferdefuhrwerken, Eselskarren, die meisten Menschen aber zu Fuß mit Bollerwagen voller Hausrat. Die meisten Kinder haben keine Schuhe, kaum jemand hat Kleidung zum Wechseln. Sechs Tage sind es zu Fuß, die Februarnächte werden eiskalt. Schon in der ersten Nacht sind so viele erfroren, niemand hat sie begraben, keine Zeit.
Als die Bomber jetzt, am zweiten Tag, auftauchten, glaubten alle, dass diese nach Almería weiterfliegen würden. Aber die Flugzeuge formierten sich in einer Linie und gingen tiefer. Als die Menge merkte: Das Ziel sind wir, brach Panik aus. Sie dauerte nur kurz, bis zur Explosion der ersten Bombe.
Tina legt sich auf den Boden und schließt die Augen. Ich will nicht sterben. Propellergeräusche, Pfeifen, Explosionen. Völlig schutzlos liege ich da. Bilder tauchen vor ihr auf, die Partys in Los Angeles und Mexiko, ihre Mutter, ihre Schwester Yole, die Bücher, die Robo ihr zu lesen gegeben hat. Marx, Freud, Nietzsche. Wieder eine Explosion, weiter weg. Um sie herum Wimmern.
Bücher, wer braucht in solchen Zeiten Bücher? Das ist die Praxis. Die Revolution muss durchgesetzt werden. Der Bombenhagel wird sie nicht aufhalten. Sie wird für die neue Gesellschaft kämpfen bis zu ihrem Tod.
1902
Sie sitzt auf den Schultern des Vaters. Viele Menschen stehen um sie herum, sie betrachtet sie verwundert von ihrem Hochsitz. Sonst sieht sie nackte Knie oder abgewetzte Hosen, Schürzensäume, Wälder aus Beinen, alles um sie ragt hoch auf. Und jetzt ist sie über ihnen, sieht auf sie hinunter. Sie reden laut, rufen etwas, dann singen sie gemeinsam und rufen wieder. Sie schwenken kleine Fahnen. Die lauten Stimmen machen ihr Angst. Auch ihr Vater singt, sie spürt die Vibrationen. Aber bedrohlich ist es dann doch nicht, die Menschen sind fröhlich.
Dann sind alle ruhig. Jemand redet, weit weg. Die Stimme klingt seltsam. Die Leute rufen Worte im Chor, singen wieder laut. Sie versteht die Worte nicht, es ist eine andere Sprache, wird ihr Vater später sagen, du wirst sie später in der Schule lernen. Vater, lass mich runter.
Baracken, dazwischen schlammige Erde, es hat geregnet. Offene Feuer brennen, darüber sind riesige Pfannen. Frauen rühren in den Pfannen Polenta, da, koste, sagt die Mutter und reicht ihr mit dem riesigen Holzlöffel einen Brocken. Sie schreckt zurück, heiß dampft es weg von dem gelben Kloß. Die Mutter bricht ein Stück ab, bläst darauf und reicht es ihr. Der noch immer heiße Kloß schmeckt süßlich, heute ist Sonntag, es gibt genug zu essen, da tut der Bauch am Abend nicht so weh.
Viel später weiß sie, dass das Bauchweh Hunger heißt.
Der Vater isst am Abend nie mit. Ich habe schon in der Fabrik gegessen, sagt er, als die Mutter ihm eine Kartoffel oder einen Polentakloß anbietet.
Sie spürt, dass etwas nicht stimmt. Jahre später wird ihr die Mutter erzählen, dass der Vater gelogen und zugunsten der Kinder auf das Abendessen verzichtet hat.
Einzelne Bilder, Worte, kurze Szenen.
»Mama, warum hat uns der Junge Polentafresser genannt? Ein anderer hat Katzelmacher gesagt.«
»Warum schauen die Menschen uns so an, wenn wir einkaufen gehen?«
Wieder auf den Schultern des Vaters. Erster Mai heißt der Tag. Ein neues Jahrhundert.
»Schau, Tina, so viele verschiedene Menschen. Deutsche, Italiener und Slowenen. Aber wir sind alle Arbeiter. Wir sind alle Brüder, wie gefällt dir das? Ist das nicht herrlich?«
Sie freut sich für ihren Vater, er vibriert unter ihr, ruft immer wieder Worte in die Menge. Rot-schwarze Fahnen überall. Und wieder lauter Gesang. Immer wieder dieselbe Melodie. Sie versteht nicht, was die Menschen singen. Die Menschen haben Zettel in ihren Händen. Die Internationaa-le er-kä-mpft das Mee-nschenrecht. Dann wird die Melodie noch einmal gesungen, sie versteht wieder nichts, obwohl es diesmal die Sprache ist, die ihre Eltern zu Hause mit ihr sprechen.
Dann wieder: Polentafresser! Katzelmacher!
»Mama, warum rufen uns die Buben das nach?«
»Wir essen eben Polenta, sie meinen das nicht böse.«
»Warum wohnen wir nicht in einem richtigen Haus wie die anderen?«
»Wir werden bald in eine richtige Wohnung ziehen. Die Holzbaracken sind nur für die, die noch nicht so lange hier sind.«
Polenta gibt es jetzt öfter, am Sonntag mit Zucker und Zichorienkaffee. Die Tage mit Brot heißen Montag, Mittwoch und Freitag.
Der Vater bekommt die Polenta in der Firma. Er macht Fahrräder aus Bambus. Der Chef ist Herr Kollitsch.
»Kollitsch Kollitsch Kollitsch«, sagt Tina. Was für eine lustige Sprache. Die Menschen in den Baracken reden alle verständlich, die Menschen in der Stadt versteht Tina nicht.
»Du wirst die Sprache noch lernen«, sagt Mama, »das ist Deutsch. Vielleicht können wir hierbleiben. In Österreich gibt es Arbeit.«
Einmal ist ein Gast da. Papa hat ihn mitgebracht, von der Arbeiterversammlung im Hotel Grömmer in Klagenfurt, Herr Pittoni aus Triest.
»Onkel Demetrio ist auch da, du kennst doch noch deinen Onkel? Er ist dein Taufpate, obwohl er Kommunist ist, aber das verstehst du ja noch nicht. Wenn die Kommunisten gewinnen, müssen wir nicht mehr hungern. Jetzt nehmen uns die Reichen noch alles weg. Wo ist denn Trina?«
Trina. Ihre Puppe.
Onkel Demetrio lacht und gibt ihr ein Geldstück.
»Giosuè, der Nachbar, hat sie geschnitzt«, sagt ihre Mutter, »ich habe ihr dann ein Kleid aus einem Stoffrest gemacht.«
Mit sieben dann die erste Klasse. In der Volksschule St. Ruprecht bei Klagenfurt sind die Hälfte der Kinder Italiener, sie verstehen fast kein Wort des Lehrers. Katzelmacher!, hört sie noch vor Beginn der ersten Stunde. Slowenenkinder sind auch da, sie sind ganz still.
Aber sie ist vorbereitet. »Ich bin seit meinem ersten Lebensjahr in Österreich«, sagt sie auf die Frage des Lehrers, warum sie so gut Deutsch spricht. »Und mein Vater hat viele deutsche Freunde.«
Sie denkt an die Männer, die Vater manchmal besuchen und mit denen er diskutiert. »Papa, was heißt: Arbeiter? Was ist ein Proletarier? Wann gehen wir wieder zurück?«
Wenigstens gibt es in der Schule ein Essen, Schulspeisung, endlich für kurze Zeit satt sein, die Wurst ist köstlich, manchmal gibt es sogar Kekse.
Und wieder ist Erster Mai. Die Straßen sind geschmückt, Leute marschieren, singen. Sie horcht hin, die Redner sprechen Deutsch, dann auch Italienisch und Slowenisch. Revolution. Rivoluzione. Revolucija.
Eines Abends kommt der Vater spät nach Hause, er ist verärgert.
»Papa, was ist denn, wir waren doch ganz brav?«
»Es ist nicht wegen euch, es ist wegen der Arbeit.« Er trinkt zwei Becher Wein, sie haben noch immer keine Gläser, nur die Becher aus glasiertem Ton. Er geht früh schlafen.
»Mama, was ist denn?«
Dreimal am Tag bekommen sie zweihundert Gramm Polenta und Käse, von sechs in der Früh bis vier Uhr am Nachmittag, das wird ihnen noch vom Lohn abgezogen. »Ach Tina, das verstehst du doch nicht. Papa findet das nicht gerecht, wie die Arbeiter behandelt werden und er möchte das ändern.«
»So wie Onkel Demetrio?«
»Genau, Tina. Alles wird sich ändern. Es kann nicht mehr so weitergehen. Wenn du groß bist, wird es keine Ungerechtigkeiten mehr geben. Alle werden gleich viel haben. Die Revolution wird kommen, das verstehst du noch nicht.
Vielleicht gehen wir auch nach Amerika. Alle zusammen. Mercedes, Tina, Valentina, Gioconda, Yole und der kleine Benvenuto.« Die Mutter streichelt den Kopf des Jüngsten, den sie gerade stillt. Die anderen sitzen auf dem großen Diwan um sie herum, Mercedes ist elf, Tina acht, beide helfen der Mutter und wickeln ihre jüngeren Geschwister, helfen bei der Wäsche und in der Küche.
»In Kalifornien scheint immer die Sonne. Dort ist es nie so feucht wie hier in der Baracke, alles ist trocken. Dort können auch die Armen etwas werden. Jeder hat eine Chance. Dort gibt es keine Grafen und Großgrundbesitzer.«
Mercedes sagt: »Tina, dort werden wir auf Pferden reiten. Vater wird als Erster gehen, das wird schon nicht so schlimm. Wir sind ja noch zu klein. Aber dann kommen wir nach und werden in einem schönen Haus wohnen, ganz aus weißen Brettern.«
Tina schaut auf die Holzbohlen, die die Wand der Baracke bilden. Sie sind sägerau, immer wieder zieht sich ein Kind einen Speil ein. Ein Haus aus weißen Brettern kann sie sich nicht vorstellen.
Es ist ihr zweiter Geburtstag. Sie sitzt auf einem Stuhl, der mit einem Tuch verhüllt ist.
In Wirklichkeit sitzt sie auf dem Schoß ihrer Mutter. Der Fotograf hat eine große Decke mit Blumenmuster über sie geworfen, Marie sitzt auf dem Schoß ihrer unsichtbaren Mutter. Sie kann sich nicht mehr erinnern, aber ihre Mutter hat es ihr oft erzählt. Ich bin bei dir, hab keine Angst, hat sie gesagt. Der Fotograf hat das Bild dann so zugeschnitten, dass die Zweijährige vor einem endlosen Blumenstoff erscheint. »Hidden mother photography« nennt man das, wird sie viel später lernen, in einem anderen Land, in einer anderen Sprache.
Nein, Erinnerungen hat sie nicht mehr viele an diese Zeit. Der Großvater hat noch gelebt, er hatte einen nach allen Richtungen abstehenden weißen Bart und immer etwas Süßes für sie in der Tasche seines Bratenrocks. Die Möbel sind immer dieselben gewesen, sie kann sich nicht erinnern, dass es einmal andere Stühle oder eine andere Anrichte gegeben hätte. Der Vater geht jeden Tag zur Arbeit in die Buchhandlung. »Wenn du groß bist, wirst du auch arbeiten«, sagt die Mutter.
1909
»Annunziata hat mich empfohlen. Bitte, Herr Raiser. Herr Direktor.«
Die Stimme der Mutter im Ohr. Immer Herr Direktor sagen, er ist dein zukünftiger Chef, vergiss das nicht, die Fabrik gehört ihm.
»Du bist erst dreizehn.«
»Aber ich kann arbeiten wie eine, die zwanzig ist. Ich kann einen Webstuhl bedienen. Wir haben in der Schule gewebt.«
»Welche Schule soll das gewesen sein?«
»Drüben, in Österreich. Sie wissen ja, dass mein Vater dort Arbeit hatte.«
»Beim Erbfeind bist du in die Schule gegangen? Und warum besuchst du die Schule hier nicht mehr?«
Wir hungern, Herr Direktor, will sie sagen, wissen Sie, wie das ist im Winter, wenn man hungrig ist? Es ist einem kalt trotz der zwei Decken, Hunger und Kälte sind Schwestern, Herr Raiser, aber das wissen Sie nicht, Sie wohnen in der gut geheizten Villa und essen jeden Tag Fleisch. Wir brauchen etwas zu essen und Holz zum Heizen und dafür braucht man Geld, Geld, Geld. In der Schule verdient man nichts. Es wird einem nichts geschenkt, Herr Raiser. Herr Direktor.
Sie sagt aber nichts, Raiser hat sicher längst verstanden. Die Frage war eine Farce, nur gestellt, um die Demütigung zu vergrößern. Er weiß, dass sie die Schule abbrechen musste, um zu arbeiten, vielleicht spürt er auch, als er das Zeugnis mustert und dann das Mädchen, das vor ihm steht, vielleicht spürt er, wie weh es ihr tut, wie gerne sie weiter gelernt hätte. Ihre Noten sind gut gewesen bis auf Italienisch, ihre Muttersprache, aber wie soll man denn schön sprechen, nachdem das erste Schuljahr auf Deutsch war, drüben bei den Erbfeinden. Sie kennt viele Ausdrücke hier nur im Dialekt, und diesen Makel ist sie erst in der Mittelschule losgeworden. Der Patron atmet tief ein und aus.
Sicher stellen sich hier jeden Tag Kinder vor, jeden Tag schaut Herr Raiser ihre Zeugnisse an, atmet tief und sagt »leider nein«.
»Na gut«, sagt er diesmal, »Annunziata hat sich ja auch geschickt angestellt und wenn du weißt, wie ein Webstuhl funktioniert, umso besser. Nur die hier sind etwas größer als die in der Schule.«
Dann geht alles sehr schnell. Er geht mit ihr in die Werkhalle, in der ein Lärm herrscht, der kein Krachen oder Dröhnen ist, sondern ein beständiges Klappern, das Schlagen von Holz auf Holz, hölzerne Peitschenhiebe für die Ohren der Arbeiterinnen in der Halle.
Keine über zwanzig, aussehen tun sie zehn, fünfzehn Jahre älter. Sie kann Annunziata nicht ausmachen, ihre ein Jahr ältere Nachbarin, aber sie muss an einem der Geräte sein, Sklavin der Maschine, Teil der proletarischen Masse, wie ihr Vater einmal gesagt hat. Keine der Arbeiterinnen blickt auf, ihre Gespräche sterben ab, als sie vorübergehen.
Raiser übergibt sie einem mausartigen Mann, der sich als Togliatti vorstellt und sie zu einem Webstuhl bringt, an dem ein hageres Mädchen mit tief liegenden Augen sitzt.
»Das ist Cinzia. Sie wird dir zeigen, was du zu tun hast. Schau ihr genau zu, dann geh ihr zur Hand. Bis zum Abend wirst du es schon heraußen haben.«
Cinzia legt gleich los, sie ist kurzatmig, ihre Anweisungen kommen hektisch gehaucht, als wäre sie gerade verprügelt worden.
Den Kamm nach vorne drücken, Kettfäden auf Spannung halten.
Pass auf, wo das Schiffchen ist, komm nicht durcheinander. Nein, nicht so. So, ja. Wenn der Kamm oben ist, dann lass das Schiffchen rechts. Wenn er unten ist, soll es links sein. Arbeite immer gleich, dann kann nichts passieren.
Kamm nach oben, Schiffchen mit Schussfaden durchziehen. Mit der Hand den Faden festziehen.
Und weiter: Kamm runter, Schiffchen durchziehen, Schuss festziehen, Kamm hoch, Kettbaum entriegeln. Halt die Schnur fest. Warenbaum entriegeln. Dann hier drehen, Gewebe auf Spannung halten, unten wieder verriegeln, dann … Tina kann nicht mehr folgen.
Sie versucht es immer wieder, die Fäden schneiden in die Fingerkuppen, Cinzia schimpft.
Nach einer Stunde schmerzen die Fingerkuppen, aber die Bewegungen gehen automatisch. Cinzia nickt anerkennend und beginnt zu reden.
Dass die dünnen Seidenfäden händisch gewebt werden müssen, das geht nicht mit einem automatischen Webstuhl. Dass die Fingerkuppen zuerst rissig und dann hart wie Horn werden. Dass Herr Raiser jeden Kommunisten sofort entlasse. Dass alle hoffen, dass einmal ein automatischer Webstuhl dafür erfunden wird. Andererseits, sagt Cinzia, hätten wir dann keine Arbeit mehr.
»Pass auf, jetzt ist der Faden fast gerissen. Das darf nicht passieren. Das hier ist Chiffon, damit beginnst du. Crêpe Georgette und Organza kommen später.«
Die Finger schmerzen, Cinzia erzählt von Maulbeerbäumen und Seidenraupen. Und von ihrem Verehrer, der Kohlen ausführt. Tina kann nicht mehr sprechen. Nach vier Stunden ist sie ganz Maschine – Kamm hinauf – Schiffchen – Kamm hinunter – Schiffchen, immer festziehen, immer – sie stellt sich Bilder zu Cinzias Worten vor, Maulbeerbäume voll von Seidenraupen, die in einem fort fressen und auf der anderen Seite einen Faden produzieren, mit dem sie den Kokon wickeln.
Zwanzig Minuten Mittagspause, die Arbeiterinnen packen Doppelbrote aus mit Käse, einige essen Polenta, die sie in zugeklammerten Emailtöpfen mitgebracht haben. Sie teilen mit Tina, die nichts dabeihat. Was auch.
Sie fragt Cinzia, ob die Menschen dann den Faden, mit dem der Schmetterling die Larve eingewickelt hat, wieder aufwickeln und so den Seidenfaden gewinnen. Stirbt dann das Schmetterlingskind, so ohne Schutz?
Cinzia sieht sie an, ihre Augen noch müder als vorher.
»Du stellst Fragen. Ich frage mich eher, wann Raiser zahlt. Er ist schon wieder im Verzug.«
Später erzählt ihr ein anderes Mädchen die ganze Geschichte noch mal von vorne, mit kleinen Änderungen. Die Raupe scheißt den Faden nicht, sondern spuckt ihn durch ein Loch vorne aus. Dann lässt sie den Kopf kreisen und hüllt sich selbst mit dem Faden ein. Nach einer Woche würde ein Schmetterling aus dem Kokon schlüpfen, aber die Menschen kommen vorher und haspeln den Faden ab.
»Es stimmt also«, sagt Tina. »Jeder Meter Faden ein totes Schmetterlingskind.«
Die Arbeiterinnen lachen.
Dir gehen Sachen im Kopf herum.
Den ganzen Nachmittag denkt sie an tote Schmetterlinge, um sie der peitschende Lärm und die Körperausdünstungen der Frauen.
Nur schnell weg! Weg von den Fabriken und den rußigen Fassaden der Arbeiterhäuser, weg von den Kohlgerüchen, die aus jedem Hauseingang wabern, von dem Mief nasser Erde, der aus den Kellerschächten kalt emporsteigt. Sie weiß, dass viele dieser Fabriken Spiegel herstellen, über achtzig Spiegelfabriken, haben sie in der Schule im Sachkundeunterricht gelernt, viele Familien leben davon. Aber wie die Arbeiter leben, das hat sie jetzt, mit neun Jahren, zum ersten Mal gesehen.
Sie zieht die Mutter an der Hand weiter. Endlich kommen die Geleise in Sicht. Erst jetzt wird ihr bewusst, welche Grenze die Gleisanlage bildet, die die Stadt in zwei Hälften teilt. Sie ist froh, auf der anderen Seite zu wohnen, wo die neuen Häuser stehen und die Altstadt mit ihren Fachwerkhäusern. Hinter dem Bahnhof, wo sie jetzt sind, sieht die Stadt völlig anders aus.
In der Bahnhofspassage ist es kalt. Marie hat immer ein wenig Angst in der Unterführung. Sie hält Mutters Hand fest, bis sie auf der anderen Seite wieder auftauchen. Das nächste Mal, wenn die Mutter einen Weg in dieses Viertel hat, was selten vorkommt, wird sie nicht mehr betteln, mitkommen zu dürfen. Lieber will sie das nächste Mal bei Helene bleiben. Sie und Jakob dürfen ja bereits alleine zu Hause bleiben, wenn die Mutter einen Weg hat. Gut, sie ist neugierig gewesen und wollte sehen, wohin die Mutter geht, wollte endlich in diesen unbekannten und so nahen Teil der Stadt, in dem sich so viele Schlote in den Himmel recken.
Als sie den Bahnhofsvorplatz überqueren, am Zentaurenbrunnen vorbei, schreit jemand hinter ihnen. »Haltet den Dieb!«
Marie und ihre Mutter drehen den Kopf. Marie sieht gerade noch, wie zwei rußige Gassenjungen im Bahnhof verschwinden, weiter vorne steht eine Dreiergruppe vornehm gekleideter Männer, von denen einer die Faust zum Himmel reckt.
»Komm weiter«, sagt die Mutter und zieht an Maries Hand.
Marie muss an die Jungen denken, die auf die andere Seite entwischt sind, durch denselben Tunnel, durch den sie gerade gegangen ist. Vielleicht hat sie schon jemand eingefangen. Arbeiterkinder. Angeblich arbeiten in manchen Fabriken Elfjährige. Die werden nie mehr eine Schule besuchen. Marie spürt die Tränen aufsteigen, schluckt den Kloß im Hals hinunter.
Die Einmündung zur Gabelsberger Straße kommt in Sicht. Ihre Straße, die sie auswendig kennt bis in den letzten Winkel. Sie wischt sich über die Augen. Keine Tränen. Das ist ihre Seite. Auf die andere möchte sie nie wieder.
Als sie nach zehn Stunden aus der Fabrik torkelt, sind ihre Finger rissig, der Hunger schlägt ihr in die Magengrube. Vor der Fabrik lungern Burschen, die einigen Frauen nachpfeifen und ihnen derbe Sachen zurufen. Tina geht schneller.
Zu Hause hat Mutter ein Stück Polenta zurückbehalten.
Onkel Demetrio hat sich auf der Küchenbank breitgemacht. Ein vierschrötiger, fleischiger Mann mit aufgequollenem Gesicht. Seit drei Tagen ist er wieder zu Besuch, er schläft nachts auf der Küchenbank.
»Du bist jetzt auch eine Arbeiterin«, sagt er. »Deswegen musst du auch zur Gewerkschaft kommen. Wir haben da eine Abteilung für die Jungen. Euch gehört die Zukunft. Die Revolution ist nicht aufzuhalten. Du wirst sie noch erleben, die Diktatur des Proletariats.«
Tina versteht nichts, sie ist hungrig, sie denkt noch immer an die toten Schmetterlingskinder. Als sie ihre Tasse mit dem Zichorienkaffee nimmt, merkt sie erst, dass sie ihre Finger nicht ganz krümmen kann.
Die Mutter zieht ein Foto aus einem Briefumschlag. Vater hat geschrieben. Er hat jetzt eine eigene Werkstatt aufgemacht, drüben in San Francisco. Er repariert alles, was man reparieren kann, vom Motorrad bis zur Wäschepresse, vom gerissenen Lederriemen bis zum stumpfen Drillbohrer. Die Mutter lacht. So einen bräuchten wir hier.
Dann sagt sie: »Der neue Laden hat viel gekostet. Er kann noch kein Geld schicken.«
Noch immer nicht, denkt Tina. Erst dann dämmert ihr, was ihre Mutter damit sagen will. Es wird nichts mit den Geldsendungen aus Amerika. Noch immer nicht. Von deinem Einkommen sind wir jetzt abhängig. Du bist die Älteste, die die Familie erhalten muss. Du bist schuld, wenn wir hungern müssen. Du hast mit zwölf Jahren die Schule abbrechen müssen, um uns sechs zu erhalten: mich, dich Valentina, Yolanda, Gioconda und den kleinen Benvenuto.
In diesem Moment fühlt sie einen stechenden Schmerz, ihr wird übel. Aber es gibt keinen anderen Weg. Mit zwölf kann man eben schon arbeiten, Yolanda, die kleine Yole, hat noch ein Jahr Schonzeit.
Mit dem Geld, mit ihrem Geld, für das sie sich in der Fabrik jeden Tag geschwollene Finger holen wird, wird die Mutter Brot und Maisgrieß kaufen, um die Polenta zu kochen, jeden Tag Polenta und Milch und Brot.
Wenigstens bekommen ihre kleinen Geschwister in der Schule zu essen, jeden Tag hundert Gramm Weißbrot, fünfundzwanzig Gramm Käse und fünfzehn Gramm Rohschinken, abgewogen und rationiert, das haben wir Roten eingeführt, hat Onkel Demetrio einmal gesagt. Satt werden sie davon trotzdem nicht.
Da Tina nichts sagt, spricht ihre Mutter.
»Vielleicht erlaubt Herr Ciampi ja, dass wir im Hinterhof ein paar Hühner halten, da kann er nichts dagegen haben«, sagt sie wie nebenbei.
Tina presst die Lippen aufeinander und nimmt die Fotografie in die Hand. Ihr Vater vor einem Bretterhaus. Das Gesicht ist unscharf. Wie er jetzt wohl aussehen mag? Seit vier Jahren ist er weg. Vier Jahre warten, dass er Geld von drüben schickt. Vier Jahre Briefe und Karten mit begeisterten Beschreibungen von San Francisco und kleinlauten Eingeständnissen, dass er das Geld noch brauche, um sich eine Existenz aufzubauen. Sie legt das Foto beiseite. Sie war acht Jahre alt, als sie ihn zuletzt gesehen hat. Wie sie ihn wohl heute sehen würde? Sie blickt sich um. Ja, seine Gewohnheiten nisten noch in der Stube. Wie er sonntags am Tisch sitzt und in der Parteizeitung liest, die müde Geste, wenn er den Bleistift vom Regal herunterholt, seinen Bleistift in der Bleistifthalterung, den niemand sonst anrühren darf, und er sich Zeilen unterstreicht, in denen es um die Rechte der Arbeiter geht. Die träge Fahrigkeit, dieses ständige Aufgescheuchtsein. Sie betrachtet das Foto noch einmal. Schmäler sieht er aus auf dem Foto, schmäler und vielleicht zufriedener hinter dem Schleier des Verschwommenen. Ob er weiß, dass hier alle hungern? Dass Tina mit zwölf die ganze Familie erhalten muss? Sicher hat es ihm die Mutter verschwiegen, sicher ahnt er es.
Vier Jahre. Dabei hat es so schön angefangen. Wir gehen wieder nach Hause, nach Udine. Weg von St. Ruprecht und Ferlach, weg von den Baracken. Wir werden wieder in einem Haus aus Stein wohnen, du wirst in eine italienische Schule gehen, dort spricht man unsere Sprache, alle sprechen sie dort, dort werden wir in einem richtigen Haus wohnen, Via Caiselli, im Zentrum der Stadt.
Die Via Caiselli, sie muss bitter lachen, wenn sie daran denkt, sie stellte sich als engste und feuchteste Gasse der Stadt heraus, die Häuser hatten zahlreiche winzige Zimmer, in denen zu viele Menschen wohnten, sodass sie ständig das Gefühl hatte, alles sei zu eng, zu klein, zu feucht.
Sie siedelten im September, als die Stadt in Regenfällen versank. In der Schule wurde sie gehänselt, weil sie nicht wusste, was Eisenbahn auf Italienisch heißt. Zu Allerheiligen verkündete Vater, dass die Familie auswandern würde. Mitten in die Freude hinein dann der Stich: Er würde als Erster gehen, ein Nest bauen, und er könne nur eine mitnehmen, Mercedes, die Älteste, sie war immerhin zwölf und hatte in den letzten zwei Monaten bewiesen, dass sie arbeiten konnte, zwei Monate in der Fabrik von Domenico Raiser. In San Francisco gebe es viele Webereien, sie könnte dort gleich eine Arbeit finden und er als Mechaniker sowieso. Jeden Monat, wenn es hart ginge jeden zweiten, würde er Geld schicken, damit sie nicht hungern müssten.
Tina erinnert sich an den Abschied, der Vater hat die Kinder einzeln hochgehoben, Valentina, Yolanda, Gioconda, sie selbst und als Letzten den kleinen Benvenuto. Tina weinte die ganze Nacht, noch heute hat sie den Geruch des feuchten Polsters in der Nase, der nach fauligem Werg stank. Nun war sie die Älteste, mit neun.
Nach zwei Monaten kam eine Postkarte, ich hole euch nach, es geht nur nicht gleich. Ich wohne in Turtle Creek, bei meinem Bruder, Mercedes arbeitet in San Francisco, dort hat es ein großes Erdbeben gegeben und dadurch haben jetzt alle Arbeit.
Vier Jahre. Vier Jahre jeden Tag Hunger und Polenta, im Winter manchmal Kohl, jede Woche anschreiben beim Kaufmann und hoffen, dass es diesmal noch geht, jeden Tag hoffen auf einen weiteren Brief, der eine von ihnen, wenigstens eine, ins goldene Kalifornien riefe. Goldenes Kalifornien, so nennen die anderen Frauen, die die Mutter manchmal besuchen, das Land. Ihre Männer haben es entweder nicht geschafft und schwärmen davon oder schicken Geld von drüben. Die Mutter verschweigt, dass von Giuseppe noch kein Geld gekommen ist. Prächtige Häuser schössen drüben aus dem Boden, erzählen die Frauen, wie Paläste sähen sie aus, Arbeit gebe es für alle.
Seit vier Jahren schläft Tina mit Yolanda und Gioconda in einem Bett, mit einer Decke, jedes Mal vor dem Einschlafen bittet Gioconda sie, ein Stühlchen zu machen. Sie winkelt die Knie an und die kleine Schwester kuschelt sich mit dem Rücken an ihre Vorderseite. »Du bist jetzt unser Papa«, sagt Yole, und es stimmt ja, sie verdient wirklich das Geld wie ein Vater.
Vier Jahre. Sie dreht die Fotografie um. Auf der Rückseite die Handschrift des Vaters: 7. März 1909, meine Werkstatt. Sie betrachtet wieder die Vorderseite, erst jetzt entziffert sie das Schild im Hintergrund, »Precision Engineering«.
Seit vier Jahren wartet sie auf den Brief, der das Ticket für sie enthält. Stattdessen lacht der Vater vor seiner neuen Werkstatt.
Dann kommt ihr auf einmal ein böser Gedanke, zuerst ganz klein, dann ergießt er sich über sie wie ein Topf schwarzer Farbe. Was, wenn der Vater inzwischen dort eine andere Frau gefunden hat? Vielleicht kommt nächste Woche schon ein anderer Brief, in dem er schreibt, ich hole niemanden mehr nach. Sie versucht, den giftigen Gedanken zu verscheuchen.
Dann wäre all das Warten umsonst gewesen.
Warum müssen Kinder immer warten?
Marie horcht an der Tür. Noch immer bereden die Eltern mit Großvater Ephraim etwas Geheimes, das die Kinder nicht hören dürfen. Walter und Helene ist es egal, sie klatschen die Spielkarten auf den Tisch und spielen Rommé, wie sie es sich von den Erwachsenen abgeschaut haben und es sich zusammenreimen. Pah. Marie weiß, dass sie in Wirklichkeit keine Ahnung haben. Hauptsache, ihre Geschwister haben sich wieder gegen sie verbündet. Walter geht mit seinen dreizehn Jahren schon in die Quarta, Helene mit elf in die Sexta, nur sie ist noch bei den Kleinen in der Grundschule. Die Geschwister denken, sie bekomme nicht mit, was läuft. Aber sie sieht genau hin, hört zwischen den Worten der Erwachsenen das Ungesagte, registriert, wie die Großen auf freudige und traurige Ereignisse reagieren und merkt sich jede Reaktion, wie andere sich Zahlen merken oder Worte.
Als sie Schritte hört, die sich der Tür nähern, setzt sie sich schnell wieder in den Sessel neben der Tür und nimmt ihr Buch zur Hand.
Ein Türflügel öffnet sich.
»Kommt rein!«, sagt die Mutter. »Gleich gibt es Abendessen.«
Während Marie sofort ihr Buch zur Seite legt und aufspringt, scheinen ihre Geschwister die Worte der Mutter gar nicht gehört zu haben.
Marie läuft hinein. Sie will neben Großvater sitzen, der zwar etwas eigenartig riecht, ein wenig nach altem Brot, der aber stets einen Scherz auf Lager hat, den die Leute nicht immer verstehen. Er kneift dann die Augen zusammen und wartet, bis der Witz gesickert ist. Sie liebt ihn gerade deswegen und weil er ihren Vater manchmal wie ein kleines Kind erscheinen lässt. Ihr Vater, der sonst so herrisch ist, wird immer zum Buben, zum Kind seines Vaters, das Maßregelungen und Lob über sich ergehen lässt.
»Worüber habt ihr geredet?«, fragt Marie.
Die Mutter wirft ihr einen strengen Blick zu. Man platzt nicht einfach so heraus.
»Ach, Politik«, sagt der Großvater. »Und über fremde Länder.«
»Was denn? Über welche?«, fragt Marie.
Der Vater zieht die Stirn in Falten, doch der Großvater winkt sie zu sich, sie setzt sich auf seinen Schoß. Sie hat das früher gerne gemacht, jetzt ist sie sich nicht sicher, ob sie nicht schon zu alt dafür ist.
»Du fragst so viel. Interessieren dich andere Länder?«
»Oh ja! Amerika! Und der Südpol.«
»Der Südpol?«
»Ja, da wo die Forscher dauernd hinfahren.«
»Woher weißt du denn das schon wieder?«, sagt der Großvater.
Walter und Helene trotten ins Zimmer, Marie rutscht vom Knie des Großvaters und setzt sich auf ihren Platz.
»Sie haben in Sachkunde einen jungen Lehrer«, sagt die Mutter. »Der hat ihnen von der Expedition von diesem Shackleton erzählt.«
»Stell dir vor, Großvater, die Männer sind tagelang durch das Eis marschiert. Sie hatten nur noch ein paar Kekse und das Wasser vom Schnee. Sie wären fast gestorben.«
Die Geschwister ziehen Grimassen. Nicht schon wieder die neunmalkluge kleine Schwester.
»Nun lass gut sein«, sagt der Vater. »Wir essen jetzt.«
Die Mutter beginnt die Suppe zu verteilen.
»Später kann ich dir von Amerika erzählen«, sagt der Großvater. »Ein Freund von mir ist vor langer Zeit ausgewandert. Ein Fürther, Julius Ochs. Aber jetzt essen wir.«
Doch Marie kann nicht lange stillhalten.
Sie löchert den Großvater.
»Wenn du groß bist, kannst du ja nach Amerika fahren. Du musst einen reichen Mann heiraten, mit dem fährst du dann.«
Heiraten? Niemals.
»Ich fahre allein. Nein, dich nehme ich mit.«
1911
»Ich mache da nicht mit. Das ist zu gefährlich!«
»Tina, wir müssen etwas tun. Nur weil wir Frauen sind, kann uns Raiser nicht so behandeln.«
Sie sitzen mit zwanzig anderen Frauen in einer Ecke der Halle, einen eigenen Raum für ihre Mittagspause gibt es nicht. Wer hier miteinander spricht, flüstert, raunt, damit die anderen nicht mithören. Die paar Stücke Salsiccia und das ölige Brot sind schnell aufgegessen, nun sitzen sie beieinander und schauen immer wieder zu den anderen.
»Lies doch lieber ein Buch, um dich abzulenken. Ich kann dir aus der Leihbücherei etwas mitbringen.«
»Du mit deinen Büchern. Es nützt dir ja doch nichts. Glaubst du wirklich noch, dass du wieder in die Schule einsteigen kannst?«
Cinzia legt den Kopf schief. Zarter Spott.
»Ich bin ja noch jung. Wenn ich genug Geld habe, gehe ich nach Amerika. Dort besuche ich dann eine englische Schule. Ich muss noch so viel lernen!«
Sie sagt nicht, dass es ihr kaum gelingt, etwas zu sparen, die paar Lire, die sie für die Fabrikarbeit bekommt, reichen gerade dafür, dass die sechsköpfige Familie über die Runden kommt. Und dass Vater noch immer kein Geld geschickt hat.
»Sei nicht dumm. Du bist fünfzehn. Du wirst in keine Schule mehr gehen. Was willst du denn noch lernen. In zwei, drei Jahren wirst du heiraten, Kinder kriegen und das war’s dann. Wir sind Arbeiter, schon vergessen? Die Arbeiterklasse. Die bleibt unter sich, genauso wie die anderen Klassen.«
Sie will noch erwidern, dass das Unsinn ist, dass es immer eine Möglichkeit gibt, aber die Klingel schrillt, Ende der Mittagspause.
Es ist vier Uhr nachmittags, noch drei Stunden bis zum Ende des Arbeitstags, als der Vorarbeiter zum Webstuhl tritt. In seiner Begleitung ist eine Frau, die Tina nur vom Sehen kennt, die Falten in ihrem hageren Gesicht wirken wie mit Kohle nachgezogen.
Der Vorarbeiter deutet wortlos: Du, komm mit. Du, übernimm ihre Arbeit. Tina ist verwirrt. Was ist los? Der Mann verschwindet mit Cinzia, die namenlose Frau stellt sich an den Webstuhl. Sicher ist es wegen des Streiks, der noch gar nicht stattgefunden hat. Sie muss sie fragen, wenn sie zurückkommt. Aber Cinzia kommt bis zum Ende der Schicht nicht zurück.
Sie trifft sie am Tor, mit roten Augen.
Tina ahnt es, trotzdem fragt sie. »Was ist los?«
Cinzias Blick ist glasig. »Gefeuert. Gleich fünf auf einmal. Dabei haben wir ja noch gar nicht gestreikt. Aber irgendwer hat Raiser das gesteckt.«
»Aber in der Produktion brauchen sie doch jede Einzelne.«
»Kindchen, für die fünf Posten warten schon fünfzig Mädchen. Und du hast es ja auch schnell gelernt, schon vergessen?«
Drei Jahre ist es her, dass Cinzia ihr den Webstuhl erklärt hat. Drei Jahre haben sie mit kleineren Unterbrechungen zusammengearbeitet.
»Ich werde auch gehen«, murmelt Tina, und sicher weiß auch Cinzia, dass es eine Lüge ist.
»Ich bin Betty.«
»Marie. Marie Rosenberg. Von der Buchhandlung in der Schwabacher Straße.«
Natürlich hätte sie es einer Gleichaltrigen gegenüber nicht dazusagen brauchen, aus welcher Familie sie stammt, aber es ist ihr herausgerutscht. Sie hat es gelernt, sich so vorzustellen. Jeder Erwachsene in Fürth ordnet ein Kind sofort einer Familie zu, was oft gleichbedeutend mit einem Betrieb oder einem Amt ist. Luise, ihre beste Freundin in der Grundschule, ist nicht mehr in der Klasse. Sie hat sich immer mit »die Tochter des Postvorstehers« vorgestellt. Alice und Fanny kennt sie noch, die sitzen auch wieder nebeneinander in der ersten Reihe, wie schon in der Grundschule. Blöde Gören. Die dicke Josefine ist auch da und schaut erwartungsvoll Richtung Tür. Alle sind sie neugierig, welcher Lehrer wohl als Erster hereinkommen wird. Bis auf die drei gibt es für Marie in dieser Klasse nur neue Gesichter. Sie ist verzweifelt gewesen, als sie den Klassenraum betreten, sich gesetzt und bemerkt hat, dass keine Freundin da ist. Dafür blickten sie dreißig Augenpaare misstrauisch und neugierig an. Zumindest kam ihr das so vor. Aber jetzt hat sie eine Banknachbarin, die nett aussieht. Betty.
»Mein Vater arbeitet am Gericht, aber er ist kein Richter.«
Ein ebenso eingelernter Satz. Es kommt Marie seltsam vor, dass sich zwei Gleichaltrige so vorstellen, wie sie es sonst immer Erwachsenen gegenüber tun. Das passt nicht für Kinder. Es ist ein Reflex.
Marie weiß nicht, was sie erwidern soll.
»Ich habe dich schon einmal gesehen«, sagt Betty. »Und deine Familie. Beim letzten Jom Kippur.«
Sie ist also auch Jüdin, und zwar eine von den frommen. Sonst würde sie nicht so reden.
»Wir gehen nicht so oft, nur zu den Feiertagen.«
Sie muss daran denken, wie ihr Vater immer freundlich, aber bestimmt die Einladungen ablehnt, die Bekannte zu jüdischen Festen aussprechen. Manchmal spricht er beim Essen den Kiddusch, wobei sie immer das Gefühl hat, dass es ihm peinlich ist. Über die Arbeitsverbote am Schabbat macht er sich immer wieder lustig. »Nur zu den Feiertagen« war nicht ganz richtig. Nicht öfter als zehnmal ist sie mit ihren dreizehn Jahren in der Synagoge gewesen, meistens zu Jom Kippur. Außer im Religionsunterricht in der Volksschule hat sie mit der Religion nie etwas zu tun gehabt.
An der Tür ertönt ein Geräusch, die Gespräche in der Klasse ersterben sofort, als ob jeder schon neben dem Reden halb hingehört und nur darauf gewartet hätte, bis der Lehrer käme. Ein Mann mit streng zurückgekämmtem schwarzem Haar, Schnurr- und Spitzbart tritt ein und schließt die Tür hinter sich. Mit einem kollektiven Rums! stehen alle auf, während der Lehrer zum Pult schreitet.
Es ist totenstill.
»Setzen! Ich bin euer neuer Klassenlehrer und werde euch in Geografie, das ist Erdkunde, unterrichten. Ihr seid jetzt im Lyzeum und hier gibt es viele Fächer, die ihr bisher nicht hattet. Mein Name ist Heinrich Zink. Ihr werdet mich mit Herr Professor Zink ansprechen. Wir werden viel lernen.«
Er nickt langsam, als würde er sich selbst bestätigen, und schaut von Schülerin zu Schülerin. »Viel lernen, und ich erwarte mir, dass ihr euch durch Fleiß und Wohlbetragen auszeichnet.«
Viel lernen. Ich will viel lernen, denkt Marie, lernen, lernen, lernen. Ich werde Vater keine Schande machen. Ich werde das Abitur machen, auch wenn er mich lieber in der Buchhandlung sehen will. Es reicht doch, wenn Walter dort arbeitet.
»Wer von euch ist auf Sommerfrische gewesen?« Die Stimme des Lehrers. Was er zuvor gesagt hat, hat Marie nicht gehört. Aber ja, ihre Familie war im Sommer eine Woche im Salzkammergut, im Österreichischen. Sie zeigt auf.
»Ja, das stimmt, drüben im Österreichischen, bei den Erbfeinden«, – Demetrio lacht auf – »die haben keinen Zwölfstundentag mehr für Mädchen in deinem Alter. Die sind schon weiter. Aber wir kämpfen auch dafür, da kannst du dir sicher sein. Ist es wegen der Hände?«
Tina schüttelt den Kopf.
Sie ist mit Onkel Demetrio am Tisch sitzen geblieben, die Mutter macht sich mit dem Geschirr im Spülstein zu schaffen, die Geschwister sind im Hof und spielen wahrscheinlich mit Holzreif und Ball.
»Schau, meine Finger haben schon so viel Hornhaut, da spüre ich nichts mehr. Es sind die Aufseher, die so …«
Sie vollendet den Satz nicht. Demetrio weiß ohnehin, wie es zugeht. Die Schikanen, wenn sie etwas auf den Boden werfen, das ein Mädchen aufheben muss. Wie sie ihnen an die Hinterbacken greifen und sie zusammendrücken wie eine Zitrone, ein Zeichen, dass der Aufseher einen mag. Die Lohnabzüge, wenn eine sich eine halbe Stunde hinlegen muss, weil sie Krämpfe hat oder Fieber.
»Hat es sich nicht gebessert?«
Tina schüttelt den Kopf.
»Die Burschen drüben in der Papierfabrik verdienen viel mehr als wir und die Arbeit ist nicht schwerer und außerdem ist dort nicht so ein Lärm. Warum tut deine Partei nichts für die Frauen?«
»Sie tut etwas, sie tut etwas«, brummt Demetrio. Er holt seine Pfeife hervor und klopft sie aus. Er stopft sie und zündet sie an. Tina mag den süßlichen Geruch.
»Aber es geht nur langsam. Du weißt, dass Frauen in unserer Partei gleichberechtigt sind. Du solltest auch mitmachen. Zumindest Mitglied des Syndikats könntest du werden.«
»Bei uns hat Raiser zwei sofort entlassen, die Werbung für das Syndikat gemacht haben. Es ist so ungerecht.«
»Ich weiß. Aber hab Geduld. Es bessert sich überall etwas. Langsam. Wenigstens seid ihr nicht eingesperrt in der Halle.«
»Eingesperrt? Das wäre ja noch schöner!«
Demetrio Canal zieht dreimal kurz an der Pfeife, jedes Mal schmatzt er dabei.
»Hast du nicht gehört, was im März in New York passiert ist?«
»Nein. Ich lese keine Zeitung.«
Dafür Bücher, zumindest versuche ich es abends, aber ich schaffe nur drei Zeilen, bis mir die Augen zufallen, will sie sagen, aber sie schweigt.
»Eine Hemdenfabrik hat gebrannt. Wahrscheinlich hat jemand eine Zigarette auf einem Stoffballen vergessen. Die zweihundert Mädchen, die in der Halle dicht aneinander an den Nähmaschinen saßen, gerieten in Panik.«
»Warum haben sie das Feuer nicht gelöscht?«
»Ich weiß es nicht, aber ich glaube, es gab kein Wasser. Jedenfalls waren die Türen geschlossen, als das Feuer um sich griff. Hundertfünfzig von ihnen sind verbrannt.«
Rauch kringelt aus seiner Pfeife. Tina spürt Übelkeit aufsteigen.
»Aber … warum hat niemand die Türen aufgemacht? Und warum sind sie nicht aus dem Fenster gesprungen?«
»Kind, in New York sind die Häuser höher als hier. Die Halle war im achten oder neunten Stock. Zwanzig oder dreißig sind tatsächlich gesprungen. Sie waren sofort tot. Warum die Türen nicht aufgingen, weiß ich nicht. Vielleicht haben sie geklemmt.«
Tina würgt. Gleich muss sie sich übergeben. Demetrio pafft eine beißend-süßliche Wolke. Seine Stimme klingt trocken.
»Man fand die verkohlten Leichen an ihren Nähmaschinen sitzend. Die Mädchen hatten Angst vor Strafe, wenn sie ihren Arbeitsplatz verließen. Die Feuerwehr kam zu spät.«
Tina denkt an die Seidenweberei, an die vertraute Fabrikhalle, um die Übelkeit zu vertreiben. Bei Raiser arbeiten alle Frauen im Erdgeschoß. Wenn im ersten Stock Feuer ausbräche, würden eher Raiser und die Leute in den Büros verbrennen, nicht die Arbeiterinnen.
Sie würgt die Übelkeit hinunter, im Magen ist immer noch ein flaues Gefühl. Sie sieht die Mädchen, die weinen und schreien, die sich im Sitzen an ihre Nähmaschinen klammern, die durch das Gas ohnmächtig werden, vornüberkippen und dann wie Puppen von den Flammen erfasst werden. Alle sind betäubt, keine schreit mehr.
Sie mag Onkel Demetrio nicht ansehen, sie blickt an die Wand neben sich zum Kalender, es ist ein Jahreskalender auf einem Blatt, an die Wand geheftet mit einer Reißzwecke, für jeden Tag steht klein gedruckt ein Heiliger im Kalender. Tina kann die Namen nicht lesen, die Buchstaben verschwimmen vor ihren Augen. Warum helfen diese Heiligen nicht, wenn man sie braucht?
Die Buchstaben verschwimmen vor ihren Augen. Wer soll sich all die Vokabel merken?
Sie lässt das Buch sinken und blickt aus dem Fenster.
Noch kein Schnee Anfang Dezember, aber draußen ist es so kalt, dass sich jede Nacht Eisblumen an den äußeren Fenstern bilden.
Kirchenglocken läuten, Sophie und die anderen christlichen Mitschülerinnen sind sicher schon auf dem Weg in die Kirche.
Marie blickt sich im Zimmer um. Sie hat ihr Bett gemacht, das von Helene ist noch so, wie sie es beim Aufstehen hinterlassen hat. Aber trotzdem ist Helene immer die brave große Schwester. Sie ist ja auch mit den Eltern spazieren gegangen und sammelt wieder Gutpunkte, während Marie nichts von den langweiligen Spaziergängen im Stadtpark hält, vor allem jetzt im Winter. Den Park kennt sie in- und auswendig. Sie wird es wohl nie schaffen, ihre Schwester von ihrem Favoritenplatz zu verdrängen. »Mein kleiner Widerborst«, hat der Vater sie neulich genannt. Marie hat das als Lob gesehen.
Sie versteht nicht, dass man mit elf Jahren so viel lernen muss. Turmrechnungen, dreistellig, vierstellig, fünfstellig, wer ist als Erster fertig, hat der Lehrer gerufen. Lateinische Vokabel, jeden Tag eine neue Lektion. So viele Fachausdrücke in Erdkunde und in Geschichte. Wer soll sich das alles merken?
Das Schulgebäude ist ja schön und neu und liegt gleich um die Ecke, aber am ersten Tag hat sie sich trotzdem fast verlaufen. »Mädchenlyzeum«, steht in großen Buchstaben über dem Eingang, »Höhere Töchterschule Oststadt« klein darunter.
Sie fragt sich, ob sie fehl am Platz ist. Sie ist doch keine höhere Tochter. Und die Klassen heißen so komisch. Sie war jetzt in der Sexta, obwohl es die fünfte Klasse ist. Der Bruder war in der Untertertia, die die achte ist, Helene in der Quinta, die die sechste ist, obwohl sie gerade gelernt hat, dass quinta fünfte heißt!
Sie gleitet von ihrem Sessel, gleitet aus dem Mädchenzimmer und klopft an Walters Tür. Er will das seit Neuestem, die kleine Schwester muss seine Privatsphäre respektieren, hat er gesagt.
»Was willst du denn schon wieder«, sagt er, als er die Tür öffnet. Er wirkt verschwitzt, als ob er gelaufen wäre.
»Kannst du mich Vokabel abprüfen?«
»Ach, Marie. Später. Oder vielleicht hat ja Vater dann Zeit oder Helene, wenn sie zurück sind.«
Sie wirft einen Blick in sein Zimmer. Zwei Hanteln liegen auf dem Boden. Offenbar hat der Bruder gerade trainiert. Er hat die Hanteln zum Geburtstag bekommen, alle seine Freunde haben so etwas, sie wollen Muskeln haben, die sie beim Turnen vorzeigen können.
Sie zieht eine Schnute.
»Hör mal«, sagt er, »du musst jetzt selbständig sein, du wolltest ja unbedingt auf diese Schule. Mir hat auch niemand geholfen.«
Sie versucht, Tränen hinauszudrücken, es kommen keine.
»Später, einverstanden?«, sagt der Bruder. Sie trottet zurück in ihr Zimmer. Die Spaziergänger würden sicher erst in einer Stunde kommen.
Mit ihrer Schwester war sie bis vor zwei Jahren unzertrennlich gewesen. Sie spielten gemeinsam, seit sich Marie erinnern kann. Sie hatten keine Geheimnisse voreinander, Marie trug ihre Kleider nach, sie war ihre beste Freundin. Aber das Lyzeum hat Helene vor zwei Jahren mit einem Mal verwandelt. Keine Zeit mehr für Kindereien. Die große Schwester hat Freundinnen, bei denen sie sich unterhakt und mit denen sie in der Altstadt zwischen den Fachwerkhäusern, wo sich Geschäft an Gasthaus reiht, herumspaziert, herumkichert und Geheimnisse hat, die sie mit Marie nicht mehr teilt. Vielleicht wird es ja jetzt besser, wenn Marie auch im Lyzeum ist.
Sie setzt sich wieder an ihr Tischchen und nimmt ihr Vokabelheft.
Walter wird sicher wieder vergessen, dass er zugesagt hat. Nach dem Mittagessen wird Vater Zeit haben. Genau das, was sie vermeiden wollte. Bei jeder nicht gewussten Vokabel wird der Vorwurf im Raum stehen: Du hast es nicht notwendig. Lass es sein. Geh an eine andere Schule, in drei Jahren trittst du sowieso die Lehre in der Buchhandlung an. Aber sie wird sich anstrengen, und der Vater wird nachgeben müssen. Sie wird ab jetzt auch ganz brav sein, nicht mehr frech zurückreden und ihr Kleid nicht mehr so oft schmutzig machen.
Nur das Kleid nicht schmutzig machen. Nicht aufsehen. Zumindest bis die Delegation vorbei ist. Langsamer arbeiten, es soll ja niemand den Eindruck bekommen, dass ihr schuften müsst, hat der Aufseher gesagt. Die drei Kleinen haben heute frei, nur Mädchen über zwölf sind in der Halle.
Auch die Maschinen rattern heute leiser, Tina hat keine Ahnung, wie die Mechaniker das geschafft haben. Trotzdem versteht man schon die Arbeiter, die fünf Meter entfernt stehen, nicht mehr. Und so kann sie auch nicht hören, ob die Herren schon da sind. Auf den Eingang der Halle sieht sie von ihrem Platz aus auch nicht. Nach einer Viertelstunde Arbeit spürt sie die Unruhe, die sich wie eine Welle unter den Arbeiterinnen ausbreitet, auch wenn sie nichts sieht oder hört. Die Delegation ist da. Direktoren von Spinnereien aus Österreich, dem Kronland Vorarlberg, wo angeblich die Hälfte der Einwohner an Webstühlen arbeitet, hat ihnen der Aufseher letzte Woche erzählt.
Die sechs dicken Männer bewegen sich durch die Halle, Raiser erklärt hin und wieder etwas, man sieht ihm an, dass er sich anstrengen muss, den Lärm zu übertönen. Die Herren nicken, sie sehen übernächtig aus. Am Webstuhl vor Tinas Arbeitsplatz bleiben sie stehen, Raiser spricht. Als sie an ihr – Gott sei Dank – vorüberziehen, läuft es ihr kalt über den Rücken. Nur nicht aufblicken, bedächtig die Arbeit tun.
Ein Geräusch lässt sie dennoch aufsehen. Etwas Silbernes liegt auf dem Boden, eine Taschenuhr, ein Mann, der sich von der weiterziehenden Gruppe abgewandt hat, steht davor und macht Anstalten, sich zu bücken. Tina gibt das Schiffchen in die Endposition, dreht sich um, bückt sich, gibt dem Mann die Uhr.
»Danke«, sagt er auf Deutsch.
»Bitte sehr, der Herr«, antwortet sie ebenfalls auf Deutsch.
Der Mann zieht die Brauen hoch.
»Du sprichst Deutsch?«
Tina senkt den Kopf, nickt Richtung Boden.
»Wo hast du denn das gelernt?«
»In der Schule. Ich bin in Österreich zur Schule gegangen.«
»Eine Arbeiterin, die Deutsch kann. So eine könnte ich brauchen.«
Er zuckt die Achseln, als wollte er sagen: Es ist ohnehin nicht möglich.
Sie sieht ihm noch ein wenig nach, wie er aufschließt zu den anderen, dann wendet sie sich wieder ihrem Webstuhl zu.
Wieder in die Schule gehen. Bücher lesen. Neue Worte lernen, Buchstabe für Buchstabe. Sie denkt an die Formen der Buchstaben auf dem Fabriksgebäude, den Bogen des »R« von »Raiser«. Warum gibt es überhaupt Buchstaben? Wie sie wohl entstanden sind? So viel dumme Gedanken, während das Schiffchen hin und her saust.
Mittwochnachmittag darf sie das erste Mal allein zu Betty. Als sie mit ihr vor dem Spiegel steht und beide Grimassen schneiden, wird ihr während des Lachanfalls klar, wie verschieden sie sind: Betty ist mager und hat eine Haut wie aus rosa Papier. Ihr dünnes blondes Haar, das ständig von einem perlmuttfarbenen Haarreif zusammengehalten wird, trägt sie offen. Neben ihr kommt sich Marie pummelig vor. Ihre Haut ist dagegen fast ledrig, ihr drahtiges dunkelbraunes Haar nur mühsam gebändigt. Während Betty schnell das Interesse an einer Sache verliert und gleich zur nächsten geht, bleibt Marie länger bei einem Spiel und hat größere Mühe, sich umzustellen. Dafür ist sie schnippischer, Betty drückt sich oft umständlich aus.
Auch die Wohnung von Bettys Familie ist so anders als ihr Zuhause in der Gabelsberger Straße. Nicht, dass es zu Hause hässlich wäre. Aber die elterliche Wohnung ist nichts Besonderes, und die meisten Wohnungen, die Marie bisher gesehen hat, sehen ähnlich aus: Möbel aus blank poliertem Eichenholz, gepolsterte Stühle, eine Vitrine für das gute Geschirr, eine Anrichte für das gewöhnliche; Kunstdrucke und echte Bilder an den Wänden.
In Bettys Wohnung sind die Räume höher, im Wohnzimmer stehen pechschwarz lackierte glänzende Möbel mit Messingbeschlägen, die zu groß für den Raum scheinen und Marie an Afrika denken lassen.
Betty ist heute wie eine Puppe gekleidet, ein Kleidchen mit Tülleinsatz und falscher Spitze am Saum. In ihrem engen Zimmer ist kaum Platz für ihr weiß lackiertes Eisenbett. In den Regalen stehen Spielsachen und Kinderbücher. Sie hat auch einen vier Jahre älteren Bruder, Isaak, der das Kabinett neben ihr bewohnt, er besucht das jüdische Gymnasium. Auch Isaak ist dünn wie eine Bohnenstange, hat ein spitzes Kinn und dunkelbraune, immer unfrisiert aussehende Haare – das Gegenteil von seiner blondschimmernden Schwester. In seinem Zimmer hängen Zeichnungen von Flugzeugen. Er erzählt den Mädchen von den neuen Wasserflugzeugen, die es jetzt gibt, und dass die Berliner Morgenpost jeden Tag frisch von der Druckerei nach Frankfurt an der Oder geflogen wird. Dann schwärmt er von seiner Schule und dass er dort neben Latein auch Hebräisch lernt. Angeber.
»Ich will das auch lernen«, sagt Marie.
»Das ist nichts für Mädchen. Die müssen kochen und nähen lernen, wenn sie einen Mann finden wollen. Aber nicht Hebräisch.«
»Ich werde nie kochen«, sagt Marie laut. »Ich werde eine Köchin haben so wie die reichen Leute, oder einen Mann, der kocht. Die modernen Frauen sind jetzt anders. Du wirst schon sehen.«
Isaak lacht.
Marie beginnt: »Aleph, Bet, Gimel, …«
»Schon gut«, sagt er, »ich glaub’s dir ja. Das kann aber jeder.«
Isaak atmet tief durch.
»Geht jetzt wieder spielen. Ich muss lernen.«
Marie schmollt, sie will kein kleines Kind mehr sein, das sich so einfach abspeisen lässt. So viel wartet darauf, entdeckt zu werden. Isaak ist um nichts besser als die Erwachsenen, die ihr nichts zutrauen. Sie wird diese Sprache auch lernen. Das Alphabet, das Aleph-Bet kann sie schon. Ist sie nicht auch Jüdin, auch wenn sie nur einmal im Jahr ins Bethaus gehen? Sie wird es ihm schon zeigen.
»Da war ich noch nie drin.«
»Obwohl du so nahe wohnst?«
Tina zuckt mit den Achseln.
»Bist du jetzt fromm geworden?«
»Meine Mutter hat mich immer mitgenommen, als ich klein war. Natürlich mussten wir hinten stehen, aber ich habe schöne Erinnerungen.«
»Was ist dann passiert?«
»Das, was auch in deiner Familie passiert ist, Dummerchen. Alle sind Kommunisten geworden.«
Cinzia schiebt die schwere Holztür auf. Tina ist froh, dass sie vorbeigekommen ist und sie abgeholt hat. Seitdem Cinzia nicht mehr bei Raiser arbeitet, vermisst Tina die Gespräche, den Klatsch und Tratsch, die Vertrautheit. Vor zwei Wochen hat sie an die Tür in der Via Caiselli geklopft und nach Tina gefragt. Sie fiel ihr um den Hals. Sie erzählte ihr, dass sie als Näherin arbeitete und sich manchmal mit einem Burschen treffe, der in einer Druckerei arbeite und immer schwarze Finger habe. Sie verabredeten sich für Sonntag zum Herumspazieren.
Sie betreten den düsteren Raum, nur durch die Obergaden fällt Schlaglicht wie von Scheinwerfern auf die Säulenkapitelle. Es riecht nach Weihrauch und Putzmitteln. Vor ihnen ein Schachbrettboden aus Marmor.
»Nur auf die Schwarzen!«, flüstert Cinzia und hopst los. Tina blickt sich um. Das ist sicher verboten. Sie tapst von Feld zu Feld, dann bleibt sie stehen und blickt nach oben. Eine riesige Kuppel wölbt sich über dem Hauptschiff, übervoll bemalt: Auf einen goldenen Hintergrund hat der Maler Wolken gesetzt, die unterhalb, in der Kirche, zu schweben scheinen, daneben schwerelose Engel und vermutlich Heilige. In der Mitte der Kuppel ist eine elliptische Öffnung gemalt, durch die der Himmel sichtbar wird, auch vor dem Blau schweben Engel und in der Mitte ein Mann, wahrscheinlich Jesus. Alles schwebt, ist leicht, golden, funkelnd.
Noch nie war sie hier, und es erscheint ihr wie eine Märchenwelt, so stellt sie sich den Palast eines Königs vor.
»Komm schon, was schaust du?«
»Ich komme!«
»Ich muss dir was Grausiges zeigen, die Reliquien.«
Zu Hause vor der dünnen Milchsuppe fragt sie Onkel Demetrio, warum Kommunisten nicht in die Kirche gehen. Die zehn Gebote sind doch nichts Schlechtes und Liebe auch nicht.
»Die zehn Gebote«, sagt Demetrio und leckt den Löffel ab, »die zehn Gebote sind ein Zeichen der Unterdrückung.«
Tina versteht überhaupt nichts. Sicher, es gibt andere Fünfzehnjährige, die in der Gewerkschaft sind und mehr wissen. Aber wie können Regeln wie »Du sollst nicht töten!« ein Zeichen der Unterdrückung sein?
»Schau nicht so verdattert, es ist wirklich so.«
Die Mutter trägt das Geschirr zur Spüle, jetzt kommt sicher wieder die Belehrung durch Onkel Demetrio.
»Ich finde es schade, dass wir da nicht hingehen. Der Raum ist so schön und die Messen sind es sicher auch: Es wird gesungen und die Orgel spielt.«
»Ja, und damit vernebeln sie den Menschen das Gehirn«, sagt Demetrio. »Marx hat geschrieben, dass Religion das Opium des Volkes ist. Das heißt, die armen Leute, die sich kein Opium leisten können, nehmen stattdessen die Religion als Beruhigungsdroge. Die Kirche hilft den Arbeitern nicht. Sie sagt: Im Himmel wird alles besser. Die halten zu den Reichen, nicht zu uns. Und außerdem stellen sie jede Menge Gebote und Regeln auf, die sie selbst nicht einhalten.«
»Die Sozialistenfrauen bei uns in der Fabrik reden die ganze Zeit von Syndikat und Revolution«, sagt Tina. »Alles muss zerstört werden. Das kann doch auch nicht gut sein. Wenn man den Reichen alles wegnimmt, sind eben andere dann reich.«
Demetrio lacht.
»Nein, das ist anders. Im Sozialismus wird alles anders. Wir Proletarier werden eine neue Welt schaffen, du wirst es noch erleben. Eine Gesellschaft, in der alle gleich sind. Wo es keine Großgrundbesitzer und Fabrikdirektoren gibt. Wo alles allen gehört. Die Syndikate sind der Anfang der neuen Gesellschaft. Alles wird von den Arbeitern selbst verwaltet, wir werden dann keine Direktoren mehr brauchen.«
Er nimmt die Zeitung, die neben ihm auf der Bank liegt, und legt sie vor Tina.
»Schau, da: In Pordenone gibt es ein neues Syndikat. Und da: Streik in der Schuhfabrik. Du solltest mehr Zeitungen lesen in deinem Alter, nicht diese lächerlichen Romane.«
Er blickt auf die Taschenuhr, steht auf, setzt seinen Hut auf, fasst Tinas Mutter von hinten an den Hüften und küsst sie auf den Nacken.
»Ich treffe mich noch mit Giovanni. Danke für die Suppe. Kann später werden.«
Er tippt mit der Hand auf die Hutkante. »Tina. Wir reden morgen weiter.«
Vaterersatz. Nein, Vater hat sich nie am Abend herumgetrieben.
Eine Woche später, beim nächsten Besuch, fragt Marie Isaak Löcher in den Bauch. Sie hat die ganze Woche Fragen gesammelt, die sie dem Vater nicht stellen will, weil sie weiß, dass er nichts davon hält. Hat Moses die Torah geschrieben? Ist das Aleph wirklich das Symbol eines Rinderkopfs gewesen? Sind das die ältesten Buchstaben der Welt? Isaak weiß auf viele Fragen keine Antwort.
»Warum fragst du nicht den Religionslehrer? Der ist doch dafür da!«
»Der nimmt uns Mädchen doch nicht ernst.«
»Unseren kann man alles fragen. Tja.«
Isaak erzählt von Professor Kissinger, der viel lebendiger unterrichtet und ganz andere Sachen durchnimmt als der Lehrer an der Mädchenschule.
»Er weiß immer eine Antwort«, sagt Isaak. »Aber wir müssen auch viel lernen.«
Marie kann niemanden fragen. Religion ist ihren Eltern egal. Und Herr Löw sagt immer »Später!« und behandelt die Fragen doch nie.
»Haltet ihr diese Schabbatgebote eigentlich ein? Stimmt es, dass sogar Spazierengehen am Schabbat als Arbeit gilt?«
»Hängt davon ab«, sagt Isaak.
Isaak doziert, die beiden Mädchen hören zu, Marie interessiert, Betty gelangweilt. So hat sie sich den Freundinnenbesuch nicht vorgestellt. Sie sieht zum Fenster hinaus und zur Decke und schnaubt immer wieder kräftig.
Aber Isaak hat Geduld, er redet sich warm. Marie spürt, dass er sich bemüht, gut zu erklären. Ein kleiner Rabbi.
Als er vom Schabbesgoi erzählt, der jeden Samstag kommt, glaubt sie es zunächst nicht.
Marie kennt das alles nicht. Was ihr Vater dazu sagen würde?
»Das meiste macht man ohnehin vorher. Wenn die Glut im Ofen ausgeht über Nacht, das passiert nicht so oft, dann kommt Herr Noack und macht das Feuer wieder an, weil uns Feuer machen am Schabbes verboten ist, zum Beispiel. Oder wenn etwas kaputtgeht, dürfen wir das nicht reparieren. Dann kommt Herr Noack.«
Marie weiß nicht, was sie davon halten soll. Oder binden sie ihr einen Bären auf und werden gleich loslachen?
»Komm jetzt«, sagt Betty. »Wir wollten doch noch die Hausübung machen.«
Später gibt es Quarkbrote mit Schnittlauch, der Vater ist inzwischen zu Hause. Marie nimmt sich ein Herz und fragt ihn nach dem Schabbesgoi. Er sieht Marie etwas länger an, bevor er spricht. Sie weiß, was er denkt: Eine jüdische Familie, die die Bräuche nicht einhält und an Religion völlig uninteressiert ist.
»Wir beten am Schabbes für alle mit, die nicht in der Synagoge sind«, sagt er, und es klingt nicht streng, eher heiter.
»Weißt du, meine Frau kocht am Freitag vor, wir bringen das Essen dann zum Bäcker nebenan, der hält es in seinem Backrohr oder neben dem Ofen warm, und Herr Noack bringt uns das dann am Schabbes, denn für uns wäre das Arbeit.«
Marie nickt und beißt in ihr Quarkbrot. Sie würde am liebsten weiter fragen, aber sie traut sich nicht. Es gibt so viel, das sie nicht weiß. Aber was bedeutet »jüdisch«, wenn man sich nicht an die Gebote hält? Ist sie dann überhaupt Jüdin? Vielleicht wird sie das nächste Mal fragen. Jetzt will sie Betty nicht verärgern.
Als sie sich später verabschiedet, steht sie mit Betty noch vor der Tür am Flur.
»Bis nächste Woche.«
»Du redest ja nur mit meinem Vater und meinem Bruder. Kommst du überhaupt noch wegen mir?«
Ein Stich ins Herz.
»Aber natürlich! So ein Unsinn. Entschuldige, bitte, Betty.«
Die Freundin presst die Lippen zusammen.
»Was hast du nur auf einmal mit der Religion? Ich habe gedacht, du wirst mich ein bisschen ablenken von diesen Sachen.«
Marie treten die Tränen in die Augen.
Betty schiebt die Unterlippe vor.
»Und überhaupt. Tust auf fromm und hast doch gar keine Ahnung von Religion. Willst du dich einschmeicheln bei meinem Vater?«
»Aber nein, Betty, nie im Leben. Mich interessiert das wirklich. Ich verspreche dir, das nächste Mal spielen wir nur.«
Betty nickt langsam.
»Das Leiterspiel?«
»Ja, und Quartett!«
Betty nickt wieder, auch in ihrem Auge sieht Marie eine Träne. Sie umarmen einander. Marie fröstelt, noch ehe sie auf der Straße ist.
Sie beschließt, Betty nächstes Mal ein Geschenk mitzubringen. Eine Kleinigkeit. Ein Tuch oder einen Schal oder Handschuhe, irgendetwas, das man im Winter gut brauchen kann. Sie wird sich bestimmt freuen und der Zwist wird vergessen sein.
»Zwanzig ist viel zu wenig.«
»Fünfundzwanzig, mehr ist der nicht wert.«
»Na kommt schon«, sagt Tina.
Sie sitzen im Speiseraum, die Blechbüchsen, aus denen die Frauen zu Boden blickend ihr Mittagessen verzehrt haben, sind leer. In den meisten Büchsen findet sich jeden Tag dasselbe: eine Schnitte Polenta, ein Stück Käse, bei manchen rohe Zwiebeln. Noch fünf Minuten, bis der Klingelton die Mittagspause beendet.
»Dreißig. Mehr wirst du für den nicht kriegen.«
»Zum Ersten … zum Zweiten … und zum Dritten!«, sagt Tina theatralisch und gibt Delia den Schal, die ihn gierig entgegennimmt.
Sie kramt nach den Münzen und gibt Tina das Geld. Die Aufmerksamkeit flaut ab, die Frauen reden wieder leise in Grüppchen.
Ihr blauer Schal. Dreißig Lire. Das reicht für drei Wochen Brot und Käse, vielleicht einen Monat. Im Frühling wird es dann schon wieder leichter.
Der blaue Schal war vor zwei Jahren ein Geschenk von Tante Veronica. Sie hat die Tante, die in Turin wohnt, seitdem nicht mehr gesehen. Ein Schal, drei Wochen Essen für sieben.
Drei Wochen kein Weinen der kleinen Geschwister, wenn sie sich abends hungrig zu dritt in ihrem Bett zusammenkauern. Drei Wochen kein Blick der Mutter, unter deren Augen die Tränensäcke immer größer werden, während sie selbst immer schmächtiger wird. Yole hätte so gerne eine richtige Puppe, Benvenuto ein Schaukelpferd. Ein paar alte Lappen, mit Spagat zu einem Körper gebunden und ein Baumstumpf vor ihrem Haus müssen genügen.
Die Frauen gehen wieder an die Arbeit. Noch sechs Stunden.
Daheim wird Demetrio sicher wieder diskutieren wollen. Zuletzt hat er immer wieder gegen die Kirche und die verlogenen Pfaffen gewettert. Die Religion hat keine Zukunft. Sie wird aussterben. Die Kirchen werden abgeschafft.
Die Mutter wird sie fragen, wo der schöne blaue Schal geblieben ist.
Ach, er hat mir nie gefallen, wird sie antworten, und beide werden sich an den Moment erinnern, als sie ihn geschenkt bekommen und die Tante umarmt hat.
Beim nächsten Besuch vermeidet Marie es, über Religion zu reden. Das Spielen ist ohnehin lustiger. Und Betty hat sich so über den Schal gefreut, dass sie sie lange an sich gedrückt hat.