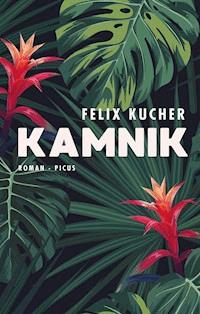18,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Picus Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Er ist einer der schillerndsten Vertreter der Lebensreformbewegung im späten 19. Jahrhundert: Der Maler Karl Wilhelm Diefenbach predigt seine Heilslehre von Rohkosternährung, Nacktkörperkultur und freier Liebe als viel geschmähter »Kohlrabiapostel« auf Münchens Straßen. Dass er selbst von wiederkehrenden heftigen Magen- und Gliederschmerzen geplagt wird, schwächt weder seine Überzeugung noch seine Ablehnung der konventionellen Medizin. Zu gesundheitlichen gesellen sich regelmäßig finanzielle Nöte, die der begabte Maler durch Auftragsarbeiten immer wieder knapp abwenden kann. In einem verlassenen Steinbruch in der Nähe von München gründet er in den 1880er Jahren eine Kommune, doch damit beginnen seine Probleme erst richtig … Felix Kucher erzählt von einem, der die Welt radikal verändern will und an seinen eigenen hehren Ansprüchen immer wieder scheitert.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 277
Veröffentlichungsjahr: 2022
Sammlungen
Ähnliche
Gefördert von der Stadt Wien Kultur.
Copyright © 2022 Picus Verlag Ges.m.b.H., WienAlle Rechte vorbehaltenGrafische Gestaltung: Dorothea Löcker, WienUmschlagabbildung: Redphotographer/iStockphotoISBN 978-3-7117-2120-4eISBN 978-3-7117-5465-3
Informationen über das aktuelle Programmdes Picus Verlags und Veranstaltungen unterwww.picus.at
Felix Kucher, geboren 1965 in Klagenfurt, studierte Klassische Philologie, Theologie und Philosophie in Graz, Bologna und Klagenfurt. Er lebt und arbeitet in Klagenfurt und Wien. Im Picus Verlag erschienen seine Romane »Malcontenta«, »Kamnik« und »Sie haben mich nicht gekriegt« (2021).
felix.kucher.at
FELIX KUCHER
VEGETARIANER
ROMAN
PICUS VERLAG WIEN
Inhalt
AUFTAKT
KAPITEL 1
KAPITEL 2
KAPITEL 3
KAPITEL 4
KAPITEL 5
KAPITEL 6
KAPITEL 7
KAPITEL 8
KAPITEL 9
KAPITEL 10
KAPITEL 11
KAPITEL 12
KAPITEL 13
KAPITEL 14
KAPITEL 15
KAPITEL 16
KAPITEL 17
KAPITEL 18
KAPITEL 19
KAPITEL 20
KAPITEL 21
KAPITEL 22
KAPITEL 23
KAPITEL 24
KAPITEL 25
KAPITEL 26
KAPITEL 27
KAPITEL 28
KAPITEL 29
KAPITEL 30
KAPITEL 31
KAPITEL 32
KAPITEL 33
NACHSCHRIFT
AUFTAKT
MÜNCHEN, KÖNIGREICH BAYERN, DEZEMBER 1884
»Daher fasse ich am Schlusse die drei Punkte zusammen, die für die Menschheit der Zukunft am wichtigsten sind: erstens kein Fleisch zu essen, zweitens so oft als möglich nackend zu wandeln und drittens nicht auf die Medizin mit ihren Pillen und Impfungen zu vertrauen, sondern allein auf die Heilkräfte der segenspendenden Mutter Natur.
Also erstens: Nähret euch von Früchten und schonet der Tiere! Mordet nicht unsere animalischen Brüder, beraubt sie nicht ihrer Kinder, ihrer Eier, ihrer Milch! Werdet nicht mitschuldig an den Morden und Diebstählen, die tagtäglich in Schlachthäusern und Ställen begangen werden, werdet nicht durch lässige Duldung selbst zu Mördern und zu Dieben!
Denn zutiefst irren die Befürworter des Carnivorismus, wenn sie meinen, ohne Fleischgenuss leide der Mensch Mangel an wertvollen Nährstoffen. Ist es doch genau umgekehrt: Der Fleischgenuss macht den Menschen krank, schwach und siech. Denn ab dem Augenblicke, da das Beil des Schlächters den Nacken des Tieres spaltet, gehet dessen Fleisch in Verwesung über und es bilden sich die schädlichen Leichengifte Putrescin und Cadaverin, die sich ungehemmt während der gesamten Zeit vermehren, da das Tier zerteilt und zerkleinert wird. Doch nicht genug damit!
Denn bevor ihr sie verzehret, werden diese Leichenteile mit Salz und Pfeffer einbalsamiert, geröstet, gebraten, gekocht, sodann mitsamt den nämlichen Giften, die ihre schreckliche Wirkung langsam und stetig im menschlichen Organismus entfalten, verschlungen, ohne dass jemand dieser schädlichen Wirkung gewahr würde, die dann Krankheit und Schmerz nach sich ziehen.
Sehet euch doch an, wie viele Leiden ihr zivilisiertes Volk mit euch herumtraget, Leiden, die alleine dem Genusse des Fleisches geschuldet sind: vergiftete Därme und schmerzende Mägen, gichtige Finger, klumpige Kröpfe und noch viele weitere Leiden, die uns erst das Leben in den Städten gebracht hat und die nun durch den Fleischgenuss befördert werden.
Gar nicht reden möchte ich über den geistigen und moralischen Verfall, der durch das Fleischessen hervorgerufen wird und der ein Kennzeichen unseres Zeitalters ist. Denn die Ursache für das Verkommen der heutigen Sitten ist nicht nur der technische Fortschritt und der damit einhergehende Luxus für breite Volksmassen, sondern die damit verbundene Gier und die Zügellosigkeit, die nachgerade durch das vermehrte Fleischessen befördert werden. Man vergleiche im Reiche der Natur doch nur einmal die friedlichen Pflanzenfresser mit den wütenden Fleischfressern!
Schlaget nach bei Rousseau und Burnett und wie sie alle heißen! Überall werdet ihr lesen, dass wir Menschen als Fruktivoren geboren sind. Die Natur hat nicht vorgesehen, dass wir rohes Fleisch essen wie ein Fuchs oder ein Tiger, nein, das hat Mutter Natur nicht vorgesehen.
Diese Einsicht ist so einfach und klar, dass es einen wundernimmt, dass nicht schon sämtliche Menschen vegetarianisch leben, dass nicht schon alle nur das essen, was der Boden hergibt, Früchte und Gemüse, Kräuter und Beeren, Samen und Blüten! Wächst denn im Boden Fleisch und Fisch? Nein! Oder Bier und Branntwein? Nein! Oder geröstete Kaffeebohnen und vergorene Teeblätter? Nein!
Darum lasset diese Geißeln der Menschheit, die schon so viele Familien ins Unglück gestürzt haben. Werdet vielmehr wahre Menschen auf dem Wege zum Übermenschen, wie der große Philosoph Nietzsche es nennet.
Und dieser Mensch, wie ich schon früher erwähnt habe, wird ein Mensch des Friedens sein. Denn wenn niemand mehr ein Mitgeschöpf tötet oder bestiehlt, dann wird sich auch das Gemüt des Menschen verändern, er wird friedlich und milde werden und im Einklange mit Tier und Pflanze leben. Dann werden auch die Kriege aufhören, dann wird der wahre Pazifismus, von dem heute so viele schwärmerisch, aber ohne Wirkung, reden, verwirklicht sein! Aber davon will ich ein andermal zu euch sprechen.
Lieber möchte ich noch einmal das zweite Charakteristikum der neuen Zeit in Erinnerung rufen: den Naturismus!
Verachtet die Nacktheit nicht! Nein, es ist nicht wider die guten Sitten, sich nackend zu zeigen. Vielmehr kann der Mensch nichts Besseres für seinen Körper tun, als ihn so oft als möglich ohne Bedeckung Licht und Luft auszusetzen. Ihr sagt, das sei unmoralisch? Ihr Heuchler! Wie kann denn ein nackter Körper, wie Gott ihn erschaffen hat, schlecht sein? Wie kann ein Urzustand sittlich verwerflich sein? Doch nur wenn falsche Sitte und verlogene Moral ihn dazu gemacht haben!
Darum werfet die Kleider von euch, so oft ihr es vermöget, und badet in Licht und Luft! Nur so kann der Körper gegen Krankheiten geschützt, nur so können Leib und Seele veredelt werden!
Denn das heißt ein wahrer Vegetarianer zu sein: Früchte zu essen und nackt zu gehen.
Die Gebildeten unter euch wissen ja, dass dieses Wort, das die deutsche Sprache aus dem Englischen entlehnt hat, vom lateinischen vegetus kommt, und vegetus heißt bekanntlich gesund und munter, nicht fleischlos, wie viele meinen. Daher gehört zum Vegetarianertum unbedingt dazu, nackt in Sonne und Luft zu wandeln.
O wie heuchlerisch unsere Gesellschaft in diesen Angelegenheiten ist! War je ein Zeitalter verlogener, was das Ausleben der natürlichen Nacktheit und der erotischen Liebe betrifft? Etwa die alten Griechen, die uns den Barberinischen Faun bescherten, der nur wenige Hundert Meter von hier sein Gemächt der Sonne aussetzt? Etwa die Menschen im galanten Zeitalter? Sehet nur die Bilder eines Rubens an! Aber davon ein andermal.
Durch das Verbot der Nacktheit in unserer sich fortschrittlich dünkenden Zivilisation wird der natürliche Trieb eingeschnürt und geknechtet wie nie zuvor in der Geschichte der Menschheit. Dazu kommt, dass durch aufreizende Kleidung der Frauen die wildeste Fantasie der Männer entfacht wird. Die Verbindung zwischen den Geschlechtern ist in unserer Gesellschaft nur in der Ehe erlaubt, doch wie es mit der Treue in unseren Tagen bestellt ist, mag jeder selbst urteilen. Verhältnisse und Affären, wohin man blickt! Der Herr hat ein Verhältnis mit dem Dienstmädchen, die Frau hat ihren Liebhaber, die Wäschermädel und Zugehfräulein sind Freiwild, von der Prostitution in dieser Stadt mag ich gar nicht sprechen. Kinder, die außerhalb der Ehe geboren werden, werden versteckt und bei anderen Menschen aufgezogen, aus Scham und verlogener Moral! Ein jeder mag sich ausrechnen, um wie viel freier und ehrlicher die Gesellschaft wäre, wenn alle nackt einhergingen und es das bürgerliche Zwangsinstitut der Ehe nicht gäbe! Aber auch darüber ein andermal.
Ein Drittes möchte ich, wie schon angekündigt, abschließend erwähnen: die Heilung durch die Natur. Die heutige Medizin – und daran besteht ja kein Zweifel – ist in eine Sackgasse geraten, aus der sie nur die Naturheilkunde wieder herausführen kann. Sie hat des Menschen und seiner Seele völlig vergessen. Sehet euch an die großen Säle, in denen die Kranken dahinsiechen, ohne frische Luft, ohne Sonnenlicht! Sehet die Doktoren, die bei so vielen Krankheiten nicht ein und aus wissen, unverständliches Zeug reden und im Zweifel Aderlass und bittere Pillen verschreiben und verderbliche Vakzine verabreichen! Gibt es nicht genug Beispiele, dass diese Art der Medizin in die Abstellkammer gehört? Hat nicht ein Arnold Rikli in Veldes Erfolg mit seinen Licht- und Luftbädern? Weltberühmt ist er mit seiner Heliopathie geworden! Pfarrer Kneipp heilt in Bad Wörishofen mit bloßem Wasser selbst Schwindsucht und Cholera! Und noch viele andere könnte ich nennen, die hier wohlbekannt sind.
Überall mehren sich die Beispiele, dass der traditionellen Medizin das Ausgedinge bevorstehet! Einzig der Ignoranz der Doktoren und der Gier der Pillendreher ist es zu verdanken, dass sich die natürlichen Methoden noch nicht durchgesetzt haben. Wir aber gehören der neuen Zeit an, wir vertrauen der Heilkraft der Natur, die in allem unsere Lehrmeisterin ist. Denn Wasser, Licht und Luft genügen, um aller Krankheiten Herr zu werden, die Pflanzenkost reicht aus, um allen, ich sage: allen Krankheiten vorzubeugen.
Darum, so rufe ich euch endlich zu, ändert euren Sinn! Bessert euer Wesen! Kehret um zur Natur, wie es Rousseau schon vor hundert Jahren gefordert hat! Esset die Früchte der Erde! Wandelt nackt! Lasst euch von nichts anderem als Licht, Luft und Wasser heilen!
Dann, ja dann werdet ihr neue Menschen sein für ein neues Zeitalter, voll Gesundheit und Freude, voll Licht und Harmonie.«
Stille.
Der Redner, sichtlich erschöpft von der Heftigkeit seines Vortrags, hält sich mit beiden Händen am Rednerpult fest, schwer geht sein Atem. Scheu blickt er auf das Publikum im Saal, das noch immer still dasitzt und offenbar noch nicht mit dem Schluss der Philippika gerechnet hat. Dann applaudiert einer zaghaft, dann mehrere, der Applaus wird lauter, dazwischen mischen sich Rufe wie »Bravo«, »Recht so«, aber auch schmähende Worte wie »Betrüger«, »Kohlrabiapostel« und »Der wird sich noch anschauen!« Einige lachen, viele reden laut, der Applaus hält an, einige erheben sich sogar.
Der Redner wirft den Kopf zur Seite, sein wallendes, schulterlanges Haar folgt nach. Er dreht sich vom Pult weg, die schmutzig weiße Kutte flattert ihm um die nackten Knie, die Gummistiefel, in denen seine knochigen Beine stecken, schlackern um seine Waden. Majestätisch wie ein römischer Senator in der Kurie und zugleich mit einem Anflug von Lächerlichkeit schreitet er von der Bühne.
Diefenbach hat gesprochen.
KAPITEL 1
Ein Mann stapft durch den Schnee, die Isarauen entlang in Richtung des Weilers Thalkirchen. Der Mitte November früh gefallene und hart gefrorene Schnee knirscht unter den Tritten des langhaarigen Bartträgers. Der Himmel ist klar, die Sonne steht tief und wirft einen weit gestreckten Schatten von ihm bis zum Ufer des eisscholligen Flusses.
Über der groben Wollkutte, unter der er nackt ist, trägt der Vollbärtige eine Decke aus ungefärbtem Wollfilz um die Schultern geschlungen, die sockenlosen Füße stecken in mit Stroh ausgestopften Gummistiefeln. Kein Leder umschließt seinen Rist, unerträglich ist ihm die Vorstellung, dass ein Tier geschlachtet werden müsste, um einen Fußschutz zu haben. Außerdem wird Leder mit giftigen Farben gefärbt, die die Fische in den Bächen, an denen die Gerbereien liegen, sterben lassen. Nein, nur diese vulkanisierten, formgepressten Kautschuktücher namens Gummistiefel duldet er als Beinkleid, und diese auch nur im Winter. Im Frühling und im Herbst erlaubt er sich Sandalen aus Holz und Bast, im Sommer geht er barfuß einher, wie es seiner Meinung nach der Natur des Menschen entspricht.
Es wird schnell dunkel in dieser Jahreszeit, er muss sich beeilen. Doch alle paar Hundert Meter hält er inne und lässt seinen Blick über die weiß angezuckerten Ufer schweifen, dahinter die Isar dunkelgrün schimmert. Er durchmisst mit dem Blick die Thalkirchner Brücke bis zum Flaucher, der Aueninsel, auf deren Westufer im Sommer das Frauenschwimmbad in Betrieb ist. Jedes Jahr, so fällt ihm wieder ein, pflegen die Männer, die nichts Besseres zu tun haben, zu den Kiesbänken zu schwimmen, um unsittliche Blicke auf die Frauenkörper zu werfen, zumindest schreiben jeden Sommer – wohl in Ermangelung anderer aufregender Ereignisse – die Münchner Zeitungen verlässlich über dieses Phänomen.
Was für eine dumme Welt!, denkt er sich und schreitet behänder aus. Wenn alle nackt badeten und sich ebenso nackt am Ufer tummelten, wären alle diese lächerlichen Frivolitäten passé. Wie er es im Vortrag gesagt hat, wird ja der Trieb gerade durch das Verbotene angestachelt und das Verbotene wird erst durch die Versagung interessant.
Nein, so hat er es nicht gesagt, aber es klingt gut. Er muss sich diese Phrase aufschreiben, sobald er in seinem Zimmer ist, das sind Worte, die er in der nächsten Rede verwenden kann.
Eine gute halbe Stunde ist sein heutiger Vortrag jetzt her, es ist der achte Sermon seit dem Beginn der Serie am 10. Oktober gewesen. Nachdem er über die Quellen des menschlichen Elends, über die Krankheiten, gegen die Religion, für die neue Sprache Volapük, die er sich zu erlernen vorgenommen hatte, gegen Alkohol und Fleischeslust und schließlich über Gustav Jägers Entdeckung der Seele gesprochen hatte, war die heutige Rede eine zusammenfassende Repetition der wichtigsten Grundsätze seiner Lehre, auf dass auch die Borniertesten endlich verstünden, auf welche Prinzipien des Lebens es in der neuen Zeit ankomme. Und wie an jedem dieser Vortragstage ist er auch heute wieder froh gewesen, der grässlichen Stadt zu entfliehen, die zwischen Gerüsten und Künetten eine einzige matschige Baustelle geworden ist. Wenigstens ruhen im Winter die Arbeiten und kein Maurer oder Zimmermann ruft dem anderen unflätige Worte zu, auch dämpft der Schnee das Geklapper der Gespanne und die Flüche der Fuhrleute. Wie selig dünkt er sich, dem Gewühl und Getriebe entkommen zu sein! »Meister«, ruft da jemand hinter ihm, »Meister, so warte Er doch.«
Und Karl Wilhelm Diefenbach, der Meister, Verkünder des neuen Menschen, Maler einer neuen Zeit, bleibt stehen und dreht sich nicht um, bis der junge Mann, der ihn gerufen hat, nach Luft schnappend, die Schultern hebend und senkend, neben ihm steht.
»Kennen wir einander denn?«
»Meister, entschuldige Er, dass ich Ihn so überfalle. Ich wollte sogleich nach dem Vortrage ein Wort mit Ihm wechseln, aber Er war so schnell weg und ich habe dem einen und dem anderen Seiner Kritiker ein Widerwort geben müssen. O dieser niederträchtigen Ignoranten!«
In kurzen Sätzen und mit ausladenden Gesten gibt der Ankömmling die Debatte wieder, die sich nach Diefenbachs Abgang im Foyer des Vortragssaals entsponnen hat. Der Meister nickt und schweigt, er kennt all die Argumente und Gegenargumente und legt dem Jüngling seine Hand auf die Schulter, der mit einem Male verstummt.
Dann erhebt Diefenbach das Wort und spricht zu ihm vom künftigen Menschengeschlecht, das nackt in Licht und Luft baden und nur Früchte essen wird.
Der Jüngling hört geduldig zu, auch er hat all das schon mehrfach gehört, aber wer würde es wagen, den Meister zu unterbrechen? Endlich setzt Diefenbach ab, und diese Pause benutzt der bisher Lauschende dazu, sich förmlich als Otto Driessen vorzustellen, Student der Medizin in Berlin. Schon beim ersten Vortrag Diefenbachs vor über einem Monat sei er Zuhörer gewesen, ob sich Diefenbach nicht seiner erinnere, er habe sich ihm schon damals vorgestellt und kurz mit ihm gesprochen.
Diefenbach mustert den Studenten von Kopf bis Fuß, viele sind es gewesen, vor allem junge Männer, die ihn nach den Vorträgen mit Fragen bedrängt und seiner Lehre zu folgen sich anheischig gemacht haben. All diesen Interessenten, die meist anfangs Begeisterung zeigen und sich dann doch nicht mehr blicken lassen, begegnet er inzwischen mit einer abgeklärten Skepsis. Die meisten Gesichter und Namen dieser Jungspunde hat er ohnehin schon wieder vergessen. Aber ja, diesen jungen Mann hat er schon gesehen.
»Ist Er der, der geweint hat?«
»O ja, Meister, der bin ich, erinnert Er sich?«
Diefenbach nickt langsam, ja dieser Student, der bei seinem ersten Vortrag in Tränen ausgebrochen ist und dann nur unzusammenhängendes Zeug gestammelt hat, gut erinnert er sich an ihn, ohne sein Gesicht wirklich im Gedächtnis behalten zu haben, denn viele sind seinem Beispiel gefolgt. Diefenbach hat damals nicht gewusst, was er mit ihm anfangen sollte, und sich etwas betreten anderen Diskutanten zugewandt.
»Verzeihe Er, da Er sich darauf sicher keinen Reim machen kann. Ich habe damals eine so eine große Übereinstimmung zwischen Seinen Worten und meiner innersten Gesinnung verspüret, dass ich von meinen Gefühlen übermannt, ja fortgerissen wurde.«
Er solle nämlich wissen, so fährt der Student fort, er solle wissen, dass er, Otto Driessen, seit einem halben Jahr Vegetarianer sei und gemäß den Schriften Jägers nur Leinen und Wolle auf seiner Haut trage. Leider habe er nach jenem Vortrag wieder für einen Monat zurück nach Berlin müssen, wo er ja studiere, aber nun, da Diefenbach weitere Vorträge halte, habe er nicht an sich halten können und sei wieder nach München gekommen, um ihn zu hören.
Als Medizinstudent schäme er sich für die Verachtung, die seine Professoren in Berlin der Naturheilkunde entgegenbrächten, blind seien sie alle gegenüber den Erfolgen von Hahn, Oertel und Kneipp, die mit Luft und kaltem Wasser heilten, was mehrfach bewiesen, belegt und in zahllosen wissenschaftlichen Journalen seriös publiziert sei.
Lange spricht Driessen und ohne Pause, und Diefenbach nickt bedächtig, während er den feurigen Studenten wieder und wieder mustert. Vor einem Monat, so will ihm dünken, hat jener diesen Bart noch nicht gehabt, der nun sein Gesicht flaumig einrahmt, auch zeigt sich der Überschwang des Gefühls, der sich damals als weinerliche Ergriffenheit geäußert hat, nun als Leidenschaft für die Sache des Vegetarianismus.
»Sehe Er dort hinten das Gebäude«, sagt Diefenbach, nachdem der Redefluss des Studenten mit einem Mal versiegt ist.
Der Jüngling blickt verwirrt. Ist das eine Antwort? Ein Gleichnis?
»Vor vierzig Jahren wurde dieses Haus als Wasserheilanstalt Thalkirchen gegründet«, fährt Diefenbach fort. »Bleile war nur ein Bader, stelle Er sich das vor, ein einfacher Bader. Er hat Oertels hydriatische Schriften studiert und dann diese Klinik eröffnet, in der er nur mit Wasser geheilt hat. Aber die studierten Ärzte haben ihm so zugesetzt, dass er nach zehn Jahren bankrott war. Inzwischen gehört sie einem Doktor Stammler. Sie machen dort noch kalte Güsse als Unterstützung, wie sie sagen. Aber sie trauen der Natur nicht mehr! Irgendwann wird es ein normales Klinikum sein.«
Diefenbach macht eine wegwerfende Geste.
Driessen weiß noch immer nicht, wie er die Antwort deuten soll. Wer ist Bleile, wer Stammler? Wenn der Hinweis auf die Klinik ein Gleichnis ist, wofür?
»Sehe Er, Driessen, solche Entwicklungen zu verhindern bin ich bestrebt. Durch meine Vorträge, durch mein Leben, durch meine Kunst. Andere Mittel stehen mir nicht zu Gebote, und jeder muss die Waffen benutzen, die er zu führen weiß. Er als Medizinstudent und später als fertiger Doktor kann dann Seinen Beitrag leisten, den wahren Heilmethoden und der richtigen Lebensweise zum Durchbruch zu verhelfen.«
Eine Gruppe von fünf Buben, in dicke, mit farbigen Stoffresten geflickte Wolljacken gehüllt, kommt vom Isarufer herauf, sie torkeln voran, indem sie einander mit Schneebällen bewerfen, die aus dem harschen Schnee zu formen ihnen offenbar gelungen ist, und erstarren, als sie Diefenbach in seiner Kutte und den gar nicht dazu passenden properen Studenten neben ihm erblicken.
»Kohlrabi! Kohlrabi!«, rufen sie, lachen und werfen Schneebälle.
»Ihr wisst nicht, wen ihr vor euch habt«, ruft Driessen und läuft auf sie zu, greift nebenbei in den Schnee und formt im Laufschritt einen Ball. Die Knaben stutzen und machen spornstreichs kehrt, Driessen wirft ihnen Schneebälle hinterher, von denen kein einziger trifft.
»Kohlrabi, Kohlrabi«, rufen die Ruhestörer noch im Laufen, indem sie sich kurz umwenden, bis sie schließlich hinter der Berberitzenhecke vor der Arbeitersiedlung verschwinden.
»Ihr Pack«, ruft ihnen Driessen nach, »ihr wisst nicht, wen ihr vor euch habt!«
»Den Verkünder des neuen Menschen«, sagt er leise zu sich selbst.
Schon hat ihn Diefenbach eingeholt, der seinen gemächlichen Schritt dabei nicht beschleunigt hat. Gemeinsam trotten sie weiter.
»Lasse Er sie nur, sie verstehen es noch nicht, diese armen Würmer. Die kommen vom Arbeiterinnenwohnheim der Tabakfabrik da hinten, kaum eines kennt seinen Vater. Es sind elende Geschöpfe, sie leben in Armut, niemand kümmert sich um sie. Solche Subjekte muss man erziehen zu Bürgern der neuen Zeiten. Riecht Er auch die Tabakfabrik?«
»Ja, Meister, natürlich«, sagt Driessen, der sich Mühe gibt, seine Verwunderung über den abrupten Themenwechsel zu verbergen.
Diefenbach bleibt wieder stehen, Driessen tut es ihm gleich.
»So hören wir doch auf mit dem Er und geben wir einander das Du«, sagt Diefenbach. »Die Menschen der neuen Zeit, und als solchen erkenne ich dich, sind alle Brüder, werden alle Brüder sein.«
»Aber Meister, ich sage Karl und fühle bereits, wie unangemessen diese Anrede ist. Nein, ich kann Ihn, kann dich niemals mit deinem Vornamen anreden. Du bist doch der Erste dieses neuen Menschengeschlechts, das wieder so sein wird, wie das erste im goldenen Zeitalter, als die Menschen als Pflanzenköstler, nackt und in Frieden auf Erden wandelten. Wenn du gestattest, werde ich dich Homo nennen. Nur Homo, nicht Homo novus, denn wir wissen ja, was das bedeutet. Ja, lasse es zu, dass ich dich so nenne und schlage es mir nicht ab. Sei mir ab jetzt Homo!«
»Wenn es dir beliebt, mein lieber Driessen«, sagt Diefenbach. Jetzt ist es an ihm, etwas irritiert zu sein über diese Volte des frischgebackenen Jüngers. Er mustert den hageren Studenten von Kopf bis Fuß und fixiert dann seine Augen.
»Ich habe wohl noch nie einen getroffen, der mir dergestalt die Treue ausspricht, kaum dass er mich kennengelernt hat. Nur Unverständnis bringen mir die Herren aus der Stadt entgegen, Ignoranz und Spott. Du aber bist mir wie ein Licht der Erkenntnis in der Dunkelheit des Unwissens. Am liebsten nennte ich dich Lucifer, Lichtbringer. Aber ich fürchte, dieser Name könnte vom ungebildeten Volke aberwitzig missverstanden werden. Nein, Lucidus sei mir genannt, der Leuchtende! Ja, wie ich dir Homo bin, sei du mir Lucidus!«
Sie fallen einander in die Arme und halten sich umschlungen, der Mann in der Kutte und der Student in Kniebundhosen und Wintermantel (Bald schon wird er sich dieselbe wollene Toga überwerfen und seine knochigen Beine in strohgefüllte Kautschukstiefel stecken).
»Du musst jetzt in die Stadt zurück, es wird dunkel.«
»Meister, Homo, ich möchte mit dir gehen.«
»Du kannst auch bei mir übernachten, mein Haus ist ein gastliches und Antonio hat sicher schon den Kamin eingeheizt.«
»Antonio?«
»Wir sind eine kleine Hausgemeinschaft. Antonio ist Tischler, ein Italiener, er wohnt vorübergehend in meinem Haushalt. Und da sind noch meine Kinder, Helios und Stella.«
»Was für Namen!«
»Kinder des Lichts. Nun bist auch du ein Lichtträger. Lucidus. Komm. Wir haben allerlei zu bereden.«
Sie setzen sich wieder in Bewegung, mittlerweile ist es merklich dunkel geworden, die ersten Laternen glimmen von ferne.
»O Meister, darf ich etwas fragen?«
»Alles, was dein Herz begehrt.«
»Worüber wirst du als Nächstes sprechen?«
»Nächste Woche kommt das Thema, auf das schon alle warten: Über die Dummheit des Impfzwangs werde ich sprechen.«
»Aber die Pockenimpfung …«
»Ich weiß, dass du als Student der Medizin anderes zu hören gewohnt bist. Die Pockenimpfung ist eine üble Propaganda der Ärzte und Apotheker, was immer dir die gelehrten Professoren auf der Universität auch erzählen. Die sind doch sämtlich von den Apothekern gekauft und verdienen an deren Geschäft mit! Wenn du die Bücher liest, die ich in den Reden genannt habe, wirst du bald einsehen, dass die Pocken nichts anderes sind als eine Degenerationserscheinung unserer Zivilisation. Sieh die Naturvölker an! Wenn Menschen an Licht und Luft nackt gehen, bekommen sie keine Pocken und auch keine andere Krankheit. Dann sind Impfungen überflüssig! Außerdem, wie der Herr Medizinstudent sicher weiß, wird die Impf-Lymphe aus Kuhpocken gewonnen, deswegen nennt ihr sie ja auch Vaccination. Da kann ich ja gleich wieder beginnen Kuhfleisch zu essen!«
»Das ist wahr, Meister. Ich habe auf der Universität über den Namen lachen müssen: Vaccination von vacca, die Kuh.«
»Nenn mich nicht Meister, lieber Lucidus. Wolltest du mich nicht mit Homo anreden?«
Sie passieren das Holzschild, das den Weiler Thalkirchen ankündigt.
»Ja, die Impfungen. Über die Schäden, die durch sie entstehen, brauchen wir gar nicht zu reden, sie sind ja allgemein bekannt und ich hoffe, du lernst darüber auch in deinem Studium. So. Wir sind da. Da vorne ist es. Du wirkst überrascht. Es ist eine einfache Behausung. Ein ehemaliges Bauernhaus. Aber mir und meinen Kindern genügt es.«
Diefenbach öffnet die Holztür, der schwere Flügel quietscht in den Angeln. Er bemerkt Driessens Blicke, die argwöhnisch auf dem bröckelnden Putz rechts neben der Tür haften geblieben sind.
»Innen ist es schöner. Ich habe Antonio die Wände weißen lassen und alle Vorhänge entfernt, damit das Licht ungehindert Zutritt hat.«
Diefenbach wendet sich zu seinem immer noch zögernden Jünger.
»Das Kaminfeuer brennt schon. Tritt ein in das Haus des Lichts! Beim Abendessen kann ich dir ja meine Geschichte erzählen.«
KAPITEL 2
Ein paar Jahre weit will Diefenbach in seiner Erzählung ausholen, aber nein, beschließt er, es ist zu wenig, Lucidus muss seinen gesamten Werdegang kennen. So lässt er nach einigen stammelnden Anfangssätzen seine Erzählung mit dem Zeitpunkt seiner Geburt in Hadamar beginnen, dem kleinen hessischen Weiler, der knapp hundert Jahre später unter dem Regime eines anderen Vegetarianers so traurige Berühmtheit erlangen sollte. Zunächst erzählt er stockend, dann immer heftiger, noch nie hat er einem Fremden so bereitwillig sein Leben erzählt, schon gar nicht am knisternden Kaminfeuer in einer klirrend kalten Winternacht.
Auch an jenem 21. Februar 1851 war es ein frostiger Abend, doch in der Stube, in der der kleine Karl Wilhelm geboren wurde, brannte kein Kaminfeuer. Nach ein paar Tagen der Februarwärme war der Winter zurückgekommen und hatte gezeigt, dass seine Herrschaft noch nicht vorüber war. Auf den Straßen lag schwerer Schnee, durch die Fensterritzen der Diefenbach’schen Wohnung zog eisige Luft. Drei Tage hatte Doktor Müller dem schwächlichen Knaben gegeben, den die junge Frau soeben hervorgepresst hatte, drei Tage, vielleicht eine Woche. Mehr nicht, sagte er mit einem missbilligenden Blick, während der Säugling sich die Seele aus dem Leibe krähte. Was sollte bei solchen Eltern schon herausschauen, so dachte der Doktor wohl bei sich, als er sich die Hände wusch in dem verbeulten Lavoir: der Vater ein verwachsener Zeichenlehrer, die Mutter ein Waisenmädchen unbekannter Herkunft, noch keine zwanzig und doch schon zwei Lebend- und zwei Totgeburten hinter sich. Nein, die Eltern dieses Wurms müssten sich darauf einstellen, dass sie sich mit ihren zwei Töchtern weiter würden durchschlagen müssen, in der Zweizimmerwohnung wäre ohnehin kein Platz mehr für ein drittes Kind.
Aber der Wurm, den alle schon Gott anbefohlen hatten, widersetzte sich dem Urteil des Arztes. In den nächsten Tagen und Wochen kam er gerade so viel zu Kräften, wie es zum Weiterleben brauchte, so als ob er keinen Anspruch auf mehr Lebensenergie erhöbe. Spät, aber doch, begann er zu laufen, noch später zu sprechen, da halfen alle Schläge des Lehrervaters nichts. Ab seinem zweiten Lebensjahr wuchs er zwar stetig wie seine Altersgenossen, doch mager blieb er die ganze Kindheit hindurch. Was Wunder, gab es ja nur karge Kost, Bohnen und Brot, Grießkoch und Graupen, Suppen und Sauerkraut. Krank war der Junge aber ständig, zu den Kinderkrankheiten, von denen er keine ausließ, kamen tagelange Kopfschmerzen, Magendrücken und Asthma. Er bekam noch zwei Brüder, die vor Kraft strotzten und ihrem älteren Bruder später das wenige Spielzeug stahlen, ohne dass dieser irgendeine Form der Gegenwehr gezeigt hätte.
Mit dreizehn Jahren wurde er Zeichengehilfe des Vaters, der am holzsplittrigen Esstisch für sechs Kreuzer die Stunde drei Bürgerkindern, die angesichts der schmuddeligen Zeichenwerkstatt die Nase rümpften, privaten Zeichenunterricht gab. Der jüngere Karl leitete die älteren Schüler seines Vaters an, den Bleistift beim Schraffieren im richtigen Winkel zu halten und nicht zu fest anzudrücken. Er lobte da, mahnte dort, wie er es vom Vater abgeschaut hatte, und die Schüler, obwohl älter, respektierten ihn. Mit vierzehn formulierte er ein Nachtgebet zu seinem eigenen Gott, denn jeder Mensch, so sagte er sich, habe wohl das Recht, sich seinen Gott auszusuchen, zu dem er betete. Die Schwestern verpetzten ihn, was ihm eine Tracht Prügel von seinem krummen Vater einbrachte, den er gleichwohl noch immer liebte und verehrte.
Als Karl Wilhelm siebzehn Jahre alt war, erlitt der Vater einen Schlaganfall und wurde von der Schule zwangsweise in Pension geschickt. Da das Geld nun kaum für das Essen reichte, aber sicher nicht mehr für den Besuch der Schule, musste Karl die Schule knapp vor dem Abitur aufgeben, was dem jungen Freigeist nur recht kam. Er spazierte in das Büro des Gymnasialdirektors Zugwitz, hielt die Hände an die Hosennaht und sprach die vorher zurechtgelegten Sätze:
»Da nach der Pensionierung meines Vaters ich das Schulgeld aufzubringen nicht imstande sein werde, melde ich mich mit dem heutigen Tage von der Schule ab und werde, sehr geehrter Herr Direktor, dieses Gebäude nie wieder betreten.«
Zugwitz, dessen Stirn sich verfinsterte, hob zu einer Ansprache über den Wert der humanistischen Bildung an, die als Ziel die Veredelung des Charakters habe, eine Rede, die er immer bei versuchten Schulabmeldungen hielt. Es sei schade um jeden Knaben, der diese Ausbildung abbreche, und er, Diefenbach, sei ja kein schlechter Schüler. Wenn er wolle, so der Direktor, könne er sich wegen eines Stipendiums erkundigen. Oder noch besser: Er habe ja seine Begabung auf dem Gebiete des Zeichnens erkannt, auch die Nachhilfeschüler seines Vaters hätten sich immer positiv geäußert. Daher biete er ihm an, und jetzt passe er gut auf, anstelle seines Vaters Zeichnen zu unterrichten, bevor er irgendwo als Hilfsarbeiter oder auf der Straße ende, Talent habe er ja zweifellos, sogar sehr großes, und ein solches dürfe man nicht achtlos wegwerfen oder verkümmern lassen.
Der Direktor hüstelte und blähte seine Hühnerbrust auf, in freudiger Erwartung einer dankbaren Ehrenbezeugung, voller Stolz, wieder einen Schüler vor der Gosse bewahrt und in diesem Fall zugleich einen billigen Lehrer eingestellt zu haben. Was für ein Exempel der Menschenfreundlichkeit er doch war! Er stand auf, um dem Jungen, der jetzt so sprachlos dasaß, die Hand darauf zu geben.
Doch Diefenbach, der sich ebenfalls aus dem Sessel erhob, begann seinerseits mit pathetischer Pose zu sprechen.
»Ich danke Ihnen, Herr Oberstudienrat, für Ihre Güte! Aber mir winkt ein anderes Ziel, eine andere Kraft zieht mich empor und hinfort. Ich will Künstler werden, und als Künstler werde ich frei sein und von nichts als meiner Kunst leben. Nie werde ich mich durch irgendeine Fessel an eine Einrichtung binden, ob das nun die Schule sei, die Kirche oder ein Fürst. Nein, für kein Salär werde ich meine Freiheit als Künstler gegen die abstumpfende Zurichtung unwilliger Mulis eintauschen, die Sie mir anbieten, nie und nimmer. Die Kunst ist frei, Herr Oberstudienrat, und lässt sich nicht einschnüren. Ich danke Ihnen, aber mein Weg ist ein anderer. Leben Sie wohl!«
»Raus!« war das einzige Wort, das Rektor Zugwitz noch über die Lippen brachte.
Und so begab sich der Siebzehnjährige auf Arbeitssuche, die bei seinem Zeichentalent nicht lange dauerte. Ein paar Monate lang skizzierte er in Limburg als Technischer Zeichner Lokomotiventender, ehe er als Fotografen-Assistent in Frankfurt, Koblenz, Witten und München – überall blieb er kaum ein Jahr – mit Bleistift, Marderhaarpinsel und Graphitpulver Falten aufhellte und Warzen verschwinden ließ und so in den Jahren, in denen andere an Akademien studierten und ihre Maltechniken verfeinerten, in schlecht beleuchteten Hinterzimmern an Fotografien herumdokterte, womit er zugegebenermaßen nicht so schlecht verdiente, sodass er den Eltern und Geschwistern hin und wieder sogar etwas zustecken konnte. Mit neunzehn begann er, nach Dienstschluss Stadtansichten in Öl zu malen (wie es sein Vater getan hatte) und käufliche Damen aufzusuchen (was sein Vater nie getan hätte). Letzteres trug ihm den Zwist und schließlich einen Gerichtsprozess mit seiner Vermieterin, Frau Oberpollinger, ein, den er zwar gewann, da der Arzt an Diefenbach keine Syphilis, sondern nur eine allgemeine schwache Konstitution und eine daraus folgende allgemeine Kränklichkeit feststellte, die Wohnstatt wechseln musste er dennoch.
Immerhin wurde er in den Tagen, als die Zeitungen nicht müde wurden, Schliemann für die Auffindung des Schatzes des Priamos zu preisen, an der Münchner Kunstakademie aufgenommen und widmete sich in der Antikenklasse von Professor Strähuber sogleich mit Inbrunst dem Skizzieren von Gipsabgüssen antiker Statuen, derer die Akademie zuhauf besaß. Er verbrachte Tage vor den Ägineten in der Glyptothek am Königsplatz und hörte abends Vorträge der vegetarianischen Gesellschaft oder das Stöhnen billiger Prostituierter in Schwabing.
Bis sich eines Tages zu Fieber und Gliederschmerzen, die seine periodischen Begleiter waren, ein hartnäckiger Durchfall gesellte und der hinzugezogene Arzt Typhus diagnostizierte. Höchste Zeit, dass in München eine ordentliche Wasserleitung gebaut werde, murmelte der Doktor, verschrieb ihm heiße Bäder und Extrakte aus Johanniskraut, riet ihm aber, sich am besten gleich im Krankenhaus behandeln zu lassen.
Doch aus den zwei Wochen, die der wohlmeinende Arzt für den Klinikaufenthalt veranschlagt hatte, wurden sechs Monate, in denen der zunehmend Ausgezehrte achtmal das Krankenbett wechselte, Hunderte Skizzenblätter mit leidenden Gestalten produzierte und sechzehn Männer neben sich sterben sah.
Jeden Tag nahm er die vorgeschriebenen heißen Bäder, aß die der strengen Diät entsprechenden Speisen und trank ausschließlich abgekochtes Wasser. Ab dem dritten Monat hatte er neben den lebhaften Träumen auch tagsüber Halluzinationen, griechische Statuen sprachen zu ihm, Ärzte schienen in der Glyptothek Visiten zu machen.
Eine schlampig angebrachte Infusion ein paar Tage vor der so lange herbeigesehnten Entlassung brachte Bakterien in die Wunde, sodass der Oberarzt angesichts einer drohenden Sepsis entschied, ein Stück Muskel aus dem Oberarm zu entfernen. Danach wurde er gemäß der ursprünglichen Frist nach drei Tagen entlassen, als ob die Operation nie stattgefunden hätte. Den Arm in der Schlinge könne er schließlich auch zu Hause tragen, sagte der Arzt. Aber selbst in seinem mittlerweile mit einer dicken Staubschicht bedeckten ehemaligen Kinderzimmer in Hadamar – wohin hätte er sonst gehen sollen? – vegetierte er noch monatelang vor sich hin und versuchte dreimal vergeblich, das Malen mit der linken Hand zu erlernen. Die Mutter bejammerte und bekochte ihn, die Elendsgemeinschaft lebte nur von der schmalen Rente des Vaters. Einzig Benno Adam, ein alter Freund des Vaters, der sich als Tiermaler einen Namen gemacht hatte, lud ihn während dieser Zeit des häuslichen Darbens zweimal zu Bergwanderungen ein, bei denen der papiergesichtige Diefenbach schnell außer Atem kam, und ermunterte ihn fortwährend, das Studium wieder aufzunehmen.