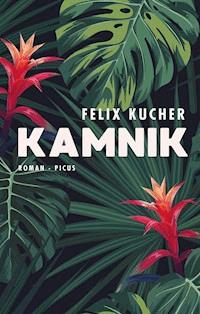18,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Picus Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Die ersten österreichischenFilme zu Beginn des 20. Jahrhunderts sind von billigem Klamauk und nackter Haut geprägt. Im Fotoatelier des Ehepaars Anton und Louise Kolm ist man sich einig: Ein niveauvoller Spielfilm muss her. Louise findet, dass sie selbst den ersten heimischen Kunstfilm drehen sollten. Doch die Männer in ihrem Leben haben Bedenken … Über hundert Jahre später verliert Marc seinen Job am Filmarchiv. Als ihm ein Foto von verschollen geglaubten Filmrollen in die Hände fällt, sieht er seine Chance auf eine akademische Karriere gekommen. Aber um an die alten Filme heranzukommen, muss er nicht nur einen Bus in die Ukraine besteigen, er muss sich auch seiner ureigensten Angst stellen: So unerschrocken er als begeisterter »Roofer« auf Hochhausbaustellen und Kräne klettert – schon beim Anblick eines Kellerabgangs wird ihm ganz anders zumute.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 292
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Copyright © 2025 Picus Verlag Ges.m.b.H.
Friedrich-Schmidt-Platz 4, 1080 Wien
Alle Rechte vorbehalten
Grafische Gestaltung: Buntspecht, Wien
Umschlagabbildung: © thenatchdl / iStockphoto
ISBN 978-3-7117-2155-6
eISBN 978-3-7117-5529-2
Informationen über das aktuelle Programmdes Picus Verlags und Veranstaltungen unterwww.picus.at
Felix Kucher
VON STUFEZU STUFE
Roman
Picus Verlag Wien
INHALT
TEIL 0
TEIL I
KAPITEL 1 – 22.12.2021, 4.25 Uhr
KAPITEL 2 – 22.-23.12.2021
KAPITEL 3 – 24.12.2021
KAPITEL 4 – 1906
KAPITEL 5 – JULI 1906
KAPITEL 6 – 24.12.2021, 11.00 Uhr
KAPITEL 7 – AUGUST 1906
KAPITEL 8 – AUGUST 1906
KAPITEL 9 – 24.12.2021, 22.00 Uhr
KAPITEL 10 – 25.12.2021, 8.34 Uhr
KAPITEL 11 – JUNI 1907
KAPITEL 12 – JULI 1907
KAPITEL 13 – JULI 1907
KAPITEL 14 – 25.12.2021, 11.55 Uhr
TEIL II
KAPITEL 15 – JULI 1907
KAPITEL 16 – 26.12.2021, 00.52 Uhr
KAPITEL 17 – AUGUST 1907
KAPITEL 18 – 26.12.2021, 09.35 Uhr
KAPITEL 19 – AUGUST 1907
KAPITEL 20 – 27.12.2021, 00.12 Uhr
KAPITEL 21 – FEBRUAR 1908
KAPITEL 22 – 27.12.2021, 09.55 Uhr
KAPITEL 23 – FEBRUAR 1908
KAPITEL 24 – 27.12.2021
KAPITEL 25 – 28.12.2021
KAPITEL 26 – 28.12.2021, 10.20 Uhr
KAPITEL 27 – MÄRZ 1908
KAPITEL 28 – 28.12.2021
KAPITEL 29 – APRIL 1908
KAPITEL 30 – MAI 1908
TEIL III
KAPITEL 31 – 28.12.2021
KAPITEL 32 – MAI 1908
KAPITEL 33 – 28.12.2021
KAPITEL 34 – MAI 1908
KAPITEL 35 – 29.12.2021
KAPITEL 36 – 29.-31.12.2021
KAPITEL 37 – SEPTEMBER 1909
KAPITEL 38 – FEBRUAR 2022
0
Ich stand auf der obersten Plattform der Hochhausbaustelle und überlegte, wie lange der Fall bis zum Aufprall dauern würde. Was mir durch den Kopf gehen würde in diesen Sekunden oder Bruchteilen von Sekunden. Der Boden unten war hart gefroren. Fünfter Stock. Das überlebt keiner.
Eine dünne Nebeldecke lag über der Stadt. Da und dort durchstieß eine Rauchsäule die milchige Schicht, darüber ein bemühter Sternenhimmel.
Ich war erst gestern in dieses Land gekommen und war schon am Ende.
Ich malte mir die Zeitungsmeldungen aus: Leiche auf Baustelle entdeckt. Österreicher aus unbekannter Ursache vom Dach einer Hochhausbaustelle gestürzt. Verzweiflungstat eines Ausländers.
Katalina würde diese Überschriften vielleicht zwei Tage später lesen, aber wahrscheinlich las sie keine Zeitung, oder vielleicht würden die Polizeibeamten in meinem Handy ihre Nummer finden, zuletzt gewählt, und ihr vom Unfall des Ausländers berichten. Karo im fernen Wien würde es wahrscheinlich überhaupt nie erfahren, wir hatten keine gemeinsamen Freunde mehr. Sie hob inzwischen nicht mehr ab, hatte mich aber nicht blockiert, sondern ließ es wohl genussvoll läuten, bis die Mobilbox sich meldete.
Ich habe hier eine Aufgabe, eine Mission, sagte ich wenig überzeugend in die Nachtluft hinein, Atemwolken ausstoßend. Wie lächerlich das klang. Ja, vielleicht brächte mir meine sogenannte Mission hier wirklich einen Job. Zumindest eine Publikation. Und damit die Chance auf den Job, auf den ich so viele Jahre gewartet hatte. Und vielleicht auch ein wenig Ruhm. Lächerlich, die Zweite.
Ich blickte über die Nebeldecke, unter der die Häuser der Stadt glommen.
In drei Monaten würde in diesem Land Krieg sein, die jetzt totenstille Stadt laut, voll mit Vertriebenen aus dem Osten, aber das wusste ich damals noch nicht.
Ich wusste nur: Ich musste mich endlich entscheiden.
I
KAPITEL 122.12.2021, 4.25 Uhr
Niemals.
Ich leuchte mit der Taschenlampe die Betontreppe hinunter. Stufen, die ins Dunkel führen.
Niemals würde ich da hinuntergehen, auch diesmal nicht.
Schon auf der ersten Stufe würde mein Puls in die Höhe jagen, der Kopf heiß werden, die Schlinge um meinen Hals sich zuziehen. Nein, ich werde die Kellertreppe auch diesmal nicht betreten, obwohl es mich jedes Mal reizt, die Grenze zu überschreiten.
Keine Keller.
Dabei kann ich nicht sagen, wann es angefangen hat.
Als Kind war es kein Problem, für die Eltern eine Flasche Bier aus der monatlich angeschafften Kiste zu holen. Oder habe ich schon zu früh mit den Horrorfilmen angefangen, die Filme mit den Folterkellern dann mit siebzehn? Unsinn, sonst müsste ich auch vor vielen anderen Dingen Angst haben, die in diesen Filmen vorkommen. Aber irgendwann als Jugendlicher war es dann da, in einem Kellerlokal. Dieses Gefühl, nicht rauszukönnen, erdrückt zu werden. Seltsam, dass man als Erwachsener Ängste bekommt, die man als Kind nicht gehabt hat. Aber Brina hat gemeint, es komme vor, dass man als Erwachsener erst checkt, wo überall Gefahren lauern. Sie ist keine schlechte Therapeutin, aber ich weiß nicht, ob sie immer richtigliegt.
Jedenfalls gehe ich nur noch in ebenerdige Lokale. Denn auch wenn man in den Kellerlokalen vielleicht vergisst, in welcher Etage man sich gerade befindet, ich weiß immer, wenn ich unter der Erde bin, in Räumen, gegen deren Wände von außen Erde, Steine und Wasser drücken, bei denen man durch kein Fenster entkommen kann. Nicht in die Macht der chthonischen Götter fallen, hallt es in meinem Hirn. Chthonischen? Aus welchem Winkel meiner Erinnerung habe ich das wieder hervorgekramt? Vielleicht sollte ich weniger Fantasy lesen.
Ich leuchte mit der Handylampe hinauf in das Rohbautreppenhaus. Besser, viel besser.
Rohe Sichtbetonstufen, die Kälte ausstrahlen, kein Geländer. Ich setze den Fuß auf die erste Stufe, halte inne, blicke auf die Uhr. Halb fünf Uhr Früh ist die ideale Zeit, kein Mensch weit und breit. Im Treppenhaus ist es stockdunkel, ich schalte die Taschenlampe aus, das Handydisplay, das ich alle paar Sekunden aktiviere, muss jetzt reichen. Kein Risiko eingehen. Ich denke an den Sonnenaufgang, der mich als Belohnung vielleicht oben erwartet. Wenn sich der Nebel lichtet.
Ich taste nach den hinabbaumelnden Enden des Rucksack-Bauchgurts, die mir nervtötend auf die Oberschenkel schlagen, klacke sie ineinander.
Seit einem Jahr gehe ich nie ohne Rucksack in den Club, habe Seil und Klettergurt immer dabei. Meistens wird es roofing, so wie heute, da brauche ich die Sachen nicht, aber man weiß nie, ob nicht ein interessantes Baugerüst oder ein Kran zum Pendeln wartet. Heute bin ich definitiv zu müde dafür. Ich spähe aus einer Fensteröffnung, schnaufe, es muss der fünfte Stock sein. Der Nebel ist dichter geworden.
Aber noch ist der Sonnenaufgang nicht verloren. Auch auf anderen Hochhäusern wäre es heute nicht besser. Die Auswahl an Baustellen ist derzeit groß, laufend werden in Wien Wohn- und Bürotürme hochgezogen, Marina Tower, DC Tower, TrIIIple und wie sie alle heißen. Sie locken mich jedes Wochenende, immer nach der Sperrstunde. Ich muss hinauf. Manchmal gelingt es mir sogar, eine Frau, die ich im Club kennengelernt habe, zu überreden. Keine Absichten, nein, komm einfach mit aufs Dach. Manchmal sind andere Roofer da, wir reden kaum, manchmal macht auch ein Joint die Runde.
Die Stufen schaffen mich, ich muss innehalten. Dürfte irgendwo im fünfzehnten Stock sein jetzt, geschätzte acht Stockwerke noch. Keuchen, alter Mann mit vierzig. Atemschwaden im matten Handylicht. Weiter. Der Sonnenaufgang auf der obersten Plattform eines Rohbaus ist unvergleichlich. Wenn die Stadt glüht und ich wach bin.
Ich habe damit begonnen, nachdem ich Victoria gesehen hatte. War eigentlich rein berufliches Interesse, dass ich mir den Film angesehen habe. Der erste abendfüllende Kinofilm, der als One Shot aufgenommen worden war, über zwei Stunden am Stück, in einem Take gedreht. Der erste Film in Echtzeit und das Gefühl, einen wichtigen Moment der Filmgeschichte mitzuerleben. Fünf Jahre ist das her. Die Geschichte von der Clique, die sich nach dem Club auf dem Hochhausdach trifft und den Sonnenaufgang erlebt. Dann habe ich das gegoogelt: Roofing. Leute, die illegal auf Hochhausdächer, auf Gerüste, auf Brückenpylonen steigen. Manche steigen auf Kräne und baumeln an Seilen hin und her. Am nächsten Wochenende habe ich dann eine Baustelle um die Ecke gecheckt. Und bin, nachdem der Club um vier Uhr Früh geschlossen hatte, zum ersten Mal ein Gerüst hinaufgeklettert und habe auf der obersten Decke auf den Sonnenaufgang gewartet.
Weiter, Stufe um Stufe. Die letzten Meter sind die schlimmsten.
Victoria, nein, das Ende hat mir nicht gefallen, alle erschossen bis auf die Protagonistin. Fünf Jahre. Muss auch einer der ersten Filme gewesen sein, bei denen ich als Kartenabreißer gearbeitet habe. Nie werde ich das Gefühl der Erniedrigung vergessen, als ich diesen Zusatzjob angenommen habe. Aber was sollte ich tun, wenn der Archivjob einfach nicht genug abwirft. Wenn du so ein Orchideenfach wie Filmwissenschaft studierst, musst du eben die Möglichkeit haben, publizieren zu können, oder die richtigen Leute kennen, um einen Job in deinem Fach zu kriegen. Wenigstens hat meine Tätigkeit entfernt mit meiner Expertise zu tun und ich sitze nicht in einem Callcenter oder so.
Au. Ein kurzer Stich im Hinterkopf, dann Nackensteife. Den dritten Gin Tonic hätte ich mir sparen können. Aber cooler Club. Fast wäre Emmi, oder hieß sie Anny, mitgegangen auf die Tour, aber als ich vom Gerüstklettern und Kranpendeln angefangen habe, hat sie gemeint, ein andermal, ich muss dann. Sie hatte auf beiden Seiten ihres Kopfes eine Zickzackfrisur, ich musste sofort an Elsa Lanchester aus Frankensteins Braut von 1935 denken. Ich weiß, ich bin wirklich berufsgeschädigt, überall sehe ich Frauen aus alten Stummfilmen. Gestern eine Mary Pickford. Letzte Woche eine Gloria Swanson. Marc, du musst mal weg von deinen Filmen und überhaupt raus aus Wien, hatte Nils gesagt. Der hat leicht reden, mit dem goldenen Löffel im Mund aufgewachsen. Einmal ist er mit gewesen beim Roofen, nein nichts für ihn, er musste ausgeschlafen sein für sein Wochenende auf dem Golfplatz.
Nach einem Jahr Herumlungern auf Dächern und Sonnenaufgangbeobachten – damals, als ich damit begonnen hatte, wurden es immer mehr Roofer, vielleicht waren sie auch durch Victoria inspiriert –, hatte ich meinen ersten Kran bestiegen. Ein Roofer auf dem Marina Tower hatte mir davon erzählt. Zuerst war ich ohne Ausrüstung nur die Leiter hinaufgeklettert und, da der Kran im Wind schwankte und knarzte, gleich wieder hinunter. In den folgenden Monaten stieg ich dann am Führerhaus vorbei bis zum Ausleger, und eines Tages auf den Ausleger selbst. Was den Kick dramatisch erhöhte, denn bei diesem Modell gab es keinen Steg, ich musste mich durch das Dreiecksfachwerk hanteln.
Viel später hatte ich dann die Videos auf YouTube gefunden. Die Typen auf den Petronas Towers, mit GoPro und Handystick. Den YouTuber Shiey, der auf die Spitze von Pylonbrücken klettert und in offenen Kohlewaggons durch Montenegro trainsurft.
All das würde ich selbstverständlich nicht machen. Aber ich hatte eine andere Idee. Nachdem ich mein Selfstorage-Abteil durchwühlt hatte, fand ich mein altes Klettergeschirr und das Seil, dreißig Meter, mehr als genug für das, was ich vorhatte. Und dann bin ich auch gependelt.
Aber heute nicht.
Ich bin oben. Luft holen. Ausschnaufen. Niemand da sonst, Gott sei Dank.
Ich gehe bis zum Rand der mit einem Brettergeländer abgesicherten Plattform. Batman blickt auf Gotham City, haha.
Aber keine Morgendämmerung in Sicht, stattdessen von unten hochwabernder Nebel.
Und auch kein Gotham zwischen den Nebelfetzen. Alles brav und geordnet hier. Die Straßen gleißende Bänder. Autos, die ihren Weg kennen. Menschen, die wissen, wohin in diesem Google Maps aus Beton, sinnlos Strom verschwendend illuminiert in dieser Jahreszeit. Nur ich verlaufe mich dauernd, obwohl ich schon so lange in dieser Stadt lebe. Manchmal vergesse ich bei meinen Spaziergängen, wohin ich wollte, obwohl ich weiß, dass ich ein Ziel hatte. Manchmal freue ich mich über neu entdeckte Wege, um später draufzukommen, dass ich sie schon gegangen oder gefahren bin. Alzheimer, erstes Stadium.
Ich gehe auf die andere Seite der Plattform.
Ob mich schon jemand gesehen hat? Ob die Polizei schon unterwegs ist? Unwahrscheinlich.
Zwischen den Nebelfetzen die Lichterkette einer U-Bahn, die oberirdisch den Fluss quert.
Lichter der Großstadt, schon wieder ein Filmtitel.
Hier oben ist es gut. Der aufsteigende Nebel lässt die Stadt allmählich verblassen. Fade out.
Ich mag nicht an die nächsten Tage denken und tue es genau deshalb. An die Feiertage, die bevorstehen. An die Wochen danach. Die letzten Wochen in meinem Job.
Ich blicke auf die Uhr, ich bin erst acht Minuten hier, eine halbe Ewigkeit.
Der Nebel steigt immer höher, auch der Sternenhimmel verblasst milchig.
Ich warte fünf Minuten, zehn.
Alles zu.
Okay, das wird heute nichts mehr mit dem Sonnenaufgang. Saukalt ist es außerdem.
Beim Hinuntersteigen pocht es in meinem Kopf. Ich gehe doch nur ins Erdgeschoß, sage ich mir. Ins Erdgeschoß.
Als ich unten ankomme, leuchte ich wieder die Kellertreppe hinunter, schüttle den Kopf. Nur weg.
Ich gehe über das Baustellengelände, aus einem Stück frisch umgebrochener Erde dampft es horrorfilmmäßig heraus.
Blick auf die Uhr. Fast fünf, kaum eine halbe Stunde hat die Aktion gedauert.
Wenigstens kann ich heute ausschlafen. Morgen erst wieder im Archiv.
Wo der Countdown weiterläuft.
In zwei Monaten werde ich arbeitslos sein.
KAPITEL 222.-23.12.2021
Bzzz bzzz.
Ach, das Telefon. Augen auf. Es muss schon gegen Mittag sein.
Ich taste nach dem Beistelltisch, ergreife das Smartphone.
Jens am Display. Elf Uhr siebenundzwanzig, nicht schlecht geraten.
»Ja?«
»Hätte einen Job für dich«, sagt er.
Dann quasselt er etwas von einem Kurzfilm, Regieassistenz, jemand ist ausgefallen, viel zahlen kann er nicht.
Ich taste nach meinem Kopf, nein, das ist kein Schmerz, eher eine Art Lähmung, auch das Denken funktioniert erst langsam. Ich bekomme gerade einen Freundschaftsjob angeboten, zeitaufwendig Mädchen für alles spielen für ein lächerliches Honorar. Nein, ich will während meiner letzten Urlaubstage, die ich nach den Weihnachtsfeiertagen verbrauche, nicht arbeiten, sondern endlich mal ausschlafen.
Ich räuspere den Schleim aus meinem Hals, sage Jens ab. »Ich werde in nächster Zeit viel zu tun haben, Übersiedlung Archiv, du weißt, aber danke!« Ob er mir die Lüge abnimmt?
Wir wünschen einander frohe Weihnachten, ich lege auf, drehe das Kissen um, die andere Seite ist angenehm kühl, dämmere wieder weg.
Kurz vor drei am Nachmittag wache ich auf, starte die Waschmaschine, bügle, lese, starre aufs Smartphone, der Tag ist vorbei, um vier ist es fast schon Nacht. Ich zappe durch die Kanäle, bleibe um Mitternacht bei Tarkowskis traumverlorenem Stalker hängen, dass so was noch im öffentlichen Fernsehen ausgestrahlt wird, nach all den Jahren. Aber wenigstens ein halbwegs befriedigender Tagesausklang.
Am nächsten Morgen bin ich früh raus, in der Straßenbahn schließe ich die Augen, rufe mir die letzte Nacht noch einmal zurück. Die Musik im Club, die Gespräche mit ein paar flüchtigen Bekannten, Emmi, den nicht stattgefundenen Sonnenaufgang. Ich öffne die Augen, räuspere mich, setze mich auf, richte die FFP2-Maske, die in den Öffis noch immer Pflicht ist. Ich bin der Einzige, der an der nächsten Haltestelle aussteigt.
Im Archiv sind die Gänge dunkel. Auf den Korridoren wird Licht gespart, in den Büros ist es taghell, ich werde das nie verstehen.
Magda biegt um die Ecke. FFP2-Maske mit Blümchen.
»Marc, gut, dass ich dich treffe. Wollte dich schon gestern zu mir bitten. Hast du meine Mail nicht gelesen?«
Dieses Säuseln. Sie liegt am Abend mit ihrem Hund im Bett und postet das fast täglich mit dümmlichen Hashtags wie #cuddletime. Da habe ich lieber ein leeres Bett neben mir.
»Doch«, lüge ich, »ich wollte noch antworten.«
Magda hebt die Brauen, blickt über ihre rote Brille, schüttelt die plissierten Haare (plissiert, sagt man das so?), macht kehrt. Ich trotte ihr nach. Wird auch immer breiter, denk ich mir, frustrierte Knackwurst im Bleistiftrock. Tonnenrock. Was bin ich für ein Sexist.
Sie wird mir sagen, dass ich ab März keinen Job mehr habe, Umstrukturierung aller Institutionen, die mit Film zu tun haben, Synergien, Einstellung eventuell wieder in einem Jahr, bla bla, alles Dinge, die ich längst schon weiß. Was soll das Gespräch? Die Archiv-Hilfsarbeiter mit befristetem Vertrag trifft es bei Fusionen eben als Erste. Ich verstehe ja, dass es Sinn macht, die Institutionen zusammenzulegen, wofür braucht das kleine Österreich ein Filmarchiv, das an drei teuren Standorten in der Wiener Innenstadt Archiv, Kino, Verlag, Filmbuchhandlung und Café umfasst, dazu ein Außendepot in Laxenburg, daneben ein mit dem Filmarchiv konkurrierendes Filmmuseum, das kein Museum, sondern ebenfalls ein Archiv mit angeschlossenem Kino ist, sowie drittens eine Filmakademie, die ebenfalls eine historische Abteilung inklusive Filmarchiv und Kinosaal besitzt. Logisch, dass der Staat all diese von ihm subventionierten Betriebe jetzt zusammenführt, um Personal- und Sachkosten zu sparen. In dem modernen Kasten aus Glas und Beton, in dem gerade die Böden verlegt werden, würden dann alle Institutionen unter dem Dach eines neuen Universitätszentrums für Filmwissenschaften Platz finden, sie bekämen einen einheitlichen wissenschaftlichen Anstrich, statt fünf Führungskräften würde es einen einzigen von der Uni nominierten Leiter geben und eben einige Mitarbeiter weniger.
»Die Übersiedlung …«, beginnt Magda, nachdem wir uns beide hingesetzt und sie die Maske abgenommen hat, und bricht ab.
Komm zur Sache.
»Wir müssen den Vertrag bereits mit Monatsende auflösen, die Umsiedlung der Archivalien beginnt gleich nach den Weihnachtsfeiertagen. Die Firma hat gestern angerufen, sie hat früher Zeit. Auch das gibt’s.«
Erster Jänner. Nicht März. Okay.
»Aber …«, setze ich an, weiß aber im selben Moment, dass es vergeblich ist. Keine Kündigungsfrist im Werkvertrag. Ich nicke nach hinten, wie es die Griechen machen. Gewohnheit.
»Okay. Den Dezember krieg ich ja wohl noch gezahlt. Und die Urlaubstage …«
»Selbstverständlich«, flötet sie, lehnt sich zurück und zwirbelt eine plissierte Haarsträhne.
Ich stehe auf, das war’s dann, draußen auf dem Gang blicke ich aufs Smartphone. 23. Dezember 2021, 9.37 Uhr. Also … fünf Arbeitstage, die ich als Urlaubstage konsumieren werde. Also heute letzter Arbeitstag hier und ab erstem Jänner arbeitslos, frohe Weihnachten und prosit Neujahr. Das Kartenabreißen bliebe mir immerhin noch als geringfügiger Zusatzverdienst zum Arbeitslosengeld, wenn die Kinos wegen Corona nicht wieder zusperren müssten. Zwei, drei Monate, nein, auch länger, würde ich noch mit dem Ersparten auskommen.
Ich gehe zum Kaffeeautomaten, drücke mir einen Cappuccino herunter, der immer picksüß ist, obwohl ich die Zuckertaste immer voll auf Minus drücke. Draußen grauer Winterhimmel, grauer Innenhof.
Dass ich es nie schaffe. Mit achtundzwanzig endlich fertig geworden, in den letzten Studienjahren als Studienassistent gearbeitet und auf Anstellung gehofft. Dann ein Jahr verschiedene Jobs. Deine Stelle an der Uni kommt, wurde mir gesagt. Hab Geduld.
Dann der Job im Filmarchiv. Bis sich auf der Uni etwas ergibt. Nächstes Jahr soll auf der Filmwissenschaft endlich ein Senior Scientist ausgeschrieben werden. Mein Provisorium Filmarchiv dauert mittlerweile elf Jahre. Und ist inzwischen auch Geschichte. Elf Jahre, in denen drei Beziehungen in die Brüche gingen. Biennial relationships hatte Jens das mal genannt. Du bist im Trend.
Gut, dreimal durfte ich in diesen Jahren etwas publizieren, Michael und Paula ließen mich in Sammelbänden, die sie herausgaben, Beiträge zu frühen Filmtheorien schreiben, Béla Balázs, Rudolf Harms, aber das war es dann. Für eine eventuelle wissenschaftliche Stellenbewerbung zu wenig. Und immer wieder die Vertröstung mit der Ausschreibung. Als sie nach drei Jahren endlich kam, wurde ich nicht einmal zum Hearing eingeladen, die Stelle wurde mit einem Fräuleinwunder aus Deutschland besetzt, feministische Filmwissenschaftlerin, eh klar. Es musste alles feministisch sein jetzt, wahrscheinlich gab es mittlerweile sogar feministische Filmkonservierung. Die Deutsche ist nach zwei Jahren weitergezogen und nicht nachbesetzt worden, inzwischen hat man sogar eine Professorenstelle gestrichen.
Nächstes Jahr also die Ausschreibung, man hat erkannt, dass es so nicht weitergeht. Ist billiger als ein Professor, jedenfalls eine Stelle, auf die ich genau passen würde. Nur bräuchte ich bis dahin eine Publikation. Und zwar nicht irgendein Zitatenflickwerk von verschwurbelter Forschungsliteratur, nein, es müsste etwas Spektakuläres und zugleich wissenschaftlich Solides sein, etwas, das in der Fachwelt Aufsehen erregt.
Aber selbst dann wäre der Job nur befristet. Österreich hat es Deutschland nachgemacht mit dem blöden Gesetz, das eigentlich Kettenbefristungen verbieten und den Leuten fixe Anstellungen verschaffen sollte. Genau das Gegenteil ist in beiden Ländern dann eingetreten: Wenn du nach sechs Jahren keinen befristeten Vertrag ergattert hast, ist es mit der akademischen Karriere vorbei und du wirst an keiner Uni mehr beschäftigt. Nicht einmal der Shitstorm unter #ichbinhanna und die vielen Petitionen konnten da etwas ausrichten.
Die Treppe zum Archiv ist noch schlechter beleuchtet als die Gänge. Mein Arbeitsplatz, bald Ex-Arbeitsplatz, befindet sich zwar im Tiefparterre, aber die bodentiefen Fenster und die sommers begrünten, jetzt allerdings graubraunen Rampen davor lassen kein Kellergefühl aufkommen.
Mein Schreibtisch unaufgeräumt wie immer, der Raum war früher eine Abstellkammer. Ich fahre den PC hoch, wieder jede Menge bescheuerter Mails von Leuten, die zu faul sind, auf Wikipedia oder in den einschlägigen Datenbanken zu recherchieren.
Ich erledige einige Anfragen, zum Glück gibt es keinen Parteienverkehr in den Tagen vor Weihnachten.
Dann mache ich mich an den Stapel der retournierten Filme und sortiere sie auf den Rollwagen, damit ich beim Zurückstellen keinen Weg zu viel mache.
Nach Weihnachten arbeitslos. Haha.
Ich könnte einen Lagerjob bei ZARA oder H&M annehmen, wie als Student. Etwas findet sich immer.
Vielleicht sollte ich wieder mal Lotto spielen. Oder für irgendwelche Schlosserben Bibliotheken sortieren, was ich einmal gemacht habe und was mir dreitausend Euro in zwei Monaten eingebracht hat. Aber so was kommt nicht noch einmal.
Morgen werde ich bei den Eltern vorbeischauen, klar. Die werden dem verlorenen Sohn ein wenig Geld zustecken, ohne zu wissen, dass der tatsächlich jeden Euro braucht.
Als ich zu meinem Schreibtisch zurückkehre und endlich ein bisschen rumsurfen will, läutet das Telefon. Die rumänische Pflegerin der Großmutter ist dran, wir wechseln ein paar Worte, sie übergibt an Oma. Die hätte ich fast vergessen.
»Kommst du mich zu Weihnachten besuchen?«, fragt sie.
»Ja, natürlich, Oma.«
KAPITEL 324.12.2021
1.46 Uhr
Seit eindreiviertel Stunden ist Weihnachten. Ich stehe auf dem Roof eines Rohbaus, diesmal auf der anderen Seite des Flusses, achtunddreißig Stockwerke habe ich gezählt. Der Eiswind lässt mich immer wieder die Augen zusammenkneifen, durch den Dampf meiner Atemwolken ziehen die Lichterketten von Autos auf der Brücke unter mir, so viele noch unterwegs um die Zeit. Ich blase die Atemwolken mit geschürzten Lippen aus wie Zigarettenrauch, wie viele Jahre ist es her, dass ich aufgehört habe?
Heute schließen die Geschäfte um vierzehn Uhr, denke ich, auch das Café ELAN, wo ich gegen Mittag noch hingehe. Dort wird es warm sein, ich werde Martin treffen und Raoul, wir werden zwei oder drei Bier trinken, gegen ein Uhr werden die beiden abziehen, um mit ihren aktuellen Partnern zu feiern; ich werde meinen Pflichtbesuch bei den Eltern machen und, ja, wahrscheinlich um Mitternacht wieder zur Augustinerkirche latschen, am Portal lauschen und versuchen zu erraten, ob zur Mette eine Haydn- oder Mozartmesse erklingt oder etwas Späteres, César Franck vielleicht. Unvorstellbar, dass ich auch mal so was gesungen habe. Unvorstellbar wie so vieles andere. Dass ich jetzt keine Arbeit mehr habe, zum Beispiel.
Ich trete an den Rand der Plattform. Der Fluss glänzt wie eine lang gezogene Lache Erdöl. In diesem Teil der Stadt war ich noch nie auf einem Dach, obwohl hier zwei Tower nebeneinander in Bau sind. Könnte mir schon vorstellen, in so was zu wohnen, Hochhaus mit Supermarkt im Erdgeschoß und U-Bahn-Station im Keller. Aber natürlich werden es Apartments für Investoren, die sie dann zu schwindelerregenden Preisen vermieten oder auch leer stehen lassen. In den Rohbau hineinzukommen, war wie üblich einfach, jeder Baustellenzaun hat eine Schwachstelle. Diesen unmittelbaren Blick auf das pechschwarze Band unter mir, den muss ich mir öfter geben. Hinter dem Strom am anderen Ufer ein dunkler Häuserwall, dahinter glosen die Lichter der Innenstadt, reckt sich der gotische Turm des Doms in den Dunst. Kein anderer Roofer hier, allen zu kalt, alle haben Stress mit Weihnachten, müssen früh raus, Verlegenheitsgeschenke in letzter Minute besorgen oder sind einfach nur völlig fertig ins Bett gefallen und schlafen aus.
Ich werfe einen Blick auf die Uhr, noch viel zu lang bis zum Sonnenaufgang. Ich versuche, in den Lichtbändern Menschen auszumachen, aber überall zerschneiden nur Autoscheinwerfer das dunstige Dunkel. Eine diffuse Erinnerung an eine Vorlesung während des Studiums schleicht sich in mein Bewusstsein. Raumtheorie. Die Szene: Michel de Certeau, wie er von der hundertzehnten Etage des alten World Trade Centers hinunterblickt und damit seine philosophischen Überlegungen beginnt. Dann war irgendwas mit Voyeurismus und der Welt, die wie ein Text lesbar ist. Das Weitere habe ich vergessen, nur noch dieses Bild ist da, der Philosoph auf dem Hochhaus, die Welt als Text. Nur – wie ging der Gedankengang weiter? Alles ist Text, alles lesbar, alles verschieden interpretierbar? Ich vergesse so viel in letzter Zeit, jeden Tag sehe ich mehrmals auf die Uhr, weil ich mir das Tagesdatum nicht merke. Beginnt Demenz schon mit Anfang vierzig?
Demenz. Oma. Die Vierundzwanzig-Stunden-Betreuerin, die angerufen hat.
Da muss ich auch noch hin. Ich blicke in den Himmel, Sterne hinter dem Dunst. Hier gibt es nichts zu sehen, meine Damen und Herren, ab nach Hause, bevor ich noch erfriere, ein paar Stunden schlafen, dann gleich in der Früh zu Oma.
Ich mache noch einen Rundblick. Die Welt als Text lesen, klingt ja gut. Man müsste nur die Sprache verstehen, in der er geschrieben ist.
9.00 Uhr
Ich läute, mustere mein blass gespiegeltes Gesicht im Glas der Haustür. Vier Stunden Schlaf, aber ich fühle mich trotzdem nicht so schlecht. Die Stimme der Betreuerin krächzt aus dem Lautsprecher, sollte wohl ein »Ja bitte?« sein.
»Marc. Ich komme zu Oma.«
Summer, die Tür springt auf, ich trete ins Treppenhaus, Terrazzostufen aus den Sechzigern.
Die Wohnungstür ist einen Spalt geöffnet, ich öffne sie ganz, trete ein und schließe sie hinter mir. Der Geruch von abgestandener Luft und feuchtem Holz bringt Kindheitserinnerungen zurück. Oma riecht nach Kleidung, die zu lange im ungelüfteten Schrank gelegen ist. Wir setzen uns an den Küchentisch, die Betreuerin abseits. Ich habe echt vergessen, wie gut sie aussieht, Mitte-Ende dreißig, würde vom Alter her genau passen, schlank, lange dunkelblonde Haare, jede Strähne in Locken gedreht, im Westen trägt das seit den Achtzigern niemand mehr. Um die Augen ist sie überschminkt wie die meisten aus dem Osten, Konturen um die Lippen – trägt man das dort, wo immer sie herkommt, so? Sie hat einen fünfzehnjährigen Sohn, der alleine zu Hause ist und für den sie diesen Sklavenjob macht, fällt mir ein. Ich sollte mal mit ihr was trinken gehen. Oder ihr ein bisschen Geld zustecken.
Das Gespräch mit Oma ist nach dem Wortwechsel von fünf Stehsätzen zu Ende.
Gut, dass sie den Namen der Pflegerin erwähnt hat, ich hatte ihn vergessen. Katalina.
Sie hat unser schleppendes Gespräch mit gespitzten Lippen beobachtet. Balkan-Vamp, nein, eher Plattenbau-Prinzessin.
»Und du fährst nach Rumänien nach Weihnachten, dann kommt die andere?«, bemühe ich mich.
»Ukraine«, sagt sie. »Andere Frau, Adriana, ist aus Rumänien. Ich fahre morgen. Adriana kommt.«
»Dann wirst du deinen Sohn endlich wiedersehen«, versuche ich etwas unbeholfen, worüber sollte ich sonst mit ihr reden. Sollte ich ihr sagen, komm später, wenn Oma schläft, bei mir vorbei? Wir könnten was trinken, und dann? In meine Wohnung abschleppen und schauen, was geht. Meine verdammte Fantasie.
»Ja und Marko«, sagt sie. Pause. »Marko ist mein Freund.«
Würde mich nicht stören, solange er in der Ukraine ist und du wochenlang hier, denke ich. Marko oder Marc, sie bräuchte sich nur ein wenig umgewöhnen, haha. Heute ist mein Tag der originellen Gedanken.
»Der freut sich sicher.«
»Ja. Hat viel zu tun gehabt jetzt. Hilft Freund bei Ausräumen von Haus.«
Sie wischt auf ihrem Smartphone herum, Oma scheint in Winterstarre verfallen zu sein, hat die Augen geschlossen.
Katalina hält mir das Handy hin, wischt.
Ein unrasierter Mann mit Schachtel. Sie wischt weiter. Ein Keller mit Regalen. Uralte Weinflaschen. Was??
»Darf ich?«, frage ich und warte die Antwort nicht ab, sondern tippe mit zwei Fingern auf das Display, ziehe es auseinander.
Filmdosen. Alte Filmdosen.
»Was macht dein Freund damit?«
»Weiß nicht. Marko hilft Juri. Opa von Juri ist gestorben. Opa hat Haus und viele Sachen. Räumen Haus und Keller aus. Verkaufen alte Sachen. Brauchen immer Geld, du weißt.«
Nächstes Bild. Die Filmdosen in Nahaufnahme. Das sind Filmdosen für Zelluloidfilme. Alte Dosen.
Nächstes Bild.
Ein Stapel von vier Filmdosen, das Bild ist abgeschnitten, halbe Beschriftungen sind lesbar. Das ist doch deutsch.
Von Stufe z
Actualit
Die Ahnf
Der Hut i
Die Ahnf. Die Ahnfrau. Das war doch ein österreichischer Stummfilm, uralt. Ich habe den in meiner Masterarbeit erwähnt, da bin ich sicher. Wenn da Zelluloidfilme drin sind, na danke. Wahrscheinlich alle zersetzt. Oder aber nicht. Etwas beginnt in mir zu arbeiten. Die Ahnfrau.
»Du musst ihm sagen, dass er das nicht in seiner Wohnung lagern soll. Wenn da alte Filme drin sind, können sich die leicht entzünden. Sogar explodieren.«
Ich muss an das Nitrofilmdepot draußen in Laxenburg denken, das jetzt auch zum neuen Synergiekonglomerat gehört, ein Betonbunker umgeben von Äckern. Einmal war ich dort, und einmal in einem Depot in Deutschland, in Hoppegarten, mitten in der Industriepampa vor Berlin, ich weiß nur noch, dass ein Friedhof daneben lag und es sehr heiß war an dem Tag. Filmarchiv neben Friedhof, passt doch. Ab dreißig Grad entzündet sich so ein alter Nitrofilm von selbst. Oder sind es vierzig? Ich weiß, dass ich für meine Masterarbeit dazu recherchiert habe, aber alles wieder vergessen. Und deswegen klingelt jetzt auch etwas. Meine Masterarbeit, die Anfänge des österreichischen Films. Die Kolms mit ihrem Kameramann Fleck und ihrer Ersten Österreichischen Kinofilms-Industrie und ihr Konkurrent Sascha Kolowrat mit seiner Sascha-Film.
Ich nicke, danke Katalina, sie steckt das Smartphone wieder ein.
Oma hustet, Katalina steht auf und macht sich in der Kochnische zu schaffen.
Ich versuche, mich an meine Masterarbeit zu erinnern.
Die Beschriftung der Filmdose, Die Ahnfrau, ja, jetzt fällt es mir wieder ein, den hat man vor dreißig Jahren irgendwo in Südamerika in einem Archiv gefunden. Inzwischen ist er restauriert und digitalisiert und gilt als ältester erhaltener österreichischer Spielfilm. Aber was bedeuten die anderen Titel?
Katalina stellt Oma eine Tasse Tee hin.
»Kannst du mir das letzte Foto noch einmal zeigen? Und darf ich das fotografieren?«
»Ich kann dir schicken. Du arbeitest bei Film, gell?«
»Habe gearbeitet. Im Archiv. Filmarchiv. Alte Filme. Aber jetzt nicht mehr.«
Katalina nickt. »Arbeitslos«, sagt sie und steht wieder auf.
Ich krame in meinem Gedächtnis nach weiteren Filmtiteln, aber es kommt nichts. Dann mal die Gedanken sortieren. Da sind in einem Keller in Osteuropa offenbar alte Filme aufgetaucht. So was kommt vor. Und vielleicht ist der eine oder andere noch erhalten. Die Chance besteht. Vielleicht sind auch welche darunter, die bisher als verschollen galten. Viel zu viele Vielleichts. Aber wenn. Wenn ich an die rankäme, könnte ich sie nach Österreich bringen. Dem Archiv übergeben. Gegenüber den Uni-Leuten darauf bestehen, dass ich darüber publizieren darf. Wissenschaftlich bemerkt werden von der Community. Und Chancen auf den Job haben, der im April ausgeschrieben werden soll.
Ich seufze. Katalina stellt mir auch eine Tasse Tee hin und wendet sich wieder der Kochnische zu.
Aber würde das überhaupt funktionieren? Auch wenn ich die Filme herbrächte und etwas Unerforschtes dabei wäre, würden andere unbedingt darüber publizieren wollen und noch sicherer in ihren unbefristeten Jobs sitzen. Ich würde anonym erwähnt werden, so à la »Ein ehemaliger Mitarbeiter des Filmarchivs entdeckte … bla bla.«
Mein Handy summt, ich öffne WhatsApp, Katalina hat mir die Bilder geschickt.
Ich sehe sie an, sie grinst, sehe auf das Display.
Von Stufe z
Actualit
Die Ahnf
Der Hut i
Was bedeuten diese Fragmente? Actualitäten? Wahrscheinlich Kurzfilme über irgendwelche Tagesereignisse, wie sie in den ersten Jahren des Films üblich waren. Und Der Hut – und wie weiter? Und die erste Beschriftung: Von Stufe z – wie ging das weiter? Von Stufe zu Stufe?
Vibration. Neue Nachricht. Ein Bild ist da, Katalina hat mich fotografiert, wie ich auf das Handy starre, ich lache, sie stimmt ein.
»Danke. Ich werde dann gehen«, sage ich zu ihr. »Gute Reise und frohe Weihnachten.«
Ich verabschiede mich mit einer einseitigen Umarmung von Oma, die im Sitzen eingeschlafen ist.
Die Straßenbahn ist rammelvoll, ich schließe die Augen, die Filmdosen lassen mir keine Ruhe. Da gibt es vielleicht alte Filme, irgendwo in der Ukraine. Die sind vielleicht wertvoll. Sie würden auf einem Flohmarkt landen. Oder weggeworfen werden. Falls sie sich nicht schon zersetzt haben.
Umsteigen, andere Linie. Hier gibt es wenigstens noch Sitzplätze.
Von Stufe z
Von Stufe zu Stufe. Vielleicht, nein, ich bin mir ziemlich sicher, dass ich den Titel in meiner Masterarbeit zitiert habe. Aber natürlich inzwischen vergessen. Ich muss das nachschauen. Sofort. Auch wenn ich dort gekündigt bin. Noch bin ich ja im Urlaub. Vielleicht heißt es auch etwas ganz anderes.
10.15 Uhr
Im Archiv stehen in der Portierloge drei Leute mit Sektgläsern. Oben in den Büros laufen wahrscheinlich schon die kleinen Weihnachtsfeiern mit billigem Prosecco und Brötchen mit eingefärbtem Lachs.
Auf den Gängen begegnet mir niemand.
Die Bibliothek ist offen, Günther, der am Eingang sitzt, schreckt von seinem Handy auf. Seine Brille ist wie immer verrutscht, sein gelb-blau kariertes Flanellhemd fürchterlich, wahrscheinlich ist so was in irgendeiner Bubble gerade in.
Ich habe ihn nie gefragt, wie viele Stunden am Tag er in Chats und Foren verbringt. Wer weiß, auf welcher Plattform er sich jetzt gerade herumtreibt. Wie wenig man über seine Kollegen weiß. Zumindest weiß ich, dass er nicht gerade ein Vielredner ist, Frau und Sohn hat und in seiner Freizeit an alten Vespas herumschraubt. Und offenbar von diesem Sektglasgeklimper des Vierundzwanzigsten nichts hält. Ich verkneife mir eine Bemerkung wie »Nicht mitfeiern mit denen da oben?«, sage stattdessen einfach:
»Frohe Weihnachten. Muss was nachschauen.«
Er nickt, zieht die Augenbrauen zusammen, als müsste er sich an etwas Entlegenes erinnern.
»Ganz ein Seltener. Frohe Weihnachten. Heute nur bis zwölf.«
»Schon klar.«
Ich setze mich an einen PC, logge mich ein.
Suchen.
Da ist es:
Der Film Von Stufe zu Stufe wurde 1908 von dem Team Louise Kolm und Jakob Fleck, den österreichischen Filmpionieren, gedreht. Der erste abendfüllende österreichische Spielfilm, davor hatte es nur Kurzfilme gegeben. Der Film ist nicht erhalten. Ja, den habe ich sicher in meiner Masterarbeit erwähnt, man kann sich nicht alles merken, was man vor fünfzehn Jahren so recherchiert hat. Ich habe jetzt Zeit, den Wikipediaartikel zu lesen, den ich früher bei Katalina schon aufgerufen habe. Moment, was steht da bitte?
»Doch im Gegensatz zu den anderen Produktionen der damaligen Zeit ließ sich nicht einmal in Zeitungen oder in einer der beiden bereits existierenden Filmzeitschriften ein Hinweis auf eine Aufführung dieses Films finden. Und das, obwohl der Film mit fünfunddreißig Minuten Spiellänge eine Sensation gewesen wäre.
Das Filmarchiv Austria konnte trotz größter Anstrengungen auch keinerlei andere Hinweise finden – etwa in den verschiedenen gleichnamigen anderen Produktionen dieser Zeit –, geschweige denn Belege für Hanus’ Ausführungen in den Interviews aus späteren Jahrzehnten.«
Das Filmarchiv, ha. Wir also. Aber wer da wohl gemeint ist? Und wer ist Hanus? Ich wechsle zum Bibliothekskatalog, fische mir ein paar Bücher aus den Regalen, eins davon habe ich seinerzeit für meine Arbeit verwendet, alle anderen sind nach meiner Masterarbeit erschienen. Damals habe ich nicht weiter auf diesen Film geachtet. Mehr als neunzig Prozent der Filme aus der Zeit sind verschollen und bleiben es auch.
Bevor ich mich an die Bücher mache, schnell noch eine Suche zu Die Ahnfrau, dem Film, der erhalten ist. Wikipedia weiß es wieder genau: Als ein Mitarbeiter des Filmarchivs 1990 – lange vor meiner Zeit – zufällig eine Kopie des Films Die Ahnfrau von 1919 im brasilianischen São Paulo entdeckt hatte, war für kurze Zeit Euphorie ausgebrochen: Vielleicht gab es noch mehr erhaltene Filme? Aber es wurden dann doch keine gefunden.
Aber weiter:
»Anton und Louise Kolm mit ihrem Kameramann Jakob Fleck waren 1919, als sie Die Ahnfrau drehten, schon über zehn Jahre im Filmgeschäft und hatten in dieser Zeitspanne an die zehn Spielfilme pro Jahr und unzählige Kurzfilme gedreht, die sämtlich verschollen sind. Manche davon vernichteten die Filmemacher selbst, da niemand an die Archivierung dachte, was damals völlig üblich war.«
Okay.