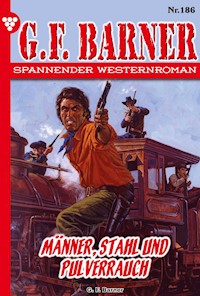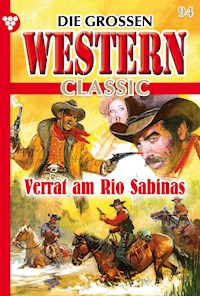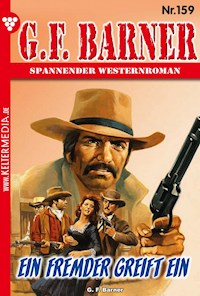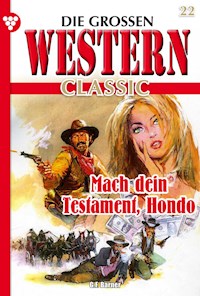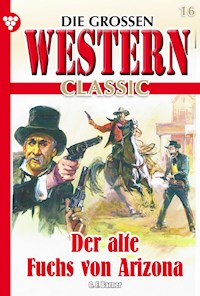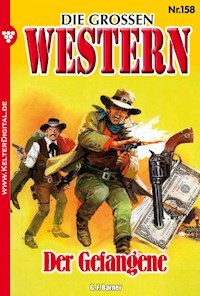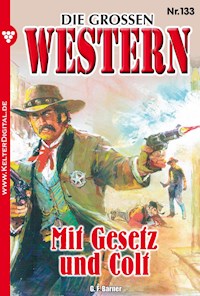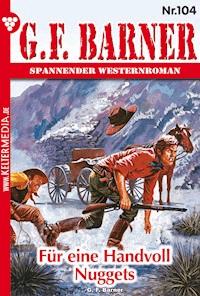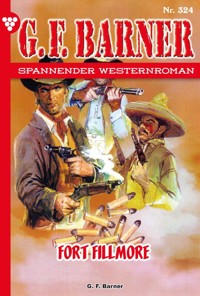Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Martin Kelter Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: G.F. Barner
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2017
Begleiten Sie die Helden bei ihrem rauen Kampf gegen Outlaws und Revolverhelden oder auf staubigen Rindertrails. G. F. Barner ist legendär wie kaum ein anderer. Seine Vita zeichnet einen imposanten Erfolgsweg, wie er nur selten beschritten wurde. Als Western-Autor wurde er eine Institution. G. F. Barner wurde als Naturtalent entdeckt und dann als Schriftsteller berühmt. Seine Leser schwärmen von Romanen wie "Torlans letzter Ritt", "Sturm über Montana" und ganz besonders "Revolver-Jane". Der Western war für ihn ein Lebenselixier, und doch besitzt er auch in anderen Genres bemerkenswerte Popularität. Sero Dunham, der den seltenen Namen Serafino Michelangelo Dunham trägt, sieht sich noch einmal um. Hinter ihm steht der Major an der Wand. Im Saloon trinken zwei Captain, ein halbes Dutzend Lieutenants und etliche Sergeants auf das Wohl von General McPherson. Dessen Besuch in Fort Stockton ist beendet. Die Garnison hat sich gut aufgeführt, es gibt Grund zu einer Feier. »Nun, Clyde?« Major Clyde Forestal wollte es eigentlich nicht sagen. Man soll keinen Mann, der 400 Meilen weit reiten muß, mit solchen Dingen belasten. »Sero, nimm einen Rat mit auf den Weg.« »Deine Ratschläge sind nie schlecht gewesen, Clyde. Also?« »Ich war Captain«, sagte Forestal. »Damals war es hier noch schlimmer als heute. Und Krieg, Sero. Ein gewisser Tremblow, ein Außenseiter, versprach uns Pferde zu liefern. Er hat das günstigste Angebot gemacht. Sero, er hat sein Versprechen nie gehalten. Sie fanden ihn und sieben seiner Leute erschossen in einer Schlucht. Die Pferde blieben verschwunden.« »Ich kannte Tremblow.« »Was denn, du hast Tremblow gekannt, Sero? Das wußte ich nicht. Dann kennst du also auch seine Geschichte?« »Ja«, antwortet Sero Dunham. »Die ganze, nicht die halbe. Ich war in Alabama an der Front, als es passierte. Sonst hätte ich mich viel- leicht um die Sache gekümmert, Clyde.« »Du? Hättest du einen Grund, dich um Tremblows Dinge zu kümmern, Sero?« »Er war der Mann meiner ältesten Schwester.« »Du großer Geist, das wußte ich nicht«, stieß der Major hervor. »Ich erinnere mich an sie.« Sero Dunham blickt auf den Mond, der wie eine große gelbe Zitrone am Himmel zu schweben scheint. »Sie starb in Mexiko«, antwortete er leise. »Der Besitzer
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 150
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
G.F. Barner – 107–
Sie trieben nach Laredo
40.000 Dollar Lösegeld für Dunhams Sohn
G. F. Barner
Sero Dunham, der den seltenen Namen Serafino Michelangelo Dunham trägt, sieht sich noch einmal um.
Hinter ihm steht der Major an der Wand. Im Saloon trinken zwei Captain, ein halbes Dutzend Lieutenants und etliche Sergeants auf das Wohl von General McPherson. Dessen Besuch in Fort Stockton ist beendet. Die Garnison hat sich gut aufgeführt, es gibt Grund zu einer Feier.
»Nun, Clyde?«
Major Clyde Forestal wollte es eigentlich nicht sagen. Man soll keinen Mann, der 400 Meilen weit reiten muß, mit solchen Dingen belasten.
»Sero, nimm einen Rat mit auf den Weg.«
»Deine Ratschläge sind nie schlecht gewesen, Clyde. Also?«
»Ich war Captain«, sagte Forestal. »Damals war es hier noch schlimmer als heute. Und Krieg, Sero. Ein gewisser Tremblow, ein Außenseiter, versprach uns Pferde zu liefern. Er hat das günstigste Angebot gemacht. Sero, er hat sein Versprechen nie gehalten. Sie fanden ihn und sieben seiner Leute erschossen in einer Schlucht. Die Pferde blieben verschwunden.«
»Ich kannte Tremblow.«
»Was denn, du hast Tremblow gekannt, Sero? Das wußte ich nicht. Dann kennst du also auch seine Geschichte?«
»Ja«, antwortet Sero Dunham. »Die ganze, nicht die halbe. Ich war in Alabama an der Front, als es passierte. Sonst hätte ich mich viel-
leicht um die Sache gekümmert,
Clyde.«
»Du? Hättest du einen Grund, dich um Tremblows Dinge zu kümmern, Sero?«
»Er war der Mann meiner ältesten Schwester.«
»Du großer Geist, das wußte ich nicht«, stieß der Major hervor. »Ich erinnere mich an sie.«
Sero Dunham blickt auf den Mond, der wie eine große gelbe Zitrone am Himmel zu schweben scheint.
»Sie starb in Mexiko«, antwortete er leise. »Der Besitzer des schmutzigen Hotels, in dem sie lebte, schwor, daß er nie eine Schlange in seinem Haus gesehen hätte. Ausgerechnet in ihrem Zimmer aber fand man eine, mein Freund.«
Major Clyde Forestal sieht den Mann, der an der Kante desVorbaues steht, starr an.
»Allmächtiger, Sero, du meinst doch nicht, daß sie…?«
»Wenn etwas zehn Jahre her ist«, gibt Sero Dunham kühl zurück, »dann ist die Chance, etwas zu finden, sehr gering. Ich habe ihren letzten Brief noch. Viel steht nicht darin. Nur das eine: sie hätte jemanden gefunden, der mehr über den Tod Tremblows wußte.«
»Wer sollte so gemein sein und eine Frau umbringen?« fragte der Major. Er ist bleich geworden. »Mann, wenn du das sagst, dann…«
»So viele Zufälle auf einem Haufen gibt es nicht«, unterbricht Sero Dunham ihn. »Vielleicht den, daß sich eine Schlange in ein Zimmer verirrt. Aber daß einen Tag darauf jemand mit sechs Schuß aus einem Gewehr ohne ersichtlichen Grund aus dem Hinterhalt abgeknallt wird – nein. Der Täter wollte sichergehen, daß der Mann auch wirklich tot war, glaube ich.«
Einen Moment kommt es Forestal vor, als wenn Dunhams Gesicht Haß oder Grimm zeigt. Forestal kann es nicht deuten.
»Darum«, sagt er seltsam spröde. »Mein Gott, Sero, du hast in dieser Gegend nie Geschäfte gemacht, aber jetzte verstehe ich, weshalb du wie der Teufel hinter der armen Seele diesem Auftrag der Armee nachgerannt bist. Es geht dir weniger um die Pferde, als…«
»Vielleicht irrst du dich, Major?« fragt Dunham leise. »Ich bin Pferdemann, das ist alles. Und wenn ich ein Geschäft wittere, dann mache ich es. Es ist gleich, zu welcher Zeit und an welchem Ort. Zehn Jahre sind eine lange Zeit, meinst du das nicht auch?«
»Du hattest doch noch eine Schwester, Sero?«
»Miriam, ja«, erwidert Sero Dunham. »Sie lebt jetzt in Washington mit einem Mann, der Texas nicht mag. Für ihn bin ich immer noch der Rebellencaptain Sero Dunham. So ist das mit meiner Familie, Freund Clyde.«
»Ist dein Schwager verrückt, Sero?«
»Puritaner«, erwidert Dunham und lächelt. »Fromm, sittenstreng und nicht zu einer anderen Meinung zu bekehren. Ich habe ihn noch nie gesehen.«
»Ja«, sagt Clyde Forestal. »Jeder hat irgendeinen wunden Punkt in der Familie. Seltsam, was? Sero, du solltest an Tremblow denken. Für diese Gegend bist du auch ein Außenseiter. Nun muß ich nichts mehr sagen, oder?«
»Gar nichts mehr, ich weiß alles, mein Freund.«
Er rückt an seinem Hut. Dann geht er los, ein großer, hagerer Mann, der nur aus Knochen und Sehnen, Muskeln und Nerven zu bestehen scheint. Es gibt Leute, die von Sero Dunham: behaupten, er habe keine Seele. Und es gibt andere, die behaupten das Gegenteil.
Hinter Forestal klappt die Tür. Lieutenant Brookes, der jüngste Offizier, der in Fort Stockton Dienst macht, tritt heraus und blickt Sero schweigend nach. Erst als Dunham außer Hörweite ist, fragt er leise: »Major, Sie kennen ihn gut, nicht wahr?«
Clyde Forestal zuckt zusammen. Er ist in Gedanken gewesen. Dunhams Eröffnungen haben ihn wie ein Schlag in den Magen getroffen. Nun erst begreift er, warum Dunham, der mehr als 300 Meilen von hier in New Mexiko wohnt, sich um den Armee-Auftrag so sehr bemüht hat. Tremblow war sein Schwager und ein guter Mann. Und seine Schwester ist jenseits der Grenze umgekommen – an einem Schlangenbiß.
»Hallo, Brookes. Ja, ich war sein Gefangener.«
»Ich hörte davon. Dann sind Sie auch nach dem Krieg mit ihm zusammengekommen?«
»Oft, Lieutenant, ziemlich oft. Er war kurz nach dem Krieg hier. Heute weiß ich erst, was er hier suchte. Himmel, ist der Mann verschlossen.«
»Aber Sie sind doch sein Freund, Major, wie es heißt.«
»Freund? Mein lieber Brookes, es ist nicht so leicht, sein Freund zu sein. Wir kennen uns ganz gut. Er hat im ersten Kriegsjahr dafür gesorgt, daß ich ausgetauscht wurde.«
»Sie haben das steife Bein aus dem ersten Kriegsjahr, Sir?«
»Ich bin unter mein getroffenes Pferd gekommen, und das Bein wurde zerquetscht. Ja, damals tauschten beide Seiten noch verwundete Gefangene aus. Das unterblieb nachher fast völlig. Dunham kümmerte sich um mich wie ein Bruder.«
»Und dann sind Sie hinterher an die Grenze gekommen, Sir?«
»Ja, zur Genesung. Und gleich geblieben. Es gefiel mir hier, Brookes – im Gegensatz zu Ihnen. Heißer als in Minneapolis, denke ich.«
»Die Hölle ist ein kleines Öfchen dagegen, Sir. Eine Frage: Kennen Sie Mr. Dunhams Frau?«
Forestal kraust seine Stirn, dann wendet er ganz langsam den Kopf und sieht seinen kleinsten Lieutenant durchbohrend an.
Dieser Junge, denkt Forestal und spürt irgend etwas wie Zorn auf den Burschen, obwohl der nichts für seine Art kann. Da kommt er aus Minneapolis. Sein Vater wollte das so, der ist im Krieg mal in dieser Gegend gewesen. Aus dem Jungen sollen wir einen harten Mann machen, hat er gemeint. Na schön, dies ist die richtige Gegend, um Leute entweder sterben oder zu widerstandsfähigeren Naturen als die breite Masse zu machen. Daß dieser Junge sich nicht die Ma-nieren eines Sohnes abgewöhnen kann, der einen zu reichen Vater besitzt. ZumTeufel, ich hasse Neugierde wie die Pest – oder Indianer, besonders Apachen.
»Sir, ich frage nur, weil ich hörte…«
»Dummes Gerede«, sagt Forestal mit unterdrückter Wut. »Brookes, merken Sie sich eins: Wenn es jemals einen Mann gibt, dem ich die Armeekasse anvertrauen und ihn von hier nach Oregon damit schicken würde, dann ist es Sero Dunham. Und dann noch etwas, mein Junge. Fragen Sie nie Dunham nach seiner Frau, er würde mit Ihnen das erste und letzte Wort gesprochen haben.«
Er schnauft, der Zorn steckt in ihm. Dieses dreimal verfluchte Gerede um Dunhams Frau.
»Sir, ich meinte ja nur…«
»Ehe Ihnen einVollidiot«, sagt der Major zerknirschend und wird richtig böse, »noch mehr Unsinn erzählt: Dunhams Frau hielt es nicht aus, daß Dunham losritt, um mit unserer Armee die Apachen aus dem Mescalero-Bergen zu jagen. Sie stellte ihn vor eine Forderung, mein Junge. Und nun frage ich Sie eine Kleinigkeit, Sie neunmalkluger Mensch aus Minneapolis: Was würde ihr Vater tun, wenn ihm Ihre Mutter eine Forderung stellt? Wohlgemerkt in diesem Land, in dem von hundert Ehemännern neunundneunzig vor ihrer Frau auf dem Bauch liegen?«
»Ich glaube, er würde schließlich nachgeben.«
»Sehen Sie, das ist in unserem so freien Land das Schicksal des Mannes«, sagte Forestal grimmig. »Er wird der Sklave seiner Arbeit und der seiner Frau. Und darum, mein Freund, werde ich den Teufel tun und jemals heiraten.Wenn meine Frau jemals eine Forderung stellen sollte, würde ich einen Ladestock nehmen und ihr beibringen, wie lang man mit ihm messen kann. Dunham hat auch den Teufel getan. Hundertsiebenundneunzig Siedlerfamilien lebten östlich der Mescalero-Berge. Merken Sie sich die Zahl, sie stimmt, mein Freund.«
Er stampft einmal mit seinem steifen Bein auf und brummelt irgend etwas, was nicht sehr freundlich klingt.
»Um diese Familien ging es derArmee – und Mr. Sero Dunham. Glauben Sie, daß ein Mann ruhig schlafen kann, wenn er im weichen Bett liegt und weiß, daß er verdammt der einzige Mensch ist, der die Apachen überall aufspüren kann? Glauben Sie, daß er friedlich schlummern wird, wenn er weiß, daß fast zweihundert Familien vielleicht in ein paar Tagen Leichen sind? Das ist Sero Dunham. Und darum ist er weggeritten – mit derArmee – und gegen den Willen seiner Frau. Und war sein Haus leer, als er nach Hause kam. Das nenne ich einen Mann wie einen Mann handeln. So, und nun sind Sie hoffentlich zufrieden.«
»Ja, Sir, ich wollte Sie nicht wütend machen.«
Forestal brummt: »Sie haben mich wütend gemacht, aber – weiß der Teufel – ein guter Whisky schmeckt mir dann noch mal so gut.«
Er dreht sich um und stampft in den Saloon. Hinter ihm aber bleibt Brookes noch einen Moment auf dem Vorbau stehen.
*
Die beiden Reiter biegen in den Hof ein. Dort stehen ein paar Pferde mit hängenden Köpfen in einem Stangencorral. Ein älterer Mann ist dabei,Wasser in die Tränke zu schütten. Es ist Clayton, der Mietstallbesitzer. Den Eimer in der Hand, dreht er sich um.
Dann sieht er zu Grimmons, einem untersetzten blonden Mann hoch, und kratzt sich am Kopf.
»Hallo«, sagt Jube Grimmons, als die Pferde stehen, »ziemlich warm heute, was Clayton? Das hier ist Sero Dunham.«
»Hallo«, murmelt Clayton »Dunham? Ben redet manchmal von dir, wenn er grade nüchtern ist. Grimmons, wolltest du zu Ben?«
»Er«, antwortet Jube Grimmons ziemlich bissig und schiebt sich den Hut nach hinten. »Ich nicht, Clayton. Von mir aus kann Ben sich totsaufen, ich habe es satt…«
»Jube!«
»Schon gut«, brummt Grimmons unwirsch. »Ich habe es dir gesagt, Captain – oder nicht? Wenn einer weiß, was ich alles versucht habe, um Ben die verdammte Flasche abzugewöhnen, dann ist es Clayton. Es ist sinnlos, niemand bringt Ben jemals zur Vernunft, Sero, das schaffst auch du nicht.«
»Eins konntest du schon immer gut«, erwidert Dunham trocken. »Dir etwas einreden, Freund Jube. Clayton, wo steckt Ben?«
Clayton kratzt sich wieder am Kopf, dann deutet er nach rechts auf den Zaun. Er muß aber wohl das Haus meinen, dessen Giebel sie von hier aus sehen können.
»Dort drüben«, sagt er heiser, »er sitzt im Jail, Dunham.«
»Was?« fragt Grimmons überrascht, wahrend sich seine Augen jäh verdunkeln und sein störrisches Gesicht erstarrt. »Clayton, Ben sitzt? Was hat er angestellt?«
»Er hatte vor vier Tagen Streit mit Thatcher, einem der Freunde der Elgins. Du kennst Thatcher doch?«
»Der Bulle, der vergangenes Jahr Wilson zusammengeschlagen hat?« fragt Jube stockheiser. »Sage nur, diesmal wäre es Ben, mit dem er sich angelegt hat?«
»Ben hat sich mit Thatcher angelegt«, gibt Clayton seufzend zurück. »Thatcher war hier und packte seinen Wagen voll. Es war mehr, als die beiden Gäule ziehen konnten. Als Thatcher mit dem Peitschenstiel auf die Pferde einschlug, ist Ben auf ihn losgegangen. Du kannst dir ausrechnen, wie er danach ausgesehen hat. So zerschlagen er war, er kroch, kaum daß ich ihn im Haus hatte, zum Schrank und holte sich mein Gewehr. Ich dachte nicht, daß er überhaupt kriechen konnte. Ich war in der Küche, als es knallte.«
»Hat er etwa Thatcher getroffen?« »Beinahe. Er hat Thatcher den Hut vom Kopf geschossen, als er auf der Straße stand. Ich konnte Ben gerade noch das Gewehr wegschlagen, ehe er ihn umbringen konnte.Thatcher hatte keine Chance, mit dem Revolver etwas gegen das Gewehr zu tun. Danach hat ihn der Sheriff eingelocht.«
»Allmächtiger«, ächzt Jube Grimmons, »Sero, wir müssen zum Sheriff.«
»Der ist nicht da«, erklärte Clayton. »Ben hat die Zelle ohne Pritsche bekommen. Er hat zwei Tage getobt wie ein Irrer, am dritten Tag versuchte er sich aufzuhängen. Er riß sein Hemd in Streifen. Sie konnten es ihm gerade noch wegnehmen.
Der Sheriff ist mittags zur Parade-Ranch geritten, jemand hat dort Vieh gestohlen. Er hat mir den Schlüssel hiergelassen. Seit gestern abend ist Ben friedlich. Er liegt am Boden und stiert an die Decke. Ich sehe alle halbe Stunde nach ihm. Er sagt kein Wort.«
Sero Dunham blickt Jube an, der bleich geworden ist.
»Er wird doch nicht verrückt geworden sein?« fragt Jube stockend.
»Du redest dir schon wieder etwas ein«, erwidert Sero kühl. »Clayton, hat der Sheriff gesagt, daß Ben im Jail bleiben muß?«
»Nein«, antwortet Clayton. »Er sagte, er würde Ben den verdammten Whisky abgewöhnen. Und wenn Ben dabei verrückt würde. Es ist eine verdammte Sache, einen Mann wie Ben James langsam aber sicher vor die Hunde gehen zu sehen, das kannst du mir glauben: Cliff kann ganz schön hart sein, wenn er will.«
»Umsonst ist er nicht dein Neffe«, sagt Jube heiser. »Clayton, ist das ein Komplott von euch beiden?«
»Ich habe mal seinem Vater versprochen, auf Ben zu achten«, gibt Clayton zurück. »Einmal mußte es genug sein. Und es war genug, als er anfing, auf Thatcher zu feuern, denke ich. Wenn er ihn getroffen hätte, na, rechne es dir selber aus, Jube. Er ist jetzt ruhig, der verdammte Bursche. Und ich will wetten, wir gewöhnen ihm das Saufen noch ab.«
»Dann weiß er also, daß ihr ihn bekehren wollt«, stellt Jube fest. »Darum redet er nicht mehr mit dir. Nun gut, der Captain will Ben mitnehmen. Ich habe versucht, es ihm auszureden, aber er will es so haben. Clayton, wo ist der Schlüssel zum Jail?«
»Hier sind sie beide, der für die Außentür und der für die kleine Zelle«, antwortet Clayton und zieht die Schlüssel aus der Tasche. »Die halbe Stunde ist ohnehin um, ich muß nach ihm sehen. Kommt mit, wenn ihr wollt, aber ich sage euch, er redet mit keinem.«
Er geht vor ihnen her aus dem Hof. Bis zum Office sind es nur 60 Yards. Clayton schließt das Office auf, tritt ein und stößt in der nächsten Sekunden einen Schrei aus. Etwas fliegt durch die Gitterstäbe, saust dicht an ihm vorbei und prallt dumpf an die Wand.
»Komm nur her, du Schuft!« brüllt James aus der kleinen Zelle mit überschnappender Stimme. »Komm herein, komm nur! Ah, zurückgesprungen ist er, was? Ich habe die Pritsche drüben mit meiner Hose erwischt und herangezogen. Kornm nur her, dann hast du ein Brett vor dem Kopf, du alter Schurke. Ich will raus, ich muß was zu trinken haben!«
Clayton hat einen entsetzten Satz gemacht und starrt auf das Brett, das am Boden liegt.
»Ich wollte es nicht glauben«, sagt Sero Dunham draußen bitter. »Und das war mein bester Sergeant, der beste Reiter, der jemals in einem Sattel hockte. Dieser Bursche winselt wie ein schmutziger, verkommener Indianer, der dem Brandy verfallen ist. Gib mir den Zellenschlüssel, Clayton, jetzt habe ich genug.«
Clayton schüttelt entsetzt den Kopf, als Dunham ihm einfach die Schlüssel wegnimmt.
»Er wird dir ein Brett an den Kopf werfen«, sagt er. »Bleib hier, der kennt sich selbst nicht. Er hat uns geblufft. Wir dachten, er sei friedlich. Bleib hier.«
Sero Dunham geht wortlos in das Office, hat den Schlüssel in der Hand und hört keinen Laut mehr.
Im nächsten Augenblick kann er in die mittlere, kleine Zelle blicken.
Es ist Dunham, als wenn der Mann, der dort an die Wand zurückweicht und ein Brett fallen läßt, der zwanzig Jahre ältere Bruder des Ben James ist, den er einmal gekannt hat. Das Haar ist verdreckt und strähnig, der dunkle blauschwarze Bart wuchert, seine Augen liegen tief in den Höhlen, und seine Wangenknochen ragen, die Haut spannend, stark hervor.
»Ich – ich«, sagt Ben James und seine Hand versucht mit einer fahrigen Bewegung das Haar zurückzustreichen, »ich wollte nur – ich habe nicht…«
Nun steht er an der Wand und schiebt sich an ihr bis in die hinterste Ecke der Zelle. Dorthin hat er auch die Pritsche gezogen.
»Sechs Jahre«, sagt Dunham langsam, »ist es jetzt her. Ich kannte einmal einen, der hielt nichts davon, bei mir zu bleiben. Er wollte hier unten in der Nähe von jemandem sein, erinnerst du dich, Ben James? Er nannte irgendwen seinen besten Freund, stimmt es, Ben James? Nun los, wirf doch, bück dich, Ben, heb das Brett auf. Du wolltest es doch deinem Besuch an den Kopf werfen. An den Schädel, hast du gesagt.«
Ben James, der groß und breitschultrig ist, hebt die eckigen Schultern langsam an. Es sieht aus, als wollte er den Kopf zwischen sie ziehen.
»Worauf wartest du?« fragt Sero Dunham kühl. »Vielleicht auf eine Flasche? Raus mit dir, raus, sage ich. Geh hin und hole dir deine Flasche. Und dann sei ein Held, sei es und setze sie an den Hals. Dazu gehört kein Gehirn, wie? Hast du nicht einmal gesagt, du hättest mehr Gehirn als andere, Ben? Du kannst jetzt gehen, die Tür ist offen. Niemand wird dich aufhalten, verstanden? Da drüben ist der Saloon. Sie werden dir sicher eine Flasche geben, meinst du nicht?«
»Hör auf«, sagt Ben James keuchend. »Ich sage dir, Captain, ich werde sonst wild.«
»Du wirst wild?« erkundigt sich Dunham eisig. »Du kannst keinen Sack Zucker mehr tragen, wette ich. Du könntest kein Wildpferd mehr bändigen. Früher hast du zwei oder auch drei am Tag zureiten können. Du hast es ausgehalten, während andere am Abend auf ihre Pritsche fielen und nicht mehr kriechen konnten. Meinst du, du kannst das jetzt noch? Komm doch her und versuche, ob du jemanden schlagen kannst, Benjamin.«
»Ich kann, ich schwöre dir, ich kann jedes Pferd reiten.«
»Du konntest«, erwidert Dunham kuhl, der den trotzigen, verbissenen Ton in Bens Stimme nicht zu hören scheint. »Ich habe neun Zureiter, Ben James, neun gute Burschen. Und ich dachte, du würdest der zehnte sein wollen. Tut mir leid, Ben, du kannst gehen, und ich werde nach Hause reiten – ohne dich.«
»Aber, ich kann bestimmt…«