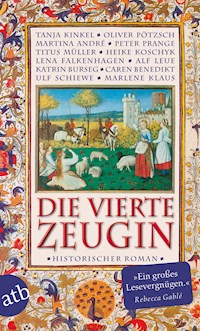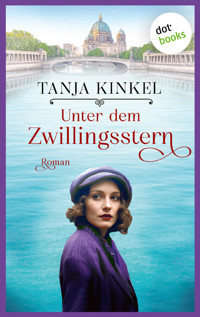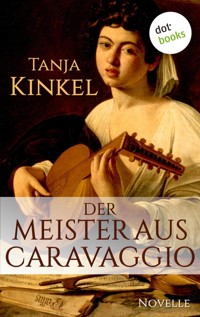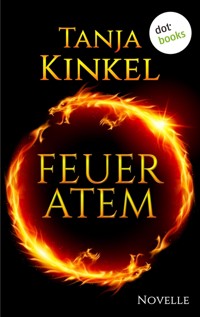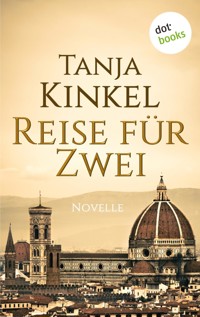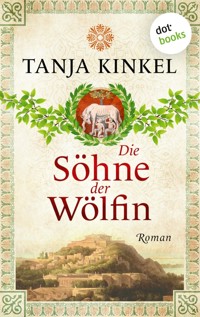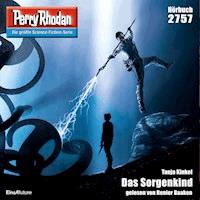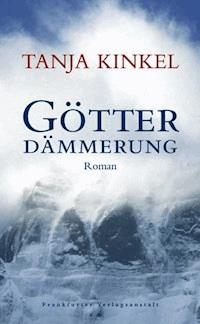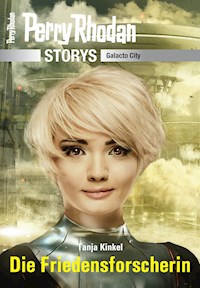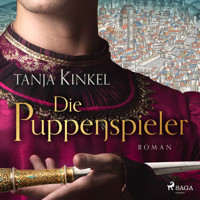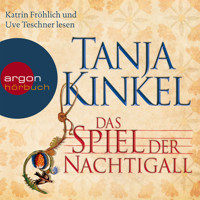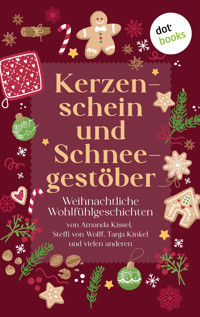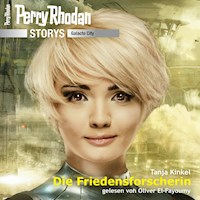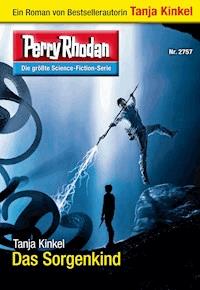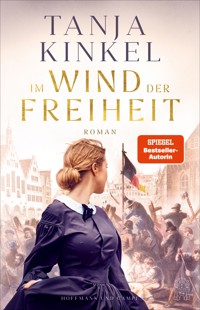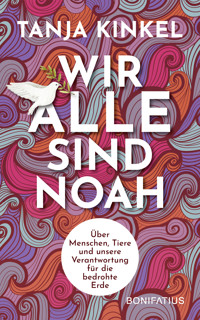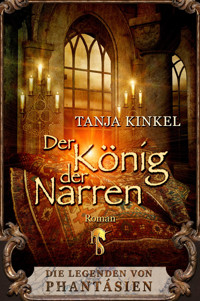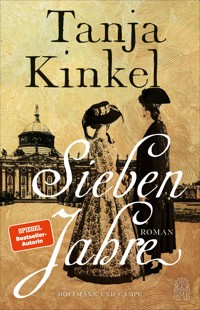
24,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: HOFFMANN UND CAMPE VERLAG GmbH
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Ein atemberaubender Roman über Krieg und Liebe, Macht und Verrat 1756: Friedrich II. von Preußen steht im Zenit seiner Macht – bis es seiner Erzfeindin Maria Theresia gelingt, das junge Königreich Preußen nahezu vollständig zu isolieren. Der König geht zum Angriff über. Sein Feldzug, der als Siebenjähriger Krieg in die Geschichte eingehen wird, verlangt auch seiner Familie alles ab: Während sein Bruder und Thronfolger Wilhelm unter dem Druck zerbricht, erweist sich der bisher als leichtfüßig verrufene Heinrich als brillanter Stratege, gleichzeitig Friedrichs schärfster Kritiker und wichtigste Stütze, und seine Schwester Amalie schickt sich an, auf unerhörte Weise eigene Wege zu gehen. Im Inferno von Krieg und Familiendrama steht ausgerechnet der rechtelose schwarze Pagen Hannibal an ihrer Seite, der gleichzeitig voller Mut für eine eigene bessere Zukunft kämpft …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 1107
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Tanja Kinkel
Sieben Jahre
Roman
Roman
Für Sherrylyn und Charlene
Königliche Familie von Preußen
Friedrich Wilhelm I. in Preußen, der Soldatenkönig
⚭
Sophie Dorothea von Hannover, Tochter und Schwester englischer Könige
Friederike Sophie Wilhelmine, Friedrichs Lieblingsschwester
⚭
Markgraf Friedrich von Brandenburg-Bayreuth
Friedrich II. »der Große«, ab 1740 König in, ab 1772 König von Preußen
⚭
Elisabeth Christine von Braunschweig-Wolfenbüttel-Bevern
Friederike Luise
⚭
Markgraf Karl von Brandenburg-Ansbach
Philippine Charlotte
⚭
Herzog Karl I. von Braunschweig-Wolfenbüttel, Bruder von Elisabeth Christine
Sophie Dorothea Marie
⚭
Markgraf Friedrich Wilhelm von Brandenburg-Schwedt
Luise Ulrike
⚭
König Adolf Friedrich von Schweden
August Wilhelm, Friedrichs designierter Thronfolger
⚭
Luise Amalie von Braunschweig-Wolfenbüttel, Schwester von Elisabeth Christine
Anna Amalie, Äbtissin von Quedlinburg
Friedrich Heinrich Ludwig, Friedrichs größter Kritiker und Stütze
⚭
Wilhelmine von Hessen-Kassel, genannt Melusine
August Ferdinand
⚭
Anna Elisabeth Luise von Brandenburg-Schwedt, seine Frau und Nichte
Weitere Personen, in alphabetischer Reihenfolge
Ferdinand von Braunschweig-Wolfenbüttel – »Prinz von Braunschweig«, Bruder von Luise Amalie und Elisabeth Christine
Franz I. Stephan – Kaiser des Heiligen Römischen Reiches
Fredersdorf, Michael Gabriel – Kammerdiener und engster Vertrauter Friedrichs II.
Fredersdorf, Caroline – seine Gattin
Hassan, Franziska – Enkelin des »Kammertürken« Hassan, Freundin Hannibals
Henckel von Donnersmarck, Viktor Amadeus – Heinrichs Adjutant bis 1758
Kalckreuth, Friedrich Adolf von – Heinrichs Adjutant ab 1758
Katte, Hans Hermann von – Friedrichs in Küstrin hingerichteter Jugendfreund
Kaunitz, Wenzel Anton von – Maria Theresias Staatskanzler
Lehndorff, Ernst Ahasverus von – Kämmerer der Königin Elisabeth Christine, Heinrichs intimer Freund
Maria Theresia – Erzherzogin von Österreich, Frau von Kaiser Franz I. Stephan, Friedrichs lebenslange Hauptgegnerin
Marwitz, Georg Wilhelm »Antonius« von der – Heinrichs erste Liebe, Page, Gardist und schließlich Quartiermeister
Mitchell, Andrew – britischer Botschafter in Preußen
Mmadi Make – genannt Hannibal, schwarzer Page bei August Wilhelm und Amalie
Schwerin, genannt »der kleine Schwerin« – Großneffe des Feldmarschalls Kurt Christoph von Schwerin, Page bei Wilhelm und Heinrich
Seydlitz, Friedrich Wilhelm von – General der Kavallerie
Valory, Louis Guy Henri de – französischer Gesandter in Preußen
Winterfeldt, Hans Karl von – preußischer General, Freund Friedrichs und Gegner seiner Brüder
Prolog: Drei Tage im August
Wusterhausen, 1. August 1730
Er ist nicht mehr der Jüngste der Familie, endlich. Heinrich ist vier Jahre alt und hat seit kurzer Zeit einen kleinen Bruder. Er hat außerdem acht ältere Geschwister, doch die Mehrzahl von ihnen sieht er sehr selten. Seit seinem vierten Geburtstag teilt er sich ein Schlafzimmer mit seinem Bruder Wilhelm. Wilhelm ist vor Kurzem acht geworden und schon viel größer als Heinrich. »Nicht doch«, sagt ihre Schwester Amalie, die im Alter zwischen ihnen steht. »Du bist nur so klein. Ein richtiger Zwerg, kein Prinz.«
Prinzen und Prinzessinnen, das sind sie alle. Mit vier Jahren hat Heinrich noch nicht wirklich erfasst, was das bedeutet. Die Kindermädchen und die Diener beten mit ihm und Wilhelm morgens und abends für den König und die Königin, ihre Eltern. Gelegentlich werden sie in ihre guten Kleider gesteckt und einer ständig erschöpft aussehenden umfangreichen Dame vorgeführt oder einem Mann in Uniform, der oft einen Stock in der Hand hat. Amalie sagt, dass dies die Königin und der König seien, doch sie muss sich irren. Beide tragen keine Kronen.
Zu Heinrichs viertem Geburtstag am Anfang dieses Jahres gab es eine große Feier, da waren auch eine in Rot gekleidete junge Frau und ein junger Mann in Gold, vor denen sich die Diener verbeugten; sie hielten aneinander an den Händen und lachten, genau wie Königspaare in den Büchern, aus denen ihnen vorgelesen wurde. Das, glaubte Heinrich, müssten der König und die Königin sein.
»Du weißt aber auch gar nichts«, sagte Amalie, als er sie anstieß und auf die junge Frau zeigte. »Das ist unsere Schwester Wilhelmine. Sie ist die Älteste.«
Nur ein halbes Jahr später sind alle seine Geschwister wieder versammelt wie zu seinem Geburtstag. Bis auf zwei Ausnahmen: Der Älteste ist nicht da, und der neue Säugling, sein kleiner Bruder Ferdinand, schläft oder schreit gerade irgendwo anders, hier in Wusterhausen, dem Haus, in welchem sie bereits im letzten Jahr waren, als der Sommer wirklich heiß wurde. Es ist nicht längst so riesig groß wie der Palast, in dem sie sonst leben. Dafür teilt Heinrich sich hier nicht nur mit Wilhelm das Zimmer, sondern auch mit zweien seiner Schwestern, Amalie und Ulrike.
Die Königin ist also doch die erschöpfte Frau, nicht mehr ganz so umfangreich, seitdem das neue Kind da ist, und jetzt gerade mit sehr viel Weiß und Rot im Gesicht. Ihr Kleid wogt braungolden um sie herum, und eine weitere Frau fächelt ihr Luft zu.
»Ist heute eine Feier?«, fragt Heinrich, denn das würde erklären, warum sie alle zusammen sind. Er fragt Wilhelm, nicht Amalie, damit Amalie nicht noch mehr Gelegenheit bekommt, sich mit ihrem größeren Wissen aufzuspielen.
Wilhelm schüttelt den Kopf. Er schaut zu der Königin, zu Wilhelmine, zu den übrigen Geschwistern und runzelt die Stirn.
»Ihre Hoheiten sind nun alle hier«, sagt die Frau, die der Königin Luft zufächelt, und die Königin erhebt sich von der Chaiselongue, auf der sie bisher mehr lag als saß.
»Meine Kinder«, sagt sie, »meine lieben Kinder, Seine Majestät der König wird bald hier sein. Ihr …« Sie hält inne und beißt sich auf die Lippen. Dann beginnt sie noch einmal. »Wenn euer Papa hier eintritt, dann müsst ihr alle sehr brav sein. Kniet vor ihm nieder und bittet für euren Bruder Fritz. Habt ihr das verstanden? Es ist sehr wichtig, dass ihr alle den König bittet, eurem Bruder Fritz gegenüber Gnade walten zu lassen.«
»Was hat er denn getan?«, fragt Wilhelm. Heinrich hätte das nicht gefragt, aus dem einfachen Grund, weil in diesem Jahr noch jedes Mal, wenn der uniformierte Mann mit dem Stock zugegen war, früher oder später ein Geschrei über »Fritz« begonnen hat. Zunächst hat Heinrich geglaubt, »Fritz« müsse einer der Diener sein oder ein Soldat. Sowohl das riesige Schloss als auch Wusterhausen sind immer voller Soldaten. Auf jeden Fall aber handelt es sich bei »Fritz« um jemand, der ständig Fehler macht. Da Heinrich und seine Geschwister getadelt werden, wenn sie brüllen, muss der Mann mit dem Stock tatsächlich der König sein, den als Einzigen niemand tadeln darf. Das ist logisch.
Die Königin beachtet die Frage nicht, aber sie winkt Wilhelm zu sich und greift ihm unter das Kinn. »Er liebt dich«, murmelt sie. »Wilhelm, mein Junge, du musst als Erster bitten. Willst du das für deinen Bruder tun?«
»Gewiss, Mama, aber was hat er denn …«
Abrupt lässt ihn die Königin los. »Tue einfach, was dir gesagt wird«, gibt sie kurz angebunden zurück.
»Verzeihen Sie, Mama, aber das ist nicht recht«, sagt Wilhelmine. Ihre Stimme klingt ein wenig heiser, als sei sie erkältet, und ihre Augen sind geschwollen, sodass man kleine rote Äderchen sieht. »Sie können doch die Kinder nicht in diese Angelegenheit hineinziehen. Ich …« Sie schluckt. »Ich bin die Älteste«, fährt sie fort. »Ich werde beim König um Gnade bitten.«
Die Königin wirft ihr einen ärgerlichen Blick zu. »Sei Sie nicht töricht. Der König hasst Sie mittlerweile so sehr wie Ihren unglücklichen Bruder. Den Bitten der Kinder jedoch wird er sich nicht verschließen können!«
Das Wort ist nicht ganz neu: »Hass«. Doch Heinrich hat es bisher nur im Zusammenhang mit Gott gehört, von den Haushofmeistern und Lakaien, welche die Aufgabe haben, mit ihm zu beten. »Gott hasst die Sünde, aber er liebt den Sünder.« »Nicht herumträumen, Hoheit, Gott hasst die Müßiggänger!«
Wenn der König Gottes Stellvertreter auf Erden ist, dann ergibt es wohl einen Sinn, dass er auch hasst. Müßiggänger, die Sünde und, laut der Königin, zwei seiner Kinder. Das ist verstörend. Wenn zwei von ihnen, warum dann nicht alle? Heinrich schaut zu den älteren Schwestern, denen, die er selten sieht: Charlotte und Sophie, die jünger sind als Wilhelmine, aber älter als Amalie, Ulrike und Wilhelm. Charlotte redet sonst viel, aber heute nicht. Heute hat sie noch gar nichts gesagt. Sie steht nur stumm da und schaut zur Königin. Sophie hat sich in eine Ecke verdrückt.
Wilhelm fragt noch einmal: »Was hat der Fritz denn getan?«
Unwillig klatscht die Königin in die Hände, wie es die Kindermädchen tun, wenn sie einen zur Ordnung rufen. »Es ist keine Zeit mehr«, sagt sie. »Meine Kinder, bitte, denkt alle daran, eurem Herrn Vater gleich die Hände zu küssen, wenn er eintritt!«
Inzwischen kann Heinrich von draußen den Lärm hören, den eine ganze Gruppe von Menschen macht, wenn sie sich nähert. Wilhelmine berührt Wilhelm rasch an der Schulter, und weil Heinrich direkt hinter ihm steht, kann er hören, wie Wilhelmine seinem Bruder zuflüstert: »Fortlaufen wollte er, und das war nicht recht, aber er hat es nicht böse gemeint.«
»Wie der Soldat aus der Leibgarde, den der Papa hat hängen lassen wollen, ehe ich für ihn gebeten habe«, sagt Wilhelm sachlich, und Heinrich fröstelt. Daran kann er sich nicht erinnern. Er muss noch zu klein gewesen sein. Er hat auch nicht die Gelegenheit, nachzufragen, weil beide Flügel der Tür aufgestoßen werden.
Und da steht er, das Gesicht dunkel vor Zorn, die blaue Uniform voll Flecken, als habe er sie tagelang getragen, den Stock in der Hand: der König. »Infame Kanaille!«, brüllt er. Er hat eine Stimme, die Paradeplätze füllt und das Schreien gewohnt ist. »Schlangengezücht!«
Wilhelm, der sonst immer vom König mit einem Lächeln und den Worten »Na, du Racker?« begrüßt wird, tritt unwillkürlich einen Schritt zurück, statt auf den König zu. Den übrigen Geschwistern geht es nicht anders, bis auf Wilhelmine. Heinrich sieht, dass sie ihre Schultern straft. Dann sinkt sie in einen makellosen Knicks vor den König, wie ihn Amalie und Ulrike immer vergeblich üben, und greift nach seiner Hand, um sie zu küssen.
Der König erfasst ihr Handgelenk und zieht sie hoch. »Sie wagt es, hier vor mir zu erscheinen? Fort mit Ihr! Sie mag Ihrem Schurken von einem Bruder Gesellschaft leisten!«
Er hebt seine andere Hand. Dann beginnt er, auf Wilhelmine einzuprügeln. Er schlägt sie nicht mit der geöffneten Handfläche, wie es das Kindermädchen bei Heinrich gelegentlich getan hat, oh nein. Der König benutzt seine Faust, um Wilhelmine ins Gesicht zu schlagen, auf den Oberkörper, in den Magen. Er zerrt ihr die Perücke vom Kopf, greift in ihr Haar, schleift sie durch den Raum, während er »Verräterin« und »Kanaille« schreit und: »Du hast es gewusst!«
Dann folgt noch etwas über jemanden namens Katte, aber zu diesem Zeitpunkt versteht Heinrich gar nichts mehr, denn er weint vor Angst, obwohl er schon vier Jahre alt ist und ein tapferer Prinz sein soll, genau wie die anderen Geschwister, während die Königin ihrerseits laut schreit, schrille, tonlose Laute ohne Sinn. Der König ist das Gesetz. Niemand steht über ihm. In diesem Moment scheint es, als ob er Heinrichs älteste Schwester zu Tode prügeln würde.
Heinrich spürt, wie jemand an seiner Hand zieht, und erst da merkt er, dass die Mädchen unter den großen Tisch gekrochen sind, der in der hinteren Hälfte des Raumes steht. Amalie winkt. Es ist Wilhelm, der an seiner Hand zieht. Wilhelm hat sonst nie Angst. Wilhelm versteckt sich nur, wenn sie miteinander spielen. Wilhelm zieht, und Heinrich folgt, quetscht sich als Letzter unter den Tisch, kann nicht mehr atmen, so eng ist es, und weiß doch nur, dass es keine Sicherheit mehr gibt, nirgends.
Niemand wird sie retten, wenn sie es nicht selbst tun.
Küstrin, 15. August 1731
Er ist vorbereitet, endlich. Diesmal wird nichts geschehen, was er nicht berechnet hat. Sie glauben alle, er sei gebrochen, und er will, dass sie es glauben. Allen voran er, der Grund seines Daseins: sein Vater. Wenn Friedrich je wieder frei sein will, dann muss er seinen Vater heute überzeugen.
Inzwischen ist der Käfig, in dem man ihn hält, ein größerer: keine zwei Räume in der Festung mehr, sondern ein Haus, in dem er mit zwei Kammerjunkern und ein paar Dienern lebt. Und den Soldaten, die ihn beaufsichtigen. Die immer noch Instruktion haben, ihn zu töten, wenn er je wieder einen Fluchtversuch unternimmt.
Der 15. August ist der Geburtstag seines Vaters, des Königs. Es ist ein Jahr her, seit sie einander das letzte Mal gesehen haben. Jetzt ist der König nach Küstrin gekommen, um sich endlich persönlich davon zu überzeugen, ob das strikte Regiment, das er zur Umerziehung seines ältesten Sohnes angeordnet hat, den gewünschten Erfolg hatte. Schon am Vorabend ist er eingetroffen, und ganz Küstrin, so schien es, lief zur Festung, um ihn zu sehen: Friedrich Wilhelm, von Gottes Gnaden König in Preußen.
An diesem Morgen haben sich die Küstriner in den Straßen aufgestellt, während Friedrich sich mit den beiden Kammerjunkern, die ihm der Vater zugeteilt hat, auf den Weg zur Festung macht. Er ist dankbar für die Menschen. Sie verdecken zum größten Teil das, was sonst unübersehbar wäre; den gewaltigen Festungswall, dann die innere Mauer, auf der vor fast neun Monaten eine Hinrichtung stattfand. Nicht, dass er sie sehen muss, um daran erinnert zu werden. Er hat seine Lektion gelernt. Nur ist das, was er gelernt hat, nicht notwendigerweise das, was der Vater ihn lehren wollte.
Er trägt keine Soldatenuniform. Dessen, so hat ihn der Vater wissen lassen, ist er noch nicht wieder würdig. Die Kleidung eines einfachen Gefangenen wiederum müsste er nicht mehr tragen – der König hat ihm längst bessere Kleidung gestattet –, doch er tut es, denn der braune Rock ist das Letzte, was ihn noch mit Katte verbindet, der an jenem Tag hingerichtet wurde. Sie trugen ihn beide, damals im November. Den braunen Rock eines preußischen Gefangenen. Wenn er heute den reuigen, gebrochenen Sohn spielt, dann will er, dass der Vater dabei zumindest auf ein Echo seines Opfers blicken muss. Ihrer beider Opfer.
Der König wartet im Arbeitszimmer des Gouverneurs auf ihn. Er hat seine übliche Entourage dabei: Grumbkow, den Kriegsminister, und Oberst Derschau. Außerdem ist General Lepel dabei, der Gouverneur von Küstrin. Sie schauen ihn alle erwartungsvoll an, während der König ihm noch den Rücken zuwendet. Keine Sorge, denkt Friedrich. Ihr bekommt, worauf ihr wartet. Ihr alle.
Der König dreht sich zu ihm um; klein und untersetzt, die Augen argwöhnisch zusammengekniffen, aber ohne den mörderischen Zorn, der vor einem Jahr noch darin loderte.
Jetzt. Jetzt muss es sein. Friedrich lässt sich nicht sinken, er wirft sich dem König zu Füßen. Er spürt den steinernen Boden unter seinem ganzen Körper, während seine Lippen die Stiefel seines Vaters berühren.
Es ist nicht das erste Mal. Doch als der König ihm das letzte Mal vor aller Augen einen Fußkuss abforderte, da hatte in Friedrich noch der Glaube gelebt, dass er seinem Vater entkommen könnte.
»Steht auf«, sagt der König.
Friedrich gehorcht und achtet darauf, es nicht zu schnell zu tun. Dies ist seine letzte Chance; er weiß es wohl.
»Ihr werdet Euch zu besinnen wissen, was nunmehr vor Jahr und Tag passiert ist und wie schändlich Ihr Euch aufgeführt, auch was für ein gottloses Vorhaben Ihr gehabt. Da ich Euch von Jugend an bei mir gehabt und Euch also wohl kennen muss, habe ich alles in der Welt getan mit Guten und Bösen, um Euch zum ehrlichen Mann zu machen.«
Sein Vater spricht Deutsch wie ein Geröll aus Steinen, das übereinanderhagelt, jedes Wort dem vorigen nachschlagend. Er hat verboten, dass irgendjemand mit Friedrich Französisch spricht während dieses langen, langen Jahres. Dass ausgerechnet sein Vater es war, der ihm eine Hugenottin zur ersten Erzieherin gab, die kaum ein Wort Deutsch sprach, ist daher nur eines von vielen Paradoxen ihrer beider Existenz.
»Da ich Euer böses Vorhaben schon argwöhnte, habe ich Euch auf das Härteste traktiert, in Hoffnung, Ihr würdet in Euch gehen und eine andere Verhaltensweise annehmen, mir Eure Fehler offenbaren und um Vergebung bitten, aber alles umsonst, und seid Ihr immer verstockter geworden!«
Ja, Vater. Gewiss, Vater. Kein Künstler, der so von dem Werk seiner Hände enttäuscht ist wie Ihr, mein Vater.
»Wenn ein junger Mensch Dummheiten tut, liederliche Händel anfängt und dergleichen, solches kann man noch als Jugendfehler pardonnieren, aber mit Vorsatz Niederträchtigkeiten und dergleichen garstige Aktion zu tun, das ist unverzeihlich! Ihr habt gemeint, mit Eurem Eigensinne durchzukommen, aber höre, mein Kerl, wenn du auch sechzig und siebzig Jahre alt wärst, so sollst du mir nichts vorschreiben!«
Der Hals seines Vaters ist rot angelaufen. Bald wird die Farbe in sein Gesicht steigen. Also sind wir wieder beim Du, denkt Friedrich. Er sieht, dass ihn Grumbkow und Derschau über die Schultern seines Vaters hinweg aufmerksam mustern. Derschau hasst ihn, daran wird sich nichts mehr ändern, und früher, als er noch der junge Narr gewesen ist, für den sein Vater ihn immer noch hält, da hat auch er Derschau gehasst. Sein neues Selbst hat sich besser im Griff und verschwendet Hass nicht auf Kreaturen wie Derschau. Grumbkow dagegen ist gefährlicher, weil intelligenter, aber Grumbkow hat auch mehr Weitblick. Friedrich hat nicht vergessen, dass es Grumbkow war, der im Herbst des letzten Jahres den vom König befohlenen Einsatz von Folter an ihm verhindert hat mit dem Hinweis, dies sei im Heiligen Römischen Reich gegen Personen königlichen Geblüts nicht gestattet. Grumbkow, dessen Intrigen wesentlich dazu beigetragen hatten, die Kluft zwischen Friedrich und seinem Vater zu vertiefen, hat dies zweifellos nicht aus Menschenfreundlichkeit getan. Nein, Grumbkow muss damals schon zu dem Schluss gekommen sein, dass Friedrich eines Tages doch den Thron besteigen und sich sehr genau erinnern wird, wem er etwas schuldet.
»Und da ich mich bis dato gegen jedermann hab durchsetzen können, da wird es mir auch nicht an Mitteln fehlen, dich zur Räson zu bringen!«
Du hast die Mittel, Vater. Aber du hast sie mittlerweile alle aufgebraucht. Ich hoffe, das Resultat gefällt dir.
Sein Vater schöpft Atem und wird wieder ruhiger. Als er fortfährt, liegt tatsächlich etwas wie Trauer in seiner Stimme. »Warum nur hat Er nicht mehr Vertrauen zu mir gehabt? Hab ich doch alles, was ich zum Ruhm unseres Hauses, der Armee und der Finanzen geschaffen, nur für Ihn getan, wenn Er sich nur würdig gezeigt hätte! Hab ich nicht alles getan, um Seine Freundschaft zu gewinnen? Alles umsonst!«
Damit haben wir nun alle drei Anredeformen, Vater. Es liegt eine gewisse Logik darin. Erst habt Ihr mit dem Kronprinzen gesprochen, und dann mit dem Verbrecher. Jetzt redet Ihr wohl gerade mit Eurem Sohn. Euer Sohn hätte einmal eine Antwort auf diese Frage gehabt, mein Vater, aber Ihr wolltet sie nicht hören. Von mir bekommt Ihr jetzt nur noch ein Schauspiel.
Erneut wirft er sich seinem Vater zu Füßen. Es liegt eine gewisse Lust in dieser völligen Erniedrigung. Noch vor einem Jahr hat er Tränen der Scham vergossen, als sein Vater sie erzwungen hatte. Aber jetzt fühlt er keine Scham mehr. Er hat ein Jahr lang Zeit gehabt, um sich neu zu schaffen. Dabei spürt er jetzt durchaus Tränen in sich aufsteigen, doch es sind Tränen, die er sich gestattet, die er heraufbeschwört. Sie sind Teil des Schauspiels vom reuigen Sohn.
»Steh auf«, sagt sein Vater erneut, und mittlerweile schaut er geradezu unbehaglich drein.
Es ist wohl doch etwas peinlich, mehr Unterwerfung zu bekommen, als man bestellt hat, mein Herr und Schöpfer.
»Hast du nach England gehen wollen?«
Vor einem Jahr hat Friedrich darauf bestanden, nur Frankreich als Ziel gehabt zu haben, nicht England, wo der Bruder seiner Mutter regiert, seines Vaters meistverabscheuter Verwandter. Es ist das letzte Geständnis, das er noch zurückgehalten hat, und er gibt es heute.
»Nun höret die Folgen! Eure Mutter würde in das größte Unglück geraten sein, weil ich sie natürlich verdächtigt haben würde, dass sie über die Sache Bescheid gewusst hat! Eure Schwester hätte ich lebenslang an einen Ort gesetzt, wo sie weder Sonne noch Mond beschienen hätte! In das Hannoversche wäre ich mit meiner Armee gezogen und hätte alles brennen und sengen lassen, sollte ich auch mein Leben, Land und Leute dabei geopfert haben. Seht, das sind die Früchte Eures unbesonnenen und gottlosen Vorhabens!«
Wilhelmine, denkt Friedrich bei den Worten »Eure Schwester«, und etwas Heißes dringt in den Wall aus Eis, den er um sich gebaut hat. Natürlich hat er gewusst, was der Vater mit ihr tun würde, wenn er sie bei ihm zurückließ. Aber es hatte keine Möglichkeit gegeben, sie mitzunehmen. Wenn es etwas gibt, das er bereut und das nichts mit der Hinrichtung seines Freundes im Schatten des Walls zu tun hat, dann dies: dass er sie durch die Flucht verlassen hat. Wie man es dreht und wendet, seine Schwester, die ihn von seinem ersten Atemzug an geliebt hat und die der einzige Mensch ist, den er noch uneingeschränkt lieben kann, hätte er nie verlassen dürfen.
Seit einiger Zeit hat er die offizielle Erlaubnis, ihr wieder zu schreiben, doch ihrer beider Briefe werden natürlich kontrolliert. Es ist ihm auch gelungen, ihr weitere geheime Briefe zukommen zu lassen, doch selbst darin hätte niemand etwas Verbotenes finden können. Aber Briefe sind kein Ersatz für Gegenwart. Er weiß immer noch nicht, ob er sie je wiedersehen wird, denn so, wie der Vater seine Unterwerfung will, wünscht er sie auch von ihr, nur dass die Unterwerfung in Wilhelmines Fall die Form einer Ehe haben wird. Einer Ehe, die sie für immer von Friedrich trennt und überhaupt nicht standesgemäß sein wird.
Der Schmerz, der ihn erfasst, ist echt, nicht geheuchelt. Doch er nimmt ihn und benutzt ihn; lässt sich von ihm erfassen und kann daher mit aufrichtiger Pein in der Stimme sagen: »Mein Vater, stellt mich auf die härtesten Proben, ich will alles tun, alles ausstehen, um die Gnade und Achtung Eurer Majestät wiederzuerlangen!«
In den Augen des Königs liegt immer noch Misstrauen, doch nun auch Hoffnung. Friedrichs Mutter, die Königin, hat einmal über ihren Gemahl gesagt, er sei wie ein Bürgersmann, der sich nichts mehr wünsche, als, angebetet von seiner Familie, seine Pfeife zu rauchen. Es war nicht als Kompliment gemeint. Sie ist die Tochter und Schwester von Königen und empfindet es als ungeheuer erniedrigend, mit dem einzigen Monarchen Europas verheiratet zu sein, der sich am liebsten als erster Bürger seines Staates sieht und daran glaubt, dass Könige für ihren Lebensunterhalt arbeiten, nicht feiern sollten, ganz wie Bürger auch. Aber wehe, wenn man den Fehler begeht, den König als Bürger zu nehmen. Dann entdeckt man, dass er groß gewachsene Kerle entführen lässt, nur um seine Leibgarde aufzustocken, dass er Gerichtsurteile umstößt, die ihm nicht gefallen, um die Todesstrafe für jemanden zu fordern, den seine eigenen Richter nur zur Haft verurteilt haben. Oder er tritt seine Kinder in den Staub.
Doch Friedrich wäre überhaupt nicht in der Lage, seinen Vater so sehr zu hassen, wenn er ihn in vielen Bereichen nicht auch bewunderte. Seinen Vater, der einen ausgeplünderten, hoffnungslos verschuldeten Staat übernommen hatte, in den übrigen deutschen Fürstentümern als »Sandbüchse des Reiches« verspottet, und ihn in eines der wohlhabendsten Länder im Heiligen Römischen Reich verwandelt hat, mit florierendem Handel, Ackerbau und vor allem einer Armee, die den Neid aller anderen deutschen Fürsten weckt. Seinen Vater, der an sich selbst am meisten spart, von morgens bis abends arbeitet, selbst wenn er schwer krank ist, und den gesamten Adel seines Landes von selbstherrlichen Möchtegernfürstchen zu eifrigen Königsdienern umerzogen hat. Seinen Vater, der als erster Herrscher die Schulpflicht für alle eingeführt hat und doch die Lehrer seines ältesten Sohnes verfluchte und hinauswarf, weil sie Friedrich mehr lehrten, als sein Vater für nützlich hielt.
»Vielleicht«, murmelt sein Vater, »vielleicht meinst du es jetzt ehrlich. Hast du Katte verführt, oder hat Katte dich verführt?«
Niemand hat den Namen mehr vor Friedrich ausgesprochen seit dem Morgen, als man ihn hingerichtet hat.
Mein Prinz, ich sterbe für Sie mit tausend Freuden.
»Ich habe ihn verführt«, erwidert Friedrich, ohne zu zögern.
»Es ist mir lieb, dass Ihr einmal die Wahrheit sagt.«
Für Euch tue ich das nicht, mein Vater. Er wäre noch am Leben, wenn ich ihn nicht dazu überredet hätte, mit mir aus Preußen zu fliehen. Das weiß ich so gut wie Ihr. Aber was Ihr nicht wisst, ist dies: Die Schuld wird von mir bezahlt. Ihm, nicht Euch. Ich komme hier heraus, und dann werde ich so leben, dass meine Existenz sein Opfer rechtfertigt. Ich werde nicht nur König sein. Ich werde ein König werden, der alle anderen in den Schatten stellt, und Ihr, mein Vater, an Euch wird man sich nur noch erinnern, weil Ihr mein Erzeuger gewesen seid und der blutige Hammer, der mich dazu formte.
Der Soldatenkönig, der Preußen zu einer einzigen riesigen Kaserne gemacht hat, lehnt gleichzeitig Angriffskriege als gottlos und unverzeihlich ab; sein vor neun Jahren verfasster letzter Wille, der Friedrich gezeigt wurde, beginnt mit einer vehementen Warnung an seine Nachfolger vor drei Dingen: Huren, Theater und Angriffskriegen. Die Heuchelei, die darin liegt, ist offensichtlich. Niemand schafft eine solche Vielzahl an Waffen ohne die Gewissheit, dass sie irgendwann benutzt werden. Und sein Vater ist der Erste, der sich öffentlich über die Gestalt Preußens beschwert, das aus vielen kleinen Teilen ohne gemeinsame Grenze besteht. Er schmeichelt dem Kaiser, hauptsächlich damit er endlich in seinen Ansprüchen auf Jülich und Berg unterstützt wird und sie mit Kleve vereinen kann. Mehr wagt die Phantasie seines Vaters nicht. Doch die Friedrichs tut es. Außerdem glaubt er nicht daran, dass der Kaiser seinem Vater je mehr als leere Versprechungen geben wird. Den söhnelosen Kaiser kümmert es nur, dass die deutschen Fürsten seine Tochter als Erbin akzeptieren werden, dafür verspricht er jedem alles und hält doch nichts, wenn er erst einmal ihre Unterschriften hat.
Warum der König das nicht schon längst begriffen hat, ist Friedrich ein Rätsel.
Sein Verstand hilft ihm, sich in Hohn und Rationalität gleichzeitig zu üben, auch wenn er darauf achtet, weiterhin reuig und erschüttert zu blicken. Es ist nicht alles Schauspiel, leider. Denn er weiß auch, dass keiner der Menschen dort draußen wirklich ihn meint, Friedrich. Sie halten ihn für eine romantische Figur: den Kronprinzen, der von seinem Vater gefangen gehalten wird. Grumbkow sieht jemanden, der ihm noch nützlich sein kann. Selbst seine Mutter – sie liebt ihn zweifellos, doch sie liebt noch mehr eine Zukunft, die sie von ihm erhofft. Es hat nur zwei Menschen gegeben, die ihn bis hin zu seinen größten Fehlern kannten und trotzdem liebten. Einer davon ist tot. Und selbst wenn der König Friedrich wieder freilässt, wird er vorher sicherstellen, dass zwischen ihm und Wilhelmine mehrere Länder liegen werden, für den Rest ihres Lebens.
Die Lektion des Königs steuert endlich auf ihr Ende zu. »Bereust du denn wirklich? Willst du dein Leben ändern?«
Ihr ahnt ja nicht, wie sehr, denkt Friedrich. »Ja, mein Vater.«
»Wenn dir das von Herzen geht, dann wird Jesus, der allen Menschen hilft, dich nicht unerhört lassen. So will auch ich dir vergeben, Fritz.«
Der Name statt des ewigen »Kerl«, »Bursche« oder auch »mein Herr Sohn« bringt etwas fertig, was Friedrich nicht mehr für möglich gehalten hat. Für einen Moment ist er wieder der Junge, der nichts mehr wollte als den Respekt seines Vaters. Dann erinnert er sich wieder daran, wie er nur ein Stockwerk tiefer an einem Fenster stand und hörte, es sei der Befehl seines Vaters, dass er die Exekution des Leutnant Katte zu beobachten habe.
Zum dritten Mal wirft er sich auf den Boden, heißt den harten Stein willkommen, der ihm hilft, sein Gesicht zu verbergen, und küsst die Stiefel seines Vaters.
»Nun, nun«, hört er die Stimme des Königs, und mittlerweile klingt sie geradezu weich. »Steh auf, mein Junge.«
Friedrich erhebt sich. »Heute ist wahrlich ein besonderer Tag«, sagte er. »Ich bin der Beschenkte, denn Ihr gebt mir die Hoffnung wieder. Dabei ist es Eure Majestät, der Geburtstag hat. Darf ich Euch gratulieren?«
Statt einer Antwort umarmt ihn der König, täppisch wie ein Bär. Von Nahem sieht der König, der die vierzig gerade erst überschritten hat, älter aus. Er hat die Wassersucht und ist immer wieder an seinen Rollstuhl gefesselt, wenn es damit besonders schlimm wird. Medizinische Diagnosen gehören nicht zu den Dingen, über die in Küstrin niemand mit Friedrich sprechen darf. Und so hat er sich gründlich über die Krankheit seines Vaters informiert.
Die Männer, die sich mit ihnen im Raum befinden, applaudieren, einige höflich, andere scheinbar aufrichtig gerührt. Als der König anordnet, dass man sich nun gemeinsam dem Volk zeigen könne, und das Studierzimmer des Gouverneurs verlässt, hält Grumbkow Friedrich zurück und murmelt mit gesenkter Stimme: »Eure Hoheit haben meinen Respekt.«
»Das höre ich mit Freude, Euer Exzellenz«, entgegnet Friedrich glatt.
»Ich hoffe, Ihr wisst, dass ich nie zugelassen hätte, dass man Euch hinrichtet. Ich hätte Euch in jedem Fall gerettet.«
Nein, mein lieber Minister, denkt Friedrich. Das hättet Ihr nicht, wenn es wirklich hart auf hart gekommen wäre. Dann hättet Ihr Euch dem kleinen Wilhelm zugewandt. Wenn ich etwas gelernt habe, dann dies: Niemand wird mich retten, wenn ich es nicht selbst tue.
Berlin, 17. August 1749
Sie ist so weit, endlich. Morgen wird ein neues Leben für sie beginnen. Amalie hat alles vorbereitet; die Reisekörbe sind gepackt, sie hat Briefe geschrieben, um sich dem König und der Königinmutter zu erklären, aber ihr Reitknecht hat strikte Order, sie erst in zehn Tagen zu übergeben. Offiziell wird sie nach Bayreuth reisen, um ihre Schwester Wilhelmine zu besuchen.
Ich habe aus Ihrem Fluchtversuch gelernt, mein Bruder, denkt sie, an die Adresse des Königs gerichtet, der erzürnt sein wird, da ist sie sicher, aber vielleicht auch ein wenig neidisch, denn tut sie gerade nicht das, was er sich einst vorgenommen hatte, damals, als Kronprinz? In jedem Fall wird er bald darüber hinweg sein. Sie ist die jüngste seiner Schwestern, die einzige, die noch unverheiratet ist und damit nur ein Quell ständiger Ausgaben für die Staatskasse. Hier in Berlin erfüllt ihr Leben keinen Sinn. Ihr verstorbener Vater, der alte König, hatte einst geseufzt, er habe viel zu viele Töchter und hätte ein paar wie die Katzen ersäufen sollen.
In London dagegen, da wird alles anders sein. Amalie wird dort nicht als überzählige Prinzessin erscheinen, oh nein. Und nicht allein. Sie wird ein erfülltes Dasein haben, ganz der Kunst gewidmet, mit dem liebsten Wesen der Welt an ihrer Seite, das sich ihr anvertraut hat.
Das glaubt sie, bis sich kurz nach dem abendlichen Souper der Geheime Kämmerer Fredersdorf bei ihr anmelden lässt. Sofort ist sie auf der Hut, denn für einen solchen Besuch gibt es keinen nachvollziehbaren Grund. Fredersdorf hat als einfacher Soldat und Kammerdiener ihres Bruders während dessen Gefangenschaft in Küstrin angefangen und ist inzwischen zu einem seiner wichtigsten Vertrauten avanciert. Zu seinen vielen Aufgaben gehört auch die Verwaltung der königlichen Börse, und nur in dieser Funktion hat Amalie gelegentlich mit ihm zu tun gehabt, wenn sie um eine Begleichung ihrer Schulden bat. Fredersdorf macht ihr keine gesellschaftlichen Besuche.
Sie könnte durch ihre Zofe ausrichten lassen, die Prinzessin Amalie habe sich bereits für die Nacht zurückgezogen, aber dann spricht er am Ende morgen früh vor und verzögert bestimmt ihre Abreise. Nein, besser, sie findet gleich heraus, was er will. Oder was der König von ihr will, denn im Grunde ist Fredersdorf doch immer nur der verlängerte Arm ihres ältesten Bruders.
Nachdem er das Vorzimmer ihrer kleinen Zimmerflucht im Berliner Stadtpalast betreten hat, begrüßt er sie mit tadelloser Höflichkeit und findet einen Grund, ihre Zofe fortzuschicken. Es sagt einiges über seinen Status aus, dass ihm widerspruchslos gehorcht wird, ohne Rückfrage bei Amalie. Mittlerweile ist sie zwischen Beunruhigung und Neugier hin- und hergerissen. Wäre Fredersdorf ein Adliger, wäre es für Amalie als unverheiratetes weibliches Mitglied der königlichen Familie undenkbar, mit ihm alleine in einem Zimmer zu sein, aber für ein Mitglied der Dienerschaft – und Fredersdorf hat nie aufgehört, der Kammerdiener ihres Bruders zu sein – gelten andere Regeln.
Erst als sich die Zofe mit Sicherheit außer Hörweite befindet, beendet Fredersdorf die belanglose Konversation und fragt nicht unfreundlich, aber sehr ernst: »Ist es richtig, dass Königliche Hoheit die Absicht haben, nicht nach Bayreuth, sondern in Begleitung der Tänzerin Barbarina nach London zu reisen?«
Ihr erster Instinkt ist, alles zu leugnen. Doch eine weitere von Fredersdorfs Aufgaben, so munkelt man wenigstens, besteht darin, das Spionagenetz für den König zu dirigieren, und die Verträge für alle Musiker, Schauspieler und Tänzer der königlichen Oper handelt er obendrein noch aus. Am Ende hat eine von Barbarinas eifersüchtigen Rivalinnen geplaudert. Amalie sammelt sich und beschließt, auf Angriff zu setzen. Sie versucht, so hochmütig und unnahbar wie möglich zu sprechen. »Und wenn es so wäre? Der Barbarina stehen fünf Monate Urlaub aus Berlin im Jahr vertraglich zu. Was mich betrifft, so habe ich Seiner Majestät eine Erklärung meiner Absichten hinterlassen. Wenn er sie nicht mit Ihm geteilt hat, wird das wohl seine Gründe haben. Ich wüsste nicht, dass ich Ihm Rechenschaft schulde, Fredersdorf.«
»Kein Mitglied der königlichen Familie darf ohne Genehmigung des Königs das Land verlassen, Königliche Hoheit, und Ihr verfügt über keine solche Genehmigung, denn sonst hättet Ihr es nicht nötig gehabt, eine zu fälschen«, entgegnet Fredersdorf, immer noch ruhig und ohne jede Hast. »Und nicht nur für Euch selbst. Ihr wart es, die eine Reiseerlaubnis für die Barbarina fabriziert hat, und das war kein guter Gedanke.«
Nun packt Amalie die Angst, und nicht um sich selbst. Barbara Campanini, die unter dem Künstlernamen »la Barbarina« bekannt ist, ist nicht irgendjemand, sondern die berühmteste Balletttänzerin Europas. Sie wurde bereits einmal gewaltsam nach Preußen geholt, vor fünf Jahren, als sie erst einen Vertrag für die Berliner Hofoper unterzeichnet und es sich dann anders überlegt hatte und stattdessen nach Venedig gereist war. Es ist sowohl Fredersdorf als auch Friedrich zuzutrauen, sie schon wieder gegen ihren Willen an einem Ort festzuhalten. Allein der Gedanke ist Amalie unerträglich. »Die Barbarina ist keine preußische Staatsangehörige, und sie hat das Recht darauf, das Land zu verlassen. Sie ist frei wie ein Vogel. Wenn mein Bruder wirklich als König der Künste und nicht als ein Tyrann wie unser Herr Vater dastehen will, dann darf er ihr die Flügel nicht stutzen!«
»Königliche Hoheit«, sagt Fredersdorf, »die Barbarina hat das Land bereits verlassen. Deswegen weiß ich ja über die gefälschte Reiseerlaubnis Bescheid. Sie hat heute in aller Frühe bereits unsere Grenzen passiert.«
Vor zwei Jahren ist eine Dachlawine über Amalie heruntergestürzt. Die plötzliche Kälte, der Schock, das Gewicht des Schnees, das drohte, sie in die Knie zu zwingen, die Benommenheit, all das empfindet sie auch jetzt. »Das kann nicht sein«, entgegnet sie. »Das … das kann nicht sein. Wir … wir wollten doch gemeinsam …«
Sie bricht ab. Eine List, es muss sich um eine List Fredersdorfs handeln, auf die sie gerade hereingefallen ist. Eine Lüge, ganz einfach. Barbara würde niemals ohne sie reisen. »Amélie, meine Prinzessin, meine Liebste«, hörte sie die warme Altstimme raunen, und: »Sind wir erst in London, dann werde ich nur noch zu Ihrer Musik tanzen.«
»Er lügt, Fredersdorf«, stößt Amalie hervor, aber es entgeht ihr nicht, dass sein Gesichtsausdruck weder hämisch noch triumphierend, sondern eher mitleidig wirkt.
»Ich fürchte, das ist immer noch nicht alles«, sagt er. »Die Barbarina ist die bestbezahlte Künstlerin des Landes, und nur ganz wenige Generäle können sich mit ihrem Einkommen messen. Aber bei siebentausend Reichstalern im Jahr und noch weiteren Vergütungen hat Seine Majestät seinerseits das Recht, zu erwarten, dass die Vertragsbedingungen eingehalten werden. Was auch bedeutet, dass sie während der Zeit ihres Engagements hier nicht heiraten darf. Schließlich würde eine Schwangerschaft sie wenigstens ein Jahr von der Bühne fernhalten. Das weiß sie. Dennoch hat sie einen Heiratsantrag akzeptiert, den ihr der Sohn unseres Großkanzlers Cocceji gemacht hat. Das, Königliche Hoheit, ist der wahre Grund, warum sie gerade jetzt nach London gehen wollte, mit den Papieren, die Ihr ihr verschafft habt, und dem Bräutigam, von dem Ihr, wie ich annehme, nichts wusstet.«
»Er lügt«, wiederholt Amalie, doch sie glaubt es schon nicht mehr. Der Sohn des Großkanzlers ist ein gut aussehender Mann, und er hat Barbara in den letzten Monaten Blumen und Juwelen zuhauf geschickt. Gewiss, Barbara hat in Amalies Gegenwart darüber gelacht und Amalie daran erinnert, dass ihr bereits Herzöge und Prinzen zu Füßen gelegen hätten, aber zurückgesandt hat sie Blumen und Schmuck nie. »Keine Sorge, meine Prinzessin, von Ihnen will ich keine Juwelen. Komponieren Sie mir lieber etwas, wozu ich tanzen kann. Aber wenn wir erst in London sind, dann wird es gut sein, für die erste Zeit Rücklagen zu haben, und Geschmeide lässt sich nun einmal leichter mitnehmen als Geldsäcke …«
Natürlich war es nach dieser Äußerung für Amalie Ehrensache, Barbara selbst mit Diademen und Ringen zu überhäufen.
»Es tut mir leid«, sagte Fredersdorf, und das Schlimmste ist, dass er es ganz offensichtlich auch so meint.
»Es steht Ihm nicht zu, mich zu bemitleiden«, gibt Amalie scharf zurück. Sie will kein Mitgefühl, sie will Feindseligkeit; damit kann sie umgehen. Sie will einen Streit, um sich nicht der Erkenntnis stellen zu müssen, dass Barbara, ihre Barbarina, am Ende nie etwas anderes in ihr gesehen hat als eine weitere Patronin, jemand, den man so lange wie möglich ausnutzen und dann verlassen kann.
Amalie dagegen hat in ihr alles gesehen, von dem sie je geträumt hatte. Eine Frau, der es gelungen war, Europa durch ihr Talent zu erobern. Eine Frau, die in einer von Männern bestimmten Welt keinem Einzigen von ihnen gehörte. Eine Frau, die nicht wie Amalie dazu geboren ist, zum Wohl des Staates und der Dynastie vermählt zu werden, sondern ihre Bestimmung selbst gewählt hat. Niemand in Amalies gesamten Leben kommt Barbarina gleich.
»Das mag wohl sein«, meint Fredersdorf. »Aber gestattet mir eine Beobachtung und einen Rat. Alle Balletttänzerinnen und Balletttänzer, die sich den dreißig nähern, wissen, dass sie sich zur Ruhe setzen sollten, ganz gleich, wie sehr die Welt von ihnen schwärmt, denn ihre Kunst ist von einer Art, die mit den Jahren leider immer schwerer wird. Eine Ehe ist für eine Frau nun einmal die sicherste Art eines solchen Ruhestandes und eine Ehe mit einem Mann von Adel die beste Partie, die eine Frau aus dem Bürgertum erhoffen kann. Das hat alles nichts mit Liebe zu tun, sondern mit dem gesunden Menschenverstand, Hoheit.«
Ein Teil von ihr hört ihn und versteht. Aber ihr Herz protestiert und wünscht sich gerade nichts so sehr, wie laut schreien zu können. Doch Amalie ist als Tochter des Soldatenkönigs aufgewachsen und hat früh gelernt, dass immer nur der brüllt, der die größte Macht am Hof hat, und das ist niemals sie, die überflüssige fünfte Tochter.
»Und Sein Rat?«, fragt sie tonlos. Seltsamerweise ist ihr nicht nach Tränen. Ihre Zukunft, die einzige Zukunft, von der sie geträumt, auf die sie alles gesetzt hat, sie wird ihr gerade genommen, schlimmer noch, sie muss erfahren, dass es diese Zukunft nie gegeben hat, dass alles nur eine Lüge war. Warum nur fehlen ihr da die Tränen?
»Niemand, auch die Barbarina nicht, ist unersetzlich. Das Leben spielt uns allen, gleich welchen Standes, manchmal böse mit. Aber es führt uns auch immer wieder neue Menschen zu, wenn wir nur die Augen öffnen, um sie zu sehen. Ich werde mich um eine neue Tänzerin für die königliche Oper bemühen, und Euch, Hoheit, wünsche ich, dass Ihr jemanden findet, der das Privileg Eurer Freundschaft zu schätzen weiß. Hört nicht auf zu suchen, das ist alles, was ich Euch rate.«
Freundschaft, denkt Amalie. Sie ist nicht nur eine Freundin für mich. Sie ist die Musik selbst.Klang, der zum Körper geworden ist.
Mit Barbara hat sich eine neue Welt eröffnet, eine Welt voller Berührungen, Umarmungen, eine Welt mit Streicheln, Liebkosen, Küssen. Alles, was Amalie Musik bedeutet, hat durch Barbara eine neue Form gefunden, Form und Erkenntnis zugleich. Unglück oder Glück, Angst oder Freude, Amalie hat stets Musik benutzt, und nur Musik, um ihren Gefühlen Ausdruck zu verleihen. Doch vor Barbara hatte sie sich allein darin gefühlt. Seit Barbara in ihr Leben getreten ist, hat sie ein Gegenüber gefunden, und sich in Ekstase zu spielen bedeutet ihr nun etwas völlig anderes.
Sie weiß noch den Tag, die Stunde, ja, sogar den genauen Sonneneinfall, als sie zum ersten Mal vor Barbara spielte. Zuerst ließ Barbara ihr Gesicht sprechen, wenn Amalie musizierte, drückte auf eine wundersame Weise genau das mit ihrer lebhaften Mimik aus, was Amalie auch empfand. Dann übernahm Barbaras Körper die Schwingungen der Musik, und alles an ihr, Kopf, Torso, Arme, Beine, folgte diesem Rhythmus. Irgendwann trug Barbara weniger und weniger Kleidung, wenn sie zu Amalies Musik tanzte. Ihr Körper, der eine Harmonie von Muskeln darstellt, wie sie sich Amalie früher bei einer Frau nie hat vorstellen können, verzauberte sie und löste Sehnsüchte aus, die Barbara durch ihren Tanz und nach ihrem Tanz stillte. Aus ihren Umarmungen wurden leidenschaftliche Symphonien.
Durch Barbara ist sie zu der Überzeugung gekommen, selbst komponieren zu können, hat es gewagt, nicht nur ein paar Noten für höflich applaudierende Verwandte zu entwerfen, sondern sich zum Ziel gesetzt, Musik zu schreiben, die vor einem fremden Publikum bestehen kann. Sie haben es gemeinsam versucht, und Barbara hat geschworen, auch ihr Tanz habe sich durch Amalie verändert, sei ausdrucksstärker geworden. So ist der Plan entstanden, Amalies Plan, das Unmögliche durch eine Flucht möglich werden zu lassen. Und jetzt? Was ist noch alles gelogen von dem, was Barbara ihr gesagt hat? Vielleicht kann Barbara Liebe heucheln, aber in der Musik ist es unmöglich, zu lügen, daran glaubt Amalie, daran klammert sie sich mit allem, was sie hat.
Musik ist für sie kein höfischer Zeitvertreib. Sie hat bereits begonnen, auf dem Cembalo ihrer älteren Schwester Ulrike zu spielen, ehe sie das Buchstabieren beherrschte. Doch vor Barbara hätte sie nie gewagt, sich vorzustellen, dass sie ihr Dasein als bloßes Ornament des preußischen Hofes hinter sich lassen und versuchen könnte, als Musikerin zu leben.
Zu Lebzeiten ihres Vaters fanden regelmäßig Jagdpartien bei Hof statt, denn der verstorbene Soldatenkönig war ein begeisterter Jäger, ganz im Gegensatz zu seinem Nachfolger, Amalies ältestem Bruder. Sie erinnert sich, wie das erlegte Wild präsentiert wurde: wie der Hirsch geöffnet wurde, um ihm das Herz zu entnehmen. Nun stellt sie sich vor, in sich selbst hineinzugreifen, um es herauszunehmen, das störrische Organ. Wozu braucht sie es noch? Sie will nie wieder so empfinden, wie sie es gerade jetzt tut.
Suchen? Sich noch einmal so verwundbar machen? Den Teufel wird sie tun. Im Gegenteil. Ihr Vater, ihr Bruder, sie haben es doch vorgemacht: Es lebt sich besser, wenn die Menschen einen fürchten. Sie kann keine Armeen führen, aber sich in jemanden verwandeln, der gefürchtet wird, das kann sie.
»Ich danke Ihm. Er kann gehen«, sagt Amalie. Dann, verspätet, fällt ihr ein, dass sie etwas Wesentliches noch nicht weiß. »Seine Majestät …«
»Seine Majestät wird von mir selbstverständlich über die Flucht der Barbarina nach London in Kenntnis gesetzt«, entgegnet Fredersdorf. »Auch über den Antrag des Sohnes des Großkanzlers. Mehr allerdings, denke ich, ist seiner Aufmerksamkeit nicht wert.« Er verbeugt sich vor ihr. »Gute Nacht, Königliche Hoheit.«
Als ihre Zofe endlich zurückkehrt, ist Fredersdorf schon eine ganze Weile fort, und Amalie ist sich immer noch nicht sicher, warum er ihr gerade geholfen hat und ob es nun Hilfe war oder Zerstörung. Auf jeden Fall wird es sich nicht wiederholen. Sie wird es nicht zulassen, jemals wieder Hilfe zu benötigen, und sie wird dafür sorgen, dass es nichts mehr in ihr gibt, was man zerstören kann.
Niemand wird ihr helfen, wenn sie es nicht selbst tut.
I. Vorkrieg
Berlin, Januar 1756
Er wachte auf, einen metallischen Geschmack im Mund, und entdeckte, dass er sich zusammengekauert hatte, Arme und Knie angezogen. Seltsam. Es musste der alte Traum gewesen sein, der, den er seit Jahren nicht gehabt hatte.
Jemand knurrte unwillig neben ihm, als Heinrich sich streckte und dabei das Bettlaken von sich stieß. Ehe er vollends in die Gegenwart zurückkehrte, dachte er noch, schlaftrunken wie er war: Wilhelm? Doch sein Bruder Wilhelm, der wahrscheinlich die Nacht genauso wenig allein verbracht hatte wie er selbst, war nicht hier. Die Kindheit, in der sie ein Zimmer und gelegentlich das Bett geteilt hatten, lag nicht nur Jahre, sondern nun schon mehr als ein Jahrzehnt zurück.
Das Licht, das ihm zwischen die Augenlider drang, war noch dämmrig, als sei die Sonne erst im Begriff, aufzugehen. So spät konnte es in der letzten Nacht also nicht geworden sein, wenn er jetzt schon wach wurde. Doch der Karneval begann in Berlin bereits im Dezember und hatte noch längst nicht seinen Höhepunkt erreicht. Im Januar tanzte man von einem Fest in das nächste.
»Henri, es ist doch noch mitten in der Nacht, komm zurück ins Bett«, protestierte sein Liebhaber, als er aufstand, und Heinrich musste lächeln. Manchmal merkte man sehr, dass Kalckreuth fast zehn Jahre jünger war.
»Heute ist mein Geburtstag«, sagte er. »Es werden bald die ersten Gratulanten da sein.«
Ehre, wem Ehre gebührte: Mehr musste er nicht sagen. Kalckreuth wurde schlagartig wach und sprang aus dem Bett. Bei aller Freiheit, die Heinrich seit seiner Eheschließung vom König zugestanden wurde, gab es Dinge, die zu weit gingen, und unangekleidet im Bett mit einem jungen Offizier vom Regiment der Garde du Corps angetroffen zu werden, gehörte dazu. Kalckreuth kleidete sich mit der Schnelligkeit eines Mannes an, der wie Heinrich selbst von Kindheit an zum Soldaten erzogen worden war.
»Der erste Gratulant bin ich«, sagte er dabei. »Meinen Glückwunsch, Königliche Hoheit.« Er zog sich das Hemd über und grinste. »Und das erste Geschenk war ich wohl auch. Auf jeden Fall das beste.«
»An Selbstvertrauen hat es dir noch nie gemangelt«, konstatierte Heinrich und wartete noch einen Moment, ehe er Kalckreuths Grinsen erwiderte.
Kalckreuth trug bereits wieder sein Kostüm vom gestrigen Abend, als er fragte: »Ich bin doch auch zum Empfang für den britischen Gesandten eingeladen, oder?«
»Selbstverständlich«, entgegnete Heinrich leicht irritiert.
»Danke, mein Prinz«, sagte Kalckreuth ein wenig heiser, trat noch näher und murmelte: »Sonst hätte ich mir nämlich die schottische Kluft ganz umsonst schneidern lassen.« Er zwinkerte Heinrich zu, trat zurück, verbeugte sich und verließ den Raum durch den kleinen Dienstboteneingang.
An der Tür seines Schlafgemachs konnte Heinrich das diskrete Klopfen seines Kammerdieners hören. »Königliche Hoheit?«
Dreißig Jahre, dachte er. Heute werde ich dreißig Jahre. Wenn ich nie geboren worden wäre, würde es keinen Unterschied für die Welt machen.
Der britische Gesandte war der einzige Diplomat, für den heute ein Empfang stattfand, und dass dem so war, beunruhigte Heinrich. Für den Gesandten Frankreichs gab es nur eine Audienz. Frankreich und Preußen waren Verbündete, gewiss, aber Verbündete sollte man nicht für selbstverständlich nehmen, gerade jetzt, wo der Vertrag mit Frankreich auslief und erneuert werden musste.
Da die Audienz gleich nach dem Frühstück stattfinden würde, tat Heinrich, was er sonst vermied: Er suchte seine Gemahlin auf, die wie er die Wintermonate im Berliner Stadtschloss verbrachte, denn der König hatte erst vor Kurzem ein weiteres Mal klargemacht, dass ein getrennter Haushalt nicht infrage kam und Heinrich bei offiziellen Anlässen mit seiner Gattin zu erscheinen habe.
»Guten Morgen, Madame.«
»Ich wünsche Ihnen alles Gute zum Geburtstag, Henri.«
Sie war, stellte Heinrich ein weiteres Mal leidenschaftslos fest, eine Frau, die es durchaus verdiente, dass man sie in Berlin »die schöne Fee« nannte: Selbst zur Morgenstunde war sie elegant gekleidet, mit Veilchenaugen und einem makellosem Teint, die Prinzessin von Hessen-Kassel, die von Wilhelm und Ferdinand, die beide für sie schwärmten, seit ihrer Heirat mit Heinrich den Spitznamen »Melusine« erhalten hatte. Dreieinhalb Jahre lag das jetzt zurück, und für ihn war es nicht leichter geworden, sich mit ihrer Existenz abzufinden. Es lag nicht an ihrer Person; es lag an dem, was sie seit dem Moment für Heinrich verkörperte, als der König diese Ehe als Symbol von Heinrichs Unterwerfung verlangte.
Er dankte ihr für die Glückwünsche und bat sie, ihn zum König zu begleiten.
»Jetzt schon? Wird denn Seine Majestät nicht noch ruhen wollen? Immerhin war er gestern Abend in der Oper.«
»Oh, er ist nicht nur wach, er arbeitet, wie immer im Winter, ab fünf Uhr bereits«, entgegnete Heinrich trocken. »Die Welt würde aus den Fugen geraten, wenn er sie nicht schon vor dem Frühstück herumkommandieren könnte.«
Melusine tat, als hätte sie das nicht gehört. Sie mochte nicht in das Haus Brandenburg hineingeboren sein, aber das Gebot, dass man den König in Preußen nicht kritisierte, das befolgte sie viel effizienter als seine Geschwister.
Da der König nur in den Wintermonaten in Berlin lebte und sonst in Potsdam residierte, wenn er nicht gerade Festungen besuchte, Militärrevuen abnahm oder durch sein Land reiste, waren Heinrich und Melusine nicht die einzigen Besucher, die sich danach drängten, bereits zum königlichen Frühstück zugelassen zu werden, Karneval hin oder her, immer in der Hoffnung, eine Petition loszuwerden. Im Vorzimmer erkannte er eine Menge übernächtigter Gestalten, darunter auch einen seiner besten Freunde.
»Lehndorff«, rief Heinrich und winkte ihn zu sich. Der Kammerherr der Königin, den ein reisewütiger Vorfahr mit dem Vornamen Ahasverus verflucht hatte, war nur ein Jahr jünger als Heinrich, aber ein solcher Berufsoptimist, dass es durchaus auch zehn Jahre hätten sein können. Seine bloße Existenz war gegen alle Wahrscheinlichkeit: Er war nach dem Tod seines Vaters geboren, bereits als Kleinkind von einer Amme so unglücklich fallen gelassen worden, dass sein rechter Fuß lebenslang verwachsen blieb, hatte die zahlreichen Versuche seiner Mutter, diesen Makel zu korrigieren, überlebt, ohne sie dafür zu verabscheuen, und brachte den meisten Menschen eine Freundlichkeit entgegen, die einen schier glauben lassen konnte, die Welt sei immer und überall ein wunderbarer Ort. Obwohl er zweifellos ebenfalls nur wenige Stunden Schlaf hinter sich hatte, strahlte er jetzt, während er leicht hinkend auf Heinrich und Melusine zukam.
»Königliche Hoheit«, sagte er, küsste Melusine pflichtbewusst die Hand und sagte zu Heinrich: »Ich hoffe, Sie sind am Abend geboren, mein Prinz, denn ich habe eine Überraschung für Sie vorbereitet, die ich leider vorher nicht Wirklichkeit werden lassen kann. Deswegen auch noch kein Glückwunsch von mir. Sie wissen ja, frühzeitig gratulieren bringt Unglück.«
Bei Kalckreuth hätte das wie Koketterie geklungen. Aber Lehndorff war nicht rücksichtslos genug, um in Gegenwart von Melusine anzüglich zu sein; es verstieß gegen sein Verständnis von Courtoisie gegenüber den Damen. Wahrscheinlich hatte er ein Festmahl vorbereitet oder Musikanten engagiert, die vor dem Abend nicht frei wurden.
Heinrich ertappte sich dabei, wie er lächelte. »Dann unter uns Neunundzwanzigjährigen gesprochen«, erwiderte er. »Was führt Sie so früh hierher, mein Lieber? Wenn es eine Petition an den König ist, dann kann ich sie mitnehmen.«
Eine merkwürdige Mischung aus Hoffnung, Verlegenheit und etwas, das fast wie Furcht aussah, glitt über Lehndorffs Miene, bis nur noch die Hoffnung blieb. »Zu gütig, mein Prinz. Ich habe in der Tat eine Petition für Seine Majestät.«
Heinrich nahm den Brief entgegen, den Lehndorff aus seiner Weste zog. Lehndorff hielt ihn noch einen Moment länger fest, als überlege er es sich in letzter Minute anders, dann übergab er ihn. Unter anderen Umständen hätte sich Heinrich gefragt, was in der Petition stand, doch Lehndorff hatte seit Jahren immer nur ein und dasselbe Anliegen, also konnte er es sich vorstellen. Lehndorff war mit neunzehn Jahren an den preußischen Hof gekommen und hatte geglaubt, zum Kammerherrn der Königin ernannt zu werden sei gewiss der Beginn einer großen Karriere. Niemand hatte ihm vorher verraten, dass der König von dem Moment seiner Thronbesteigung an aufgehört hatte, mit der Königin zusammenzuleben, nur selten im Jahr gemeinsame Verpflichtungen mit ihr wahrnahm und im Übrigen nichts mehr von ihr wünschte, als nicht mit ihrer Existenz behelligt zu werden. Den größten Teil des Jahres residierte die Königin in Schönhausen, der König in Sanssouci, und ein Amt, das Lehndorff verpflichtete, seine Zeit in erster Linie der Königin zu widmen, war die Garantie dafür, vom König nie bemerkt zu werden. Seit Jahren versuchte er deshalb, ein anderes Amt zu erlangen.
»Dann bis später, mein Freund«, sagte Heinrich, bot seiner Gemahlin den Arm und ließ sich bei seinem Bruder anmelden.
Wie von Heinrich erwartet, hatte der König bereits mit seinem Arbeitsalltag begonnen, obwohl Kaffee, Quitten und Gebäck gerade erst aufgetischt wurden. Neben ihm lag ein Dokumentenstapel. Außer den Pagen und Lakaien war auch einer seiner neueren Leibgardisten anwesend, der ihm gerade Kaffee einschenkte und den König mit einem lauten Flüstern auf die Gegenwart von »Prinz und Prinzessin Heinrich« aufmerksam machte, als wären sie nicht gerade erst laut angekündigt worden.
»Ah«, sagte der König. »Unser Geburtstagskind.«
Er schaute auf, und ihre Blicke trafen sich. Friedrich war vierzehn Jahre älter, und Heinrich hatte einen Teil seiner Jugend damit verbracht, sich wie ein Zerrspiegel des Königs zu fühlen. Friedrich war nur mittelgroß, Heinrich war klein; Friedrich hatte große dunkelblaue Augen; die Heinrichs waren heller, an manchen Tagen nur von einem verwaschenen Grau. Friedrich hatte als Junge die Pocken durchlebt, doch keine Narben zurückbehalten; Heinrichs Pockennarben waren unübersehbar. Beide hatten sie die lang gezogene Nase und das Kinn ihrer Mutter, was sich seltsam in der runden, vom Vater ererbten Gesichtsform ausnahm.
»Sire«, sagte er, während Melusine neben ihm knickste.
Der König machte ihr ein nichtssagendes Kompliment und bedeutete ihnen, sich zu ihm zu setzen. »Drei Jahrzehnte Henri«, sagte er aufgeräumt. »Wie haben wir das nur alle überlebt? Kaffee?«
Selbst Melusine machte bei dem Angebot unwillkürlich ein bestürztes Gesicht, ehe sie sich wieder fing. Der König war berüchtigt dafür, seinen Kaffee versetzt mit Senfkörnern zu trinken, ganz gleich, wie sehr ihm die Ärzte davon abrieten. Heinrichs Gemahlin lehnte höflich ab.
»Gerne«, gab Heinrich zurück und bereitete sich innerlich auf das grässliche Gebräu vor. Er sollte inzwischen wirklich darüber hinaus sein, aber es war ihm immer noch unmöglich, eine Herausforderung seines ältesten Bruders abzulehnen, und sei sie noch so subtil. Die Mundwinkel des Königs zuckten, während er mit den Fingern schnipste und einem der Pagen bedeutete, Heinrich einzuschenken.
Es schmeckte ganz genauso entsetzlich wie immer, doch Heinrich trank die kleine Porzellantasse aus der neuen Wegely’schen Porzellanmanufaktur schweigend aus, ohne den Blick von Friedrich zu wenden, während seine Gemahlin sich nun ihrerseits in nichtssagenden Komplimenten erging und schließlich damit endete, zu fragen, ob man in diesem Jahr wieder auf ein Werk des Königs hoffen dürfe, nachdem alles noch immer von Montezuma sprach, der von Graun komponierten Oper, für die der König das Libretto geschrieben hatte.
»Nun, ich habe Voltaires Mérope zu einem Libretto für Graun umgeschrieben, doch was eigene Werke betrifft, da, glaube ich, halte ich mich in diesem Jahr mehr an das Welttheater«, entgegnete Friedrich. Das war der Ansatzpunkt, auf den Heinrich gehofft hatte.
»Ein Chorus für dieses Stück ist bereits vorhanden«, warf er ein. »Sire, die Gerüchte in Sachen Frankreich und England sind lauter als Hornissenschwärme. Darf ich hoffen, dass sie verstummen werden, wenn Sie den Vertrag mit Frankreich erneuern?«
Friedrich zog eine Augenbraue hoch. »Hoffnung steht jedem frei, kleiner Bruder.«
Ich habe es gewusst, dachte Heinrich. Er will tatsächlich ein Glücksspiel mit den Allianzen treiben.
Es mochte an dem entsetzlichen Kaffee liegen, aber er fühlte sich, als rinne eine Mischung aus Feuer und Eis durch seine Adern.
»Sire, Frankreich ist unser wichtigster Verbündeter«, sagte er so gelassen wie möglich.
»Bisher«, gab sein Bruder kühl zurück, »ist Frankreich, nun, sagen wir, ein wichtiger Verbündeter, während wir für Frankreich ständig die Kartoffeln aus dem Feuer picken mussten, wenn es gemeinsam gegen die Österreicher ging. Niemand schätzt die Franzosen und ihre Kunst mehr als ich, Henri, doch Tatsache bleibt, dass sie nicht mehr im Zeitalter des Sonnenkönigs leben. Schauen Sie sich und Ihre bezaubernde Frau doch an. Von Kopf bis Fuß in französische Mode gekleidet, und auch die Düfte, die Sie umschweben, stammen aus Frankreich. Dort wird nur noch in Spitzen, Seide und Gobelins investiert, während England seine Flotte ausbaut. Das heutige Frankreich wird von einem Unterrock regiert. Man kann ein Land, in dem eine Pompadour das Sagen hat, nicht auf die gleiche Weise ernst nehmen. Kein Wunder, dass die Engländer ihnen in Kanada auf den Pelz rücken.«
Er kann sich nicht völlig sicher sein, dachte Heinrich. Sonst hätte er einfach erklärt, »davon verstehen Sie nichts, mein Bruder«, und mich hinausgeworfen. Er sammelte sich kurz, dann zitierte er aus dem Gedächtnis. »Man sagt, und dies wird ohne viel Nachdenken wiederholt, dass Verträge alle nutzlos sind. Punkte der Abmachung werden fast nie geehrt, und die Fürsten sind in diesem Jahrhundert nicht gewissenhafter als in jedem anderen. Ich antworte denen, die so denken: Ich bezweifle nicht, dass sie unter den lebenden und toten Fürsten genügend Beispiele finden, die ihre Verpflichtungen nicht genau erfüllt haben. Dies ändert jedoch nichts an der Tatsache, dass es immer sehr vorteilhaft ist, Verträge abzuschließen. Verbündete, die man sich schafft, können genauso gut zu Feinden wie zu Helfern werden, aber man kann eine eigene Verpflichtung immer zu einer strikten Neutralität reduzieren.«
Schon zu Beginn des zweiten Satzes wusste Heinrich, dass Friedrich sein Zitat erkannt hatte. Schon allein dafür hatte es sich gelohnt, den Antimachiavell gelesen zu haben, jenes Werk, das sein Bruder kurz vor seiner Thronbesteigung veröffentlicht und in dem er eine prinzipientreue Herrschaft befürwortet hatte, nur ein paar Monate, ehe er in Schlesien einmarschierte.
»Ich wusste gar nicht, dass Sie so ein eifriger Leser meines Frühwerks sind, Henri«, bemerkte der König und ließ sich selbst Kaffee nachschenken. »In der internationalen Politik geht es nie um Recht oder Unrecht, sondern um die Interessen von Staaten, das sollten Sie sich merken. Im Übrigen sehe ich hier keinen Widerspruch zu meinen jugendlichen Äußerungen. Neutralität ist genau das, was ich für Preußen anstrebe. Wir werden das Zünglein an der Waage sein, zwischen Frankreich und England vermitteln, weil keiner der beiden ohne uns sein kann. Wem sollen sich die Franzosen sonst an den Hals werfen, etwa den Österreichern?« Er lachte. »Die Bourbonen und die Habsburger sind seit zweihundert Jahren Todfeinde. Wenn die Gebärmaschine in Wien jemanden noch mehr verabscheut als mich, dann zweifellos die Franzosen.«
Es war ein ehrgeiziger Plan, und Heinrich gab innerlich zu, dass er etwas Grandioses, Kühnes hatte, wie das meiste, was sein Bruder bewerkstelligte. Preußen war auch nach der Eroberung Schlesiens nur einer von mehreren deutschen Staaten. Frankreich und England dagegen beherrschten weite Teile der Welt auch jenseits der Meere. Sich solchen Großmächten als Vermittler und Verbündeter unentbehrlich zu machen, ihnen dadurch Ebenbürtigkeit aufzuzwingen, das war ein großes Ziel. Aber er glaubte nicht, dass Friedrich es durch ein Bündnis mit England zu diesem Zeitpunkt erreichen konnte, und den Preis für ein Scheitern würde nicht nur sein Bruder zahlen, sondern auch Preußen.
»Aber vielleicht bedauern Sie nur, dass Sie nicht die Chance haben werden, Krieg gegen England zu führen«, setzte Friedrich hinzu und wandte sich mit geheuchelter Freundlichkeit an Melusine. »Teure Schwägerin, wussten Sie, dass Ihr Gatte die viele freie Zeit, die ich ihm zugestehe, dazu genutzt hat, mit unserem Bruder Wilhelm Strategiespiele zu spielen? Ein ganzes Jahr lang, wie ich höre. Ein Jahr, in dem meine Brüder Belagerungen und Schlachten eines Krieges zwischen Preußen und England an der Seite Österreichs entworfen haben.«
Zu Heinrichs Überraschung lachte Melusine. »Ja, Sire«, sagte sie, »das weiß ich. Ihr Bruder Wilhelm hat mir das Resultat verehrt. Es ist ein wunderschöner Privatdruck. Aber, Sire, da Sie selbst ein Dichter sind, dürfen Sie sich nicht wundern, wenn Ihre Brüder Ihrem Beispiel folgen.«
Es war in der Tat ein Spiel gewesen, ein Gedankenspiel, geboren aus dem Gefühl der Nutzlosigkeit. Die einzigen Aufgaben, die der König seinen Brüdern zugestand, war das Exerzieren mit Regimentern. Jede weitere Aufgabe wäre auf ein Teilen von Macht hinausgelaufen, und dazu war der König nicht imstande. Im Nachhinein wünschte Heinrich allerdings, er hätte Wilhelm ausgeredet, die Karten und fiktiven Briefe, die sie sich als Teilnehmer dieses gespielten Krieges in der Rolle von Botschaftern, Feldherren und Königen geschickt hatten, drucken zu lassen. Ja, es gab nur ganz wenige Exemplare, aber eines war offensichtlich dem König in die Hand gefallen, und das war eindeutig eines zu viel.
»Nun, ich hätte mir denken können, dass Sie von Heinrichs Umtriebigkeiten nicht von Ihrem Gatten selbst erfahren haben«, bemerkte der König und begann, die Pastete, die man ihm aufgetischt hatte, systematisch zu zerlegen. Dass er, der sonst immer darauf bestand, Französisch zu sprechen, die deutsche Namensform verwendete, war ein Zeichen von aufziehendem Unwillen.
»Ich folge auch hier nur Ihrem Beispiel, Sire«, sagte Heinrich, ehe er sich zurückhalten konnte. »Da es Ihnen nie einfiele, die Königin mit Politik zu belasten.«
Friedrich legte seine Gabel nieder. »Sie haben die Erlaubnis, sich zurückzuziehen, Madame«, sagte er knapp.
Melusine wartete nicht auf die Bestätigung durch Heinrich. Dafür, dachte Heinrich bitter, wusste sie zu genau, wer wirklich das Sagen hatte, auch was ihrer beider Ehe betraf. Sie erhob sich, knickste noch einmal und verließ den Raum. Insgeheim war Heinrich erleichtert. Auf Gefechte mit seinem ältesten Bruder musste man sich ganz und gar konzentrieren können, ohne Ablenkung.
»Es war ein Spiel«, sagte Heinrich, sobald sie den Raum verlassen hatte, »aber es begann aus einer Gewissheit heraus, die mir geblieben ist. Es wird noch einen weiteren Krieg geben, Sire. Die Königin von Ungarn hat nie verwunden, dass Sie ihr Schlesien genommen haben, und sie ist, das müssen Sie selbst zugestehen, eine Kämpfernatur.«
»Der einzige Mann, den die Habsburger in mehreren Jahrhunderten hervorgebracht haben, und es ist eine Frau«, sagte Friedrich. »Einverstanden. Weiter.«