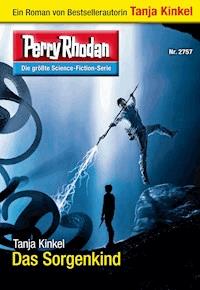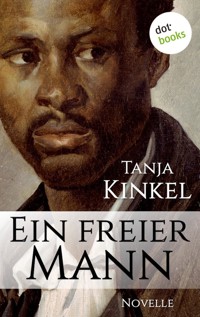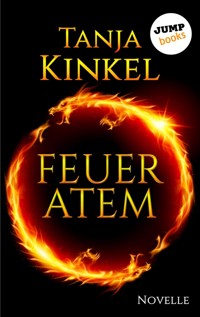6,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dotbooks Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Der Glanz der Macht, das Feuer des Ehrgeizes und das Herz einer Frau Sie ist die Tochter eines Königs und Priesterin einer Göttin, Opfer und Täterin zugleich. Als man die etruskische Prinzessin aus ihrer Heimat verbannt, beginnt für sie das Abenteuer ihres Lebens: Ilian bringt zwei Söhne zur Welt, denen sie die Namen Romulus und Remus gibt. Den beiden soll gelingen, was ihr verwehrt blieb: Sie sollen herrschen! Doch wer nach den Sternen greift, braucht einen mächtigen Verbündeten – und nur das Orakel von Delphi kann Ilian helfen, den kühnen Plan zu verwirklichen. Aber die Gunst des Orakels hat einen hohen Preis. Und so muss Ilian als seine Spionin in das ferne Ägypten reisen, mitten hinein in den Krieg dreier Völker … »Wieder zaubert Tanja Kinkel opulente Bilder vom Leben in vergangenen Zeiten. Das tut sie auf bewährte Art: wohl recherchiert und mit feinem Gespür für ihre Figuren.« BRIGITTE »Geradezu meisterhaft zeichnet Kinkel die verschiedenen Charaktere nach. Ein historischer Roman von seltener Eindringlichkeit, in dem nicht nur die geschichtliche Handlung, sondern auch und vor allem die Psychologie der Charaktere auf großartige Weise verdeutlicht wird.« FOCUS Tanja Kinkels Bestseller »Die Söhne der Wölfin« über die Gründung Roms – inklusive ergänztem Nachwort und exklusivem Interview; für alle Fans der Bestseller von Jennifer Saint und Madeline Miller.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
Über dieses Buch:
Sie ist die Tochter eines Königs und Priesterin einer Göttin, Opfer und Täterin zugleich. Als man die etruskische Prinzessin aus ihrer Heimat verbannt, beginnt für sie das Abenteuer ihres Lebens: Ilian bringt zwei Söhne zur Welt, denen sie die Namen Romulus und Remus gibt. Den beiden soll gelingen, was ihr verwehrt blieb: Sie sollen herrschen! Doch wer nach den Sternen greift, braucht einen mächtigen Verbündeten – und nur das Orakel von Delphi kann Ilian helfen, den kühnen Plan zu verwirklichen. Aber die Gunst des Orakels hat einen hohen Preis. Und so muss Ilian als seine Spionin in das ferne Ägypten reisen, mitten hinein in den Krieg dreier Völker …
Über die Autorin:
Tanja Kinkel, geboren 1969 in Bamberg, studierte in München Germanistik, Theater- und Kommunikationswissenschaft und promovierte über Aspekte von Feuchtwangers Auseinandersetzung mit dem Thema Macht. 1992 gründete sie die Kinderhilfsorganisation Brot und Bücher e.V, um sich so aktiv für eine humanere Welt einzusetzen (mehr Informationen: www.brotundbuecher.de). Tanja Kinkels Romane wurden in mehr als ein Dutzend Sprachen übersetzt und spannen den Bogen von der Gründung Roms bis zum Amerika des 21. Jahrhunderts.
Bei dotbooks veröffentlichte Tanja Kinkel ihre großen Romane »Die Puppenspieler«, »Die Löwin von Aquitanien«, »Wahnsinn, der das Herz zerfrisst«, »Morgenröte über der Alhambra«, »Die Söhne der Wölfin« - der Roman ist auch im Sammelband »Die Frauen der Ewigen Stadt« erhältlich -, »Die Schatten von La Rochelle« und »Unter dem Zwillingsstern«, die Novelle »Ein freier Mann« sowie ihre Erzählungen »Der Meister aus Caravaggio«, »Reise für Zwei« und »Feueratem«, die auch in gesammelter Form vorliegen in »Gestern, heute, morgen«. Die Kurzgeschichte »Ein unverhofftes Weihnachtswunder« ist außerdem in der Anthologie »Kerzenschein und Schneegestöber« erhältlich.
Die Website der Autorin: www.tanja-kinkel.de
***
Erweiterte Neuausgabe Oktober 2014, Januar 2025
Copyright © der Originalausgabe 2001 by Blanvalet Verlag, München, in der Verlagsgruppe Random House GmbH
Copyright © der um ein Personenverzeichnis, Nachwort und Interview erweiterten Neuausgabe 2014, 2024 dotbooks GmbH, München
Der Roman wurde nach den alten Rechtschreibregeln korrekturgelesen, Nachwort und Interview nach den neuen Rechtschreibregeln
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Titelbildgestaltung: Nele Schütz Design unter Verwendung von Shutterstock/belander, NBvector, Ana Lo; AodbeStock/moma 1135 und ein Gemälde von Julius Ahlborn »Blick in Griechenlands Blüte«
ISBN 978-3-95520-839-4
***
dotbooks ist ein Verlagslabel der dotbooks GmbH, einem Unternehmen der Egmont-Gruppe. Egmont ist Dänemarks größter Medienkonzern und gehört der Egmont-Stiftung, die jährlich Kinder aus schwierigen Verhältnissen mit fast 13,4 Millionen Euro unterstützt: www.egmont.com/support-children-and-young-people. Danke, dass Sie mit dem Kauf dieses eBooks dazu beitragen!
***
Liebe Leserin, lieber Leser, wir freuen uns, dass Sie sich für dieses eBook entschieden haben. Bitte beachten Sie, dass Sie damit gemäß § 31 des Urheberrechtsgesetzes ausschließlich ein Leserecht erworben haben: Sie dürfen dieses eBook – anders als ein gedrucktes Buch – nicht verleihen, verkaufen, in anderer Form weitergeben oder Dritten zugänglich machen. Die unerlaubte Verbreitung von eBooks ist – wie der illegale Download von Musikdateien und Videos – untersagt und kein Freundschaftsdienst oder Bagatelldelikt, sondern Diebstahl geistigen Eigentums, mit dem Sie sich strafbar machen und der Autorin oder dem Autor finanziellen Schaden zufügen. Bei Fragen können Sie sich jederzeit direkt an uns wenden: [email protected]. Mit herzlichem Gruß: das Team des dotbooks-Verlags
***
Sind Sie auf der Suche nach attraktiven Preisschnäppchen, spannenden Neuerscheinungen und Gewinnspielen, bei denen Sie sich auf kostenlose eBooks freuen können? Dann melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an: www.dotbooks.de/newsletter (Unkomplizierte Kündigung-per-Klick jederzeit möglich.)
***
Besuchen Sie uns im Internet:
www.dotbooks.de
www.facebook.com/dotbooks
www.instagram.com/dotbooks
blog.dotbooks.de/
Tanja Kinkel
Die Söhne der Wölfin
Roman
dotbooks.
Widmung
Für meine Mutter
Dramatis Personae
Etrusker (Rasna, Tusci)
Ilian – Tochter des enthronten Königs Numitor, Novizin der Göttin TuranFasti – oberste Priesterin der Göttin TuranArnth – neuer König von Alba; Ilians OnkelAntho – Arnths lebenslustige TochterUlsna – Barde mit einem Geheimnis; Ilians bester Freund
Latiner
Faustulus – Hirte, mit dem Ilian verheiratet wird, Ziehvater ihrer SöhneRomulus und Remus – Ilians ZwillingssöhneNuma – Freund der Zwillinge
Griechen
Arion – Händler und Kapitän aus KorinthProkne – Hetäre aus AthenIolaos – Priester des Orakels von Delphi
Ägypter
Nesmut – Gattin des Fürsten von Sais, Besitzerin von Ilian und UlsnaPsammetich – Nesmuts Sohn, später PharaoNeter-Nacht – Priester des Orakels von Ammon
TEIL IDAS GESCHENK DER GÖTTER
Kapitel 1
Für Fasti war das Bestürzendste an der Enthüllung, die ihre Novizin ihr machte, daß sie aus heiterem Himmel kam. Trotz all der Ereignisse der letzten Wochen, trotz all der Zeichen, die gedeutet wurden, hatte es keinen Moment der Vorahnung bei der Hohepriesterin gegeben. Was Fasti, die im Innersten dazu neigte, ihrer scharfen Beobachtungsgabe genauso wie den meisten Hinweisen der Götter zu vertrauen, jedoch noch mehr verletzte, war, daß es auch im Verhalten des Mädchens, das jetzt vor ihr stand, nichts Auffälliges gegeben hatte.
Die frühe Morgensonne zauberte eine Schwelle aus hell glühendem Terrakotta in den Eingang der Zelle und zeichnete für Fasti, die sich im dämmrigen Inneren des Raumes befand und gerade erst ihr morgendliches Gebet für die Göttin gesprochen hatte, die Gestalt des Mädchens so scharf wie eine der Figuren, mit denen die Griechen ihre kostspieligen Vasen zierten. Ilian hielt sich kerzengerade, und ihre Hände preßten sich an die Oberschenkel, doch ansonsten unterschied sie sich in nichts von der Novizin, die Fasti noch am gestrigen Morgen über nichts Schlimmeres als eine Erhöhung der Ölpreise für die Tempellampen unterrichtet hatte. Fasti starrte sie an und versuchte ihrerseits, gefaßt zu sein. Die Mischung aus Bestürzung, Enttäuschung und Entsetzen, die in ihr hochstieg, machte ihr das schwer. Ein Teil von ihr hoffte, sich verhört zu haben, ein anderer war versucht, Ilian bei den Schultern zu packen und zu schütteln, während ihr verläßlicher, vorausplanender Verstand, der ihr seit mehr als einem Jahrzehnt ihre Position sicherte, sich bereits verzweifelt bemühte, eine Lösung zu finden.
»Ich erwarte ein Kind«, wiederholte Ilian mit der klaren, tragenden Stimme einer ausgebildeten Priesterin und klang dabei erzürnenderweise nicht im geringsten reuig oder eingeschüchtert.
Nicht zum ersten Mal fragte sich Fasti, ob Ilian je ihr Selbstverständnis als Tochter des Königs abgelegt hatte. Sich der Göttin Turan zu weihen bedeutete, seine Herkunft hinter sich zu lassen. Eigentlich sollte man meinen, daß Ilian diese Lektion verinnerlicht hätte, zumal ihr Vater niemand war, auf den man stolz sein konnte. Allein das Weiterleben Numitors war bereits eine Schande. Numitor war für Alba ein schlechter König gewesen; unter seiner Regentschaft hatte die Stadt alle wichtigen Handelsverträge verloren, sich in einen törichten Kleinkrieg mit Xaire verstrickt und stand nun als die unbedeutendste im Bund der Zwölf dar. Sogar die latinischen Barbaren wagten es immer häufiger, Handelszüge aus Alba zu überfallen, was früher undenkbar gewesen wäre. Fasti hatte gemeinsam mit den Hohepriestern der übrigen Götter die Zeichen beraten, und die Blitze, die ihnen bald darauf gesandt wurden, verkündeten eine eindeutige Botschaft: Der König mußte sterben.
Es war ein altes Gesetz, das nur noch selten Anwendung fand; in Zeiten der Not starb der König für seine Stadt und holte ihr so das Glück zurück. Das Opfer mußte jedoch freiwillig gebracht werden; ein König, der gegen seinen Willen getötet wurde, bewirkte nur Unglück. Keiner von ihnen hatte damit gerechnet, daß Numitor sich weigern würde – weigern mit einer Arroganz, die offenbar ein verhängnisvolles Merkmal seiner Familie darstellte.
Nicht, daß der Hochmut Numitor viel genützt hätte. Einen König zu entthronen, der einmal von den Göttern anerkannt worden war, hatte keiner der Priester gewagt, doch als Numitors Bruder Arnth diese Pflicht auf sich nahm, war ihm ihre volle Unterstützung zuteil geworden. Nicht bedingungslos; Fasti selbst hatte Arnth gewarnt, daß ein Bruder, der einen Bruder tötete, den schlimmsten aller Flüche auf sich lüde. Und so hatte Arnth Numitor nicht umgebracht, sondern lediglich verbannt; allerdings nicht, ohne einige gründliche Vorsichtsmaßnahmen zu treffen. Numitor würde keine rachedurstigen Söhne mehr zeugen können, denn seine Männlichkeit war ihm genommen worden, ebenso wie den beiden bereits vorhandenen Söhnen, die man den Phöniziern als Sklaven verkauft hatte.
Fastis Mitleid mit den jungen Männern hielt sich in Grenzen. Die beiden waren empört über die Forderung der Priester nach dem freiwilligen Opfertod ihres Vaters gewesen und zeigten die gleiche kurzsichtige und verhängnisvolle Überheblichkeit wie er.
Ilian, Numitors einzige Tochter, hatte sie bisher anders eingeschätzt. Ilian war bereits als Kind der Göttin übergeben worden und hatte stets eine vielversprechende Mischung aus gesundem Menschenverstand und Intuition gezeigt. Sie war wißbegierig, sie begriff rasch, und es gab Anzeichen, daß sie die Blitze nicht nur deuten, sondern auch herbeirufen konnte. Von ihr waren keine Proteste über die Notwendigkeit eines Königsopfers laut geworden, und wenn sie die Machtübernahme durch ihren Onkel übelnahm, dann war sie zu klug, um es auszusprechen. Alles in allem berechtigte sie zu den schönsten Hoffnungen, und Fasti hatte geplant, sie im nächsten Winter, wenn ihr fünfjähriges Noviziat beendet wäre, zu ihrer Nachfolgerin auszubilden. Es stand nicht zu erwarten, daß Arnth protestieren würde. Eine Priesterin durfte niemals heiraten, und solange es keinen Ehemann für Ilian gab, der in ihrem Namen Anspruch auf den Thron von Alba erheben konnte, würde sie ihm nicht gefährlich sein.
All das machte Ilians Verhalten um so unbegreiflicher. Die Jungfräulichkeit einer Novizin war heilig, denn sie diente dem Aspekt der Göttin, der Jungfrau war. Erst die Priesterinnen, die Turan der Gebenden huldigten, der Mutter allen Lebens, hatten das Recht, sich einem Mann hinzugeben, und sie taten es nur, wie die Göttin es wünschte.
»Du bist...«, begann Fasti, dann hörte sie, daß ihre Stimme rauh klang, und hielt einen Moment lang inne, bis sie sicher sein konnte, ihre übliche kühle Gelassenheit wiedererlangt zu haben, »du bist nicht vergewaltigt worden?«
Schon als sie dies sagte, wußte sie, daß es eine Feststellung war, keine Frage. Eine Priesterin zu vergewaltigen war ein solch ungeheuerliches Vergehen und zog eine so grausame Strafe nach sich, daß es höchstens einmal in drei Generationen vorkam. Überdies hätte Ilian in einem solchen Fall nichts daran gehindert, es Fasti sofort zu berichten und dafür zu sorgen, daß der Schuldige bestraft würde.
»Nein«, entgegnete Ilian. Sie schaute zu dem Altar hinter Fasti, auf dem ein Abbild der geflügelten Turan stand. »Aber ich hatte auch keinen Liebhaber«, fügte sie mit einem Anflug von Trotz hinzu, der Fasti daran erinnerte, daß Ilian bei aller Schulung noch sehr jung war, zweimal sieben Jahre erst. Dann trat sie einen Schritt näher, löste sich aus dem Lichtfleck am Eingang und fuhr fort, ohne den Altar aus den Augen zu lassen: »Es ist das Kind eines Gottes, und die Göttin selbst hat es gebilligt.«
Diesmal versuchte Fasti nicht einmal, ihre Reaktion zu unterdrücken. Sie ging zu Ilian und schlug ihr, ohne zu zögern, ins Gesicht, zweimal, einmal mit der Handfläche, dann, weit ausholend, mit dem Handrücken. Ilian keuchte unwillkürlich auf, aber sie machte keine Anstalten, sich zu schützen, was einiges an Selbstbeherrschung erforderte. Sie überragte Fasti bereits, doch Ilians schlanke Gestalt hatte noch etwas Weiches, Unfertiges, während die muskulöse, untersetzte Fasti über die Zähigkeit und Härte einer Bäuerin verfügte. Einen Moment lang wünschte sich Fasti, das Mädchen umbringen zu können, und wußte gleichzeitig, daß sie es nie fertigbrächte.
Nicht einmal einen Herzschlag lang zog sie in Erwägung, daß Ilian die Wahrheit sagen könnte. Im Gegenteil, nun war ihr alles klar. Sie hatte nicht einfach eine leichtsinnige Novizin vor sich, die ihre Zukunft für ein paar süße Worte eines unbekannten Verführers fortgeworfen hatte und die nun Zuflucht in einer blasphemischen Ausrede suchte. Nein, es war viel gefährlicher. Wenn Ilian öffentlich behauptete, das Kind eines Gottes in sich zu tragen, dann würde ein Teil der Bevölkerung ihr Glauben schenken, statt sie als gefallene Priesterin zu verachten. Der Trotz ihres Vaters gegen den Willen der Götter wäre dann vergeben und seine Erblinie wieder gültig. Ilians Kind, ob Mädchen oder Junge, hätte nicht nur Anspruch auf den Thron, nein, seine halbgöttliche Herkunft würde es auch jedem Sprößling Arnths überlegen machen. Und da Arnth bisher so sorgfältig darauf geachtet hatte, keinen seiner Blutsverwandten zu töten, stand nicht zu erwarten, daß er jetzt bei einer schwangeren Frau den Anfang machen würde. Selbst die trächtige Häsin war unantastbar. Seine Nichte in ihrem augenblicklichen Zustand zu töten wäre selbst dann ein Sakrileg, wenn sie nicht der Göttin geweiht wäre.
Zumindest hatte Fasti sich nicht in Ilian getäuscht, was ihren Verstand anging. Beinahe mischte sich widerwillige Bewunderung in den Zorn, der sie nun ganz und gar erfüllte.
»Du wirst uns nicht in einen Krieg mit dem König hineinziehen«, stieß sie mit zusammengebissenen Zähnen hervor. »Es hat schon genug Zwist zwischen Tempel und Thron gegeben, glaube nur nicht, daß wir dich um dieser Lüge willen schützen werden.«
»Es ist keine Lüge.«
Fasti musterte Ilian, als sähe sie das Mädchen zum ersten Mal. In dem dämmrigen Licht der Zelle wirkten Ilians Augen, die braun waren, fast schwarz. Sie hatte eine sehr helle Haut, und so konnte man immer noch die roten Male, die Fastis Finger hinterlassen hatten, erkennen. Ihr herzförmiges Gesicht mit der breiten Stirn und dem spitzen Kinn würde in ein paar Jahren schön sein; jetzt wirkte es nur kindlich, da die hohen Wangenknochen noch nicht zur Geltung kamen. Ihr Haar war hochgesteckt, wie es sich gehörte, doch unter der Wucht von Fastis Schlägen hatten sich einige der dunklen Locken gelöst und standen im Widerspruch zu den zusammengepreßten Lippen. Fasti weigerte sich, etwas wie Rührung in sich aufkommen zu lassen.
»Und welcher Gott«, fragte sie bitter, »soll das gewesen sein?«
Insgeheim war sie gespannt auf die Antwort, die das Ausmaß der Katastrophe verraten würde. Nur die Priesterschaften von Nethuns und von Cath waren mächtig genug, den Zorn des Königs riskieren zu können, aber sie hatten bei seiner Inthronisierung geholfen, und es wäre töricht von ihnen, einen fähigen, geneigten Herrscher, der bereits alle gewünschten Reformmaßnahmen eingeleitet hatte, gegen ein Kleinkind, ein vierzehnjähriges Mädchen und den Mann, der das verwünschte Kind gezeugt hatte, einzutauschen. Andererseits stand es durchaus im Bereich des Möglichen, daß sich eine von ihnen von dem Machtwechsel mehr versprochen hatte und nun bereit war, es auf einen Aufruhr des Adels ankommen zu lassen, um die Verehrung ihres Gottes über die der anderen zu erheben. Nethuns war der traditionell Mächtigere, aber in den letzten Jahren waren Cath mehr und mehr Opfergaben gebracht worden, und wenn einer von beiden erhoffte, auf diese Weise den endgültigen Vorrang zu erreichen ... Sie sah einen Bürgerkrieg vor sich, betrieben von gewissenlosen Ehrgeizlingen, sah Alba endgültig zugrunde gehen, seine Bewohner gezwungen, in den übrigen Städten des Bundes Zuflucht zu suchen, und es schauderte sie.
»Keiner von unseren Stadtgöttern«, entgegnete Ilian, und die Last auf Fastis Schultern verringerte sich ein wenig. Das bedeutete, daß Ilian von niemandem unterstützt wurde und allein handelte. In diesem Fall war es weise, nicht einen der Götter, deren Priester hier in der Stadt weilten, als Vater zu beanspruchen; die Priester von Nethuns wären durchaus imstande, bis nach der Geburt des Kindes zu warten und sie dann zeremoniell als Strafe für ihre Blasphemie zu ertränken.
»Was für ein Gott dann?« gab sie spöttisch zurück und war überrascht, Ilian mit einemmal die Beherrschung verlieren zu sehen.
»Du glaubst mir nicht«, sagte Ilian heftig. »Als mein Vater solchen Unglauben zeigte, was den Willen der Götter anging, da nanntest du es Lästerung, Fasti, und bis heute dachte ich, du seist dabei aufrichtig gewesen, daß es dir um mehr ging, als um einen Machtwechsel. Nun, ich habe die Zeichen auch gelesen, Fasti.«
Sie wandte sich von Fasti ab, kniete vor dem Altar nieder und legte ihre rechte Hand auf das Abbild der Göttin, das Fasti erst vor kurzer Zeit nichtsahnend wie jeden Morgen mit jungem Wein besprengt hatte. »Ich schwöre bei der geflügelten Turan und bei Nurti, die über das Schicksal regiert, daß ich nur dem Willen der Götter gehorcht habe. Sie haben sich mir offenbart. Ein Band wurde gebrochen um der Macht willen, und die Zwölf werden untergehen, aber wenn sich Leben und Zerstörung vereinigen, dann wird geboren, was in alle Ewigkeit fortdauern wird.«
Die leidenschaftliche Aufrichtigkeit in Ilians Stimme ließ Fasti einen Moment lang zurückschrecken. Dann holte die Wirklichkeit sie wieder ein. Das Mädchen hatte gerade so gut wie zugegeben, daß sie die Entmachtung ihres Vaters übelnahm. Der Plan, mit dem sie diese wieder rückgängig machen wollte, war für eine Vierzehnjährige erstaunlich gut durchdacht, aber daß sie sich dabei der Götter bediente, war unverzeihlich.
»Du hättest meine Nachfolgerin werden können«, meinte Fasti kopfschüttelnd und mehr traurig als ärgerlich. »Hätte das nicht genügt?«
Ohne zu antworten, stand Ilian langsam auf. »Mein Kind ist das Kind eines Gottes«, erwiderte sie. »Geh nur zu meinem Onkel und berichte ihm das.«
***
Der übertriebene Reichtum des königlichen Palasts war einer der Gründe, warum die Bevölkerung nicht übermäßig um den gestürzten Numitor trauerte. Das Haus eines Königs sollte Ehrfurcht einflößen, denn der König vertrat die Stadt, aber in schlechten Zeiten statt Getreide griechische Maler einzuführen, wie Numitor es getan hatte, war eine weitere Herausforderung der Untertanen gewesen. Dennoch zollte Fasti dem Ergebnis dieser unklugen Eigennützigkeit bei jedem Besuch aufrichtige Bewunderung. Der Palast mit seinen drei Innenhöfen stand nicht, wie die wichtigsten Tempel, auf einem der höchsten Punkte von Alba, aber er bot eine wunderbare Aussicht auf den See, und wenn man ihn einmal betrat, dann war es unmöglich, nicht den Einfallsreichtum zu würdigen, den diese Lage hervorgerufen hatte. Die Wände des ersten Innenhofes zeigten Wasservögel und Schiffe, Nethuns mit seinen fischschwänzigen Wassergreisen und die ihm zugehörigen Kräuter, Bachginster und Bachminze. Während sie darauf wartete, daß man Arnth von ihrer Ankunft benachrichtige, fiel Fasti auf, daß ein breiter schwarzer Streifen bei einem der Wassergreise die Flügel verdeckte, mit denen man diese Wesen sonst darstellte. Ruß zweifellos; eine Erinnerung an die Nacht, in der Numitor gestürzt worden war? Aber inzwischen war ausreichend Zeit vergangen, um derartige Überreste zu entfernen. Andererseits stand es durchaus im Bereich des Möglichen, daß solche Nebensächlichkeiten Arnth gar nicht auffielen.
Einer der Sklaven näherte sich ihr, die Augen niedergeschlagen, wie es sich der Hohepriesterin gegenüber ziemte, und bat, die Edle Fasti möge ihm folgen, der König freue sich darauf, sie zu empfangen. Das bezweifle ich, dachte Fasti. Arnth war von Natur aus mißtrauisch und fragte sich gewiß, ob sie, oder vielmehr die Göttin Turan, schon wieder Forderungen um Unterstützung an ihn stellen wollte.
Wegen der Mittagshitze hatte man vor das Fenster des Raumes, in den man sie führte, eine helle Leinwand gespannt, aber dennoch ließ sich der Gast, in dessen Gesellschaft Arnth auf sie wartete, von einem Sklaven Luft zufächeln. Der Barttracht und der Kleidung nach ein Inselgrieche; er wandte hastig die Augen ab, als sie eintrat. Wenn die Lage nicht so ernst gewesen wäre, hätte es Fasti belustigt. Die Griechen hatten eigenartige Sitten in bezug auf Frauen. Wie man hörte, ließen sie nur Sklavinnen und Huren ohne Begleitung durch die Straßen gehen und empörten sich über die hiesige Sitte, gemeinsam zu speisen. Da ein Grieche, der mit seiner Meinung zurückhielt, noch nicht geboren war, gab es in den zwölf Städten ein Sprichwort, das besagte, das einzige, was einen Hellenen noch mehr schrecke als ein phönizischer Handelsrivale, sei eine Frau der Rasna. Sie konnte sich denken, warum Arnth ihn bei sich behalten hatte. Mutmaßlich hatte er eine vorteilhafte Vereinbarung geschlossen und wollte ihr verdeutlichen, daß er nicht länger mehr nur auf die Unterstützung der Priester angewiesen war.
Angesichts der Nachricht, die sie überbringen mußte, stellte die Anwesenheit des Griechen jedoch ein Hindernis dar. Sie nickte ihm flüchtig zu und erhob die Hand, um Arnth, der sich zu ihrer Begrüßung lächelnd erhoben hatte, Einhalt zu gebieten.
»König von Alba«, sagte sie ernst, »das, was ich zu sagen habe, ist nur für deine Ohren bestimmt.«
Es würde ohnehin bald genug Stadtgespräch werden, doch gerade jetzt konnte sie keinen fremden Zeugen gebrauchen. Arnth, den selbst seine Feinde nie als dumm bezeichnet hätten, begriff offenbar sofort, daß sie nicht hier war, um wegen weiterer Privilegien für den Tempel zu feilschen.
»Alkinoos, mein Freund«, meinte er in seinem gewinnendsten Tonfall und in dem attischen Dialekt, der von den meisten Griechen bevorzugt wurde, »wir werden später weitersprechen, und heute abend werde ich zu Ehren unseres neuen Bündnisses mit Korkyra ein Gastmahl geben. Aber wenn die Götter gebieten ...«
»Gewiß«, entgegnete der immer noch etwas befangen wirkende Alkinoos, stand auf und entfernte sich hastig, wobei er peinlichst auch weiterhin jeden Blick in Fastis Richtung vermied.
Als er verschwunden war, bemerkte Fasti trocken: »Korkyra? Bedeutet das, daß wir endlich wieder unser Erz über das Meer schicken können?«
Die Griechen waren dabei, sich um das Meer auszubreiten wie Frösche um einen Teich, und mittlerweile war es fast unmöglich, sich am Seehandel zu beteiligen, ohne sich mit mindestens einem griechischen Reich zu verbünden, es sei denn, man begab sich ganz und gar in die Hand der Phönizier. Nichtverbündete galten als Freiwild für Seeräuber, und als Numitor den Vertrag mit Korinth zugunsten von Xaire verlor, geriet der rege Tauschhandel von Bronze und Eisen gegen Weizen, Öl, Wein und Tonwaren mehr und mehr zum Erliegen. Die Insel Korkyra war als Verbündeter eine gute Wahl; ihre kleinen, wendigen Schiffe taugten selbst nicht zum Transport großer Lasten, aber das Handelsschiff, das von ihnen eskortiert wurde, kam gewöhnlich auch an. Allerdings ließen die Korkyräer sich ihre Dienste einiges kosten, und die Überlegung, wie Arnth sie wohl angesichts der leeren Schatzkammer seiner heruntergewirtschafteten Stadt bezahlen wollte, lenkte Fasti tatsächlich für einen Moment von ihren Sorgen ab.
»Nun«, meinte der neue König von Alba, der nicht aufgehört hatte zu lächeln, »wenn die Götter es wollen und ihre Priester bereit sind, Opfer dafür zu bringen, dann können wir das gewiß.«
Noch gestern wäre Fasti ob der Herausforderung, die in diesen Worten lag, nicht weiter böse gewesen, doch jetzt kam ihr der Verdacht, daß die ganze königliche Familie die unselige Neigung besaß, die Götter und deren Diener zu ihren Zwecken einzuspannen, statt sich selbst dem Willen des Schicksals zu beugen.
»Sprechen wir ein andermal davon«, entgegnete sie schroff und unterrichtete dann den König von der Schwangerschaft seiner Nichte und von dem, was diese über den Vater des Kindes gesagt hatte.
Arnth, der mehr als zehn Jahre jünger als sein entthronter Bruder war und nie zu Gefühlsausbrüchen neigte, erblaßte und wirkte mit einem Schlag gealtert. Zum ersten Mal fiel Fasti das Netz feiner Falten auf, das sich von Augen- und Mundwinkeln über das Gesicht ausbreitete. In die Stirn hatten sich drei Kerben eingegraben, und die Augenbrauen, die geschwungen wie die Ilians und Numitors waren, zogen sich abrupt zusammen.
Er ließ sich wieder auf die Liege sinken, auf der er vorher geruht hatte, und sackte in sich zusammen. Nach einer Weile meinte er tonlos: »Es besteht wohl keine Möglichkeit, daß dieses Kind nie geboren wird?«
»Nein«, erwiderte Fasti scharf. »Die Göttin verbietet dergleichen. Das keimende Leben ist heilig. Du solltest daran noch nicht einmal denken.«
»Vergib mir, Edle Fasti«, sagte Arnth kühl, »aber gebietet die Göttin nicht auch, unnatürliches Leben zu vernichten? Ich meine mich zu erinnern, daß du selbst mißgestaltete Kinder dem Fluß übergeben und die Mütter, die solche Kinder behalten wollten, dafür bestraft hast.«
»Es gibt keinen Grund anzunehmen, das Kind, das Ilian erwartet, sei mißgestaltet. Und hüte dich davor, dir so etwas zu wünschen. Es könnte auf deine eigenen Kinder zurückfallen.«
Unwillkürlich berührte Arnth die kleinen Bronzekugeln, die er wie die meisten Männer um den Oberarm gebunden hatte, um mißgünstige Einflüsse des Schicksals abzuwehren. Seine Lippen preßten sich zusammen.
»Es mag sein«, versetzte Fasti versöhnlicher, »daß die Göttin Ilian für ihren Verrat bestraft, und das kann sehr wohl durch ihr Kind geschehen. Doch es ist nicht an uns, dergleichen zu fordern.«
»Ich verstehe. Aber als König obliegt es mir, diese Stadt zu regieren. Was ich dazu mit meinem Bruder und seinen Söhnen machen mußte, hat mir im Gegensatz zur allgemein herrschenden Meinung keine Freude bereitet, doch es war notwendig. Ich wünsche Ilian kein Leid, aber ich kann auch nicht zulassen, daß sich die Stadt um ihretwillen schon wieder spaltet.«
Fasti nickte. »Das kann nicht dem Willen der Götter entsprechen«, meinte sie zustimmend.
Er wartete, doch sie fügte nichts hinzu. Die Zeichen hatten sich Fasti diesmal verweigert, und auch stundenlanges Grübeln hatte keine Erleuchtung gebracht, was sie dem König in bezug auf Ilian vorschlagen könnte. Sie wußte nur, was sie nicht tun würde. Aber eine derartige Ratlosigkeit stellte eine Schwäche dar, die sie nicht gern zeigte. Schweigen senkte sich über den Raum, und sie hörte Flötenspiel aus einem der Nachbarzimmer. Wie die meisten Angehörigen ihres Volkes liebte sie die Musik, doch diesmal verfehlten die perlenden Töne ihre Wirkung auf sie. In Gedanken häufte sie abermals Verwünschungen auf Ilians Haupt. Vor allem anderen sollten für eine Priesterin der Wille der Götter und das Wohl des Volkes stehen. Wie kleinlich, wie selbstsüchtig, das um der Rache willen zu verwerfen.
Als Arnth endlich wieder sprach, war sie mehr als bereit, ihm zuzuhören.
***
Ilian war es verboten worden, den Tempelbezirk zu verlassen, doch Fasti hatte vergessen, eine solche Anordnung auch für den Rest der Novizinnen zu erlassen, die mit Ilian im Haus der Jungfrauen lebten. Sie mochten ihr Leben Turan geweiht haben, doch sie waren so klatschsüchtig wie alle jungen Mädchen geblieben, und alle hatten Familie in der Stadt. Überdies hatte sich vor zwei Mondwechseln eine der Novizinnen durch einen unglücklichen Sturz das Genick gebrochen, was Fasti zu einer noch nicht wieder zurückgenommenen ständigen Besuchserlaubnis für die Eltern veranlaßt hatte, um die aufgeregten Familien der übrigen Mädchen zu beschwichtigen. Nun zeigten sich die unliebsamen Folgen dieser Geste. Als Fasti aus dem Palast zurückkehrte, wurde sie dreimal angehalten und gefragt, was es mit der ungeheuerlichen Neuigkeit auf sich habe. Ihre Stimmung war dementsprechend, als sie Ilian aufsuchte.
Ilian saß auf einer Bank, ein Wachstäfelchen auf den Knien. In der linken Hand hielt sie den Griffel, mit dem sie schrieb. Einen Moment lang wollte Fasti sie wie so oft darauf aufmerksam machen, daß sie mit der rechten Hand zu schreiben hätte. Die Schrift war erst vor einer Generation von den Griechen ins Land gebracht worden und noch immer etwas so Außergewöhnliches, daß nur die Priester und sehr wenige Adlige sie beherrschten. Ilian hatte das Schreiben schnell gelernt, doch ihr beharrliches Benützen der falschen Hand war so widersinnig wie vieles andere an ihr. Ohne ein Wort zu sagen, nahm Fasti ihr das Täfelchen ab und warf einen Blick darauf. Es handelte sich um eine Aufzählung der elf verschiedenen Blitzarten und der Götter, denen sie zugeordnet waren. Offensichtlich hielt Ilian es für nötig, sich mit anderen Dingen als dem, was sie angerichtet hatte, zu beschäftigen.
»Blutrote Blitze für Tin«, las Fasti laut, »in drei Arten. Ich hoffe, du weißt auch noch, welche drei Arten.«
Ilian schaute zu ihr auf. Diesmal bemerkte Fasti die Schatten unter ihren Augen, doch sie weigerte sich, sich davon rühren zu lassen.
»Die erste Art ist friedlich«, gab das Mädchen zurück, ohne Überraschung, als handele es sich immer noch um eine weitere Lektion ihrer Lehrerin, als könnten sie wieder sein, was sie noch gestern gewesen waren. »Ein solcher Blitz rät von etwas ab oder rät zu etwas zu. Die zweite Art Blitz kann Schaden anrichten oder nützen und ist sehr schwer zu deuten; Tin zieht die übrigen Götter zu Rate, ehe er sie verwendet. Um die dritte Art zu benutzen, braucht er ihr Einverständnis, denn es ist die schlimmste, verheerendste. Sie vernichtet und gestaltet den Zustand von Mensch und Gemeinwesen um.«
»Zwei Tage, ehe der alte König, dein Vater, gestürzt wurde«, sagte Fasti, während alles in ihr gegen die Verschwendung protestierte, die jetzt unausweichlich war, »sahen du und ich einen solchen Blitz. Ich habe ihn gedeutet. Ich nehme an, du willst mir jetzt erzählen, daß meine Deutung nicht die richtige war und sich die Götter vielmehr dir offenbarten?«
»Deine Deutung«, begann Ilian vorsichtig, »war nicht vollständig.« Man konnte die erwachende Hoffnung in ihrer Stimme hören. Vermutlich nahm sie an, daß Fasti über ihre Worte am Morgen nachgedacht hatte und nun eher bereit war, ihr zu glauben. »Ich wünschte, sie wäre es gewesen, Fasti«, fuhr sie fort und biß sich auf die Lippen, eine kindliche Geste, die Fasti ihr nie hatte abgewöhnen können. »Ich bin nicht blind, ich weiß, was auf uns zukommt. Aber es war notwendig. Die Götter haben es mir offenbart.«
»Nun«, sagte Fasti langsam und ließ die Falle zuschnappen, »wenn du dir deiner Sache so sicher bist, dann wirst du wohl nichts dagegen haben, wenn ich dich auf die Probe stelle. Der König läßt dir die Wahl zwischen zwei Lösungen. Der Vater deines Kindes hat sich gefunden, oder vielmehr: Der König hat ihn gefunden. Es ist einer der latinischen Barbaren in seinen Diensten.«
Ilians Gesicht verhärtete sich wieder. »Das ist nicht wahr, und du weißt es, und er weiß es auch.«
Ohne auf den Einwurf einzugehen, fuhr Fasti fort: »Da keine unserer Adligen einen solchen Mann heiraten kann, verlierst du deinen Stand und deinen Namen, was im übrigen auch eine angemessene Strafe für deinen Verrat an der Göttin ist. Aber du wirst ihm zur Frau gegeben und mit ihm in seine Heimat zurückkehren. Dein Kind wird ehelich zur Welt kommen, und ihr bleibt beide am Leben, doch es versteht sich von selbst, daß der Sproß eines Latiners niemals Anspruch auf den Thron erheben kann.«
»Das versteht sich. Aber du und mein Onkel, ihr habt euch verrechnet. Es ist eine Lüge, Fasti, das werde ich allen sagen, und ich werde niemanden heiraten. Zu lügen ist eine Beleidigung der Götter, nicht wahr – Priesterin?«
Die erbitterte Enttäuschung, die in den Worten lag, prallte an Fasti ab. Sie empfand sogar einen Hauch Befriedigung darüber, daß Ilian nun etwas von dem fühlen mußte, was sie in ihrer Lehrerin ausgelöst hatte. Die einzige andere Novizin, deren Ausbildung so weit fortgeschritten war wie die Ilians, die einzige, welche Ilian als zukünftige Hohepriesterin hätte ersetzen können, war das Mädchen gewesen, dem es gelungen war, sich aus unverzeihlicher Unachtsamkeit das Genick zu brechen. Eine Priesterin gehörte der Göttin, nicht sich selbst, doch der Groll, der sich in Fastis damalige Trauer gemischt hatte, war nichts im Vergleich zu ihrem Zorn über Ilian.
»In der Tat. Wenn du die Wahrheit sagst und die Götter dich als ihr Instrument erwählt haben, wenn ein Gott der Vater deines Kindes ist, dann werden sie dich auch schützen. Dann brauchst du uns nicht.«
Ilian richtete sich auf. »Wie meinst du das?«
»Nun, der König weiß, daß er dich zu nichts zwingen kann. Aber er darf auch nicht zulassen, daß die Stadt durch dich leidet. Also werden wir dich dem See übergeben, gebunden an einen Stein, der so schwer ist, daß ihn nur zwei Männer tragen können. Wenn du die Wahrheit sagst, dann werden die Götter nicht zulassen, daß du ertrinkst. Sie werden dich vor unser aller Augen retten, und ich selbst werde mich vor dir beugen und dich um Verzeihung anflehen, wie auch der König. Und nun frage ich dich, Ilian, Tochter des Numitor und der Aprthnei, bist du die Erwählte der Götter? Ist dein Glaube stark genug?«
Vor vielen Jahren, in ihrer Kindheit, hatte Fasti einmal einen Winter erlebt, der so kalt gewesen war, daß es eine Woche lang an jedem Tag geschneit hatte wie sonst nur oben im Norden. Sie hatte den Schnee mit den Händen aufgefangen und die kristallene Schönheit der Flocken bewundert, aber nur für sehr kurze Zeit, ehe sie sich auflösten und zu kaltem Wasser zerschmolzen, das nur noch lästig war. Jetzt erinnerte sie sich daran, als sie sehen konnte, wie in Ilians Augen etwas zerbrach, wie das Feuer aus ihnen schwand und nur noch ein verängstigtes kleines Mädchen zurückblieb. Zum ersten Mal spürte sie einen Anflug von Reue, denn sie wußte, daß es grausam war, was sie tat. Es gab kaum einen Menschen, dessen Glauben stark genug war für so eine Prüfung, und wenn sie ihr eigenes Inneres erforschte, so war sie bereit einzugestehen, daß sie selbst nicht derart auf die Probe gestellt werden wollte. Aber, so sagte sich Fasti, sie hätte auch nie gewagt zu behaupten, das Kind eines Gottes in sich zu tragen.
»Das würde er nicht tun«, flüsterte Ilian, aber der Protest war bereits ein Zugeständnis, und sie wußten es beide. »Er würde mich nicht töten.«
Fasti zwang sich, nur an ihrem Zorn festzuhalten und die Versuchung, ihrer alten Zuneigung zu Ilian nachzugeben, zu unterdrücken. »Selbstverständlich würde er das, wenn du lügst und gewissenlos den Frieden der Stadt gefährdest. Dafür hat er deinen Vater und deine Brüder verstümmelt, und dafür wird er dein Leben nehmen. Und wenn du nicht lügst, wird er dich auch nicht töten, denn dann werden die Götter dich retten.«
»Du würdest das zulassen, Fasti?« fragte Ilian heiser. »Gegen das Gebot der Göttin, das alle Schwangeren schützt?«
»Wenn du lügst, verdienst du nichts anderes.«
Ilian drehte ihr Gesicht zur Wand. Mit erstickter Stimme stieß sie hervor: »Geh.«
Fasti rührte sich nicht. Das Mädchen mußte endgültig gebrochen werden, sonst bestand die Gefahr, daß sie wieder Mut schöpfte und das Ganze von vorne begann.
»Was also soll ich dem König sagen?« gab sie zurück und ließ Hohn in ihre Stimme einfließen. »Soll er die Stunde bestimmen, um ein Wunder der Götter zu erleben?«
»Sag ihm, daß ihr gewonnen habt«, antwortete Ilian ausdruckslos. »Sag ihm, mein Glaube sei nicht stark genug. Nicht an die Götter, nicht an ihn und nicht an dich. Sag ihm das.«
Es wäre nur ein Ausstrecken der Arme nötig, und Fasti hätte Ilian an sich ziehen und ihr versichern können, daß sie ihren Tod nie zugelassen hätte. Doch erneut erinnerte sie sich daran, daß all dies allein Ilians Schuld war, daß Ilian selbst ihre vielversprechende Zukunft zusammen mit Fastis Hoffnungen auf eine würdige Nachfolgerin fortgeworfen hatte. Also rührte sie sich nicht. Erst Jahre später fragte sie sich, ob sie damals die letzte Gelegenheit hatte verstreichen lassen, um dem Schicksal eine andere Wendung zu geben.
Kapitel 2
Faustulus neigte im allgemeinen nicht zu hastigen Entscheidungen. Als er sich vor zwei Jahren an einem Raubzug beteiligt hatte, um den Tusci Vieh zu stehlen, hatte das weniger mit jugendlichem Übermut als mit Armut und bitterer Notwendigkeit zu tun gehabt. Die Herden seines Dorfes bestanden nach einer Seuche und einigen weiteren Unglücksfällen nur noch aus ein paar abgemagerten Tieren, die kaum zwei Familien ernährt hätten. Und jeder wußte, daß die Tusci reich waren, reich an allem, auch an Vieh, und obendrein waren sie Magier, so daß ihre Herden nie krank wurden.
Also hatte er sich den anderen jungen Männern angeschlossen, und fast hätten sie mit ihrem Plan Erfolg gehabt. Es war geradezu lächerlich einfach gewesen, zwei Dutzend Schafe von den Herden der Tusci-Stadt Alba abzusondern und fortzutreiben. In einem jähen Anfall von Tollkühnheit hatte Faustulus geglaubt, auch noch nach einer Kuh Ausschau halten zu müssen. Seither hütete er sich davor, sich je wieder Erfolg zu Kopf steigen zu lassen, denn die Strafe ließ nicht lange auf sich warten. Der Bruder des Herrschers von Alba, der mit einem kleinen Trupp die Viehdiebe verfolgte, hatte ihn gefangen genommen.
Bei einem Krieg hätte wohl die Möglichkeit bestanden, ausgelöst zu werden, aber sein Dorf führte keine Kriege, das konnte man sich nicht leisten. Also wurde er das Eigentum des Mannes, der ihn aufgespürt hatte. Er hätte es schlimmer treffen können. In die Steinbrüche geschickt zu werden oder in die Erzgruben, zu den Blasebälgen in der Nähe der heißen Feuer, die den Tusci ihren Reichtum sicherten, das war es, was jeder Latiner fürchtete. Doch sein neuer Herr war nicht grausam zu Faustulus, und wenn er zaubern konnte und mit Unterweltsdämonen im Bunde stand, so wie man das von den Tusci behauptete, dann ließ sich nichts davon erkennen. Und, so stellte sich heraus, er brauchte Krieger, deren Treue nicht seinem Bruder galt.
Faustulus lernte, ein Schwert zu gebrauchen. Er war weder sonderlich gut noch sonderlich schlecht darin, aber als Arnth die Macht in Alba übernahm, tat Faustulus seinen Teil. Zu diesem Zeitpunkt beherrschte er die Sprache der Tusci, die sich sehr von der seinen unterschied, immerhin ausreichend, um nicht nur die Befehle der Anführer zu verstehen, sondern auch mit seinen Kameraden über die Dinge des Alltags reden zu können. Er war kein mißtrauischer Mensch, und so dachte er sich nichts dabei, von seiner Hoffnung zu sprechen, als Belohnung für seine Dienste vielleicht irgendwann einmal freigelassen zu werden. Nicht, daß es ihm in Alba schlecht erging; anders als in den letzten Jahren in seinem Dorf hatte er hier zumindest immer einen vollen Magen. Aber er fühlte sich unwohl inmitten der vielen Häuser aus Stein, ihm fehlten seine alten Freunde, seine Sprache, und er war sich wohl bewußt, daß die Tusci auf seinesgleichen herabsahen.
Als er vor den König gerufen wurde, meinte Sico, der Sabiner, der weder die Tusci noch die Latiner besonders mochte, nun sei wohl die Zeit genommen, wo Faustulus für sein loses Maul büßen müsse. Dergleichen wäre Faustulus nicht eingefallen, und er weigerte sich, Angst zu zeigen, nun, da Sico ihm den Gedanken in den Kopf gesetzt hatte. Einen Schritt nach dem anderen, pflegte sein Vater zu sagen.
Was der König ihm anbot, klang fast zu schön, um wahr zu sein. Er würde wieder frei sein und ein Hirte, mit zwei gedeckten Kühen und zehn Schweinen bestimmt der reichste Mann im Dorf. Als Gegenleistung mußte er nicht mehr tun, als ein schwangeres Mädchen als sein Weib mitzunehmen und dafür zu sorgen, daß sie nicht fortlief. Trotzdem wartete er erst ein wenig ab, ehe er einwilligte. Er war nicht dumm. Es gab verdienstvollere Krieger als ihn, und er verstand nicht, warum der König ausgerechnet ihn ausgewählt hatte.
»Es stört dich doch nicht, daß sie das Kind eines anderen erwartet, oder?« fragte der König verwundert, als Faustulus nicht sofort sein Einverständnis erklärte.
»Aber nein«, entgegnete Faustulus ehrlich. »Eine fruchtbare Frau ist gut.« Wäre der König seinesgleichen gewesen, dann hätte er vielleicht noch hinzugefügt: »Wie ein Acker, der schon Früchte getragen hat.« Aber so vertraut mit dem Herrscher der Stadt zu reden brachte er nicht fertig. Er dachte nach, entschied, daß Offenheit am besten wäre, und fragte schließlich: »Warum ich?«
Die Augenbrauen des Königs hoben sich. »Weil du ein treuer Diener und ein ehrlicher Kerl bist, jedenfalls seit ich dir den Viehdiebstahl abgewöhnt habe«, antwortete er schmunzelnd. Faustulus dankte ihm und wußte damit auch nicht mehr als vorher.
Am Abend wanderte er mit ein paar Kameraden durch die Stadt, um seinen Abschied zu feiern. Durch das Geschwätz der Leute entdeckte er, was ihm der König nicht erzählt hatte, und begriff. Das schwangere Mädchen war eine der Tusci-Priesterinnen, obendrein die Nichte des Königs, und sie hatte zuerst behauptet, ihr Kind sei von einem Gott gezeugt worden. Kein Mann der Tusci würde sie danach auch nur mit dem kleinen Finger anfassen. Wenn sie die Wahrheit sprach, dann war es Gotteslästerung, wenn sie log, dann war sie verflucht wegen ihres Eidbruchs, und in jedem Fall bedeutete der Bankert einer Priesterin, Enkel eines Königs, der sich dem Gebot der Götter verweigert hatte, nichts als Ärger.
Faustulus wußte nicht, was er von all dem zu halten hatte.
Das Mädchen sollte ihm erst am Ende der Woche übergeben werden, doch er beschloß, sie sich schon vorher anzuschauen. Die Leute sprachen über nichts anderes mehr, und so hörte er, daß sie morgen, wenn die Sonne am höchsten stand, öffentlich ihres Amtes und ihres Namens entkleidet und danach aus der Stadt verbannt werden würde.
»Wenn ihr mich fragt«, meinte der Wirt der Schenke, in der Faustulus und seine Kameraden am liebsten einkehrten, »hat der König das eingefädelt. Sie hätte Hohepriesterin werden können, sie war doch ständig an der Seite der Edlen Fasti. Jetzt braucht er sich keine Sorgen mehr zu machen, daß irgendwann eine rachsüchtige Nichte für die Göttin spricht.« Er schenkte sich selbst noch etwas ein und fuhr fort: »Bestimmt hat einer von seinen Handlangern sie verführt. Es muß ein Mann des Königs gewesen sein, denn wie hätte er sonst so schnell den Vater finden können? Ihr glaubt doch nicht, daß der sich freiwillig gemeldet hat.«
»Gewiß nicht«, fiel Sico ein und lächelte boshaft. Faustulus hatte nichts von dem schwangeren Mädchen erzählt, nur von dem Vieh, das ihm der König zum Abschied versprochen hatte, doch Sico hatte offenbar die richtige Schlußfolgerung gezogen. »So etwas würde nur ein ausgemachter Trottel tun.«
»Ein Verbrecher, meinst du wohl«, protestierte ein anderer Kamerad schaudernd. »Eine Priesterin schänden – so etwas bringt doch Unglück über Generationen hin. Das würde ich nicht mal tun, wenn sie mir die ganze Stadt dafür hinterherwürfen.«
Faustulus waren die Götter der Tusci zwar unheimlich, aber er hatte seine eigenen Götter, die ihn beschützen würden. Seine Götter gehörten zum Land und waren daher älter als die der Tusci; er erinnerte sich vage, daß ihm sein Großvater erzählt hatte, die Tusci seien nicht immer hier gewesen, sondern erst vor langer Zeit gekommen, von jenseits des Meeres wie die Griechen und die Phönizier, mit denen sie Handel trieben. Also vertraute er auf seine Götter. Dies war gewiß seine letzte Gelegenheit, um zu seinem alten Leben zurückzukehren. Nur wünschte er sich Gewißheit, daß er sich keine Hexe ins Haus holte.
***
Bis auf die Jahresnagelung hatte Faustulus noch nie einer Tusci-Zeremonie beigewohnt, also wußte er nicht, ob die der Verdammung seiner zukünftigen Frau etwas Ungewöhnliches war. Ihm fiel auf, daß die Priesterschaft statt der roten Festtagsgewänder von der Jahresnagelung diesmal weiße Tebennas trug. Sogar ihre Kopfbedeckungen waren weiß. Aber bei dem Reichtum der Tusci mochte es wohl sein, daß ihre Priester für jeden Anlaß anders angezogen waren. Es gab keine Musik wie hei der Jahresnagelung, niemand spielte Flöte oder schlug die Crotali. Doch die Weißgewandeten schritten in der gleichen Anordnung aus dem Tempel heraus auf den Vorplatz, wo sich wohl die halbe Stadt versammelt hatte – drei voran, gefolgt von den anderen sieben. Die Priester der übrigen Schutzgötter der Stadt erschienen in genau der gleichen Ordnung, erst drei, dann sieben.
Es fiel Faustulus nicht schwer herauszufinden, welche die Nichte des Königs war. Sie trug als einzige keine Mitra und stand in der Mitte der sieben aus dem Turan-Tempel. Die drei Frauen an ihrer linken und rechten Seite traten alle einen Schritt zurück, als die drei vor ihnen sich umwandten.
Die Menge, in der er sich befand, wurde still. Er kniff die Augen zusammen und versuchte, das Gesicht des Mädchens besser auszumachen. An ihrer Gestalt ließ sich nichts aussetzen. Man erkannte noch nichts von einer Schwangerschaft; mit den langen Beinen und den gutgeformten Brüsten entsprach sie durchaus seinen Vorstellungen. Er spürte Sehnsucht in sich aufsteigen. Es war lange her, daß er ein Weib gehabt hatte. Wenn er damals mit der Kuh zurückgekommen wäre, hätte es in seinem Dorf ein Mädchen für ihn gegeben, aber er machte sich keine Hoffnungen, daß sie noch auf seine Rückkehr wartete. Ihr Vater hatte sie gewiß längst einem anderen gegeben; so war das Leben. Für einen Unfreien wie ihn bestand hier in Alba zwar die Möglichkeit, sich mit einer Sklavin einzulassen, aber dabei war ihm gewöhnlich kein Glück beschieden gewesen. Ja, es würde gut sein, wieder bei einer Frau zu liegen.
Er schob sich etwas weiter durch das Gedränge vorwärts, und jetzt konnte er auch ihre Gesichtszüge erkennen. Sie schaute starr geradeaus, während eine der Priesterinnen eine lange Rede hielt, von der Faustulus nur die Hälfte verstand. Ein Kinnmuskel zuckte, aber sie öffnete weder den Mund, um selbst zu sprechen, noch schlug sie die Augen nieder, um den auf sie gerichteten Blicken der Menge zu entgehen. Es waren große, dunkle Augen, und unwillkürlich fröstelte ihn, denn der erste Mann, den er je getötet hatte, einer der Krieger des alten Königs, hatte genau so einen Blick gehabt, als er starb.
Bisher hatte er das Mädchen als willkommene Ergänzung zu dem versprochenen Vieh betrachtet und gehofft, daß sie trotz des Geredes der Leute nichts Böses an sich hatte, aber jetzt fragte er sich zum ersten Mal, was sie über das Geschehene dachte. Er kannte sich mit Einsamkeit und verlorenen Hoffnungen gut aus, aber er hatte noch nie ein so einsames Wesen gesehen wie das Mädchen, das er heiraten sollte, und mit einemmal wurde ihm bewußt, daß er noch nicht einmal ihren Namen kannte. Sie war ihm immer nur als »das Mädchen«, »die Nichte des Königs« oder »die Priesterin« bezeichnet worden.
Die kleine, sehnige Frau, welche die ganze Zeit gesprochen hatte, war am Ende ihrer Rede angelangt und winkte einer anderen, die ihr einen Holzkasten übergab. Die Rednerin tauchte ihre Finger hinein, zog sie wieder heraus und berührte das Mädchen einmal auf jeder Wange, was jeweils einen langen roten Streifen hinterließ.
»Du bist nicht länger Priesterin der großen Göttin Turan«, verkündete sie, und diesmal verstand Faustulus sie klar und deutlich. »Du hast keinen Namen mehr. Du hast kein Volk mehr. Mögen die Götter dir gnädig sein.«
Das Mädchen rührte sich nicht. Einen Moment lang fragte sich Faustulus, ob sie nun alle gehen und sie so stehenlassen würden. Dann trat einer der Hauptleute des Königs vor und bedeutete ihr, ihm zu folgen. Sie rührte sich noch immer nicht, und die Menge geriet in Unruhe. Die Priesterin, die gesprochen hatte, sagte noch etwas, aber zu leise, als daß Faustulus es hätte verstehen können. Abrupt wandte sich das Mädchen ab und ließ sich von den Waffenträgern fortbringen, während die Priesterin der Menge verkündete, sie werde jetzt das Sühnegebet sprechen, dessen man auch dringend bedürfe, da dieser Frevel doch ausgerechnet in dem der Göttin geweihten Monat Turanae geschehen sei. Faustulus hatte genug, und auch er brach in Richtung Palast auf.
***
Er verstand nicht, warum er noch einen Tag warten mußte, statt gleich mit dem Mädchen aufbrechen zu können, aber es hing wohl mit einer weiteren der vielen Tusci-Zeremonien zusammen. Oder der König hatte genügend Mitleid mit seiner Nichte, um verhindern zu wollen, daß ihr die Straßenjungen nachliefen, wenn sie die Stadt verließ, und wählte daher einen anderen Tag. Wie dem auch sein mochte, als Faustulus das Mädchen wiedersah, geschah es am kleinsten der drei Stadttore, dem, durch das die Bauern und Hirten zum Markt kamen. Wie versprochen, warteten dort zehn Schweine und zwei Kühe auf Faustulus und außerdem ein kleiner Holzkarren voller Gerätschaften, alles bewacht von demselben Rasna-Krieger, der gestern das Mädchen eskortiert hatte.
»Der König kommt gleich«, meinte der Mann. »Rühr dich nur nicht vom Fleck. Nicht daß du auf die Idee kommst, mit dem Viehzeug und ohne das Mädchen zu verschwinden.«
»Ich weiß, was vereinbart ist«, antwortete Faustulus gekränkt.
Der Krieger grunzte. »Einmal ein Viehdieb, immer ein Viehdieb.«
Während sie warteten, untersuchte Faustulus die Tiere. Sie waren allesamt gut genährt, und die prallen Euter der Kühe verrieten, daß man sie heute noch nicht gemolken hatte. Bei den Schweinen handelte es sich um eine Sau und ihren Wurf. Die Ferkel alle in eine Richtung zu treiben würde nicht einfach sein, aber er hatte Zeit. Niemand in seinem Dorf wußte, daß er zurückkehren würde, und die Überraschung über die Reichtümer, die er brachte, würde allen den Atem verschlagen, ganz gleich, wann er eintraf.
Er kniete gerade neben einer der Kühe, um ihre Hufe zu begutachten, als der Krieger sich räusperte und ihm zuraunte, der König sei da. Faustulus stand hastig auf und sah sich nicht nur dem König, sondern auch dessen Nichte gegenüber. Heute trug das Mädchen ein einfaches braunes Wollkleid. Faustulus fragte sich, ob sie es selbst gewebt hatte, wie die Frauen in seinem Dorf. Es entsprach in seiner Schlichtheit nicht gerade dem, was die Adligen der Tusci sonst trugen, was ihn erleichterte, denn so würden sie nicht sofort unliebsame Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Lediglich die Spangen, die das Kleid über ihren Schultern zusammenhielten, waren aus viel zu fein gearbeiteter Bronze, als daß sich eine Landfrau dergleichen hätte leisten können. Sie trug ein kleines Bündel, einen ledernen Sack, und schaute mit dem gleichen starren Blick wie gestern ins Nichts. Er ertappte sich dabei, wie er versuchte, ihre Augen auf sich zu ziehen, um ihr beruhigend zuzulächeln.
»Faustulus«, sagte der König, »hiermit übergebe ich dir deine Braut. Sei gut zu ihr.«
Der Blick des Mädchens verlor seine Starrheit, aber er richtete sich immer noch nicht auf Faustulus. Stattdessen beobachtete er, wie das Leben in sie zurückkehrte, als sie mit einer Stimme voll Zorn zu ihrem Onkel sagte: »Verschone mich wenigstens mit deiner Heuchelei.«
»Es tut mir leid«, erwiderte der König. »Aber du hast mir keine andere Wahl gelassen.«
Das Mädchen lachte, ein kurzes, bitteres Lachen, in dem nicht ein Funken Erheiterung lag. Die Stirn ihres Onkels umwölkte sich.
»Mach keine Dummheiten, Talitha«, sagte er scharf, und einen Moment lang dachte Faustulus, das sei ihr Name, bis ihm wieder einfiel, daß »Talitha« in der Sprache der Tusci für ein junges Mädchen stand, das verheiratet werden sollte. »Und geh nicht nach Tarchna. Dein Vater hatte ohnehin Glück, dort Obdach zu finden, und er wird es dir nicht danken, wenn du ihm einen weiteren Fluch ins Haus bringst, das weißt du.«
Das Mädchen schüttelte den Kopf, erwiderte aber nichts mehr, und erneut begann sich die Starrheit über seine Züge zu legen. Um das zu verhindern, fragte Faustulus rasch: »Wie soll ich dich nennen?«
Da schaute sie ihn endlich an. In diesem ersten Blick, den sie ihm schenkte, lag Feindseligkeit, doch es war eine Abneigung eher unpersönlicher Art, wie man sie etwa für eine allzu lange Dürre empfand oder für einen Händler, der einen zu übervorteilen versuchte; sie glich in nichts dem leidenschaftlichen Haß, den sie gerade ihrem Onkel gegenüber gezeigt hatte.
»Gibst du diesen hier« – sie machte eine Handbewegung in Richtung Vieh – »denn Namen? Wenn ja, dann kannst du mir auch einen geben. Schließlich hast du mich zusammen mit ihnen bekommen, und mein eigener Name wurde mir genommen.«
Der König schloß kurz die Augen, dann nickte er dem Krieger zu und verschwand, ohne ein weiteres Wort mit seiner Nichte oder Faustulus zu wechseln. Faustulus lag es auf der Zunge, zu antworten, der Verlust ihres Namens tue ihm leid, doch er ließ es sein. Er hatte das Gefühl, daß sie für weitere Mitleidsbekundungen nicht empfänglich sein würde.
Bei den Latinern trugen Frauen den Namen ihrer Väter und später auch den ihrer Gatten; er wußte allerdings, daß es die Tusci anders hielten. Wenn sie erst in seinem Dorf waren, würde sie von allen Faustula genannt werden, aber er hielt es für unklug, ihr das jetzt schon zu sagen. Er wollte sein Zusammenleben mit ihr versöhnlich beginnen, und so war es ihm ernst damit, sich später einen Namen für sie auszudenken »Und nun«, schloß er beschwichtigend, »laß uns gehen.«
Sie schaute von den Schweinen zu den Kühen und dann wieder zu ihm, mit derselben stetigen, unpersönlichen Abneigung. Dann schulterte sie achselzuckend den Lederriemen, an dem ihr Beutel hing, und folgte ihm.
***
Wie Faustulus erwartet hatte, kamen sie nur sehr langsam vorwärts, und seine Vermutung, daß die vor sich hin brütende Nichte des Königs nicht die geringste Ahnung davon hatte, wie man Vieh trieb, bestätigte sich. Schließlich meinte er ärgerlich, wenn sie nicht auch etwas auf die Tiere achtgäbe, werde er sie »Stulta« nennen, was in seiner Sprache Dummkopf bedeute, denn ohne die Tiere wären sie nichts als Bettler.
Sie wirkte aufrichtig verblüfft, als sie zurückfragte: »Und was, glaubst du, sind wir jetzt?«
Das machte ihm einmal mehr klar, wie sehr sich die Welt, aus der sie kam, von der seinen unterschied. Immerhin hatte sein Vorwurf sie aus ihrer Grübelei gerissen. Von Zeit zu Zeit ertappte er sie dabei, wie sie ihm einen prüfenden Blick zuwarf.
Endlich sagte sie: »Wenn du den Auftrag hast, mich umzubringen, sobald wir weit genug von der Stadt entfernt sind, dann tu es gleich.«
Das entsetzte Faustulus genug, um ihn auf der Stelle innehalten zu lassen. »Das habe ich nicht!« erklärte er bestürzt. »So etwas würde ich nie tun.«
All seine alten Vorbehalte gegenüber den Tusci, die während der zwei Jahre in ihrer Mitte eingeschlafen waren, flackerten wieder auf. Eine schwangere Frau zu töten war der schlimmste Verstoß gegen alle Gesetze von Göttern und Natur, der sich denken ließ, und nur Dämonenanbeter brachten dergleichen fertig.
Das Mädchen neigte den Kopf leicht zur Seite, runzelte die Stirn und meinte nachdenklich: »Wenn dem so ist, dann tut es mir leid, daß ich dich gefragt habe. Aber ich kenne dich nicht, und ich vertraue niemandem mehr.«
Das blieben für Stunden ihre letzten Worte, und auch er fühlte sich nicht mehr zum Sprechen aufgelegt. Sie verwirrte ihn. Sie tat ihm leid, sie machte ihm angst, und er begann zu ahnen, daß er sich mehr eingehandelt hatte, als gut für ihn war.
Als sie gegen Mittag immer weiter zurückblieb, fand er eine Stelle etwas abseits des Weges, wo sie rasten konnten. Er erinnerte sich dunkel, daß es in der Nähe einen Bach gab, suchte eine Weile und fand ihn schließlich, nicht zuletzt dank der Ferkel. Wegen der Hitze gab es nur noch ein Rinnsal, aber das genügte den Ferkeln, um sich mit Begeisterung darin zu suhlen. Das Mädchen ging etwas weiter bachaufwärts, um zu trinken, dann band sie mit sichtlicher Erleichterung ihre Sandalen los und ließ die Füße in das Naß sinken. Während er sie beobachtete, fiel von dem Lorbeerbaum, unter den sie sich gesetzt hatte, ein Blatt herab und verfing sich in ihren braunen Locken. Faustulus lächelte und beschloß, sie Larentia zu nennen. Dann holte er einen Eimer aus dem Karren und machte sich daran, eine der Kühe zu melken.
Als er mit dem Eimer zu ihr kam, stand in den Augen des Mädchens erstmals weder Mißtrauen noch Abneigung, sondern nur Hunger. Sie dankte ihm und trank so gierig von der Milch, daß er sich unwillkürlich fragte, wann sie zum letzten Mal etwas gegessen hatte. Danach saßen sie eine Weile friedlich nebeneinander, und er nannte ihr ihren neuen Namen. Sie wirkte weder erfreut noch gekränkt, aber immerhin fragte sie nach dem seinem und wollte wissen, wie lange er in Alba gelebt hatte. Ihr vorsichtiger Versuch, eine Unterhaltung zu führen, ging so lange gut, bis er sie fragte, wer der Vater des Kindes sei. Er meinte dies nicht als Vorwurf, doch er wollte wissen, wessen Kind er aufziehen würde und warum der Mann sie nicht selbst zum Weib genommen hatte. Es war ein Fehler. Mit einemmal zog sie sich in ihre eisige Erstarrung zurück.
»Es war ein Gott«, sagte sie kalt.
Nun hatte Faustulus in seiner Kindheit zwar durchaus Geschichten von Kindern der Götter mit Menschenfrauen gehört. Er kannte auch die Erzählung vom Fürsten Tarchetius, in dessen Haus urplötzlich ein männliches Glied aus dem Herd gewachsen war, woraufhin ihm geweissagt wurde, die Jungfrau, die sich von diesem Glied begatten lasse, werde einen Helden gebären. Sein Großvater hatte geschworen, der Dienerin des Tarchetius, die von diesem Phallos ein Kind bekommen hatte, persönlich begegnet zu sein. Dennoch, diese Legenden mit dem staubigen, erschöpften Mädchen in Verbindung zu bringen, das neben ihm saß, war ihm einfach unmöglich. Er erwiderte nichts, doch sie merkte ihm offenbar seine Ungläubigkeit trotzdem an.
»Was versteht ein Barbar wie du schon von den Göttern und ihren Plänen für uns!« stieß sie hervor und stand auf.
Für den Rest des Tages sprach sie nicht mehr mit ihm. Da sie nun durchaus darauf achtete, die Schweine beisammen zu halten, gab es keinen Grund, sie zu tadeln, und so sprach er auch nicht mehr mit ihr. Er versuchte alle Ansiedlungen, die er kannte, zu umgehen, denn bis auf seine eigenen Leuten traute er jedem zu, ihm seine Tiere und sein neues Weib zu stehlen. Als sie sich seinem Dorf näherten, noch ehe die Sonne unterging, fiel ihm ein Stein vom Herzen, und die Vorfreude darauf, endlich wieder unter Freunden und Familienangehörigen sein zu können, beflügelte seinen Schritt. Erst nach einer Weile fiel ihm auf, daß auf jedem Acker, an dem sie vorbeikamen, das Unkraut wucherte. Keines der Felder machte den Eindruck, als sorge sich jemand darum, und es war Hochsommer.
Eine böse Ahnung überfiel Faustulus, aber er konnte es noch nicht glauben. Ohne auf das Vieh, den Karren oder das Mädchen Rücksicht zu nehmen, rannte er aus Leibeskräften auf das Dorf zu. Er wollte es nicht wahrhaben, bis er inmitten der längst verlassenen Hütten stand, in denen schon seit mindestens einem Jahr niemand mehr gelebt hatte. Statt des üblichen Lärms von Mensch und Tier hörte man lediglich die Grillen zirpen und ab und zu das Klappern einer unverriegelten Tür, die von der leichten Abendbrise gegen ihren Rahmen gedrückt wurde. Betäubt ging er in eine der Hütten, in der früher sein bester Freund Ancus mit seiner Familie gelebt hatte, und fand nichts als Leere vor. Er lief zum Haus des reichsten Mannes im Dorf, Mamulius, und begegnete nur den Vögeln, die sich dort eingenistet hatten. Es gab keine Leichen oder neuere Gräber; es schien nicht so, als ob sie alle gestorben wären. Aber sie hatten hier nicht mehr leben können, und so waren sie fortgezogen, und Faustulus, mit dessen Rückkehr niemand mehr gerechnet hatte, wußte nun nicht, wohin.
Es hatte Zeiten gegeben, in denen er geglaubt hatte, nie wieder nach Hause zu kommen. Dann hatte es Zeiten gegeben, in denen er sicher war, daß es nur noch eine Frage von Wochen sein würde. Aber nie hatte er daran gezweifelt, daß sein Dorf, seine Freunde, seine Eltern und Geschwister noch genau dort sein würden, wo er sie zurückgelassen hatte. Und seit dem Angebot des Königs hatte er sich seine Ankunft hier ausgemalt, die Freude der anderen, wenn sie ihn sahen, wenn sie begriffen, mit welchen Gaben er zurückkehrte. Nun zerfiel sein Traum vor seinen Augen zu Asche, so kalt wie die, die der Wind im letzten Jahr von Mamulius' Feuerstelle durch den gesamten Raum geblasen haben mußte. Er stand da und versuchte es zu fassen, als er gewahr wurde, daß er kaum noch etwas im Raum erkennen konnte. Offensichtlich ging die Sonne unter. Ihm wurde bewußt, daß er eines der Gatter notdürftig wiederherstellen mußte, um die Schweine darin unterzubringen. Um sich selbst und das Mädchen machte er sich keine Sorgen, sie konnten in eine der Hütten gehen. Es gab ja, sagte er sich bitter, eine genügend große Auswahl. Dann fiel ihm ein, daß er seine neue Frau mit dem Vieh noch vor dem ersten Haus des Ortes zurückgelassen hatte. Wenn ihn das Pech weiterverfolgte, dann hatte sich die Sau mit den Ferkeln irgendwo verkrochen, wo sie nie mehr jemand finden würde, und das Mädchen desgleichen. Er hoffte nicht, daß sie so töricht wäre, in der Dunkelheit fortzurennen, aber er kannte sich mit den Frauen der Tusci nicht aus. Vielleicht neigten sie zu Verrücktheiten, und das war auch der Grund, warum sie so auf ihrer Geschichte mit dem Gott beharrte.
Hastig trat er wieder ins Freie und dankte den Göttern für den klaren Himmel. Der Mond hatte sein Gesicht zwar schon zur Hälfte abgewandt, aber die Dämmerung bot noch genügend Licht, um sich umschauen zu können.
Das Mädchen stand, ohne die Karre, aber neben einer der Kühe, an eines der Häuser gelehnt. »Sie... sind fort, Larentia«, sagte Faustulus hilflos und gebrauchte erstmals den Namen, den er für sie ersonnen hatte. »Alle Menschen, die ich je gekannt habe, sind fort.«
Gleich darauf hätte er sich am liebsten auf die Zunge gebissen. Er hatte nicht vergessen, wie sie ihn einen Barbaren genannt hatte. Wahrscheinlich würde sie jetzt schnippisch bemerken, das könne sie selbst sehen. Er hätte sie lieber fragen sollen, wo die Schweine und die andere Kuh mit dem Karren steckten.
Sie überraschte ihn. »Ich verstehe«, murmelte sie, sank in die Hocke und legte ihren Kopf auf die Knie. »Das verstehe ich nur zu gut.«
Ihm fiel wieder ein, wie einsam sie ihm inmitten der Menge erschienen war, und er kniete neben ihr nieder. Sie hatte auch ihre Welt verloren. Plötzlich war er auf eine Weise froh, daß sie hier war, die nichts mit seinem Hunger nach einer Frau zu tun hatte; nach dem langen Marsch und der bitteren Enttäuschung fehlte ihm ohnehin die Lust, seine Ehe sofort zu vollziehen. Doch er hätte es nicht ertragen, ausgerechnet in dieser Nacht allein zu sein, und er vermutete, daß es ihr ebenso erging.
»Morgen«, meinte er bedrückt, »morgen können wir überlegen, was zu tun ist. Jetzt sollten wir die Tiere für die Nacht versorgen.«
In der Dämmerung konnte er sich nicht ganz sicher sein, aber ihm war, als zuckten ihre Mundwinkel und er sähe sie zum ersten Mal lächeln. Nur ein angedeutetes, schiefes Lächeln, doch immerhin ein Lächeln.
»Du hängst wirklich an diesen Schweinen«, stellte sie fest.
Er wußte zwar nicht, warum sie das belustigte, doch er nickte. »Und den Kühen«, entgegnete er sachlich. »Die Kühe sind unser wichtigster Besitz.«