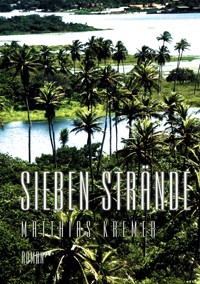
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: BoD - Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Nachdem er einige Seiten vollgeschrieben hatte, lächelte er zufrieden und legte den Block zurück auf den Tisch. Der Abend war noch jung, aber es war dunkel und in der Ferne war nichts zu sehen, außer tausende von kleinen Lichtern auf dem Festland. Hinter sich hörte er das leise Klappern der sich öffnenden Terrassentür und sofort wurde die Stille von einem lauter werdenden Gemurmel unterbrochen. Er spürte eine Hand auf seinem Rücken, die ihn zärtlich berührte und dann sanft seinen Nacken drückte. Ein leichter Kuss folgte und er roch den vertrauten Duft. "Kommst du?", fragte er. "Die Leute warten schon, sie haben nach dir gefragt." Er drehte sich zu ihm um und lächelte. "Ich komme." "Gut, wir freuen uns!" Dann entfernten sich die Schritte. Spontan griff er nach dem Block. 'Unter Palmen geht es mir besser', schrieb er und unterstrich den Satz. Dann legte er den Block wieder hin, stand auf, schloss die Terrassentür hinter sich und mischte sich unter die anderen. 'Sete Praias', auf Deutsch 'Sieben Strände, ist ein Ort und auch Ausgangspunkt der Geschichte. Er symbolisiert auch die Lebensstationen dieses Mannes, die Wendepunkte, die er durchlebt hat: Als kleiner Junge bis in die Gegenwart der Erzählung, als er beschließt, jemanden aufzusuchen, den er vor langer Zeit aus den Augen verloren hat. Einst war er sein bester Freund, beide wuchsen in der Metropole São Paulo auf. Sie waren unzertrennlich. Doch es wird ein Wiedersehen mit Folgen, das das Leben beider auf den Kopf stellt.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 1033
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
In Gedenken an Mike, der uns viel zu früh und unerwartet verlassen hat.
Inhaltsverzeichnis
Am Anfang
Teil Eins
1 Die Kanzlei
2 Blaumachen
3 In Sete Praias
4 Schulferien
5 Der Wintergarten
6 Der Mann im Rollstuhl
7 Nackt
8 Glanz und Glitzer
9 ›The Carpet Crawlers‹
10 Die Trillerpfeife
11 Spuren Beseitigen
12 Ein auffällig roter Bettbezug
13 Seite an Seite
14 ›Durchgang Verboten!‹
15 Hausaufgaben
16 Der Leuchtturm
Teil Zwei
17 «Nimm einen Joint Mein Freund»
18 Eine einsame Bucht
19 ›Es gibt keinen Ort weit weg‹
20 Wie eine gierige Spinne
21 Ärger im Paradies
22 Der amerikanische Tourist
23 Ein Rucksack voller Bücher
24 Die alte Akte
Teil Drei
25 Gestörte Komfortzone
26 Bauchschmerzen
27 Miteinander und auseinander
28 Der steinige Weg zurück
29 Ein Junge der ein rot kariertes Flanellhemd trägt
Am Ende
Der Strand
Am anderen Ende
In eigener Sache (Danke!)
Anhang
Am Anfang
Das Meer verschwand in der Unendlichkeit des Horizonts, wo Himmel und Wasser verschmelzen und nicht mehr zu unterscheiden sind. Und das immer dunkler werdende Blau des Himmels, gemischt mit dem rötlichen Licht der letzten Stunde vor Einbruch der Dunkelheit, spiegelte sich in Abermillionen von kleinen und großen Wellen im Spiel des Wassers. Ein wunderschönes Bild. Möwen schrien laut, während sie hoch über dem Gewässer schwebten, oder segelten lautlos im Wind und erweckten den Eindruck, als würden sie ihre Flugfähigkeit bis zum Äußersten ausnutzen, um uns Menschen zu zeigen, dass uns eine wesentliche und große Gabe fehlt: das Fliegen. Während er den Vögeln zusah, stellte er sich vor, was sie an Freude und Frieden empfanden. Wie gerne würde er durch die Luft fliegen und von oben aus in Ruhe auf sein Leben herabschauen, während er sanft dahintreibt. Einfach wie ein Vogel aufbrechen. Der Nachmittag neigte sich dem Ende zu. Er hörte das Tor aufgehen und ein Auto wegfahren, und lächelte, als er erkennen musste, dass es nur das ›Jetzt‹ gibt. Noch am Morgen, als er die Augen öffnete, war dieser Moment nicht anders als die Tage davor, außer einer Kleinigkeit: Es war sein Geburtstag. Nichts Besonderes oder Wichtiges für ihn. Als kleiner Junge hatte er es noch aufregend gefunden, einmal im Jahr im Mittelpunkt zu stehen, all die Geschenke, die liebevoll vorbereitete Feier, das war schon etwas. Aber jetzt empfand er das Älterwerden als etwas Unangenehmes, ja Beängstigendes, die Zeit verging schnell, immer schneller. Eine persönliche Apokalypse im Zeitraffer, so empfand er diesen Zustand der Zeitbeschleunigung des Alters. Er dachte an seinen Vater, den er in seiner Jugend als alten Mann betrachtet und mit Respekt und Ehrfurcht wahrgenommen hatte. Nun hatte er selbst das damalige Alter seines Vaters um einige Jahre überschritten. War er deshalb ein anderer Mensch, empfand er anders, waren die vergangene Zeit und die gesammelten Erfahrungen etwas, was ihm Respekt und Ehrfurcht einflößte? Nein, so war es nicht. Wie sahen ihn die Menschen, die ihn schon lange kannten? Als einen alten, weisen Mann? Eher nicht. Er war derselbe Junge von damals, die grauen Schläfen begannen sich zu zeigen, sein Körper war nicht mehr so straff und schlank, aber er war derselbe Mensch. Erfahrener, aufgeklärter, sicher, viele Fragen waren beantwortet, aber einige Unsicherheiten blieben. Gedankenverloren starrte er wieder in die Ferne und atmete die Ruhe ein, es war lau und schön, eine angenehme und entspannte Stimmung, die ideale Voraussetzung für sein Vorhaben. Schon als Kind hatte er gerne Kurzgeschichten und Aufsätze geschrieben, später hatte er es zu seinem Beruf gemacht. Und so nahm er Block und Bleistift von dem kleinen Tisch neben sich, atmete tief durch und setzte an.
›Saudade‹, begann er zu schreiben, ›dieses wunderschöne Wort der brasilianischen Sprache. Alles ist saudade, alles ist diese unbeschreibliche Sehnsucht, dieses ewige Fehlen von etwas, mein Leben, das von diesen Schwingungen der Melancholie durchzogen ist. Wie der Sand am Meer, der durch das Kommen und Gehen der Wellen vom Meerwasser durchtränkt wird, so ist mein Wesen von diesem ständigen Weltschmerz bestimmt, von dieser großen Sehnsucht, von den Zweifeln, von den Ängsten in mir, das bin ich‹, schrieb er. Das wäre seine Geschichte. Klingt banal? Vielleicht. Aber es war ihm wichtig, sie zu erzählen. ›Ich habe keine Revolution angezettelt, keine Bank überfallen, keine große wissenschaftliche Entdeckung gemacht, ich bin weder extrem reich noch sehr arm geworden‹, fuhr er fort. ›Ich habe niemanden umgebracht und war auch nicht Gast in einem Raumschiff, das unbemerkt hier gelandet ist. Nein, nichts dergleichen, es ist meine Geschichte und ich schreibe über die Ereignisse und Menschen, die mich geprägt haben. Aber auch schreibe ich über das Scheitern, über die Unvollkommenheit der Dinge. Vor allem schreibe ich über einen Jungen, den ich einmal getroffen habe, der ein Teil von mir geworden ist und den ich immer wieder aus meinem Leben verbannt habe‹.
Nachdem er einige Seiten vollgeschrieben hatte, lächelte er zufrieden und legte den Block zurück auf den Tisch. Der Abend war noch jung, aber es war dunkel und in der Ferne war nichts zu sehen, abgesehen von kleinen Lichtern auf dem Festland. Die Möwen waren längst verstummt, über seinem Kopf summten Insekten in der Glühbirne. ›Eigentlich ist alles wie immer‹, dachte er. Hinter sich hörte er das leise Klappern der sich öffnenden Terrassentür und sofort wurde die Stille von einem lauter werdenden Gemurmel unterbrochen. Er spürte eine Hand auf seinem Rücken, die ihn zärtlich berührte und dann sanft seinen Nacken drückte. Ein leichter Kuss folgte und er roch den vertrauten Duft. «Kommst du?», sagte er. «Die Leute warten schon, sie haben nach dir gefragt.»
Er drehte sich zu ihm um und lächelte. «Ich komme.»
«Gut, wir freuen uns!» Dann entfernten sich die Schritte wieder.
Spontan griff er zum Block. ›Unter Palmen, dachte er, geht es mir besser‹, schrieb er und unterstrich den Satz. Dann legte er den Block wieder hin, stand auf, schloss die Terrassentür hinter sich und mischte sich unter die anderen.
Teil Eins
1.Die Kanzlei
Das schrille, laute Klingeln des Telefons reißt mich aus dem Tiefschlaf, die elektronische Stimme am anderen Ende der Leitung begrüßt mich mit «Guten Morgen, 9 Uhr, Ihr Weckruf, wir wünschen Ihnen einen schönen Tag». Ich will noch nicht aufstehen, drehe und wälze mich hin und her, schläfrig, lustlos, bis mir nichts anderes übrig bleibt, als aus dem Bett zu steigen. Ich zwänge mich in das fensterlose, aber geräumige Badezimmer, mein Gegenüber im Spiegel hat ein blasses, müdes Gesicht. Ich rasiere mich, putze mir die Zähne, steige unter die Dusche. Das alles macht mich nicht wirklich munter, ich fühle mich immer noch schläfrig und lustlos, das Bild im Spiegel hat sich nicht wesentlich verändert, blass. Das bin ich, nach einem unruhigen, schlaflosen, elfstündigen Flug. Ich, vor zwei Monaten vierzig geworden und zurück in der Stadt, in der ich einmal zu Hause war, im Zimmer 1512 des Hilton-Hotels im Zentrum von São Paulo.
Auf meiner Zimmerkarte steht die Frühstückszeit: bis 10.30 Uhr. Als ich kurz vor Schluss den Frühstücksraum betrete, bin ich einer der letzten Gäste, die Kellner sind eilig dabei, die Tische abzuräumen. Als ich mir einen Tisch nehme und einen schwarzen Tee bestelle, begrüßt mich der Kellner mit gespielter Freundlichkeit und versteckter Verärgerung und schaut mich von der Seite an. Der Tee schmeckt etwas lau, aber der Geschmack einer reifen Papaya weckt in mir ein Gefühl von Lebendigkeit. Nach einer weiteren Papaya und einer Tasse Tee beende ich mein Frühstück und mache mich auf den Weg zur Rezeption.
In einer Stunde ist mein Termin. Ob die Zeit wohl reicht, um die halbe Stadt zu durchqueren? Unpünktlich will ich nicht sein, gespannt auf das, was mich erwartet, bin ich auch. An der Rezeption nehme ich mir ein Faxformular, setze mich in die Lobby und schreibe Doro eine Nachricht: dass ich gut angekommen bin, dass alles in Ordnung ist und dass sie mir fehlt.
Das Mobiliar und die Einrichtung des Hotels mischen Stile aus den Siebzigern und Achtzigern mit Teppichen in Orange- und Brauntönen und einigen grellen, kunstvoll gerahmten Postern, die eher an schlechte Pop-Art erinnern. Der Gesamteindruck ist wie ein Déjà-vu, es hat sich nicht viel verändert, auf diesem Sessel in der Lobby habe ich bestimmt schon mal gesessen, mein Vater hat hier oft Geschäftspartner empfangen und besucht. Die modern umgebaute Rezeption in der Mitte des Eingangsbereichs wirkt dagegen wie aus der Gegenwart. Die Mitarbeiter dort sind männlich und jung, fast alle in Gespräche vertieft oder am Telefon. Doch einer fällt mir auf, er steht etwas abseits am Tresen und ist nicht beschäftigt. Sofort kommt er auf mich zu, freundlich und zuvorkommend, als ich ihm das ausgefüllte Formular zum Abschicken gebe, lächelt er einstudiert und nimmt es mit ins Büro. Ich warte ein paar Minuten, dann bekomme ich das Fax mit dem Sendeprotokoll zurück. Ich bedanke mich und verabschiede mich, wir tauschen Blicke aus. Es sind diese leicht zweideutigen Blicke, die etwas länger anhalten. Für mich irritierend und angenehm zugleich, wann habe ich das letzte Mal mit einem Mann geflirtet? Trotz meiner Müdigkeit scheine ich zu wirken. Ach was, ich bin in Brasilien, hier wird ständig geflirtet ...
Der Portier öffnet mir die Tür und winkt ein rot-weißes Taxi Especial vor den Eingang. Ich steige ein und werde mit einem Kopfnicken begrüßt. Ich muss nach Santo Amaro, sage ich. Aus meiner Jacke ziehe ich den gefalteten Zettel mit der Adresse. «Rua João Barroso, 110, am Rande von Santo Amaro.»
Der Fahrer nickt. «Ich weiß, wo das ist», antwortet er und meldet seine Fahrt per Funk an die Zentrale.
São Paulo ist ein Dschungel der Neuzeit. Wohin man schaut, nur Beton, Menschen, Autos. Alles in Eile, alles in Hektik. Damals, als ich hier lebte, hatte ich mich an den Schmutz gewöhnt, an die Menschen, die auf Pappkartons am Straßenrand ausharrten, an die bettelnden Kinder, die streunenden Hunde, die Händler an den Ampeln. Während sich das Taxi stockend durch den Verkehr der Innenstadt quält, nehme ich diese Details nicht mehr als alltäglich wahr, sondern spüre die Hitze, der schlechte Geruch steigt mir in die Nase, der Smog liegt wie ein grauer Schleier über der Stadt. Ich öffne das Fenster, sofort fragt mich der Fahrer, ob er die Klimaanlage einschalten soll.
Meine letzten drei Besuche in der Stadt waren geschäftlicher Natur und daher sehr kurz und oberflächlich. Diesmal soll es anders sein, ich habe mir ein paar Tage Urlaub genommen. Es wäre schön, Julia zu sehen, meinen Vater und seine Frau, vielleicht auch Anja. Oder meinen Bruder, wenn er mich treffen will. Etwas in Gedanken versunken, überhöre ich die Fragen des Taxifahrers. Erst als er wiederholt, fast aufdringlich und neugierig fragt, reagiere ich. São Paulo würde mir gefallen, ja, aber für immer möchte ich hier nicht leben, meine ich. Wo ich wohne? In Rom. Auch hektisch und heiß, aber anders, antworte ich. Die Stadt hat viel Geschichte, eine große Vergangenheit. Sein Urgroßvater war auch Italiener, sagt der Fahrer. Ich bin kein Italiener, sage ich. Ich bin Deutscher, aber ich lebe und arbeite in Rom. Deutscher? Warum ich so gut Brasilianisch spreche, ohne Akzent, wundert er sich. Ich bin hier aufgewachsen, antworte ich. Hätte jetzt wieder viel zu tun, Leute zu besuchen. Wie lange ich hier sein werde? Eine Woche, antworte ich. Wieder wundert er sich, dass ich so akzentfrei spreche.
Ich schaue aus dem Fenster und fühle mich wie auf einer Reise, auf der ich vergangene und vertraute Bilder in mich aufnehme. All die Momente, die wie Blitzlichter durch das Taxifenster an mir vorbeiziehen, all die Autos, die Menschen, die Wolkenkratzer. Einige dieser Gebäude sind noch in meiner Erinnerung. Wie oft bin ich diese Strecke schon gefahren? Ob ich die Straßen noch kenne, fragt mich der Fahrer. Einige schon, antworte ich. Er lächelt. Dann schaltet er das Radio ein und summt leise ein Lied mit, merkt, dass ich nicht gesprächig bin.
Schneller als gedacht sind wir in Santo Amaro. Ich bezahle und bedanke mich beim Fahrer. «Alles Gute, viel Spaß noch in São Paulo und viel Glück in Rom», wünscht er mir. Ich stehe vor einem dunkelbraunen Hochhaus, gebaut im Stil der 70er Jahre: etwa 15 Stockwerke hoch, geometrische, gleichmäßige, nüchterne Formen, wie man sie oft in der Stadt sieht. Eine kleine Rampe und ein paar Stufen führen zum Pförtner am Eingang, der mich bei der Anwaltskanzlei anmeldet. Er schickt mich in den siebten Stock.
Als ich klingele und der Türöffner die Haustür öffnet, stehe ich in einem kurzen Flur mit einer Pendeltür aus Milchglas, auf der in großen schwarzen Buchstaben ‹Rodrigues & Filho, advogados‹ steht. Der Empfangsbereich der Kanzlei ist dunkel und wirkt wie aus einem alten Film. Die mollige, lächelnde Sekretärin bittet mich, im Wartezimmer Platz zu nehmen, der Termin sei in einer Viertelstunde, Herr Rodrigues käme gleich. Sie weist mir den Weg.
Im Wartezimmer sitzt nur ein Ehepaar, sonst niemand. Neugierig betrachte ich den jungen Mann mit dem runden Gesicht und dem schütteren blonden Haar und die hagere, aber hübsche Frau, die seine Hand hält. Es ist Maximilian, Ingrids Sohn. Ich habe ihn zuletzt als Kind gesehen, als Mann hat er einige seiner markanten Gesichtszüge behalten. Ich gehe auf ihn zu. «Maximilian?»
Er blickt zu mir auf und sein Gesichtsausdruck verändert sich, wirkt hart, aber keineswegs überrascht oder neugierig. «Guten Tag, Robert.» Seine Stimme klingt emotionslos, er schüttelt mir die Hand. Der Händedruck ist kräftig, aber schweißnass. «Das ist meine Frau Suzana.» Sie reicht mir die Hand, lächelt unverbindlich, ohne etwas zu sagen. Sicher haben sie sich schon über mich unterhalten.
«Mensch, Maximilian, es ist eine Ewigkeit her, und doch hast du dich nicht sehr verändert.» Ich lächle.
Sein Blick weicht stumm aus. Da er keine Lust auf ein Gespräch hat, belassen wir es dabei. Wir hatten nie viel mit ihm zu tun, eigentlich mochte er keinen von uns aus der Familie Brunner.
Als kurz darauf der Anwalt Rodrigues den Raum betritt, begrüßt er jeden von uns überschwänglich freundlich mit einem kräftigen Händedruck. Er bittet uns, in dem kleinen Besprechungszimmer Platz zu nehmen. Der Raum ist heller als das Wartezimmer und wird von Halogenlampen erhellt. Die Luft steht, es ist sehr warm. Die Sekretärin schenkt Kaffee und Mineralwasser ein. Ich kenne ihn von früher, er war Ingrids Anwalt, als sie und mein Vater sich scheiden ließen. Er hat sich nicht sehr verändert, nur die Schläfen sind etwas grauer und er hat sich einen Vollbart wachsen lassen.
Er erzählt von Ingrid, ihren Plänen und dem Krebs, der sie nach einer Pause schließlich besiegt hatte. Ich hatte sie vor zwei Jahren bei einem Besuch in der Stadt gesehen, wusste von einer erneuten Operation und wir hatten auch ein paar Mal telefoniert. Beim letzten Anruf klang sie schon sehr schwach und resigniert. Vor vier Wochen erhielt ich dann den Brief von der Kanzlei. So erfuhr ich von ihrem Tod und dem Termin der Testamentseröffnung.
Maximilian wirkt nervös und hat Schweißperlen auf der Stirn. In seinem dunklen Anzug und im Schein der Halogenlampen wirkt er noch blasser, als er ohnehin schon ist. Und ich, so müde wie ich bin, sehe auch nicht besser aus. Als der Anwalt mit feierlicher Miene die Akten öffnet, liegt Spannung in der Luft.
Nach der Verlesung des Testaments und einem Blick in die Runde wird mir der Grund für Maximilians Kälte klar, denn er hat mit Sicherheit im Vorfeld über den Inhalt Bescheid gewusst: Ingrid hat ihm die Wohnung in der Stadt, das Grundstück in der Nähe von Florianópolis im Süden Brasiliens und das Inventar ihres Hauses vermacht. Ich erhielt ihr Anwesen in Sete Praias und das Guthaben auf einem ihrer Konten. Zwei Bedingungen wurden mir testamentarisch auferlegt: Erstens, dass das Hausmeisterehepaar, das sich um das Anwesen kümmert, mindestens bis zum Eintritt in den Ruhestand, also noch fünf Jahre, weiter beschäftigt werden muss. Zweitens: Das mir zugedachte Vermögen liegt auf einem Treuhandkonto. Es soll dazu dienen, die laufenden Kosten des Anwesens zu decken. Es ist auf fünf Jahre befristet, wird vom Anwalt verwaltet und geht dann an mich über.
Maximilian kündigt mit leiser Stimme an, dass er Ingrids Entscheidung, mir etwas zu vermachen, anfechten wird. Mir stünde überhaupt nichts zu, sagt er, verabschiedet sich und verlässt mit seiner Frau wortlos den Raum.
Rodrigues blickt den beiden schweigend nach und klärt mich über das rechtliche Verfahren auf. Das Inventar sei fast fertig, wir müssten in den nächsten Tagen die vorläufige Grundbucheintragung vornehmen, beim Notar die entsprechenden Vorkehrungen treffen und die Gebühren bezahlen. Ich erteile ihm Vollmacht. Die Anfechtung und die gerichtliche Entscheidung würden noch einige Zeit dauern, meint er, aber ich solle mir keine Sorgen machen. In der Zwischenzeit müsse ich mich gedulden, er werde mich auf dem Laufenden halten. Ob ich das Haus besichtigen könne, frage ich. «Natürlich», sagt er. Er habe später in der Gegend zu tun, wir verabreden uns für den Nachmittag, so gegen 18 Uhr. Seine Sekretärin ruft mir ein Taxi und ich fahre zurück ins Hotel. Erschöpft lege ich mich aufs Bett und döse ein.
Gegen Mittag gehe ich ins Hotelrestaurant, setze mich an einen Tisch mit Blick auf die Straße, beobachte das Treiben im Park direkt vor dem Hotel und bestelle mir einen Salat, dazu ein Bier. Ich habe kaum Hunger, blättere in der Zeitschrift vor mir, kann mich aber nicht konzentrieren: Ich kann es nicht glauben, gerade habe ich erfahren, dass Ingrid mir tatsächlich das Haus überlassen hat!
Am späten Nachmittag, es ist schon 17 Uhr, komme ich mit dem Taxi an der Kreuzung nach Sete Praias an. Der Fahrer fragt, ob er mich bis zum Haus bringen soll, aber ich gehe das letzte Stück bis zur Hausnummer 2.032 lieber zu Fuß, schließlich habe ich noch etwas Zeit und die Bewegung wird mir gut tun. Ich bezahle und melde mich beim Pförtner an der Schranke an. Es ist sehr heiß, der Asphalt scheint zu glühen. Der verschwitzte Wächter registriert mich lustlos und öffnet die Schranke. Ich mache mich auf den Weg zur Nummer 2.032. 2.032 Meter Fußweg bis zum letzten Haus. Kein Mensch weit und breit, ganz anders als noch vor wenigen Minuten in der Stadt. Das einzige Geräusch ist das unermüdliche Konzert der Grillen und Zikaden in der Hitze. Ich schwitze, setze mir Kappe und Sonnenbrille auf.
Die Avenida sieht viel gepflegter aus, als ich sie in Erinnerung habe, neu asphaltiert, mit Bürgersteigen auf beiden Seiten und Straßenbeleuchtung. Warum gab es das damals nicht, als ich spät abends so allein durch diese dunkle Straße nach Hause gehen musste und mir vor Angst fast in die Hose gemacht habe?
Warum heißt sie Avenida Sete Praias, denn das müsste per Definition eine Hauptstraße sein, eine mehrspurige, viel befahrene Allee, das ist eine Straße, eine schmale noch dazu?
Nur ein Gebäude kommt mir bisher bekannt vor. Bungalows in verschiedenen Größen und Baustilen stehen dort, wo früher leere und zum Teil verwahrloste Grundstücke waren, aber der Blick auf die Häuser ist durch zum Teil hohe Mauern versperrt. Als ich an einem großen, alten und schattigen Mangobaum vorbeikomme, fällt mir ein, dass ich einmal in einer dunklen, nebligen und kalten Nacht unter einem dieser Bäume schlafen musste, vielleicht war es sogar dieser. Ich hatte solche Angst! Durch den dichten Nebel in der dunklen Nacht konnte ich nichts sehen, nur das Echo des unheimlichen Gebells der Wachhunde war deutlich zu hören. Ich wusste nicht, ob sie frei herumliefen oder eingesperrt waren, und ich wollte es nicht riskieren, also blieb ich unter dem Baum, die ganze Nacht, bis zum Morgen, als mich, durchgefroren und übermüdet, der hilfsbereite Zeitungsausträger in seinem alten Kombi mitnahm.
Das Restaurant, das auf halbem Weg sein sollte, kann ich nicht entdecken. Vielleicht hat es zugemacht? Es war bekannt, das Essen im Restaurante do Lago war hervorragend, Ingrid und mein Vater gingen gerne dorthin. Ein schönes Gebäude aus den vierziger Jahren, das einst einem reichen portugiesischen Kaufmann gehörte, der daraus ein Restaurant machte, mit Blick auf den See, einen Park und einen großen Spielplatz für die Kinder. Und der Hundezwinger: Vier riesige Schäferhunde wurden nachts nach der Sperrstunde freigelassen. Sie bewachten das Grundstück und machten mir das Leben zur Hölle, wenn ich spät nach Hause kam, wie in jener Nacht. Dort, wo ich das Restaurant vermutete, sehe ich jetzt eine hohe, lange weiße Mauer.
Was nun folgt, ist der kurvige Teil der Strecke, immer noch wenig bebaut und mit dichtem Wald zu beiden Seiten der Fahrbahn. Hier hat sich nichts verändert.
Und nun, ein Stück weiter in der Ferne, nähere ich mich der weißen Mauer mit der eingravierten Nummer 2.032. Hier endet die Avenida an dem Kreisverkehr vor dem Haus. Es liegt oberhalb der siebten kleinen Bucht des Sees, der unter den Grundstücken verläuft und der Straße ihren Namen gibt: Sete Praias. Das Rondell vor der Einfahrt ist üppig bepflanzt. Und am Ende der Straße stehen jetzt auch ein paar Häuser. Damals waren dort nur leere Grundstücke. Früher fuhr mein Vater, bevor er abends in die Garage kam, mit dem Auto ein paar Runden. Dabei hatte er das Licht immer auf höchster Stufe, um sicherzugehen, dass keine Gefahr bestand.
Ich nähere mich dem Haus und spüre sofort meine Aufregung, als ich die Klingel drücke.
«Robert, sind Sie das?», ertönt Rodrigues Stimme aus der Gegensprechanlage.
«Ich bin es, ja ...», bevor ich weitersprechen kann, öffnet Rodrigues die Haustür. «Ich bin zu Fuß gekommen, um in Erinnerungen zu schwelgen, ich hoffe, ich komme nicht zu spät.»
«Kein Problem», sagt er. «Aber ich habe es etwas eilig, denn ich habe einen Termin hier im Eldorado. Das Haus ist offen, schauen Sie sich ruhig um, ich bin in ein, zwei Stunden zurück.»
Wir stehen am Eingang neben der Garage. Er bittet mich, ihm das Garagentor zu öffnen, damit er hinausfahren kann. Ich sehe sein Auto kurz darauf hinter der ersten Kurve verschwinden und schließe das Tor wieder.
2.Blaumachen
(Robert, 17 Jahre alt)
Das tägliche Aufstehen um 5.15 Uhr unter der Woche war für Robert eine große Qual. Kaum klingelte der Wecker, begann der Kampf gegen die Zeit, um jede Minute, die er länger im Bett bleiben konnte.
So auch an diesem Morgen. Nachdem er es endlich geschafft hatte, aufzustehen, sich schnell zu waschen und hastig die Zähne zu putzen, schaute er wieder auf den Wecker: 6.10 Uhr. Er hatte noch 20 Minuten Zeit zum Frühstücken, dann musste sein Vater los.
Es dämmerte schon, und es war noch sehr kalt, als er die Zimmertür hinter sich schloss und mit dem Rucksack in der Hand den Seitengang zur Küche nahm. Er hörte das Rumoren aus dem Esszimmer, das Klappern von Besteck und die durchdringende, laute Stimme von Maximilian, der wie jeden Morgen jammerte. Auch wenn sie sich nicht mochten, eines hatten sie gemeinsam: Sie waren keine Morgenmenschen. Und sie ignorierten einander.
«Robert, beeil dich, dein Vater muss gleich los», hörte er Ingrid rufen.
«Erst mal guten Morgen ...», antwortete er gereizt und machte sich eine große Tasse Kaffee mit heißer Milch.
Da saß seine Familie beim Frühstück: Ingrid, die ihn mit ihren durchdringenden hellblauen Augen zur Eile mahnte, sein Vater, der ihm kurz einen guten Morgen wünschte und sich wieder den Notizen widmete, die er neben sich liegen hatte. Seine Brüder begrüßte er mit einem Lächeln und einem Schulterklopfen. Stefan und Peter sagten ein von Restmüdigkeit getränktes, aber freundliches ›Hallo Robert‹ und kauten weiter an ihren Brotscheiben oder aßen ihre Cornflakes. Robert setzte sich neben Stefan und schmierte sich ein Brötchen mit Erdbeermarmelade. Als er einen Schluck Kaffee und den ersten Bissen nahm, trafen sich seine und Ingrids Blicke.
«Robert, ich muss dir etwas sagen», meinte sie kurz angebunden. «Ich habe mit deinem Vater gesprochen. Es ist schwierig für mich, euch vier jeden Tag von verschiedenen Schulen in verschiedenen Ecken der Stadt abzuholen, und einen Chauffeur können wir uns nicht leisten. Deshalb haben wir beschlossen, dass du und Stefan ab sofort mit dem Bus nach Hause kommt.»
Robert sagte nichts, sah sich nur kurz um und versuchte, Ingrids fragendem Blick auszuweichen. Sein Vater nickte nur. Er wollte etwas sagen, aber Ingrid kam ihm zuvor.
«Und noch etwas. Wir haben über dich gesprochen. Es wird Zeit, dass du dein eigenes Geld verdienst. Ab jetzt sollst du ein bisschen arbeiten, auch wenn es nur ein Praktikum ist. Du hast viel Zeit und deine Noten sind nicht so gut. Da du eher praktisch veranlagt bist, wäre es gut, es auszuprobieren. Was meinst du?»
Robert dachte nur ›Scheiße‹ und antwortete: «Ich werd's mir überlegen», was Ingrid mit einem strengen Blick quittierte. Die Ankündigung, mit den öffentlichen Verkehrsmitteln nach Hause fahren zu müssen, hatte er schon länger erwartet und es störte ihn nicht, im Gegenteil. So hätte er mehr Zeit für sich und wäre nicht gezwungen, auf dem Nachhauseweg Gespräche zu führen. Aber dass er arbeiten gehen sollte, dieser für ihn seltsame und abstrakte Gedanke kam sicher von ihr. Aber darüber wollte er zu dieser frühen Stunde noch nicht nachdenken.
«Übrigens, wegen der Abholung heute: Keine Sorge, ich gehe nach der Schule zu Julia und komme dann mit dem Bus zurück», sagte Robert, stand auf und brachte seinen Teller und seine Tasse in die Küche. «Dann kann ich mich schon mal daran gewöhnen ...»
«Das ist gut», sagte Ingrid. «Aber komm nicht zu spät wieder, wir müssen noch über das Praktikum und die Arbeit reden.»
Mit seinem Blick signalisierte Robert Desinteresse, winkte aber zum Abschied.
Klaus Brunner hatte jeden Morgen einen langen Weg von Sete Praias in die Stadt. Zu der langen Strecke kam noch der stockende, chaotische Verkehr von São Paulo: Staus, hupende Autos, Fußgänger, die ohne Vorwarnung die Straße überquerten, rote Ampeln, die ignoriert wurden, und das alles unter einer ständigen Dunstglocke aus verschmutzter Luft und Abgasgeruch. Neunzig Minuten brauchte er mindestens. Um Zeit zu sparen, ließ er Robert und Stefan an einer Bushaltestelle am Weg aussteigen, von wo aus sie mit dem Bus weiter zur Schule fahren konnten. Dann brachte er die beiden Kleineren, Peter und Maximilian, zu ihrer Schule. Von dort aus fuhr er schließlich zur Arbeit. Von einem Vorort zum anderen, in ein Industriegebiet am Stadtrand, quer durch die Metropole, zweimal am Tag, das war nervenaufreibend.
Robert sagte an diesem Morgen nicht viel, die Stimmung war allgemein müde, er konzentrierte sich auf die Musik und die Nachrichten im Radio. Es liefen die üblichen Hits. ›Sailing‹ von Christopher Cross und ›Bette Davis Eyes‹ von Kim Carnes, unter anderem. Die Nachrichten brachten an diesem Morgen die neuesten Meldungen über Verkehrsunfälle und Staus, gefolgt von der Politik, die Robert aufmerksam verfolgte. Brasilien erlebte in diesem Jahr mit der neuen Regierung unter General João Figueiredo (1) eine leichte Öffnung in Richtung Demokratie. Robert konzentrierte sich auf die Nachricht vom Ende des Zweiparteiensystems und vergaß für einen Moment seine Müdigkeit.
An der Bushaltestelle angekommen, bat er seinen Vater um Geld, verabschiedete sich mit einem flüchtigen Kuss und wartete mit Stefan auf den Bus. Kaum war er eingestiegen, schaute Robert hinterher und wartete kurz auf die Linie 61. Der Bus war wie fast jeden Morgen um diese Zeit überfüllt, aber mit etwas Mühe drängte er sich an den Leuten vorbei und stieg eine Haltestelle früher als sonst aus. Keiner seiner Mitschüler, zumindest keiner, den er kannte, war zu sehen, und so ging er die Hauptstraße in entgegengesetzter Richtung zur Schule entlang bis zu einer unscheinbaren Nebenstraße, die er drei Häuserblocks entlang lief, bis er an den Ort kam, den er suchte: Etwas versteckt zwischen den Häusern und der Straße befand sich ein kleiner, unscheinbarer, aber gepflegter Park, umgeben von alten Bäumen und Sträuchern. Bis auf zwei Hundebesitzer, die ihre morgendliche Runde drehten, war Robert allein und setzte sich auf eine Bank, um die frühe Sonne zu genießen.
Nach und nach spendete die Sonne etwas Wärme, die anfängliche Kälte wich, er nahm sich Zeit, zündete sich eine Zigarette an und genoss die Stille, die plötzlich von einem Lied unterbrochen wurde. Es kam mit hoher Lautstärke aus einem der umliegenden Häuser und fügte sich harmonisch und auf ganz besondere Weise in die ruhige, sonnige Morgenstimmung ein. Robert hatte es noch nie gehört, aber es berührte ihn wie selten ein Lied zuvor. Der tiefsinnige, poetische Text über Zeit und Veränderung und der stilsichere, charakteristische Gesang von Gal Costa, getragen nur von einer akustischen Gitarre, passten perfekt zusammen. (2) Es munterte ihn auf, brachte ihn auf andere Gedanken. Und als das Lied zu Ende war und es gleich wieder losging, hatte er das Gefühl, dass es tatsächlich noch Menschen gab, die so empfanden wie er, das tröstete ihn und er fühlte sich in diesem Moment nicht mehr so allein. Vieles ging ihm durch den Kopf. Er war misstrauisch und aufgewühlt. Seine beiden Brüder würden bald die Schule wechseln. Ingrid hatte durchgesetzt, dass beide in ein Internat gingen. Dort könnten sie besser lernen, wären besser untergebracht und hätten einen geregelteren Tagesablauf. Maximilian sei mit seinen 6 Jahren noch zu klein für ein Internat, aber für Peter und Stefan mit ihren 9 bzw. 13 Jahren wäre es optimal, betonte sie. Am Wochenende und in den Ferien wären sie zu Hause oder könnten besucht werden. «Blödes Geschwätz!», sagte er laut. Er wäre gerne in ein Internat gegangen. Das sei zu teuer, hieß es, in seinem Alter müsse er die letzten Schuljahre erfolgreich abschließen, um dann zu studieren. Musste er nicht gut untergebracht sein? Brauchte er nicht auch einen geregelten Tagesablauf? Aber er sollte doch ein Praktikum machen. ... Wo und wozu? Das passte nicht. Ja, dachte er, immer diese sinnlosen Sprüche. Und sein Vater stimmte immer nur zu, schien geradezu hörig zu sein. Er rauchte die Zigarette zu Ende, saß noch eine Weile da, schloss die Augen und spürte die Wärme der Morgensonne auf seiner Haut. Inzwischen lief ein anderes Lied, das ihm nicht so gut gefiel, obwohl es von derselben Sängerin stammte. Seine Uhr zeigte 8.40 Uhr, der Unterricht hatte vor zehn Minuten begonnen. «Scheiß drauf», sagte er laut und ging wieder in Richtung Hauptstraße. Er überquerte sie und wartete an einer Bushaltestelle auf die Linie 711, die ihn nach Jabaquara bringen würde. Als der Bus endlich kam, war er überfüllt, aber das machte ihm nichts aus, denn er würde sowieso an der Endstation aussteigen. Dort angekommen, ging er eine halbe Stunde später durch die lange Unterführung zum Busbahnhof, wo er gezielt den Schalter der Viação Ultra aufsuchte, der Buslinie nach Guarujá. Der nächste reguläre Bus würde gleich abfahren, der Executivo, die Luxusvariante mit Service, Fernseher und mehr Beinfreiheit, eine Viertelstunde später. Ohne zu zögern kaufte Robert das Ticket für die etwas spätere und bequemere Variante. Die Fahrkarte war viel teurer und das restliche Geld würde gerade für die Rückfahrkarte und ein Sandwich reichen, aber das war ihm egal. Im Bus saßen nur ein paar Frauen mit Kindern und Männer in Anzügen, die geschäftlich in Guarujá zu tun hatten. Robert setzte sich in die hinteren Reihen, wo sonst niemand saß, lehnte sich zurück und beobachtete das Treiben durch das Fenster. Ein ganz normaler, geschäftiger Tag in São Paulo war bereits in vollem Gange. Auch der Schulunterricht. Er sah schon, wie seine Geschichtslehrerin amüsiert fragte, wo denn der ›Tourist‹ sei. Das schleichende schlechte Gewissen verschwand, als der Bus die Stadt hinter sich ließ. Das Meer von Häusern und die Hektik der Stadt wichen dem Grün der Natur, die so üppig wucherte. Wo vorher eine hässliche, unästhetische Mischung aus grauem Beton, Dreck und dem heillosen Durcheinander planlos errichteter Siedlungen und Favelas geherrscht hatte, begann sein Lieblingsabschnitt der Reise: die Serra do Mar, ein gewaltiges Naturschauspiel inmitten riesiger Regenwälder. Wie ein plötzlicher Schnitt auf dem Reißbrett endete die Stadtlandschaft und machte Platz für eine frei wuchernde, grüne und farbenfrohe Natur, die nur von der Autobahn unterbrochen wurde. Ein Großteil des Abstiegs erfolgte über vierspurige Viadukte oder durch lange Tunnel. Es war eine architektonische Meisterleistung der Militärdiktatur in den siebziger Jahren.
Robert dachte an seine Zukunft und daran, dass er noch fast zwei Jahre Schule und ein Jahr Vorbereitung auf die Aufnahmeprüfung für die Universität vor sich hatte. Dann würde er weggehen, studieren und den ganzen Mist hinter sich lassen, Hauptsache weg von zu Hause. Die Schule würde er schon schaffen. Nur heute noch, dann würde er sich wieder anstrengen, dachte er. Was dachten seine Mitschüler über ihn? Der Spitzname ›Tourist‹ bezog sich nicht nur auf seine Fehlerquote, sondern auch auf seine schlechten Noten. Aber es machte ihn interessant, verlieh ihm die Aura eines freien, unabhängigen Menschen. Zumindest verkaufte er sich gerne so. Dennoch drohte ihm ein weiteres Mal in seiner Schullaufbahn die Nichtversetzung. Er senkte den Kopf tief in den bequemen Sitz des leisen und komfortablen Busses und genoss die Landschaft, ohne an die Schule, seine Mitschüler oder Lehrer zu denken.
Er hatte Zeit, und um das Geld für die Busfahrt vom Busbahnhof ins Stadtzentrum zu sparen, ging er zu Fuß zu der Wohnung, die er in 40 Minuten erreichen konnte und die nur wenige Häuserblocks vom Strand und der Strandpromenade entfernt lag. Obwohl er Guarujá nicht besonders mochte, war es außerhalb der Saison und unter der Woche ein ruhiger und verschlafener Ort. Die alte, schäbige und hässliche Promenade von einst wurde in einen großen Steg verwandelt, der sich auf einer Anhöhe entlang des Strandes und der Straße erstreckte. Es entstand eine elegante Strandpromenade aus breiten Holzplanken, die sich geschickt in die 4 km lange Strandlinie einfügte, mit durchgehenden Bänken zum Meer hin. Nur Treppen, die den Zugang zum Strand ermöglichen, unterbrechen die Promenade. Alle paar Meter wurden Palmen gepflanzt und der Verkehr teilweise umgeleitet. Guarujá war angesagt, ein Ort, an dem sich viele gestresste Großstädter am Wochenende oder in den Ferien aufhielten. Oder besser: die es sich leisten konnten.
Die neue Wohnung hatten sein Vater und Ingrid im Jahr zuvor gemeinsam gekauft. Robert öffnete die Fenster, Jalousien und Vorhänge und stellte sich ans Schlafzimmerfenster. Der Blick auf das offene Meer war leider fast vollständig durch andere Gebäude verdeckt, die Sicht beschränkte sich auf ein paar freie Lücken zwischen den Hochhäusern. Trotzdem lauschte er dem fernen Rauschen der Wellen und atmete entspannt die Seeluft ein, dann zog er sich bis auf Boxershorts und T-Shirt aus und legte sich auf das abgezogene Bett im Schlafzimmer. Müde döste er vor sich hin und hatte sofort Tagträume, die wie abstrakte Filmausschnitte aus seinen Gedanken wirkten: Weil er verschlafen hatte, kam Ingrid schimpfend in sein Zimmer; in der Schule schauten ihn seine Mitschüler fragend an, was er denn da mache; Stefan war in den falschen Bus eingestiegen und er lief hinterher und versuchte, ihn aufzuhalten; Wieder kam Ingrid und sagte ihm, er solle ausziehen und arbeiten gehen, und sein Vater saß stumm daneben, der kleine Maximilian sah ihn fordernd an; mit Marcelo fuhr er auf seinem Moped durch die Stadt; spät nachts kam er nach Hause und konnte das Tor nicht öffnen, musste sich vor den Wachhunden verstecken; wieder sah er sich mit Marcelo, diesmal mit Julia in der Stadt. … Plötzlich hatte er das Gefühl, dass jemand an der Wohnungstür stand, und er wachte mit einem Schlag auf. Aber es war niemand da, die Spannung ließ nach. Langsam zog er sein T-Shirt und seine Unterhose aus, streichelte seinen nackten Körper, räkelte sich auf dem Bett und genoss die wachsende Erregung. Er ließ sich Zeit, tauchte ein in seine Fantasien, die er ausschweifen ließ, bis er kam und sein lautes Stöhnen die Unsicherheiten und Ängste überdeckte. Er säuberte sich mit dem T-Shirt, das neben ihm auf dem Bett lag, zündete sich eine Zigarette an und betrachtete sich nackt rauchend im Spiegel. Er betrachtete sich von vorne, von den Seiten, betrachtete seinen Hintern, seinen schlaffen Penis, warf sich in Pose, lachte. Kein schlechtes Gewissen mehr, keine Zweifel. Er zog eine kurze Hose an, suchte ein sauberes T-Shirt aus dem Schrank, schnappte sich eine Sonnenmatte und ein Buch und machte sich auf den Weg zum Strand. Selbstbewusst winkte er dem Portier zu. Er breitete die Sonnenmatte aus und freute sich über den menschenleeren Strand, ohne die vielen Sonnenschirme, die sonst an Wochenenden oder in der Hochsaison die Strände bevölkern.
Schwimmen konnte er nicht lange, denn das Wasser war für die Jahreszeit zu kalt, und so machte er es sich wieder auf der Strandmatte bequem, genoss die wärmende Sonne und las in dem Buch, das er sein ›Guarujá-Buch‹ nannte, aus dem er bei jedem seiner Ausflüge ein Stück las. Mittags machte er einen langen Spaziergang am Strand und aß dann ein Sandwich, bis er am Nachmittag in die Wohnung zurückkehrte. Nach dem Duschen war er bereit für die Rückfahrt, seine Uhr zeigte erst 15:10, er hatte noch etwas Zeit. Er holte sich ein Bier aus dem Kühlschrank und schaltete den Fernseher ein.
Kaum hatte er die ersten Minuten der Nachmittagsserie gesehen, hörte er einen Schlüssel und die Tür wurde geöffnet. Plötzlich stand Ingrid vor ihm. Eine Möglichkeit, die nicht einmal in seinen wildesten Träumen vorkam. Erstarrt blickte er in ihre Richtung.
Sie hatte diesen typischen hellen, scharfen Ton in der Stimme. «Ich habe neulich den Hausmeister gefragt, ob unsere Putzfrau unzuverlässig ist. Wir sind nicht oft hier, aber wenn ich in letzter Zeit manchmal unter der Woche komme, merke ich, dass jemand die Wohnung benutzt hat. Findest du das nicht seltsam? Jetzt weiß ich warum», sagte sie und blickte auf Roberts Hand, die etwas unbeholfen die Bierdose umklammerte. «Und nachdem ich heute Morgen einen Anruf von deiner Schule bekommen habe, dachte ich, es wäre keine schlechte Idee, einen kleinen Ausflug hierher zu machen. Es hat sich gelohnt. Das Wetter ist wirklich schön heute!», sagte sie mit einem ironischen Unterton.
«Ja, das ist es», antwortete Robert leise.
«Du wolltest heute zu Julia, hast du heute morgen gesagt», sagte sie. «Ist sie auch hier?»
Er schüttelte stumm den Kopf.
«Na gut. Ich werde einen kleinen Spaziergang machen. Du wartest hier auf mich.» Robert sah ihr nach, als sie die Tür hinter sich schloss. Der Fernseher lief, aber er konnte sich nicht konzentrieren, das Bier wurde warm in seiner Hand. In Gedanken begann er, sich eine Reihe von Ausreden auszudenken, aber das würde nicht viel nützen, das ahnte er. Als sie zurückkam, bereitete er sich auf ein Donnerwetter vor, das während der Rückfahrt und des gemeinsamen Abendessens über ihn hereinbrechen würde. Während der Fahrt nach São Paulo saß er schweigend auf dem Beifahrersitz und Ingrid erwähnte weder die Schule noch stellte sie Fragen, sondern erzählte gesprächig von der Zeit, als Guarujá noch ein unbedeutendes kleines Dorf an der Küste war. Doch Robert konnte sich nicht auf ein lockeres Gespräch einlassen. Zu aufgeregt war er, zu unsicher, was auf ihn zukommen würde.
Entgegen seinen Befürchtungen blieb das Gewitter aus. Das Abendessen verlief wie immer: Ingrid gut gelaunt, sein Vater mit sich selbst beschäftigt, Peter und Stefan eher schweigsam, Maximilian nervig und schrill. Nach dem Essen schaute der Vater Nachrichten und Stefan machte sich an seine Schulaufgaben. Peter setzte sich auf die Couch und Maximilian ging in sein Zimmer, um zu spielen. Robert hilft Ingrid, den Tisch abzuräumen.
«Robert, bevor ich es vergesse: Gibst du mir bitte den Ersatzschlüssel für die Wohnung in Guarujá?»
Er kramte in seiner Tasche und gab ihr den Schlüssel schweigend. Und als der Tisch abgeräumt, der Geschirrspüler angestellt und Robert auf dem Weg in sein Zimmer war, legte sie nach. «Und Robert, bitte nimm morgen den richtigen Bus zur Schule. Ich habe deiner Betreuerin versprochen, dass deine Fehlerquote ab sofort auf Null geht.» Sie schüttelte den Kopf. «Auch wenn eine Versetzung jetzt fast unmöglich ist ... Und noch etwas: Morgen Nachmittag hole ich dich von der Schule ab. Dann haben wir einen Termin bei Siemens. Ich möchte, dass du dort jemanden kennen lernst.»
«Ist gut. Gute Nacht, ich gehe in mein Zimmer», sagte er.
«Robert, du hast noch ein Semester bis zum Schulabschluss. Und die Sommerferien kannst du dir sparen. In der Zeit arbeitest du bei Siemens.»
Robert starrte Ingrid an. «Aber ... Wir haben doch ausgemacht, dass wir auf die Ilha do Mel fahren ...»
Jetzt hatte sie diesen Blick, auf den Robert den ganzen Abend gewartet hatte. «Junger Mann, dein Vater gibt viel Geld für deine Ausbildung aus. Und was machst du? Verbringst deine Tage in Guarujá oder mit deinen lieben Freunden...».
«Meine Freunde haben damit nichts zu tun.»
«Schon gut. Ich will nicht wieder damit anfangen. Du gehst arbeiten und schaffst das Schuljahr! Und dann kannst du auch wieder mit deinen Freunden auf die Ilha do Mel fahren.» Ihre Lippen wurden schmal und ihre Mundwinkel zogen sich nach unten. Sie meinte es ernst. «Hast du verstanden?», fragte sie eindringlich.
Robert nickte. «Weiß Papa Bescheid?»
«Nein. Er hat schon genug Sorgen. Das bleibt unter uns. So soll es bleiben, halt dich an die Abmachung.»
«Und wenn ich das Schuljahr nicht schaffe?»
«Zeig mir, dass du es kannst.»
«Ist gut», sagte er und schloss die Küchentür hinter sich.
Eine Weile saß er auf der Treppe vor seinem Zimmer, die Nacht war dunkel und kalt. Nachdenklich rauchte er eine Zigarette. Dann zog er sich aus, legte sich aufs Bett, schaltete das Radio ein und rauchte noch eine letzte Zigarette. Marcelo fehlte ihm. Was würde er ihm in dieser Situation raten? Noch ein paar Wochen, dann wäre er wieder da, endlich. Aber er könnte auch Julia um Rat fragen. Robert hatte ein schlechtes Gewissen und ein mulmiges Gefühl. Sicher würde er am nächsten Tag ins Sekretariat gehen müssen, seine Kursleiterin würde ihm sagen, dass eine Versetzung immer schwieriger, fast unmöglich würde, und alle in seiner Klasse würden ihn ziemlich blöd anschauen. Aber das hat er ja auch verdient, dachte er sich, aber dieser Gedanke verschwand sehr schnell, so plötzlich wie er gekommen war, denn eigentlich fühlte er sich ungerecht behandelt.
3. In Sete Praias
Ich muss schmunzeln, wenn ich an sie denke: Ingrid. Sie hat mir das Leben schwer gemacht. Zeitweise habe ich sie gehasst, wie selten oder nie jemanden zuvor. Irgendwann waren wir uns zwar sehr nahe, aber das hat lange gedauert.
Auf der ersten Stufe, die zum Haus hinunterführt, sitze ich und genieße den Moment und die Stimmung. Rodrigues' wegfahrendes Auto ist das einzige Geräusch, das die Stille durchbricht. Die Sonne spiegelt sich auf dem See, ein wunderschönes Panorama, das sich vom Eingangstor neben der Garage aus bietet und das sie mit üppigen Blumen entlang des Weges und der Stufen in Szene zu setzen wusste. Und nun hat sie mir das Haus vererbt. Auf die Frage, warum gerade ich und womit habe ich das verdient, fällt mir keine Antwort ein. Sie wollte es so. Eine unerwartete, unglaubliche Überraschung für mich.
Die Sonne blendet, ein kompakter, kleiner, flinker Mann eilt die Treppe hinauf, steht bald vor mir und reicht mir die Hand.
«Herr Roberto, sehr erfreut», sagt er atemlos. «Mein Name ist Souza.»
Ich lächle. «Souza, ja, schön! Ich habe schon viel Gutes über Sie gehört!»
«Das ist sehr nett von Ihnen», antwortet er bescheiden. «Meine Frau und ich sind schon sehr lange hier bei Dona Ingrid. Gott hab sie selig. Wir vermissen sie.»
«Ja, das glaube ich.»
«Wir hoffen, dass wir in ihrem Sinne weitermachen können.»
«Da bin ich mir sicher», antworte ich und nehme ihm etwas von seiner Unsicherheit, indem ich aufstehe und ihm freundschaftlich auf die Schulter klopfe.
Er lächelt und reicht mir einen Schlüsselbund. «Das sind die Schlüssel zum Haus, zu allen Zimmern und zum Außenbereich. Soll ich Ihnen alles zeigen?»
«Nicht nötig, danke.» Ich deute auf einen Rundbogen auf halbem Weg zur Eingangstür. «Dort durch, das war früher mein Zimmer.»
«Ach ja, daneben ist unsere Wohnung. Das war wirklich Ihr Zimmer?»
Ich nicke.
«Dann lasse ich Sie mal allein, Herr Roberto. Wenn Sie etwas brauchen, ich bin im Garten neben dem Bootshaus. Meine Frau ist auch zu Hause.» Er lächelt und schon eilt der kleine, agile Mann die Treppe hinunter in den Garten. Die Souzas habe ich noch nie gesehen. Ich war seit meinem Auszug nicht mehr hier gewesen. Wenn ich Ingrid in den Jahren danach getroffen habe, dann in der Stadt.
Langsam gehe ich den Weg hinunter, der zum Haupteingang des Hauses führt. Der Blick auf den See ist malerisch, ich hatte ganz vergessen, wie schön das sein kann. Der Weg und die Bepflanzung sind sauber und gepflegt, man sieht dem Haus nicht an, dass es seit Wochen leer steht. Unterhalb des Eingangsbereiches, etwas nach rechts versetzt, befindet sich der bohnenförmige Pool. Die Gartenmöbel und der Pool selbst sind mit Planen abgedeckt. Die Grillhütte und der lange, breite Tisch daneben stehen noch wie früher, sind aber sehr abgenutzt.
Mir wird etwas flau im Magen, als ich die große Eingangstür öffne. Drinnen riecht es ein wenig muffig. Die Möbel stehen zusammengestapelt und abgedeckt in der Mitte des Raumes, daneben ein paar gepackte Umzugskartons. Die großen, dick verglasten Schiebetüren zur Terrasse im geräumigen, hellen Wohnzimmer lassen sich leicht öffnen, die frische Luft vertreibt den schlechten Geruch. Früher thronte in der Mitte des Raumes die ausladende Sitzecke, bestehend aus zwei breiten Sofas und vier Sesseln auf einem rötlichen Perserteppich sowie einem quadratischen Couchtisch. In der gegenüberliegenden Ecke stand der Fernseher, daneben das Sideboard, die Möbel harmonierten gut mit dem Eichenparkett. An den Wänden hingen Bilder von Ingrids Schwiegervater aus erster Ehe, einem leidenschaftlichen, aber wenig erfolgreichen Maler. Doch jetzt, wo die Möbel zusammengepackt sind, wirkt der Raum trostlos. Rodrigues hatte mir im Vorfeld erzählt, dass Maximilian bereits kurz nach Ingrids Tod alles hat einpacken lassen. Von der Terrasse aus genieße ich den Blick auf den See. Die Sonne steht schon etwas tiefer, das Licht ist nicht mehr so grell wie noch vor ein paar Stunden. Eine etwas kühlere Brise weht vom See herüber, das Rauschen der Bäume im Wind untermalt diesen Moment der Wiederentdeckung. Ich zünde mir eine Zigarette an, jetzt bin ich entspannter, die anfängliche Unsicherheit ist wie weggeblasen. Es ist ein schöner Moment der Ruhe, der sich in mir ausbreitet.
Vom Wohnzimmer aus gelangt man direkt in die Küche mit der Speisekammer und dem Hinterausgang mit der abgenutzten Fliegengittertür. Bis auf ein paar Kartons ist hier alles ausgeräumt. Im hinteren Teil des Wohnzimmers, gleich hinter der Garderobe, führt ein breiter Flur zur Treppe ins Obergeschoss und zur Bibliothek, einem geräumigen, wenn auch etwas dunklen Raum. Ich verbrachte viel Zeit auf dem ausladenden, bequemen Sofa und mit den unzähligen Büchern, die Ingrid in den vielen Regalen angesammelt hatte. Der Kamin und der dicke, flauschige Teppich unterstrichen die Gemütlichkeit, ich fühlte mich wohl, es war ein guter Rückzugsort. Die Regale sind leer geräumt, aber das Sofa steht noch wie früher, wirkt aber abgenutzt: Der schwere, dunkelbraune Lederbezug hat Risse und ist teilweise abgewetzt. Sicher ein Grund, warum Maximilian es nicht weggeräumt hat. Ich sitze eine Weile darauf und lasse in Gedanken einige Momente Revue passieren, in denen ich hier gesessen habe. Momente, in denen ich wichtige Entscheidungen zu treffen hatte oder einfach nur spätabends mit meinem Bruder Stefan einen Film geschaut habe. Oder wenn ich auf dem dicken, weichen Teppich lag und träumte und einmal ein unvergessliches, tiefes romantisches Erlebnis hatte. Dieser Raum war etwas Besonderes, hier fühlte ich mich geborgen.
In der oberen Etage befinden sich die Zimmer mit Terrasse, sie sind leergeräumt. Eine Seitentreppe führt in den Garten und zum Pool. Ich schwimme gerne und hatte hier die Gelegenheit dazu, ohne lange und beschwerliche Wege zum Schwimmbad des Clubs zurücklegen zu müssen. Jetzt ist es abgedeckt, ich hebe einen großen Teil der Plane hoch. Die hellblauen Fliesen sind alt und abgenutzt, einige sind gesprungen, andere fehlen, die Lampenhalterungen sind teilweise verrostet. Eines ist sicher: Es muss renoviert werden.
Gartenfeste mit Grillen waren die Leidenschaft meines Vaters. Die Grillhütte am Pool war neben dem Fernsehsessel sein Lieblingsplatz. Ich sehe uns an dem langen Holztisch sitzen, oft zum Mittag- und Abendessen in den Frühlings- und Sommermonaten. Mein Vater gut gelaunt beim Grillen, eine Flasche Bier vor sich, eine Zigarette im Mundwinkel, es lief Musik, meistens deutsche Schlager. Ein paar Meter weiter führt eine kleine, unscheinbare Steintreppe zum unteren Teil des Gartens mit der Außenmauer. Dahinter liegt das Seeufer. Der Baumbestand ist sehr alt, mit einigen Eukalyptusbäumen, schönen Mimosen sowie Kirsch- und Birnbäumen, die reichlich Blüten tragen. Entlang der Mauer wurde ein Gemüsegarten angelegt, wo Herr Souza gerade fleißig gräbt. Wir winken uns zu.
Die Holztür des Bootsschuppens auf der anderen Seite quietscht beim Öffnen. Drinnen liegt Werkzeug verstreut, ein Ruderboot aus Aluminium lehnt an der Wand. Am Seeufer vor dem Tor ist es heiß und windstill, hier brennt fast den ganzen Tag die Sonne. Doch im Gegensatz zu früher stinkt der See nicht mehr und am Ufer liegt kein Dreck. Das Wasser, früher eine dunkle, stinkende Brühe, ist viel sauberer geworden. Ein sehr großer Fortschritt.
Meine letzte Station auf dieser kleinen Reise ist mein ehemaliges Zimmer: Der Weg führt durch den Rundbogen in den weißen Anbau mit den dunkelgrünen Fensterläden. Auch hier ist es muffig. Gerümpel liegt herum, und sobald ich die Fenster öffne, wirbelt viel Staub auf. Es scheint in den letzten Jahren als Abstellraum gedient zu haben, nur die zementierte Bett-Sofa-Konstruktion erinnert an frühere Zeiten. Ich setze mich auf den harten Beton, dort, wo einmal eine Matratze lag, und muss sofort grinsen: Meine Jugend! Sofort denke ich an Marcelo. In den letzten Jahren war der Gedanke an ihn etwas verblasst. Aber in dem Moment, in dem ich das Flugzeug von Rom nach São Paulo bestieg, wurde diese Vergangenheit wieder lebendig. Der Gedanke keimte seit meiner Ankunft: Diesmal werde ich ihn besuchen, vielleicht noch heute. Ja, so muss es sein! Hier zu sitzen, wo wir so viel erlebt haben, und an ihn zu denken, das ist ein deutliches Zeichen.
Meine Gedanken werden von Geräuschen und Stimmen aus der Garage unterbrochen. Rodrigues ist zurück. Er steht am Eingang und unterhält sich mit einer grauhaarigen, asiatisch aussehenden Frau, lächelt und winkt, als er mich sieht. Dann stellt er mich Dona Alice vor, Souzas Frau.
Wir gehen noch einmal im Schnelldurchlauf durch das Wohnzimmer und das Erdgeschoss des Hauses. Er deutet auf den zusammengerollten Perserteppich. «Maximilian braucht sich um seinen Anteil wirklich keine Sorgen zu machen. Allein der Teppich ist ein Vermögen wert. Und die Massivholzmöbel sind auch einiges wert.» Er lächelt. «Haben Sie sonst alles gesehen?»
«Ja, viele Erinnerungen kommen hoch wenn ich hier durchgehe.»
«Um die Instandhaltung und Sicherheit des Hauses brauchen Sie sich keine Sorgen zu machen. Die Souzas sind sehr zuverlässig und fleißig. Bis zur Rente sind es noch ein paar Jahre, bis dahin bleiben sie hier und wollen sich dann zur Ruhe setzen. Und eine private Sicherheitsfirma bewacht die Wohnanlage zuverlässig».
Ich nicke zustimmend und erwähne meine Verwunderung über den angeblich sauberen See und die Abwesenheit von Gestank, einst das einzige und größte Manko von Sete Praias. Unglaublich, meint Rodrigues, und ja, es habe sich viel getan, das Gewässer sei keine öffentliche Kloake mehr, sondern fast gereinigt. Es sei auch an der Zeit gewesen, sagt er, denn er habe selbst ein Haus in Eldorado am See, der Gestank sei früher unerträglich gewesen. Jetzt habe die Gegend erheblich an Wert gewonnen. Ob ich denn überhaupt wisse, was ich da an Vermögen bekommen habe? Ich weiß es nicht, sage ich, aber bestimmt eine Menge ...
Er lächelt. «Soll ich Sie mitnehmen?»
«Das wäre sehr schön. Von Santo Amaro aus kann ich ein Taxi in die Stadt nehmen.»
«Dann lass uns gehen», sagt er und zeigt mir den Weg. «Übermorgen sind wir beim Notar und beglaubigen die Vollmacht, danach gehen wir zum Amt, geht das?», fragt er. «Vormittags? 11 Uhr bei mir?»
«Das ist perfekt», antworte ich gut gelaunt.
In Santo Amaro angekommen, nehme ich mir ein Taxi in die Stadt. Das letzte Mal habe ich Marcelo vor vielen, vielen Jahren gesehen. Laut Julia wohnt er immer noch in der Rua João Francisco de Assis Nr. 166. Wenn er noch dort wohnt, dann bestimmt bei seinem Vater.
Es ist Stau, Berufsverkehr. Wir müssen einen großen Teil der Stadt durchqueren. Es dauert lange, bis ich die Adresse erreiche, es ist schon 19 Uhr. Das Haus, ein moderner Bungalow aus den siebziger Jahren, ist mir noch gut in Erinnerung. Das wuchtige Eisentor und der gepflegte Vorgarten sind noch genauso wie damals. Im Wohnzimmer brennt Licht und ich drücke auf die Klingel.
4. Schulferien
(Robert, 13 Jahre alt)
Frühlingsferien
Trotz des Ferienbeginns war der Verkehr auf der Autobahn Via Dutra in Richtung São José dos Campos nicht so stark, wie Roberts Mutter zunächst befürchtet hatte. Bisher verlief die Fahrt ohne größere Staus oder Unfälle. «Das wird bestimmt eine schöne Zeit. Wenn es so gut anfängt, kann es nur besser werden», meinte sie lächelnd. «Du bist heute so still», sagte sie zu Robert, der nickte und seit Beginn der Fahrt mucksmäuschenstill auf dem Beifahrersitz saß. «Freust du dich nicht auf die Ferien?»
«Ich freue mich schon, Mami», antwortete er. «Aber ich werde dort bestimmt allein sein. Warum darf Stefan Rainer mitnehmen und ich nicht? Andreas wäre sicher gerne mitgekommen.»
«Andreas war letztes Mal dabei», sagte Stefan mit seiner schrillen Stimme. «Jetzt bin ich dran! Stimmt's, Mami?"
«Genau so ist es, aber jetzt macht keinen Unsinn da hinten», ermahnte sie die Jungs auf den hinteren Plätzen. «Du lernst bestimmt jemanden kennen.»
«Ich weiß nicht ... Die meisten haben immer ihre Freunde dabei ...»
«Du wirst schon sehen, du lernst bestimmt jemanden kennen. Sollen wir bald anhalten, was meint ihr? Eine kleine Pause?» Sofort ertönte großer Jubel von der Rückbank.
Roberts Freund Andreas war mit seiner Familie nach Guarujá gefahren. Er wäre gerne mitgekommen, aber die Abmachung war, dass er und Stefan abwechselnd jemanden mit in den Urlaub nehmen durften. Das ärgerte ihn trotzdem sehr, denn beide hatten in den letzten Ferien in Ilhabela viel erlebt und Spaß gehabt. Und jetzt musste er sich jemanden suchen. Gar nicht so einfach für ihn, der eher zurückhaltend und schüchtern war.
Robert war mitten im Stimmbruch, ein schmächtiger, schlaksiger Junge, der gerade die ersten Wellen der Pubertät durchmachte. Ein paar lästige Pickel störten sein Gesicht, auf seiner Oberlippe bildete sich ein Flaum, sein Körper veränderte sich: An den Beinen, unter den Achseln, im Schritt wuchsen auffällig dunkle Haare. Veränderungen, die er auch bei einigen seiner Klassenkameraden bemerkte. Bei manchen waren sie noch ausgeprägter als bei ihm, bei anderen gar nicht. Sie weckten eine neue Art von Neugier und innerer Unruhe. Einmal beobachtete er seine Mitschüler in der Umkleidekabine und unter der Dusche und wurde dabei erregt. Er konnte es nicht rechtzeitig verbergen und wurde ertappt, ein allgemeines Gelächter war die Folge, es war ihm sehr peinlich. Seine Unsicherheit wurde dadurch noch größer.
Da der Vater beruflich nach Deutschland musste, verbrachte der Rest der Familie die zweiwöchigen Frühlingsferien auf der malerischen Insel an der Nordküste São Paulos, wo ihnen ein Motorboot und die Mitgliedschaft in einem Yachtclub zur Verfügung standen. Zum Club gehörte ein Gästehaus mit 30 Zimmern, Restaurant, Schwimmbad, Sauna, Fernseh- und Spielzimmer, verteilt auf ein großes Gelände in Strandnähe, ideal für ein Wochenende oder einen Kurzurlaub. Ilhabela ist bei Tauchern und Seglern in Mode gekommen, nachdem immer mehr Menschen die schöne und unberührte Nordküste des Bundesstaates entdeckt hatten. Ein Naturreservat, mit der Fähre 30 Minuten von der gegenüberliegenden Küstenstadt São Sebastião und nur wenige Stunden mit dem Auto oder Bus von der Millionenstadt São Paulo entfernt. Weit genug, um nicht so überlaufen zu sein wie Guarujá oder andere Strände an der Südküste, aber dennoch gut erreichbar.
Die Insel mit einem Umfang von 300 km war auf dem Küstenstreifen zum Festland hin bebaut, die Seite zum offenen Meer gehörte zum Naturschutzgebiet, wo weder gebaut noch gejagt oder gefischt werden durfte. Eine einzige Hauptstraße verband die verschiedenen Strände mit der Anlegestelle und dem Dorf, ›die Vila‹ genannt. In den zahlreichen Kolonialgebäuden, die die Vila schmückten, befanden sich Geschäfte, Bars, Restaurants und Hotels. Portugiesische Kanonen, die auf das Festland gerichtet waren, zeugten von der längst vergangenen Kolonialzeit. Abends traf man sich in den zahlreichen Bars, schlenderte durch die Gassen und Straßen, saß auf den Mauern und beobachtete die Passanten oder ging zur Pier, um das Spektakel des Schwertfischfangs zu bewundern, der nachts mit winzigen schwimmenden Lichtkugeln gefangen wurde und das ruhige Wasser in ein Meer aus glitzernden Lämpchen verwandelte. Es gab viele Geschichten über versunkene Schiffe: Schmuggler und Piratenschiffe legten in der Bucht von Castelhanos auf der unbewohnten Seite an, um Schmuggelware aufs Festland zu bringen und Vorräte zu laden. Einige Hobby-Wissenschaftler verbrachten ihr Leben mit der Suche nach vergrabenen Schätzen oder nach Beweisen dafür, dass die Insel einst Teil des sagenumwobenen Kontinents Atlantis war. Dreitausend Einwohner bevölkerten die Insel, an Wochenenden und in der Saison waren es weit mehr. Lange Wartezeiten auf der Fähre mussten in Kauf genommen werden, was sich eher positiv auf die Umwelt auswirkte, denn viele Urlauber verzichteten lieber auf die Überfahrt und suchten sich einen der Strände auf dem Festland.
Obwohl Cora Brunner schöne und erholsame Ferien vorausgesagt hatte, war der Frühling ausnahmsweise extrem kalt. Auf der Insel regnete es viel, die Sonne zeigte sich selten. So stand vor allem die Einrichtung des Clubs auf dem Programm, sehr zum Ärger der Eltern und zur Verzweiflung des Personals über die ungeduldigen Kinder, die alles Mögliche anstellten. Schon wenige Tage nach der Ankunft in der ersten Woche gab es einen so heftigen Sturm, dass eine Fähre fast gesunken wäre und der Fährverkehr für drei Tage eingestellt werden musste. Auch der Strom fiel teilweise aus, was die Ungeduld der Urlauber noch steigerte.
Roberts Mutter war von Natur aus kontaktfreudig und hatte schon einige bekannte Gesichter getroffen. Sie habe noch nie in ihrem Leben so viel Karten gespielt und gelesen, scherzte sie später über diesen Urlaub.
Robert hingegen hatte keinen Grund zur Freude. Er hatte zwar Bekannte vom letzten Urlaub getroffen, viel Unternehmen konnte er jedoch mit denen nicht, entweder waren sie so jung wie sein Bruder Stefan, mit dem er nicht viel anfangen konnte, oder sie waren um einiges älter und hatten bereits andere Interessen. Ihm fehlte ein richtiger Kumpel, mit dem er alles Mögliche unternehmen konnte. An stürmischen Tagen verbrachte er die meiste Zeit damit, mit seiner Mutter Karten zu spielen, sich in seinem Zimmer zu verkriechen und zu lesen oder auf seinen kleinen Bruder aufzupassen. Er langweilte sich schrecklich.
In der zweiten Ferienwoche wurde das Wetter jedoch besser. Seine Mutter machte mit einer Freundin und den Kindern einen Ausflug, Robert wollte nicht mit, er saß auf der Terrasse im Club und blätterte in einem Comic.
«Ich kenne dich», sagte ein Junge und setzte sich gleich neben ihn. «Du bist doch in der Stefan-Zweig-Schule. Da habe ich dich gesehen.»
«Genau, in der 7B. Und du?»
«Ich war dort, habe gewechselt. Bin seit dem neuen Schuljahr in der Nossa Senhora do Bonfim, auch in der 7.»
«Warum hast du gewechselt?»
«Meine Eltern wollten es so. Ist näher von zu Hause. Du bist also in der 7B? Das ist die Deutschklasse, bist du ein richtiger Kartoffel-Deutscher?», er grinste.
«Kartoffel-Deutscher? Nein, so viele Kartoffeln esse ich gar nicht...» Er lächelte amüsiert. «Ich bin in Deutschland geboren, aber ich habe ein paar Probleme mit der Sprache ... Meine Eltern kommen beide von dort. Deshalb bin ich im Deutschkurs.»
Er nickte. «Man sagt, ihr seid besser, ihr habt die besseren Lehrer und auch ein paar Vorteile. Aber ihr habt auch schlimme Lehrer, wie den Richter.»
«Den Richter habe ich nicht. Und die Vorteile? Na ja, eigentlich wäre ich lieber woanders, wir haben die ganzen blöden Fächer wieder auf Deutsch! Hattest du die Kuh von Beatrice auch in Portugiesisch?»
«Dona Beatrice? Ja, die kenne ich, die ist nicht lustig», sagte er gelangweilt und rollte mit den Augen. «Und wie heißt du?»
«Robert. Und du?»
«Marcelo.» Er sah ihn an und grinste. «Mann, ich bin vorgestern hier angekommen. Mit André und seinen Eltern. Nur Regen. Langweilig. Heute Abend wollen wir in die Vila. Kommst du mit?»
«Gerne! Mir ist auch langweilig. Sonst war immer ein Freund von mir dabei. Diesmal nicht. Wer ist André?»
«Der da drüben. Spricht schon wieder die Mädchen an. Er versucht es immer wieder. Die sind viel zu alt.»
«So wie die in meiner Klasse. Die sind zwar hübsch, aber noch arroganter als die da», er zeigte auf die beiden Mädchen, mit denen sich der dunkelhaarige Junge namens André unterhielt.
«Was nützen uns die hübschen Mädchen, wenn sie auf die Älteren stehen? Da hat André keine Chance», lachte Marcelo.
«Ja, genau wie Beate aus meiner Klasse.»
«Sieht sie gut aus?»
«Ja. Alle finden sie gut, wirklich alle. Aber die hat auch keine Chance. Die ist immer mit so einem Typen aus der 9 B zusammen, Klaus heißt der. Ist schon ein bisschen älter, sieht ganz gut aus. Den hatte sie mal bei einer Party dabei und hat mit dem geknutscht, da haben wir alle nur blöd und neidisch geguckt ... Und wie ist das bei dir in der Klasse?", fragte Robert.





























