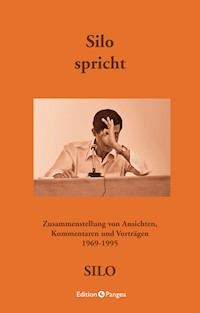
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Edition Pangea
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Der argentinische Denker und Schriftsteller Silo hat sich im Laufe seines Lebens zu den unterschiedlichsten Themen geäußert. Dieses Buch umfasst ausgewählte Betrachtungen, Kommentare und Vorträge zu Themen der Philosophie, Psychologie, Soziologie, Mythologie, Politik, Religiosität und Spiritualität. Es gibt uns einen tiefgehenden Einblick in sein Denken und vermittelt uns die erstaunliche Spannweite und Universalität dieses Autors. Kein Bereich des menschlichen Lebens und der menschlichen Erfahrung scheint ihm fremd. In diesem Werk sind dreiundzwanzig Ansprachen, Vorträge und Buchvorstellungen versammelt, die uns in die Ideen und Vorschläge des von ihm begründeten Neuen Humanismus oder Universalistischen Humanismus einführen. Nicht zuletzt finden wir hier auch Silos erste öffentliche Ansprache Die Heilung vom Leiden, die er 1969 in Punta de Vacas auf 2.500 Metern Höhe in der Grenzregion zwischen Argentinien und Chile hielt. Unter den widrigen Umständen der damaligen Militärdiktatur legte er in dieser Ansprache die wichtigsten Eckpfeiler seines Denkens sowie seine grundlegenden Vorschläge dar. Sie laden uns dazu ein, unserem Leben und unserer Umgebung in einer orientierungslosen, widersprüchlichen und gewaltvollen Welt eine positive und gewaltfreie Richtung zu verleihen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 407
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Silo spricht
Zusammenstellung von Ansichten, Kommentaren und Vorträgen 1969 - 1995
Silo
Silo ist das Pseudonym von Mario Luis Rodríguez Cobos. Er wurde am 6. Januar 1938 in Mendoza, Argentinien, geboren, wo er bis zu seinem Tode 2010 lebte. Seine Werke umfassen ein breites Spektrum, das von Philosophie über Psychologie, Soziologie, Mythologie bis hin zur Fiktion und Spiritualität reicht. Er ist u.a. Verfasser der Werke Der Innere Blick (1972), Die Innere Landschaft (1979) und Die Menschliche Landschaft (1980), die später in der Trilogie Die Erde menschlich machen (1989) veröffentlicht wurden. Später verfasste er Geführte Erfahrungen (1989), Beiträge zum Denken (1990), Universelle Wurzelmythen (1991), Der Tag des geflügelten Löwen (1993), Briefe an meine Freunde (1993), Silo spricht (1996), Wörterbuch des Neuen Humanismus (1997), Silos Botschaft (2002) und Notizen zur Psychologie (2006). Seine Schriften erschienen als Gesammelte Werke I und II erstmals 2002 in Mexiko. Er gilt als Gründer der international als Neuer Humanismus (oder auch Universalistischer Humanismus) bekannten Denkströmung sowie als Wegbereiter einer neuen Spiritualität, welche die auf Gewaltfreiheit basierende, gleichzeitige persönliche Entwicklung und gesellschaftliche Veränderung hin zu einer „universellen menschlichen Nation“ fördert.
Die Originalausgabe erschien unter dem Titel
Habla Silo. Recopilación de opiniones, comentarios
y conferencias 1969 - 1995
im Verlag Virtual Ediciones, Santiago de Chile,
Chile, 1996
Copyright der spanischen Originalausgabe © 1996 Silo
Der Originaltext ist auf www.silo.net erhältlich.
Übersetzung aus dem Spanischen
Daniel Horowitz
Revision: Gustavo Joaquin
Lektorat: Heike Steinbach und Ivetta Csongradi
Edition Pangea
Zürich - Berlin - Wien
Februar 2023
www.editionpangea.ch
Copyright deutsche Ausgabe: © 2023 Pangea, Zürich
Gestaltung: Mariana Garcia
Design Umschlag gdi Kohl
E-Book-Herstellung: Zeilenwert GmbH
ISBN 978-3-907127-21-6
Inhaltsverzeichnis
Vorwort zur zweiten deutschsprachigen Ausgabe
Silo spricht
An die Leserschaft
I. Ansichten, Kommentare und Teilnahme an öffentlichen Veranstaltungen
Die Heilung vom Leiden
Die Gültige Handlung
Über das Rätsel der Wahrnehmung
Der Sinn des Lebens
Freiwillige
Öffentliche Veranstaltung, Madrid
Das Landwirtschaftskollektiv von Sri Lanka
Öffentliche Veranstaltung, Bombay
Über das Menschliche
Die Religiosität in der heutigen Welt
II. Buchvorstellungen
Geführte Erfahrungen
Die Erde menschlich machen
Beiträge zum Denken
Universelle Wurzelmythen
Denken und literarisches Werk
Briefe an meine Freunde
III. Vorträge
Humanismus und Neue Welt
Die Krise der Zivilisation und der Humanismus
Die zeitgenössische Sicht des Humanismus
Die Vorbedingungen des Dialogs
Humanistisches Forum
Was wir heute unter Universalistischem Humanismus verstehen
Das Thema Gott
Vorwort zur zweiten deutschsprachigen Ausgabe
Die Sammlung Silo spricht wurde erstmals in Spanisch durch den Verlag Virtual Ediciones in Santiago de Chile unter dem Titel Habla Silo veröffentlicht. Der Originaltext kann unter www.silo.net eingesehen und heruntergeladen werden.
Die deutsche Erstausgabe erschien im Jahre 1998 durch den M. Uzielli Verlag, München. Die vorliegende 2. Ausgabe basiert auf dieser deutschen Erstausgabe, aber die deutsche Übersetzung wurde komplett überarbeitet und Sprache und Begriffe wurden in Bezug auf die übrigen in Edition Pangea veröffentlichten Werke Silos vereinheitlicht.
Wir möchten an dieser Stelle insbesondere Gustavo Joaquin, Luz Jahnen, Marita Simon, Harald Freyer, der 2015 verstorbenen Mariana Uzielli sowie all den anderen Personen danken, die an der Übersetzung der erwähnten Erstausgabe mitgewirkt haben. Für die vorliegende zweite Ausgabe bedanken wir uns wiederum an erster Stelle bei Gustavo Joaquin, der unsere Übersetzung mit den spanischen Originaltexten verglich, Fehlinterpretationen im begrifflichen Verständnis suchte (und immer wieder solche fand) und den Text entsprechend revidierte. Und nicht zuletzt gilt unser Dank unseren beiden Lektorinnen Heike Steinbach und Ivetta Csongradi.
Dieses Buch umfasst nur die Ansichten, Ansprachen, Vorträge und Buchvorstellungen, die Silo in den Jahren 1969 bis 1995 gab und deren Zusammenstellung in dieser Form er selbst zustimmte. Weitere mündliche Ansichten, Kommentare und Buchvorstellungen, die Silo zwischen 1996 und seinem Tode im Jahre 2010 präsentierte, sind in diesem Band nicht enthalten. Wir hoffen aber, diese in einer näheren Zukunft in diesem Verlag zu veröffentlichen.
Daniel Horowitz, Januar 2023
Silo spricht
Zusammenstellung von Ansichten, Kommentaren und Vorträgen 1969 - 1995
An die Leserschaft
Dieses Buch ist eine Zusammenstellung dessen, was Silo im Verlauf von fast drei Jahrzehnten mündlich vorgetragen hat.
Wir haben uns erlaubt, einige erläuternde Anmerkungen hinzuzufügen. Eine davon findet sich vor Silos erstem öffentlichen Auftritt vom 4. Mai 1969. Mit dieser Anmerkung wollten wir über die Umstände berichten, die diese öffentliche Veranstaltung umgaben, in der Silo die Grundlagen seines Denkens schuf. Die zweite Anmerkung findet sich vor seiner Rede vom 27. September 1981 und die dritte besteht aus den einführenden Worten des Vorredners am 6. Juni 1986. Das Einfügen der Anmerkungen am Anfang der jeweiligen Vorträge – anstelle von Fußnoten oder Notizen am Ende des Buches – verfolgt den Zweck, der Leserschaft einen Kontext näher zu bringen, der sonst außer Acht gelassen werden könnte.
Wir haben all das weggelassen, was Silo vor den Medien gesagt hat. Eine umfassende Zusammenstellung dieser Art würde eine andere Behandlung erfordern als die in dieser Sammlung verwendete.
Die vorliegenden Texte stammen aus transkribierten Notizen sowie Audio- und Videoaufnahmen.
Die Herausgeber (der spanischen Originalausgabe)
I. Ansichten, Kommentare und Teilnahme an öffentlichen Veranstaltungen
Die Heilung vom Leiden
Punta de Vacas, Mendoza, Argentinien 4. Mai 1969
Anmerkungen:
1. Die argentinische Militärdiktatur hatte alle öffentlichen Veranstaltungen in den Städten verboten. Als Folge davon wurde eine verlassene Gegend gewählt, die als Punta de Vacas bekannt ist und im Grenzgebiet Chiles und Argentiniens liegt. Vom frühen Morgen an kontrollierten die Behörden die Zugangsstraßen. Man konnte Maschinengewehrnester, Militärfahrzeuge und bewaffnete Männer erkennen. Um durchgelassen zu werden, musste man seinen Personalausweis und seine Papiere vorzeigen, was einige Auseinandersetzungen mit der internationalen Presse hervorrief. Vor einer wundervollen Kulisse verschneiter Berge begann Silo seine kurze Ansprache vor einem zweihundert Personen umfassenden Publikum. Es war ein kalter und sonniger Tag. Gegen 12 Uhr mittags war die Veranstaltung vorbei.
2. Das ist der erste öffentliche Auftritt Silos. In einer mehr oder weniger poetischen Verpackung erklärt er, dass das für das Leben wichtigste Wissen („die wirkliche Weisheit“) nicht aus der Kenntnis von Büchern, universellen Gesetzen usw. besteht, sondern dass es eine Frage der persönlichen, inneren Erfahrung ist. Das für das Leben wichtigste Wissen hat damit zu tun, das Leiden zu verstehen und wie man es überwinden kann.
Anschließend stellt Silo eine sehr einfache These auf, die aus mehreren Teilen besteht: 1. Sie beginnt damit, zwischen körperlichem Schmerz sowie seinen Nebenerscheinungen einerseits und geistigem Leiden andererseits zu unterscheiden. Dabei stellt er fest, dass Erstere dank dem Fortschritt der Wissenschaft und der Gerechtigkeit zurückweichen können, während Letzteres nicht dadurch überwunden werden kann. 2. Man leidet über drei Wege: der Wahrnehmung, der Erinnerung und der Einbildung. 3. Das Leiden verweist auf einen Zustand von Gewalt. 4. Die Wurzel der Gewalt ist das Begehren. 5. Es gibt verschiedene Abstufungen und Erscheinungsformen des Begehrens. Indem man darauf achtet („mittels inneren Nachsinnens“), kann man vorankommen.
Also: 6. Begehren ruft Gewalt hervor („je niedriger die Begierden sind“), die nicht im Inneren der Personen bleibt, sondern die Beziehungsumgebung vergiftet. 7. Man kann verschiedene Formen von Gewalt beobachten und nicht nur die primärste, nämlich die körperliche Gewalt. 8. Es ist notwendig, auf ein einfaches Verhalten zählen zu können, das dem Leben eine Orientierung gibt („erfülle einfache Gebote“): Lernen, Frieden, Freude und vor allem Hoffnung in sich zu tragen.
Schlussfolgerung: Wissenschaft und Gerechtigkeit sind notwendig, um den Schmerz im Menschengeschlecht zu besiegen. Die Überwindung der primitiven Begierden ist unerlässlich, um das geistige Leiden zu besiegen.
Wenn du gekommen bist, um einen Menschen anzuhören, von dem man annimmt, er vermittle die Weisheit, so hast du den falschen Weg gewählt, denn wirkliche Weisheit lässt sich nicht durch Bücher oder Reden vermitteln. Wirkliche Weisheit liegt in der Tiefe deines Bewusstseins, so wie wahre Liebe in der Tiefe deines Herzens ruht.
Wenn du gekommen bist, aufgestachelt von Verleumdern und Heuchlern, um diesen Menschen anzuhören, nur damit dir das, was du hörst, später als Argument gegen ihn dienen kann, so hast du den falschen Weg gewählt. Denn dieser Mensch ist weder hier, um irgendetwas von dir zu verlangen, noch um dich auszunutzen, denn er braucht dich nicht.
Du hörst einem Menschen zu, der die Gesetze nicht kennt, die das Universum regieren, der die Gesetze der Geschichte nicht kennt, der nichts über die Beziehungen weiß, die unter den Völkern herrschen. Weit weg von den Städten und ihrem krankhaften Ehrgeiz wendet sich dieser Mensch an dein Bewusstsein. Dort in den Städten, wo jeder Tag ein Streben bedeutet, das vom Tod vereitelt wird, wo Hass der Liebe folgt und Rache der Vergebung. Dort in den Städten der Armen und Reichen, dort auf den weiten Feldern der Menschen, hat sich ein Schleier des Leidens und der Traurigkeit ausgebreitet.
Du leidest, wenn der Schmerz an deinem Körper nagt. Du leidest, wenn der Hunger sich deines Körpers bemächtigt. Aber du leidest nicht nur an den unmittelbaren Schmerzen deines Körpers, nicht nur am Hunger deines Körpers. Du leidest gleichermaßen an den Folgen der Krankheiten deines Körpers.
Du musst zwei Arten von Leiden unterscheiden: Einerseits das Leiden, das in dir aufgrund von Krankheit entsteht – und dieses Leiden kann dank dem Fortschritt der Wissenschaft zurückweichen, ebenso wie der Hunger vor dem Reich der Gerechtigkeit. Es gibt andererseits eine Art von Leiden, die nicht von den Krankheiten deines Körpers abhängt, sondern sich von ihnen ableitet: Wenn du körperlich von einer Behinderung betroffen bist, wenn du nicht sehen oder hören kannst, so leidest du. Aber obwohl sich dieses Leiden von deinem Körper oder von den Krankheiten deines Körpers ableitet, so entspringt es doch eigentlich deinem Geist.
Es gibt eine Art von Leiden, das weder aufgrund des Fortschritts der Wissenschaft noch aufgrund des Fortschritts der Gerechtigkeit zurückweichen kann. Diese Art von Leiden, das ausschließlich in deinem Geist ist, weicht aufgrund des Glaubens zurück, aufgrund der Lebensfreude, aufgrund der Liebe. Du musst wissen, dass dieses Leiden immer aus der Gewalt stammt, die es in deinem eigenen Bewusstsein gibt. Du leidest, weil du das zu verlieren fürchtest, was du besitzt, oder weil du bereits etwas verloren hast oder weil du etwas verzweifelt zu erreichen suchst. Du leidest, weil du etwas nicht haben kannst oder weil du ganz allgemein Angst hast … Das sind die großen Feinde des Menschen: die Angst vor Krankheit, die Angst vor Armut, die Angst vor dem Tod, die Angst vor Einsamkeit. All das sind Leiden deines Geistes selbst. Sie alle verraten die innere Gewalt, die Gewalt, die in deinem Geist vorhanden ist. Beachte, dass sich diese Gewalt immer aus dem Begehren herleitet. Je gewalttätiger ein Mensch ist, desto niedriger sind seine Begierden.
Ich möchte dir eine Geschichte erzählen, die sich vor langer Zeit ereignet hat.
Es lebte einmal ein Reisender, der eine lange Reise machen musste. Zu diesem Zweck spannte er sein Tier vor einen Wagen und machte sich auf den langen Weg zu einem weit entfernten Ziel, wozu er über eine begrenzte Zeit verfügte. Das Tier nannte er Bedürfnis, den Wagen Begehren, ein Rad nannte er Lust und das andere Schmerz. So lenkte der Reisende seinen Wagen nach links und nach rechts, behielt dabei aber immer die Richtung auf sein Ziel bei. Je schneller der Wagen fuhr, desto schneller bewegten sich auch die Räder der Lust und des Schmerzes, denn beide waren ja durch dieselbe Achse verbunden und trugen den Wagen des Begehrens. Da die Reise sehr lang war, langweilte sich unser Reisender. So beschloss er, den Wagen zu schmücken, und so begann er, ihn mit vielen hübschen Dingen zu verzieren. Aber je mehr er den Wagen des Begehrens schmückte, desto schwerer wurde er für das Bedürfnis, sodass das arme Tier schließlich von den Kurven und steilen Anhöhen ganz erschöpft war und den Wagen des Begehrens nicht mehr ziehen konnte. Auf den sandigen Wegen versanken die Räder der Lust und des Leidens im Boden. Eines Tages verzweifelte der Reisende, da der Weg sehr lang war und sein Ziel noch sehr weit entfernt lag. In dieser Nacht beschloss er, über das Problem nachzusinnen. Und als er das tat, hörte er seinen alten Freund wiehern und verstand die Botschaft. Am nächsten Morgen entfernte er allen Schmuck vom Wagen und erleichterte ihn so von seinem Gewicht. Er versetzte sein Tier sehr früh in Trab und näherte sich so seinem Ziel. Doch er hatte bereits Zeit verloren, die nicht mehr aufzuholen war. In der folgenden Nacht sann er wiederum nach und verstand jetzt durch einen erneuten Hinweis seines Freundes, dass er eine doppelt so schwierige Aufgabe vollbringen musste, da sie nämlich Loslassen bedeutete. Im Morgengrauen opferte er den Wagen des Begehrens. Indem er das tat, verlor er zwar das Rad der Lust, aber mit ihm verlor er auch das Rad des Leidens. Er stieg auf den Rücken des Bedürfnis genannten Tieres und begann, durch die grünen Wiesen zu galoppieren, bis er sein Ziel erreichte.
Beachte, wie dich das Begehren in die Enge treiben kann. Aber es gibt Begierden unterschiedlicher Qualität. Es gibt niedrigere Begierden und es gibt höhere Begierden. Erhebe das Begehren, überwinde das Begehren, reinige das Begehren! Damit wirst du zwar gewiss das Rad der Lust opfern müssen – doch gleichzeitig befreist du dich auch vom Rad des Leidens.
Die Gewalt im Menschen, die durch die Begierden entsteht, bleibt nicht nur als Krankheit in seinem Bewusstsein zurück, sondern sie hat Auswirkungen auf die Welt der anderen – sie wird gegen den Rest der Menschen ausgeübt. Wenn ich von Gewalt spreche, dann glaube nicht, dass ich mich nur auf die bewaffnete Tatsache des Kriegs beziehe, in welchem einige Menschen andere vernichten. Das ist eine Form körperlicher Gewalt.
Es gibt eine wirtschaftliche Gewalt: Wirtschaftliche Gewalt ist die, die dich dazu bringt, andere auszubeuten. Wirtschaftliche Gewalt kommt zustande, wenn du andere bestiehlst, wenn du nicht mehr Bruder des anderen bist, sondern zum Raubvogel für deinen Bruder wirst.
Es gibt auch eine rassistische Gewalt: Glaubst du, dass du keine Gewalt ausübst, wenn du den anderen verfolgst, weil er einer anderen Ethnie angehört? Glaubst du, dass du keine Gewalt ausübst, wenn du ihn verleumdest, weil er einer anderen Ethnie angehört?
Es gibt eine religiöse Gewalt: Glaubst du, dass du keine Gewalt ausübst, wenn du jemandem keine Arbeit gibst, dieser Person die Türen verschließt oder sie entlässt, weil sie nicht deiner Religion angehört? Glaubst du, es ist keine Gewalt, wenn du mittels Verleumdungen Mauern um jemanden errichtest, weil dieser Mensch deinen Glauben nicht teilt – ihn in seiner Familie und bei seinen geliebten Menschen isolierst, nur weil er mit deiner Religion nicht übereinstimmt?
Es gibt weitere Formen von Gewalt, die durch die Philistermoral aufgezwungen werden. Du möchtest anderen deine Lebensform aufzwingen, du glaubst, anderen deine Berufung aufzwingen zu müssen. Aber wer hat dir gesagt, dass du ein Vorbild bist, dem man folgen müsse? Wer hat dir gesagt, dass du anderen eine Lebensform aufzwingen kannst, nur weil sie dir gefällt? Wo ist das Modell, wo ist das Vorbild, nach dem du es aufzwingst? Auch das ist eine Form von Gewalt.
Die Gewalt in dir, in den anderen und in der Welt um dich herum kannst du nur durch inneren Glauben und innere Meditation beenden. Es gibt keine falschen Türen, um die Gewalt zu beenden. Diese Welt ist im Begriff auseinander zu bersten und es gibt keinen Weg, der Gewalt ein Ende zu bereiten! Suche keine falschen Türen! Es gibt keine Politik, die diesen wahnsinnigen Drang nach Gewalt lösen könnte. Es gibt keine Partei oder Bewegung auf diesem Planeten, welche die Gewalt aufzuhalten in der Lage wären. Es gibt keine falschen Auswege für die Gewalt in der Welt … Man sagt mir, junge Menschen auf verschiedenen Erdteilen seien auf der Suche nach falschen Auswegen, um sich von Gewalt und innerem Leiden zu befreien. Sie suchen Drogen als Lösung. Suche keine falschen Türen, um die Gewalt zu beenden.
Mein Bruder, beachte einfache Gebote, die so einfach sind, wie diese Steine und dieser Schnee und diese Sonne, die uns segnet. Trage Frieden in dir und trage ihn zu den anderen. Mein Bruder, dort in der Geschichte ist der Mensch und zeigt das Gesicht des Leidens, schau dieses Gesicht des Leidens an … Aber denke daran, dass es nötig ist, voranzuschreiten, dass es nötig ist, Lachen zu lernen und dass es nötig ist, lieben zu lernen.
Dir, mein Bruder, werfe ich diese Hoffnung entgegen – diese Hoffnung auf Freude, diese Hoffnung auf Liebe, damit du dein Herz und deinen Geist erhebst und damit du nicht versäumst, deinen Körper zu erheben.
Die Gültige Handlung
Las Palmas de Gran Canaria, Spanien, 29. September 1978
Vortrag vor einer Studiengruppe
Worin besteht die gültige Handlung? Man hat auf diese Frage auf verschiedene Arten geantwortet oder zu antworten versucht, wobei fast immer die Gutwilligkeit oder Böswilligkeit einer Handlung in Betracht gezogen wurde, um herauszufinden, was eine Handlung gültig macht. Mit anderen Worten hat man Antworten darauf gegeben, was man von alters her als ethisch oder moralisch kannte. Jahre lang haben wir herauszufinden versucht, was moralisch und was unmoralisch ist, was gut und was böse ist. Aber in erster Linie waren wir daran interessiert, was eine Handlung zu einer gültigen Handlung macht.
Man antwortete uns auf unterschiedliche Art und Weise. Es gab religiöse Antworten, juristische Antworten, ideologische Antworten. Bei all diesen Antworten wurde uns gesagt, dass die Leute die Sachen auf eine bestimmte Art und Weise machen sollten und dass sie es vermeiden sollten, die Sachen auf eine andere Art und Weise zu tun. Es war für uns sehr wichtig, auf diese Frage eine klare Antwort zu erhalten. Und es war deshalb sehr wichtig, weil das menschliche Tun, je nachdem, ob es die eine oder die andere Richtung einschlägt, auch zu unterschiedlichen Lebensweisen führt. Alles im menschlichen Leben passt sich dieser Richtung an. Wenn ich eine bestimmte zukünftige Richtung habe, so wird sich auch meine Gegenwart an sie anpassen. Das heißt nun, dass die Frage darüber, was gültig oder ungültig, was gut oder was böse ist, nicht nur die Zukunft des Menschen betrifft, sondern auch seine Gegenwart – sie betrifft nicht nur das Individuum, sondern auch die menschlichen Gemeinschaften bis hin zu ganzen Völkern.
Verschiedene religiöse Haltungen stellten ihre Lösung zur Frage vor. Also gab es für die Gläubigen bestimmter Religionen die Pflicht, gewisse Gesetze zu befolgen, gewisse von Gott inspirierte Gebote. Und das war für die Gläubigen dieser Religionen gültig. Überdies stellten unterschiedliche Religionen unterschiedliche Gebote auf. Einige wiesen ihre Gläubigen an, dass man bestimmte Handlungen nicht durchführen sollte, um eine gewisse Wendung der Ereignisse zu vermeiden; andere empfohlen dasselbe, um der Hölle zu entgehen. Und manchmal stimmten diese Religionen, die grundsätzlich universell waren, auch in ihren Geboten und Vorschriften nicht überein.
Aber das Beunruhigendste an all dem war, dass in zahlreichen Gebieten der Erde die meisten der dort lebenden Menschen – selbst wenn sie es mit sehr viel gutem Glauben wollten – diese Gebote und diese Vorschriften nicht erfüllen konnten, weil sie sie nicht spürten. Also konnten die Ungläubigen – die ja für die Religionen ebenfalls Kinder Gottes sind – diese Vorschriften nicht erfüllen, so als ob sie von Gott verlassen worden wären. Eine Religion ist nicht deswegen universell, weil sie geografisch die ganze Welt umfasst, sondern vielmehr deswegen, weil sie – unabhängig von den Umständen und Breitengraden – das Herz der Menschen erfüllt. So stellten uns die Religionen mit ihren Antworten über Ethik also vor gewisse Schwierigkeiten.
Wir fragten dann andere, die Einfluss auf menschliche Verhaltensweisen haben, um Rat, nämlich die Rechtssysteme. Sie sind Gestalter und Former von Verhaltensweisen. Die Rechtssysteme legen auf irgendeine Weise fest, was man im zwischenmenschlichen und gesellschaftlichen Verhalten tun oder lassen soll. Es gibt Gesetzbücher aller Art, um die Beziehungen zu regeln. Es gibt sogar Strafgesetzbücher, die für bestimmte Vergehen – das heißt für als unsozial, asozial oder antisozial erachtete Verhaltensweisen – eine Strafe vorsehen. Die Rechtssysteme haben auch versucht, Antworten auf menschliches Verhalten zu geben bezüglich dem, was gute oder böse Verhaltensweisen ausmacht. Und so wie die Religionen ihre Antworten gegeben haben, was gut ist – was gut ist für ihre Gläubigen –, so haben auch die Rechtssysteme ihre Antworten gegeben, was gut für einen bestimmten geschichtlichen Moment und für eine bestimmte gegebene gesellschaftliche Organisationsform ist. Dem Individuum, das bestimmte Verhaltensweisen einhalten muss, sagt all das aber nichts.
Zweifellos stellen die vernünftigen Leute fest, dass eine Regelung des gesellschaftlichen Verhaltens gut ist, um totales Chaos zu vermeiden. Aber bei solchen Regelungen handelt es sich um eine Technik, die Gesellschaft zu organisieren und nicht um die Begründung der Moral. Und gewiss haben die verschiedenen menschlichen Gemeinschaften, je nach ihrer Entwicklung und ihren Auffassungen, juristisch geregelte Verhaltensnormen, die einander manchmal entgegengesetzt sind. Die Rechtssysteme haben keine universelle Gültigkeit – sie gelten für eine bestimmte Zeit und für eine bestimmte Art gesellschaftlicher Struktur, aber sie gelten weder für alle Menschen noch für alle Zeiten oder Breitengrade. Und das Wichtigste von allem ist: Sie sagen dem Individuum nichts darüber, was gut und böse ist.
Wir wandten uns auch an die verschiedenen Ideologien. Die Ideologien sind den längeren Ausführungen viel freundlicher gesonnen und geben buntere Erklärungen als die flachen Rechtssysteme oder etwa als diese ganze Sache mit den Geboten oder Gesetzen, die vom Himmel heruntergebracht wurden. Einige Lehren erklärten, dass der Mensch eine Art Raubtier sei, ein Wesen, das sich um jeden Preis entwickelt und sich über alles hinwegsetzen muss, ja selbst über andere Menschen. Hinter dieser Moral steht eine Art Wille zur Macht. Diese einigen als romantisch erscheinende Moral ist aber einfach auf Erfolg ausgerichtet – sie sagt dem Individuum nichts darüber, wenn es in seinem Willen zur Macht keinen Erfolg hat.
Es gibt eine andere Art Ideologie, die uns sagt: Da alles in der Natur in Evolution begriffen ist und der Mensch selbst ein Ergebnis dieser Evolution ist, und da der Mensch die Spiegelung der in einem bestimmten Moment vorhandenen Bedingungen ist, wird sein Verhalten die Gesellschaft widerspiegeln, in der er lebt. Folglich wird also eine Klasse eine bestimmte Art von Moral haben und eine andere Klasse wird eine andere Art von Moral haben. Auf diese Weise wird die Moral durch die objektiven Bedingungen bestimmt, durch die gesellschaftlichen Beziehungen und durch die Produktionsweise. Demzufolge braucht man sich nicht viele Gedanken zu machen, da man einfach das macht, wozu man mechanisch getrieben wird, obwohl aus Werbegründen von der Moral der einen Klasse oder von der Moral der anderen Klasse gesprochen wird. Wenn wir uns auf die mechanische Entwicklung beschränken, dann mache ich das, was ich mache, weil ich durch mechanische Kräfte dazu angetrieben werde. Wo befindet sich dann der gute Mensch und wo der böse? Es gibt nur einen mechanischen Zusammenstoß von sich bewegenden Teilchen.
Andere eigentümliche Ideologien sagten uns Sachen wie diese: Die Moral ist ein gesellschaftlicher Druck, der wie eine Art Über-Ich dazu dient, die Macht der Triebe einzudämmen. Dieser im Dampfkessel des Bewusstseins erzeugte Druck ermöglicht, dass jene Grundtriebe nach und nach sublimiert werden und eine bestimmte Richtung einschlagen.
Und unser armer Mensch, der die einen und die anderen mit ihren Ideologien vorbeigehen sieht, setzt sich plötzlich auf den Gehsteig und sagt: „Was soll ich tun? Denn hier übt eine gesellschaftliche Gemeinschaft Druck auf mich aus, ich habe Triebe, und es scheint, dass ich diese sublimieren kann, sofern ich eine künstlerisch begabte Person bin. Aber wenn nicht, dann muss ich mich entweder auf das Sofa eines Psychoanalytikers legen oder aber ich ende mit einer Neurose.“ Das heißt, dass die Moral in Wirklichkeit ein Mittel ist, um diese Triebe zu kontrollieren, die manchmal den Dampfkessel zum Bersten bringen.
Es gibt andere Ideologien, ebenfalls psychologischer Natur, die Gut und Böse auf der Grundlage der Anpassung erklärten. Aber eine auf angepasstem Verhalten beruhende Moral, das heißt auf einem Verhalten, das es erlaubt, sich in eine Gemeinschaft einzufügen, wobei man in dem Maße aus der Gemeinschaft ausgeschlossen wird, wie man nicht in diese Gemeinschaft passt, bringt Probleme mit sich. Das Beste ist also, auf dem „rechten Pfad“ zu wandeln und sich gut in die Gemeinschaft einzufügen. Diese Moral sagt uns, dass was gut und böse ist, vom Anpassungsgrad des Individuums abhängt – davon, wie gut sich das Individuum in seine Umgebung einfügt. Und das ist in Ordnung so, es ist ja eine weitere Ideologie.
Aber zu Zeiten großer kultureller Erschöpfung, wie es bereits immer wieder in anderen Zivilisationen geschehen ist, tauchen kurzfristige und unmittelbare Antworten auf die Frage auf, was man tun und lassen soll. Ich beziehe mich hier auf das, was man „moralische Schulen der Dekadenz“ nennen könnte. In verschiedenen, bereits im Untergang begriffenen Kulturen tauchte eine Art von Moralisten auf, die sehr schnell versuchten, ihr Verhalten bestmöglich anzupassen, um ihrem Leben eine Richtung zu geben. Einige sagten ungefähr Folgendes: „Das Leben hat keinen Sinn, und da es keinen Sinn hat, kann ich tun, was immer mir gefällt – sofern ich damit durchkomme.“ Andere sagten: „Da das Leben nicht viel Sinn hat (Lachen), muss ich das tun, was mich befriedigt, was bewirkt, dass ich mich gut fühle – und zwar um jeden Preis.“ Wieder andere meinen: „Da ich mich ja schon in einer üblen Situation befinde und da das Leben selbst Leiden ist, muss ich tun, was ich tue und dabei eine gewisse Form wahren. Ich muss die Dinge wie ein Stoiker tun.“ Deshalb nennen sich diese Schulen der Dekadenz Schulen der Stoa.
Obwohl diese Schulen aus der Not geborene Antworten darstellen, gibt es in deren Hintergrund ebenfalls eine Ideologie. Diese zugrunde liegende Ideologie scheint darin zu bestehen, dass alles den Sinn verloren hat, und diesem Sinnverlust wird eine dringliche Antwort entgegengehalten. Heutzutage gibt es zum Beispiel jene, die versuchen, die Handlung anhand einer Theorie des Absurden zu begründen, in welche die „Verpflichtung“ eingeschmuggelt wird. Es ist wie eine Rückzahlungspflicht bei Krediten – ich bin eine Verpflichtung eingegangen und demzufolge muss ich sie auch erfüllen. Es ist allerdings schwer zu begreifen, wie es Verpflichtungen geben kann, wenn die Welt, in der ich lebe, absurd ist und im Nichts endet. Andererseits verleiht dies der Person, die diese Haltung vertritt, keinerlei Überzeugungskraft.
Die verschiedenen Religionen, Rechtssysteme, ideologischen Systeme und moralischen Schulen der Dekadenz haben sich also bemüht, eine Antwort auf diese ernsten Fragen nach dem Verhalten zu finden, um so eine Moral aufzustellen, um eine Ethik zu definieren – sie alle verstanden die Bedeutung, eine Handlung zu begründen oder nicht zu begründen.
Worin besteht die Grundlage der gültigen Handlung? Die Grundlage der gültigen Handlung wird nicht durch Ideologien gegeben, nicht durch religiöse Gebote, nicht durch Glaubensvorstellungen, nicht durch das Aufstellen gesellschaftlicher Regeln. Auch wenn all diese Sachen von großer Bedeutung sind, verleihen sie alle der gültigen Handlung keinerlei Fundament. Die Grundlage der gültigen Handlung wird vielmehr durch das innere Registrieren gegeben, die das Individuum von der Handlung hat. Es gibt einen grundlegenden Unterschied zwischen der Beurteilung, die von außen zu stammen scheint, und der Beurteilung aufgrund des Registrierens, die der Mensch von dem hat, was er tut.
Und was registriert man bei einer gültigen Handlung? Eine gültige Handlung wird als einheitlich erlebt, sie verleiht gleichzeitig das Gefühl inneren Wachstums und sie ist schließlich eine Handlung, die man wiederholen möchte, weil sie nach zeitlicher Fortführung „schmeckt“. Wir werden diese Aspekte getrennt betrachten: einerseits das Registrieren innerer Einheit und andererseits die zeitliche Fortdauer.
Angesichts einer schwierigen Situation kann ich auf die eine oder auf die andere Weise antworten. Wenn ich zum Beispiel bedrängt werde, kann ich mit Gewalt antworten, ich kann mich angesichts dieser Irritation und Spannung, die der äußere Reiz in mir hervorruft, entspannen – ich kann mich entspannen, indem ich mit Gewalt reagiere und dabei eine Empfindung von Erleichterung erfahre. Somit scheint die erste Bedingung für eine gültige Handlung erfüllt. Angesichts eines störenden Reizes räume ich ihn aus dem Weg und indem ich dies tue, entspanne ich mich und beim Entspannen registriere ich innere Einheit.
Die gültige Handlung lässt sich nicht einfach durch diese momentane Entspannung begründen, denn diese bleibt zeitlich nicht bestehen, sondern sie erzeugt mit der Zeit das Gegenteil. Zum Zeitpunkt A erzeuge ich eine Entspannung, indem ich auf die beschriebene Weise mit Gewalt reagiere, aber zum Zeitpunkt B bin ich nicht im Geringsten mit dem einverstanden, was ich vorher getan habe. Das ruft in mir die Empfindung von Widersprüchlichkeit hervor. Diese Entspannung ist also nicht einheitlich, weil der folgende Moment dem vorhergehenden widerspricht. Um gültig zu sein, muss eine Handlung Einheit verleihen, die zeitlich fortdauert, und zwar ohne Lücken und Widersprüche. Wir alle könnten zahlreiche Beispiele anführen, bei denen eine Handlung zwar für einen Moment als gültig erscheint, dies aber in einem darauffolgenden Zeitpunkt nicht mehr ist. Und so kann die Person nicht wirklich versuchen, diese Art von Haltung beizubehalten, da sie nicht innere Einheit, sondern Widersprüchlichkeit registriert.
Aber es gibt noch einen Punkt, nämlich das Registrieren einer Art Empfindung inneren Wachstums. Es gibt zahlreiche Handlungen, die wir in unserem täglichen Leben ausführen, durch die wir Spannungen entladen und uns so entspannen. Diese Handlungen haben nichts mit Moral zu tun – wir führen sie aus und entspannen uns dabei, was uns einen gewissen Genuss bereitet, sie gehen nicht weiter. Und wenn erneut eine Spannung auftaucht, würden wir sie wieder mit dieser Art Kondensator-Effekt entladen, mit diesem Effekt, bei dem eine Ladung zunimmt und sich entlädt, sobald sie eine gewisse Grenze erreicht hat. So haben wir zum Schluss – mit diesem ständigen kondensatorartigen Laden und Entladen – den Eindruck, dass wir in einem ewig wiederholenden Kreislauf von Handlungen stecken, bei dem sich im Moment der Spannungsentladung zwar eine angenehme Empfindung einstellt, in uns aber einen eigenartigen Geschmack hinterlässt, nämlich dass wenn das Leben nur aus diesem Kreislauf von sich wiederholenden Freuden und Leiden bestünde, dann würde es sicher nicht über das Absurde hinausgehen. Heute rufe ich also gegenüber dieser Spannung diese Entladung hervor und morgen wieder dasselbe … so wie Tag und Nacht sich ablösen, dreht sich das Rad der Handlungen weiter, unabhängig von jeglicher menschlichen Absicht, unabhängig von jeglicher menschlichen Wahl.
Es gibt jedoch Handlungen, die wir vielleicht sehr selten in unserem Leben gemacht haben. Es sind Handlungen, die uns im jeweiligen Augenblick eine große Einheit verleihen. Es sind Handlungen, bei denen wir überdies registrieren, dass sich etwas in uns verbessert hat, als wir sie ausführten. Es sind darüber hinaus Handlungen, die uns ein Versprechen liefern, und zwar in dem Sinne, dass etwas wachsen würde, dass sich etwas verbessern würde, wenn wir sie wiederholen könnten. Es sind Handlungen, die uns Einheit und ein Gefühl von innerem Wachstum verleihen, und sie dauern in der Zeit fort. So werden gültige Handlungen registriert.
Wir haben niemals gesagt, dass dies besser oder schlechter sei oder dass es zwingend getan werden müsse. Wir haben vielmehr Vorschläge gemacht und auf die hingewiesen, die diesen Vorschlägen entsprechen. Wir haben von den Handlungen gesprochen, die Einheit oder Widerspruch erzeugen. Und schließlich haben wir von der Vervollkommnung der gültigen Handlung durch die Wiederholung solcher Handlungen gesprochen. Um ein Registriersystem gültiger Handlungen abzuschließen, haben wir gesagt: „Wenn du deine Handlungen innerer Einheit wiederholst, kann dich nichts mehr aufhalten.“ Das spricht nicht nur vom Registrieren innerer Einheit, vom Gefühl des Wachstums und von der zeitlichen Fortdauer, sondern es spricht auch von der Vervollkommnung der gültigen Handlung, da nicht alles, was wir machen, immer von Anfang an gut gelingt. Oftmals versuchen wir, interessante Dinge zu tun, die nicht auf Anhieb so gut gelingen und wir bemerken, dass wir diese Dinge verbessern können. Auch die gültigen Handlungen lassen sich vervollkommnen. Die Wiederholung jener Handlungen, die Einheit und Wachstum erzeugen sowie zeitlich fortdauern, stellt die Vervollkommnung der gültigen Handlung selbst dar. Das ist möglich.
Wir haben das Registrieren der gültigen Handlung in sehr allgemeinen Grundsätzen angegeben. Es gibt einen Hauptgrundsatz, der als Goldene Regel bekannt ist. Dieser Grundsatz lautet: „Behandle die anderen so, wie du selbst behandelt werden möchtest.“ Dieser Grundsatz ist nichts Neues, er ist Jahrtausende alt. Er hat den Lauf der Zeit in verschiedenen Regionen und in verschiedenen Kulturen überdauert. Es ist ein universell gültiger Grundsatz. Es ist auf unterschiedliche Weise formuliert worden. Man hat ihn beispielsweise unter dem negativen Gesichtspunkt betrachtet, indem man in etwa sagte: „Tu den anderen nicht an, was du nicht willst, dass sie dir antun.“ Dies ist eine andere Betrachtungsweise der gleichen Idee. Oder man sagte auch: „Liebe deinen Nächsten wie dich selbst.“ Das ist wieder eine andere Betrachtungsweise. Natürlich ist das nicht genau das Gleiche, wie wenn man sagt: „Behandle die anderen so, wie du selbst behandelt werden möchtest.“ Und das ist gut so – die Menschen haben von jeher von diesem Grundsatz gesprochen, dem größten der moralischen Grundsätze, dem größten der Grundsätze der gültigen Handlung.
Aber wie möchte ich behandelt werden? Denn es wird als selbstverständlich betrachtet, dass es gut sei, die anderen so zu behandeln, wie man selbst behandelt werden möchte. Und wie möchte ich behandelt werden? Ich werde darauf antworten müssen, indem ich sage, dass wenn sie mich auf eine bestimmte Art behandeln, dann behandeln sie mich schlecht, und wenn sie mich auf eine andere Art behandeln, dann behandeln sie mich gut. Ich werde das also in Begriffen von Gut und Böse beantworten müssen. Und so werde ich zum ewigen Kreislauf zurückkehren und die gültige Handlung nochmals definieren müssen, entsprechend der einen oder anderen Theorie, der einen oder anderen Religion. Für mich wird eine Sache gut sein und für eine andere Person nicht. Und es wird auch jene geben, die diesen Grundsatz anwenden und die anderen sehr schlecht behandeln, weil es ihnen eben gefällt, selbst schlecht behandelt zu werden.
Dieser Grundsatz, der von der Behandlung des anderen auf der Grundlage dessen spricht, was für einen selbst gut ist, ist eigentlich sehr gut. Aber noch besser wäre es zu wissen, was für mich gut ist. So steht es also und unser Interesse wendet sich nun hin zur Grundlage der gültigen Handlung, und die Grundlage der gültigen Handlung liegt in der Registrierung, die man von ihr hat.
Wenn ich sage, dass ich die anderen so behandeln soll, wie ich selbst behandelt werden möchte, dann frage ich mich sofort: „Weshalb sollte ich das?“ Es muss wohl irgendeinen inneren Vorgang geben, irgendeine Art, wie der Geist arbeitet, die mir Probleme bereitet, wenn ich die anderen schlecht behandle. Und was könnte diese Arbeitsweise sein? Wenn ich jemanden sehe, der sich in einem sehr schlechten Zustand befindet, oder wenn ich plötzlich jemanden sehe, der eine Schnittverletzung oder Verwundung erleidet, dann stößt das in mir auf eine Resonanz. Wie kann in mir etwas auf Resonanz stoßen, das einer anderen Person widerfährt? Das klingt fast nach Zauberei! Es kommt vor, dass jemand einen Unfall erleidet und ich es beinahe physisch nachempfinde, so als wäre es mir passiert. Ihr habt euch mit derartigen Phänomenen befasst und wisst gut, dass jeder Wahrnehmung ein Bild entspricht, und ihr versteht, dass einige Bilder bestimmte Körperstellen verspannen können, so wie andere Bilder diese Stellen entspannen können. Wenn jeder Wahrnehmung eine Vorstellung entspricht und wenn man diese Vorstellung wiederum registriert – das heißt von ihr eine Empfindung hat –, dann ist es nicht allzu schwierig zu verstehen, wie es bei der Wahrnehmung eines Phänomens ein dem Phänomen entsprechendes inneres Bild gibt. Und wenn dieses innere Bild ausgelöst wird, habe ich an verschiedenen Stellen meines Körpers oder Binnenkörpers1, die durch die Wirkung dieses Bildes modifiziert wurden, entsprechende Empfindungen. Ich fühle mich „identifiziert“, wenn jemand eine Schnittverletzung erleidet, da mit der visuellen Wahrnehmung eines solchen Phänomens ein visuelles Bild und parallel dazu zahlreiche koenästhetische und taktile Bilder ausgelöst werden, von denen ich wiederum Empfindungen habe, welche in mir schließlich das Registrieren der Schnittverletzung der anderen Person hervorrufen. Es wird also nicht gut sein, wenn ich die anderen schlecht behandle, weil ich dann diese Handlung auch in mir entsprechend registriere.
Fahren wir in einer fast technischen Sprache fort. Dazu werden wir die schrittweise Funktionsweise von Schaltkreisen simulieren – auch wenn wir wissen, dass die Bewusstseinsstruktur als Gesamtheit arbeitet. Nun gut, die eine Sache ist der erste Kreislauf, bestehend aus Wahrnehmung, Vorstellung, erneuter Übernahme der Vorstellung und innerer Empfindung. Und eine andere Sache ist der zweite Kreislauf, der mit der Handlung zu tun hat und in etwa Folgendes bedeutet: Jede Handlung, die ich in Richtung Welt in Gang setze, registriere ich ebenfalls innerlich. Dieses Feedback erlaubt es mir zum Beispiel zu lernen, während ich Dinge tue. Gäbe es in mir kein solches Feedback der Bewegungen, die ich ausführe, könnte ich diese Bewegungen niemals perfektionieren. Ich lerne Schreibmaschinenschreiben durch Wiederholung, das heißt, ich präge mir Handlungen durch Erfolg und Irrtum ein. Ich kann mir aber Handlungen nur dann einprägen, wenn ich sie ausführe. Jede Handlung, die ich ausführe, wird von mir registriert.
Erlaubt mir einen Exkurs: Es gibt ein großes Vorurteil, das manchmal in den Bereich der Pädagogik eingedrungen ist. Gemäß dieser Überzeugung lernt man, indem man denkt anstatt zu handeln. Gewiss lernt man etwas, weil man Daten aufnimmt, aber diese Daten werden nicht einfach abgespeichert, sondern sie gehen immer mit einem Bild einher, das seinerseits eine neue Aktivität in Gang setzt: Es wird verglichen, abgelehnt usw., was die ständige Aktivität des Bewusstseins zeigt und nicht eine angebliche Passivität, in der die Daten bloß abgelegt werden. Es ist gerade dieses Feedback, das mir zu sagen erlaubt: „Ich habe mich vertippt.“ Ich registriere dabei die Empfindung des Erfolgs und des Irrtums, wobei ich die Empfindung des Erfolges perfektioniere, und dabei entsteht die Gewohnheit und so wird die korrekte Handlung des Maschinenschreibens automatisiert. Wir sprechen hier von einem zweiten Kreislauf. Der erste bezog sich auf den Schmerz im anderen, den ich in mir registriere, während sich der zweite Kreislauf auf das Registrieren der von mir ausgeführten Handlung bezieht.
Ihr kennt die Unterschiede, die zwischen den kathartisch genannten Handlungen und den Übertragungshandlungen bestehen. Die kathartischen Handlungen beziehen sich grundsätzlich auf die Entladung von Spannungen und enden dort. Die Übertragungshandlungen erlauben dagegen, innere Ladungen zu verschieben, Inhalte zu integrieren und die reibungslose Arbeit der Psyche zu erleichtern. Wir wissen, dass das Bewusstsein in Schwierigkeiten gerät, wenn es Inseln geistiger Inhalte gibt, die unter sich nicht in Verbindung stehen. Wenn man zum Beispiel in eine Richtung denkt, aber in eine andere Richtung fühlt und schließlich noch in eine andere Richtung handelt, können wir sehen, dass dabei „etwas nicht zusammenpasst“ und dass wir keine Ganzheit registrieren. Es scheint, dass sich die Arbeit der Psyche nur dann zu einem Ganzen zusammenschließen kann, wenn wir zwischen den inneren Inhalten Brücken schlagen, was es dann auch erlaubt, weitere Schritte vorwärts zu machen. Es gibt sehr nützliche Übertragungstechniken, die bestimmte problematische Bilder in Bewegung bringen und umwandeln. Ein Beispiel dieser Technik wird in literarischer Form im Buch Geführte Erfahrungen vorgestellt. Wir wissen aber auch, dass nicht nur die Arbeit mit Bildern, sondern auch die Handlungen Übertragungs- und Selbstübertragungsphänomene bewirken können. Es gibt Handlungen unterschiedlicher Art. Einige Handlungen erlauben es uns, innere Inhalte zu integrieren, während andere Handlungen fürchterlich desintegrierend wirken. Bestimmte Handlungen erzeugen im Menschen eine solch schwere Last, solche Reue und innere Spaltung, solch tiefe Unruhe, dass die betreffende Person diese Handlungen niemals wiederholen möchte. Unglücklicherweise sind aber solche Handlungen stark mit der Vergangenheit der Person verbunden. Selbst wenn man solche Handlungen künftig nicht wiederholen würde, so üben sie doch von der Vergangenheit her ständig Druck aus, ohne dabei gelöst zu werden, ohne sich zu „ergeben“ und ohne es dem Bewusstsein zu ermöglichen, seine Inhalte zu verlagern, zu verschieben oder zu integrieren, was einer Person ermöglichen würde, diese Empfindung inneren Wachstums zu haben, von der wir vorher gesprochen haben.
Es ist nicht bedeutungslos, welche Handlungen man in der Welt macht. Es gibt Handlungen, bei denen man innere Einheit registriert und es gibt Handlungen, die eine Registrierung von Widerspruch und Desintegration hinterlassen. Wenn wir diese Tatsache im Lichte dessen, was wir bezüglich kathartischer und übertragender Phänomene wissen, sorgfältig studieren, dann wird diese Angelegenheit – die Handlung in der Welt bezüglich Integration und Entwicklung der Inhalte – viel klarer. Aber natürlich ist diese Simulation mithilfe von Kreisläufen, um die Bedeutung der gültigen Handlung zu verstehen, ein kompliziertes Thema. Währenddessen fragt sich unser Freund immer noch: „Und was soll ich tun?“ Wir empfinden es als einheitlich und wertvoll, dieser Person, die – ohne Bezugspunkte in ihrem Leben – auf dem Gehsteig sitzt, wenigstens diese Sachen, die wir wissen, mit einfachen Worten und Taten zu vermitteln. Wenn niemand das für sie tut, dann tun wir es – so wie vieles andere, was Schmerz und Leiden zu überwinden erlaubt. Indem wir so vorgehen, werden wir auch für uns selbst arbeiten.
1 - Im Original intracuerpo. Der Begriff „Binnenkörper“ (intracuerpo) wurde bereits von Ortega y Gasset häufig in seinen Vorlesungen verwendet und insbesondere in seiner Vorlesung Vitalität, Seele, Geist ausführlich beschrieben. (Anm. d. Ü.)
Über das Rätsel der Wahrnehmung
Las Palmas de Gran Canaria, Spanien, 1.Oktober 1978
Vortrag vor einer Studiengruppe
Vor 2500 Jahren behandelte Buddha in einem Meisterunterricht beschreibender Psychologie eines der wichtigsten Probleme in Bezug auf die Wahrnehmung und auf das die Wahrnehmung beobachtende Bewusstsein. Dabei stützte er sich auf eine Methode des Registrierens.
Diese Art von Psychologie unterscheidet sich stark von der offiziellen westlichen Psychologie, die eher mit Erklärungen über die Phänomene arbeitet. Wenn ihr ein Lehrbuch über Psychologie öffnet, werdet ihr feststellen, wie zu einem gegebenen Phänomen sofort eine Reihe von Erklärungen über dieses Phänomen zusammengetragen wird, aber das eindeutige Registrieren des Phänomens wird nicht beschrieben.
Folglich erklären die psychologischen Strömungen die psychischen Phänomene ganz unterschiedlich, und zwar abhängig davon, wie sich ihre Auffassungen und ihre Daten mit der Zeit ändern und wie sich ihre Erkenntnisse erweitern oder verringern. Wenn wir also ein einhundert Jahre altes Psychologielehrbuch aufschlagen, werden wir darin eine ganze Reihe von naiven Behauptungen finden, die für heutige Standards inakzeptabel sind. Diese Art von Psychologie ohne eigenen Schwerpunkt ist in großem Maße von den Beiträgen anderer Wissenschaften abhängig. Beispielsweise ist eine neurophysiologische Erklärung der Bewusstseinsphänomene interessant und stellt einen Fortschritt dar. Einige Zeit später werden wir auf eine noch komplexere stoßen. Auf alle Fälle schreitet die Erkenntnis hinsichtlich der Erklärung voran. Was aber die Beschreibung des Phänomens an sich angeht, bringen uns solche Erklärungen nicht weiter. Eine vor 2500 Jahren richtig abgegebene Beschreibung ermöglicht uns jedoch, an der Entstehung der geistigen Phänomene teilzunehmen, und zwar genau so, als wäre diese Beschreibung heute gemacht worden. Auf die gleiche Weise wird eine heute richtig abgegebene Beschreibung noch für lange Zeit dienlich sein. Diese Art der beschreibenden und nicht erklärenden Psychologie (außer wenn Erklärungen unerlässlich sind) basiert auf dem Registrieren, das für alle, die der Beschreibung folgen, ähnlich ist. Es ist, als würden diese Beschreibungen alle Menschen zu Zeitgenossen machen, selbst wenn sie zeitlich sehr weit auseinanderliegen – und selbstverständlich machen sie sie auch zu Landsleuten, sogar wenn sie in weit voneinander entfernten Breitengraden leben. Eine solche Psychologie stellt darüber hinaus eine Geste der Annäherung an alle Kulturen dar, egal, wie verschieden sie sein mögen, weil sie weder die Unterschiede hervorhebt noch versucht, das eigene kulturelle Schema den anderen aufzuzwingen. Diese Art Psychologie bringt die Menschen einander näher, anstatt sie zu trennen. Sie ist also ein guter Beitrag zur Völkerverständigung.
Kommen wir nun zur Sache. Anscheinend war Buddha mit einer Gruppe von Sachverständigen zusammen und in einer Art Dialog legte er das dar, was später als Das Rätsel der Wahrnehmung bekannt wurde.
Plötzlich hob der Buddha seine Hand und fragte einen seiner bemerkenswertesten Schüler: „Was siehst du, Ananda?“
Mit seinem nüchternen Stil fragte und antwortete der Buddha jedes Mal ganz präzise. Ananda dagegen schmückte seine Darlegungen reichlich aus. Daher sagte Ananda: „O edler Herr! Ich sehe die Hand des Erleuchteten, die sich vor mir befindet und sich schließt.“
„Sehr gut, Ananda. Wo siehst du die Hand und von wo aus siehst du sie?“
„O Meister! Ich sehe die Hand meines edlen Herrn, die sich schließt und die Faust zeigt. Ich sehe sie selbstverständlich außerhalb von mir und von mir aus.“
„Sehr gut, Ananda. Womit siehst du die Hand?“ „Selbstverständlich, Meister, sehe ich die Hand genau mit meinen Augen.“
„Sage mir, Ananda: Ist die Wahrnehmung in deinen Augen?“
„Gewiss, ehrwürdiger Meister.“
„Und sage mir Ananda: Was geschieht, wenn du deine Augenlider schließt?“
„Edler Meister, wenn ich meine Augenlider schließe, dann verschwindet die Wahrnehmung.“
„Dies, Ananda, ist unmöglich. Ananda, wenn sich dieser Raum verdunkelt und du immer weniger siehst, verschwindet etwa die Wahrnehmung?“
„In der Tat, Meister.“
„Und Ananda, wenn dieser Raum im Dunkeln bleibt und du dich jedoch mit offenen Augen darin befindest und nichts siehst, ist die Wahrnehmung etwa verschwunden?“ „O edler Meister, ich bin doch dein Neffe … erinnere dich, dass wir gemeinsam erzogen worden sind und dass du mich sehr liebtest, als ich klein war; also bringt mich nicht durcheinander!“
„Ananda, wenn sich der Raum verdunkelt, dann sehe ich keine Objekte, aber meine Augen sind weiterhin tätig. Also: Wenn es hinter meinen Lidern Licht gibt, sehe ich dieses Licht vorübergehen; und wenn dort absolute Finsternis herrscht, dann bleibe ich in dieser Finsternis. Das heißt nun, dass die Wahrnehmung nicht durch die Tatsache verschwindet, dass die Augenlider geschlossen werden. Sage mir Ananda, wenn sich die Wahrnehmung im Auge befindet und du dir vorstellst, dass du meine Hand siehst, wo siehst du sie dann?“
„Herr, es wird wohl so sein, dass ich deine Hand sehe, indem ich sie mir von meinem Auge aus vorstelle.“
„Was willst du sagen, Ananda? Dass sich die Vorstellungskraft im Auge befindet? Das ist nicht möglich. Wenn sich die Vorstellungskraft in deinem Auge befinden würde und du dir die Hand innerhalb deines Kopfes vorstellen würdest, dann müsstest du dein Auge nach hinten drehen, um die Hand zu sehen, die sich innerhalb deines Kopfes befindet. So etwas ist nicht möglich. Das heißt, du wirst erkennen müssen, dass sich die Vorstellungskraft nicht im Auge befindet. Wo befindet sie sich dann?“
„Es wird wohl so sein, dass sich sowohl das Sehen als auch die Vorstellungskraft nicht im Auge befinden, sondern dass sie sich hinter dem Auge befinden, und wenn sie sich hinter dem Auge befinden, kann ich, wenn ich mir etwas vorstelle, nach hinten sehen; und wenn ich sehe, wenn ich wahrnehme, kann ich das sehen, was vor dem Auge liegt.“
„Im zweiten Fall, Ananda, würdest du nicht die Gegenstände sehen, sondern du würdest das Auge sehen …“
Und so ging es bei diesen Dialogen weiter. Beim Rätsel der Wahrnehmung werden die Registrierungen immer komplizierter, es werden scheinbare Lösungen gegeben, aber es werden auch immer gewichtigere Einwände gemacht, bis Ananda – sehr ergriffen – den Buddha um eine entsprechende Erklärung bittet, wie diese Geschichte mit dem Sehen und der Einbildung und dem Bewusstsein im Allgemeinen ist. Und obwohl Buddha in seinen Beschreibungen sehr streng ist, beginnt er bei seinen Erklärungen große Umschweife zu machen. So schließt sich dann dieses Kapitel, das im Surangama Sutra enthalten ist, einer der interessantesten Schriften dieser Gelehrten.
Wenn wir die Hand vor uns halten, dann sehen wir die Hand außerhalb von uns, aber von unserem Inneren aus. Das heißt, dass uns das Objekt an einem Standort erscheint, der sich vom Beobachtungspunkt des Objekts unterscheidet. Wenn mein Beobachtungspunkt außen wäre, könnte ich keine Kenntnis meines Sehens haben. Somit muss der Beobachtungspunkt innen sein und nicht außen, während das Objekt außen und nicht innen sein muss. Wenn ich mir nun aber die Hand im Innern meines Kopfes einbilde, tritt der Fall ein, dass sowohl das Bild als auch der Beobachtungspunkt innen sind. Im ersten Fall – dem der Hand, die ich draußen von innen aus sehe – scheint der Beobachtungspunkt sich ungefähr mit dem Auge zu decken. Im zweiten Fall – wenn die Hand innen ist – deckt sich der Beobachtungspunkt nicht mit dem Auge, da ich die Hand ja – wenn ich sie mir in meinem Kopf vorstelle – von meinem Auge her in Richtung nach innen sehen kann, vom hinteren Teil meines Kopfes in Richtung nach innen. Ich kann meine Hand auch von oben sehen, von unten und ebenso von vielen anderen Standorten aus. Das heißt, wenn es sich um eine Vorstellung und nicht um eine Wahrnehmung handelt, ändert sich der Beobachtungspunkt. Demzufolge ist der Beobachtungspunkt bei der Vorstellung nicht im Auge fixiert.
Wenn ich mir jetzt einbilde, dass sich meine Hand – die sich im Mittelpunkt meines Kopfes befindet – nach hinten hinausbewegt, dann stelle ich mir meine Hand weiterhin vom Inneren meines Kopfes aus vor, auch wenn ich sie mir außerhalb von ihm vorstelle. Man könnte denken, dass der Beobachtungspunkt zu irgendeinem Moment aus meinem Kopf herausgeht. So etwas ist nicht möglich. Wenn ich mir beispielsweise vorstelle, dass ich mir selbst gegenüberstehe und mich von dort aus betrachte, dann kann ich mir den vorstellen, der mich sieht, und zwar von hier aus, wo ich mich befinde. Ich könnte mir sogar mein Aussehen vorstellen, so als ob ich von dort gesehen würde, von demjenigen aus, der mich betrachtet. Doch auch wenn ich mich in die Lage dessen versetze, der mir gegenübersteht, das Registrieren empfinde ich von mir aus, von da aus, wo ich mich befinde. Ähnliches geschieht, wenn ich mich im Spiegel anschaue: Ich kann doch nicht sagen, dass ich mich innerhalb des Spiegels sehe oder mich innerhalb des Spiegels empfinde. Ich bin hier und sehe mich dort, ich bin nicht dort und sehe mich hier. Man könnte sich täuschen und glauben, dass dadurch, dass man seinem eigenen Abbild gegenübersteht, der Beobachtungspunkt dort liegt. Doch nicht einmal in diesem Fall ist so etwas möglich. Bei bestimmten Versuchen (zum Beispiel im Isolationstank) verliert man die Wahrnehmung vom Ich, wenn gewisse Wahrnehmungen weniger registrierbar sind. Und indem die Wahrnehmung vom Ich verloren geht und der Bezug zur Grenze des Tastsinnes verschwindet, hat man manchmal
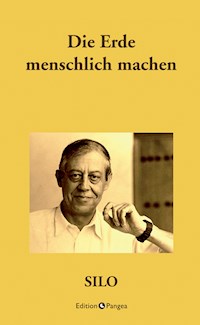
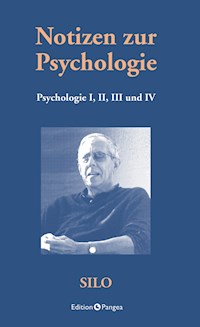

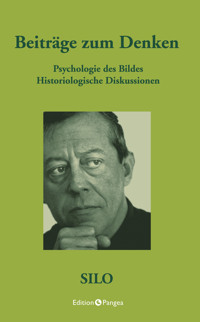
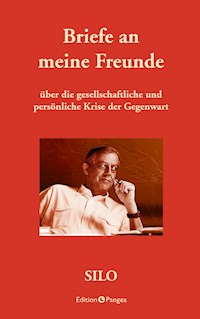
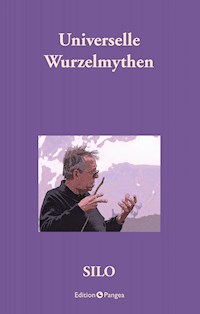
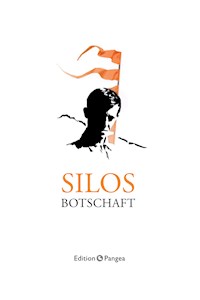
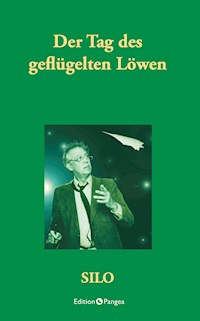
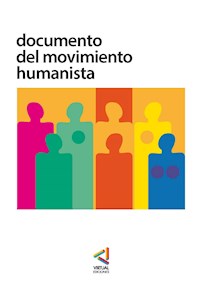
![[Colección del Nuevo Humanismo] Habla Silo (segunda edición ampliada) - Silo - E-Book](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/cc830963ad1d8c858c89ca0c845218e8/w200_u90.jpg)

![[Colección del Nuevo Humanismo] Silo. Obras completas - Silo - E-Book](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/510b4419af7104621f6e74dee8ced2fc/w200_u90.jpg)
![[Colección del Nuevo Humanismo] Contribuciones al pensamiento - Silo - E-Book](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/aab675b8808889b6db918eaba06930eb/w200_u90.jpg)
![[Colección del Nuevo Humanismo] Cartas a mis amigos - Silo - E-Book](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/309ff5fc8cfe6fc640ef26b4f1d8c445/w200_u90.jpg)
![[Colección del Nuevo Humanismo] Apuntes de Psicologia - Silo - E-Book](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/5b1745b0742bcfd52ae0294b27ae1d83/w200_u90.jpg)
![[Colección del Nuevo Humanismo] El día del León Alado - Silo - E-Book](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/6a8875d9a1d0262324a8cf0005f22def/w200_u90.jpg)
![[Colección del Nuevo Humanismo] Diccionario del Nuevo Humanismo - Silo - E-Book](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/53dd0908b684c28f27f1e5d351fdb57a/w200_u90.jpg)
![[Colección del Nuevo Humanismo] Humanizar la tierra - Silo - E-Book](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/9ce2e094ae7da55ef2fe59a8ba6da9ca/w200_u90.jpg)
![[Colección del Nuevo Humanismo] Notas - Silo - E-Book](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/3be9ec4c08cc977f0c6f4905ca405abd/w200_u90.jpg)










