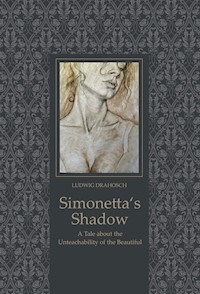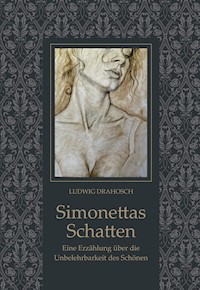
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Verlag Margarete Tischler
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Der alte Maler Giorgio hat all seine Pinsel und Ideale längst eingesperrt. Seine von der Renaissance inspirierte Kunst wird in dieser Welt nicht mehr geschätzt. Er lebt abgeklärt in Florenz, bis zu dem Moment, wo zwei Begegnungen seine malerische Leidenschaft wieder wecken und deren Intensität die Brücke zwischen Traum und Wirklichkeit langsam auflöst. Jeden Abend sitzt er bis spät vor seiner Lieblingscafeteria und beobachtet die Schatten, welche von Passanten auf die gegenüberliegende Kirchenwand geworfen werden, vergleicht die Umrisse mit Gemälden. Er sieht es als seine Aufgabe, sein Umfeld für die Kunst zu sensibilisieren. Seine Eindrücke teilt Giorgio mit seiner Muse, der unglaublich sinnlichen Genoveva, die schnell in den Bann der Renaissance gezogen wird. Eines Nachts sieht Giorgio einen ganz besonderen Schatten, der ihn an die Renaissance-Schönheit Simonetta Vespucci erinnert. Diese Inspiration öffnet Giorgio ein Tor, die Grenze zwischen Realität und Fantasie verschwimmt bei einem leidenschaftlichen Gespräch mit Geistern aus der Vergangenheit. Zweifelnd an seiner Wahrnehmung vertraut er sich seiner Muse Genoveva an, die sich mit Giorgio auf die Suche nach den Spuren seiner Vision macht.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 112
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Ludwig Drahosch
Simonettas Schatten
Eine Erzählung über die Unbelehrbarkeit des Schönen
I ~ Giorgio
Die Malerei befasst sich mit den zehn Dingen, die man sehen kann, diese sind: Dunkelheit und Helligkeit, Substanz und Farbe, Form und Ort, Entfernung und Nähe, Bewegung und Ruhe.
Leonardo da Vinci
Als Giorgio in seine wahrscheinlich letzte Lebensdekade vordrang, machte sich in ihm keine Wehmut breit.
Im Gegenteil. Er begann, sich mit dem Winter seines Daseins anzufreunden und war dankbar für die unermesslich vielen Einsichten, die er durch die Augen der alten Maler im Laufe seines Lebens sammeln hatte können. Sie befähigten ihn, Gewohnheiten zu entwickeln, die ihm halfen, sich in seiner Umgebung so einzurichten, dass er immer mit der für ihn notwendigen Dosis Schönheit versorgt war.
Fragte man Giorgio, was denn die schönsten von Menschen geschaffenen Welten seien, so würde er von Florenz und der Renaissance zu sprechen beginnen, von Malern, die auch Architekten waren, denen das Talent zur Form in die Wiege gelegt wurde.
Seine mittlerweile alten, aber von klein auf an Malerei geschulten Augen vermittelten ihm nur dann Wohlbefinden, wenn sich sein ganzes Wesen in ein Bild versetzt fühlte. In Bilder, die er liebte. Bilder von Caravaggio oder Tizian, auch Monet und manchmal sogar den vierhundert Jahre später geborenen Hopper, was auf den ersten Blick denen, die ihn näher kannten, vielleicht etwas ungewöhnlich erschien, nicht zuletzt, weil die Menschen gerne die Zeit mit der Idee einer Zeit verwechseln, während Giorgio die Idee einer Zeit anstrebt und diese, zwar selten aber doch, auch in anderen Zeiten wiederfindet.
Jeden Tag, wenn die Sonne langsam eher den Horizont als den Himmel prägte, und die Schatten länger wurden, genau genommen, wenn die Schatten der Menschen doppelt so lange wurden wie sie selbst, nahm Giorgio seinen Hut und verließ seine Wohnung, die irgendwo zwischen dem Zentrum und der florentinischen Peripherie lag.
Jeden Tag, als die Dämmerung sich bemerkbar machte, drang Giorgio in stillere Gassen vor, wo Menschen, Schilder und Neonlichter Platz machten für die Patina vergangener Zeiten und die Straßenlaternen den täglichen Kampf um die Herrschaft des Lichtes gewannen.
Mit jedem Schritt wurde Giorgio langsamer, mit jedem Schritt erschien ihm seine Umgebung malerischer. Er atmete durch und sein Gang bekam allmählich eine ähnliche Ausstrahlung wie die des sich in Würde verabschiedenden Tages.
Es war so, als würde er bewusst durch eine – in Liebe koexistierende – Harmonie aus Dunkelheit und Helligkeit, Farbe und Form, Bewegung und Ruhe gleiten. Des Lebens Leichtigkeit stellte sich wie von alleine ein, die Schwere überließ er den steinernen Prachtbauten, die aneinandergereiht das Bild Florenz‘ prägten.
Giorgios abendliches Ziel war seit geraumer Zeit immer dasselbe: eine unauffällige, in den Gassen Florenz‘ versteckte Cafeteria. Eine schmale und dunkle, von altem Mauerwerk umschlossene Gasse führte dort hin. Zwischen schmiedeeisern vergitterten Fenster, an denen Kletterpflanzen aus Blumentöpfen rankten, hingen von Wand zu Wand gespannte, weiße Laken.
Giorgio liebte dieses Szenerie. Nirgendwo waren Schwere und Leichtigkeit, Hell und Dunkel so eng beisammen wie in dieser florentinischen Gasse, in dem Moment der blauen Stunde, als das seitlich einfallende Licht alle Gegenstände nur mehr streifte, ihre Formen zeichnete und ausformulierte, als würden sie gerade auf der Staffelei eines nach Sinn suchenden Malers entstehen. Er dachte jedes Mal an Tintoretto, Raffael und ihre vom Himmel flatternden Faltenwürfe.
Geradeaus in der näher kommenden Ferne wuchs die Fassade einer alten weißen, von der Zeit gedunkelten, Marmor verkleideten Kirche empor.
Als Giorgio an einer aus der Wand ragenden und mit schwarzen, verspielten, gusseisernen Trägern befestigten Laterne vorbeiging, begann sich sein Schatten an der Kirchenwand abzuzeichnen. Die Laterne war unmittelbar vor einer kleinen, nach frischem Weißbrot duftenden Panetteria befestigt. Er stieg eine fünfstufige, steinerne Treppe Richtung Kirchenwand hinauf und sein Schatten wurde kleiner. Jetzt zeichneten sich auch seine Füße, stets die Richtung beibehaltend, an der Wand ab. Er überquerte eine schmale Gasse, deren Pflastersteine so abgetreten waren, dass Giorgio, kurz innehaltend, jedes Mal an Michelangelos Hundelederstiefel dachte und daran, dass sie bestimmt an der Politur dieser alten Pflastersteine beteiligt waren.
Sein Ziel lag nun ganz nah. Noch drei Meter florentinische Mauer zu seiner Rechten und das Eckhaus gebar Antonios Cafeteria in einem versteckten Inneneck, welche die Angewohnheit hatte, erst dann sichtbar zu werden, wenn man direkt davor stand. Giorgio hatte die Angewohnheit, sich so und nicht anders zu setzen, dass die Kirchenwand direkt vor ihm aufragte, während die Längsseite der Cafeteria zu seiner Rechten und die kürzere Seite hinter ihm lag.
Auf seinem Tisch wartete jeden Abend ein Glas Portwein auf ihn, dessen Inhalt fast so alt wie er selbst war.
Der erste Schluck des durch sein Alter dick gewordenen, nahezu ölig, herb-süßen Weines löste sich fast vollständig auf seinem Gaumen auf und ließ Giorgio nun auch von innen die eigene Gegenwart vergessen.
Eine Leichtigkeit machte sich in ihm breit und überwog jeden seiner schweren Gedanken, welche Giorgio ständig mit sich trug. Heimlich schlüpfte er aus seinen Schuhen, spürte den aufgewärmten steinernen Boden und sog mit den Fußsohlen florentinische Geschichte in sich auf.
Wieder kamen ihm die Hundelederstiefel Michelangelos in den Sinn und die Hingabe, mit der er sein letztes halbes Jahr nurmehr arbeitete oder schlief, sich selbst so vergessend, dass er die Stiefel nie auszog. Ein kurzer schmerzhafter Moment an Selbstironie kam auf. Im Vergleich zu Michelangelos fühlte sich Giorgios eigener Wille wie ein in der Jugend erwachter Wunsch, der vom Leben verweht wurde.
Antonio, der Besitzer der Cafeteria, ein dunkelhaariger und durchaus barocker Mann mit einem echtem Lachen, der Kellner, Koch und gesprächsfreudiger Gastgeber in einem war, liebte seinen Gast nicht nur, weil er ein gutes Trinkgeld gab, er sagte über ihn: „… Giorgio ist der letzte Mensch mit Kultur, den ich kenne!“ Der Zufall wollte, dass Antonio an einer Acrylfasern-Allergie litt, die ihn dazu zwang, nur reine, ungefärbte Leinenhemden zu tragen, was wiederum für Giorgio ein Grund mehr war, diesem Mann mit einer gewissen Wertschätzung entgegenzutreten. Das scharfe Seitenlicht mit den im Hintergrund sich aufbauenden Renaissancemauern, in Verbindung mit rohen Leinen, ließ die Illusion zu, in einem Gemälde von Caravaggio zu spazieren.
Antonios Tochter hieß Chiara. Nomen est omen, dachte Giorgio jedes Mal, wenn er diesem Wesen mit seiner hellen und klaren Ausstrahlung begegnete. Chiara half manchmal in der Cafeteria aus. Doch meistens saß sie an einem kleinen runden Tisch, vertieft in Bücher der Veterinärmedizin. Manchmal sah sie verstohlen zu Giorgio hinüber, der sie an einen alt gewordenen weißen Leoparden erinnerte.
Chiara und ihr Vater waren ein Grund, warum Giorgio sich hier so wohlfühlte.
Der Hauptgrund aber waren die Schattenspiele an der Wand der Kirche. Sie entstanden durch das Laternenlicht und die Kunden der Panetteria unter den fünf Stufen in der schmalen Gasse, gekreuzt von den etwas kleineren Schatten der flanierenden Florentiner, die über die Quergasse mit den alten Pflastersteinen vorbeigingen.
An der Kirchenwand wuchsen Bilderwelten, mit denen Giorgio kommunizierte. Silhouetten, die nach vorne und hinten huschten, geradewegs vorbeigingen, stehen blieben, sich unterhielten, ineinander- und auseinanderflossen. Diese Schatten ergaben jeden Abend scheinbar spielerische Zufälle und Giorgio besaß die Gabe, diese Zufälle in ein malerisches Schicksal zu verwandeln.
Die Schatten platzierten sich in die Erker der Kirchenwand, eingefasst von fragmentarisch erhaltenen Säulen, und während Giorgio ihnen lauernd zusah, wusste Antonio genau, wann der Augenblick gekommen war, der Moment, in dem Giorgio das Schattenbild einfing. Jenes flüchtige Schattenbild, das aus der Kunstgeschichte kam.
„… erkennst du es, Antonio!?“
Antonio schaute gespannt auf die Schattenwand, den Ellbogen in den Bauch gestützt, die Hand am Kinn gelehnt, als müsste sich der Kopf zum Denken Unterstützung holen. „… ein Jesusknabe in einer alten Ikone, Giorgio?“
„Ja, Antonio! Ein wunderbares Beispiel für eine Bedeutungsperspektive!“
Vor der Panetteria stand ein Mann mit einem kleinen Kind auf den Schultern. Der lockige Kopf des jungen Knaben war fast in gleicher Höhe wie die Laterne und zauberte dadurch einen überdimensionalen Schatten mitten auf die Kirchenwand.
Giorgios Augen blitzten vor Freude.
„In der gotischen Malerei wurden die Figuren gemäß ihrer Bedeutsamkeit dargestellt, Antonio! Der mindere Mensch war klein, der mächtige groß. Da die Kirche über jedes Motiv die Entscheidungsgewalt besaß, wurden die Heiligen meist als Giganten dargestellt. Das Kleinkind genau in der Mitte, ganz nah dem Lichte … siehst du, viel zu groß als Schatten, das ist der Jesusknabe. Jetzt fehlen nur noch die weniger wichtigen Heiligen Könige, die etwas zwergenhaft um den Jesusknaben herumstehen sollten. So hätten wir einen Wink aus der Gotik vor uns!“
Chiara, die am Nebentisch etwas unmotiviert in ihren Studien versunken war, sprang auf und tänzelte an die Seite des imaginären Jesusknaben. Antonio tat es ihr gleich und ging auf die andere Seite des überdimensionalen Schattens.
„Ist‘s so recht, Giorgio?“, rief Chiara und machte eine kokette, für den gefragten Stil doch etwas zu kokette Pose. Giorgio lächelte. Diese Abende machten ihn glücklich.
„Sehr recht, Chiara. Weißt du, in der Malerei ist alles fließend. Ein paar Jahre später beendete der junge Masaccio diesen Spuk und gab den Figuren durch naturgetreue Perspektive ihre eigentliche Größe zurück. Wofür ich ihm sehr dankbar bin.“
Antonio nickte verständig. Giorgio blieb noch eine Weile sitzen, während er darüber nachdachte, wie der Mensch sich von Jahrhundert zu Jahrhundert immer mehr die Größe einer Gottheit zuschrieb.
II ~ Genoveva
Der Mensch – das Augenwesen – braucht das Bild.
Leonardo da Vinci
Am nächsten Morgen saß Giorgio an seinem Schreibtisch, auf dem sich eine Landschaft aus Stiften, Büchern, Skizzen und kleinen Schachteln ausbreitete.
Beiläufig blätterte er durch Skizzenbücher seiner Jugend – Zeugen einer regen Auseinandersetzung mit weiblicher Anatomie und seiner mitunter beachtlich erfolgreichen Suche nach Anmut – als eine auswärtige Geräuschkulisse durch das Fenster zu seiner Linken seine Aufmerksamkeit auf sich zog. Das Haus auf der gegenüberliegenden Straßenseite war ein für ihn noch halbwegs erträglicher Ausblick. Die Fassade kleidete sich in ein architektonisches Flickwerk, wo die Renaissance an manchen Stellen noch aufblitzte, insbesondere an dem loggiaähnlichen, dreibögigen Balkon, der unmittelbar gegenüber seinem Fenster die Aussicht prägte.
Doch spürte Giorgio täglich, wie die Zeit daran nagte und die stillen sinnlichen Momente, die aus der Renaissance hervorblinzelten, immer bedrohter um ihr Dasein kämpften.
Er merkte gerade, wie sich auf dem Balkon gegenüber Leben regte, was schon, abgesehen von den Tauben, die sich dort tummelten, seit langem nicht mehr der Fall war. Eine Röte flatterte über seine alten Wangen, als er eine Frau mit auffallend sinnlicher Ausstrahlung entdeckte. Sie dürfte schätzungsweise Mitte, Ende dreißig sein und hatte lockige Haare, deren Farbe Giorgios Aufmerksamkeit sofort auf sich zog: weder weiß noch blond, auch nicht hellgrau, sie strahlten, als würden sie kein Licht benötigen, aus sich selbst heraus und erinnerten an Opale, die über Nacht im Wasser gelegen hatten. Doch ganz war Giorgio mit dem Vergleich noch nicht zufrieden, bis es ihm gelang, seinen Geist so anzuspornen, dass er jetzt, beim Anblick dieser Haare, an schillernde Innenflächen französischer Austern dachte und sich in verzückter Aufregung erwischte, als er einsah, dass „die Schaumgeborene“ höchst persönlich in seine Nachbarschaft gezogen war.
Sichtbar gut gelaunt verteilte die Fremde, umrankt von steinernen Geländern mit Geschichten, die niemand mehr zu erzählen vermochte, Blumentöpfe auf ihrem Balkon. Sie blickte abwechselnd freudig erregt und planlos um sich, bis sie auf einmal Giorgio bemerkte. Seine offensichtliche Aufmerksamkeit brachte sie in Verlegenheit und verlangsamte ihre Bewegungen, bis sie ganz zum Stehen kam und nicht recht wusste, sich weiter zu gebärden. Sie fühlte sich ganz und gar beobachtet von dem großen, alten Mann, der mittlerweile an seinem Fenster gegenüberstand und sie regungslos anstarrte.
Sie fasste ihren ganzen Mut zusammen.
„Kann ich irgendwie behilflich sein!?“
Giorgio zuckte leicht zusammen, als erwachte er aus einem Tagtraum und sein Blick wandte sich dem Hier und Jetzt zu.
„Meine Dame, ich möchte mich vorstellen, da wir nun offensichtlich Nachbarn sind. Ich heiße Giorgio und freue mich sehr, Ihre Bekanntschaft zu machen!“
Das Verlegene in der schönen Frau wich. „Ich bin Genoveva und ja, wie Sie eben bemerkt haben, gerade eingezogen!“
„Ich freue mich, dass meine Aussicht in Zukunft belebter sein wird, insbesondere, wenn meine neue Nachbarin von der Natur so einfallsreich beschenkt wurde“, antwortete er galant. „Doch habe ich eine kleine Befürchtung, die ich, wenn Sie gestatten, gerne äußern würde!“
Eine kleine Zäsur füllte den Raum zwischen Balkon und Fenster. Die Schaumgeborene strich sich eine ihrer Austernlocken von der Stirn.
„Ich weiß nicht, was für eine Befürchtung Sie haben könnten, aber bitte, lassen Sie ihr freien Lauf. Vielleicht erübrigt sie sich von selbst!“
„Sie sehen sich nicht, aber ich sehe Sie …“, begann Giorgio.
„Aha … !“
Genoveva schob fast unmerklich ihre Hüfte von rechts nach links und wieder retour. Diese winzige Rotation der weiblichen Hüfte erschien Giorgio wie eine warnende Naturgewalt.
„… so, wie sie hier auf dem Balkon stehen, sehen Sie sich nicht, aber ich sehe Sie!“
„Ja, das ist wohl so, doch worauf wollen Sie hinaus?“, erwiderte Genoveva etwas hilflos ob der doch etwas merkwürdigen Situation.
„Meinen Sie, es wäre in Ordnung, wenn ich ein wenig bei der Gestaltung Ihres Balkons nachhelfen würde, da diese in Zukunft meine Morgenstimmung prägen wird!“
„Ah, so! Ja, so gesehen …“
Genoveva wusste nicht, was sie sonst entgegnen sollte und fasste sich erneut ins Haar, als suchte sie dort etwas, fand jedoch nur Ratlosigkeit und ein Rosenblatt, das ihr der Boboligarten bei ihrem morgendlichen Spaziergang heimlich geschenkt hatte.
„Darf ich also vielleicht ein paar Anmerkungen machen, um Ihre derzeitige Balkonsituation zu verfeinern?“, bat Giorgio in ausgesuchter, aber doch bestimmter Höflichkeit, die ihm grundsätzlich eignete. Genoveva stützte beide Hände in die Hüfte.
„Legen Sie los!“
Giorgio stützte seine Ellbogen aufs Fensterbrett und holte Luft.
„Dankeschön! Zu allererst sollten wir festhalten, dass dieses Haus, in dem Sie leben, aus dem Jahre 1570 ist! Das verpflichtet uns aus Respekt vor den Erbauern, dem Architekten und den Handwerkern jener Epoche, gewissermaßen zu einer Farbtreue!“
„… Verstehe!“
Genoveva stützte ihre Ellbogen ebenfalls auf das Balkongeländer, während Giorgio fortfuhr: „… und natürlich schulden wir auch der Patina, die über Jahrhunderte dafür gesorgt hat, dass wir in dieser sommerlich-diesigen Morgenstimmung uns vorstellen könnten, in einem Gemälde von Francesco Guardi zu sein, die gebührende Wertschätzung. Sie werden in keinem seiner Bilder farbliche Disharmonien entdecken.“