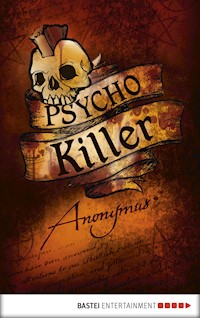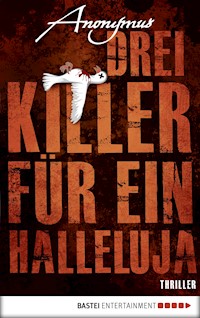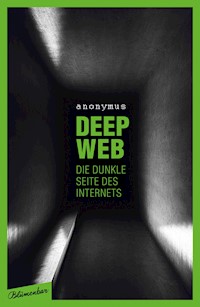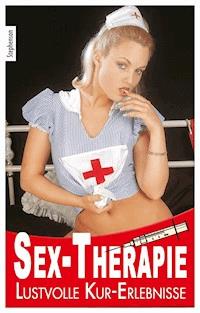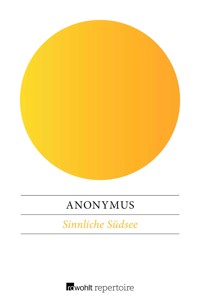
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Rowohlt Repertoire
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Neuseeland im 19. Jahrhundert. Stella, behütete Ehefrau eines englischen Offiziers, viktorianisch erzogen, wird von den Maori verschleppt und erfährt am eigenen Leib sexuelle Praktiken, von deren Existenz sie nichts ahnte. Eine Hölle, so glaubt sie anfangs – die sich aber bald verwandelt in ein Paradies der Lust, ein Paradies ohne Tabus und Prüderie, in dem Stellas verdrängte Sexualität erwacht. Und sie hofft nur eines: aus diesem Paradies nie vertrieben zu werden …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 229
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
rowohlt repertoire macht Bücher wieder zugänglich, die bislang vergriffen waren.
Freuen Sie sich auf besondere Entdeckungen und das Wiedersehen mit Lieblingsbüchern. Rechtschreibung und Redaktionsstand dieses E-Books entsprechen einer früher lieferbaren Ausgabe.
Alle rowohlt repertoire Titel finden Sie auf www.rowohlt.de/repertoire
Anonymus
Sinnliche Südsee
Aus dem Französischen von Sara Pitti
Ihr Verlagsname
Über dieses Buch
Neuseeland im 19. Jahrhundert. Stella, behütete Ehefrau eines englischen Offiziers, viktorianisch erzogen, wird von den Maori verschleppt und erfährt am eigenen Leib sexuelle Praktiken, von deren Existenz sie nichts ahnte. Eine Hölle, so glaubt sie anfangs – die sich aber bald verwandelt in ein Paradies der Lust, ein Paradies ohne Tabus und Prüderie, in dem Stellas verdrängte Sexualität erwacht. Und sie hofft nur eines: aus diesem Paradies nie vertrieben zu werden …
Über Anonymus
Der anonyme Autor dieses Buches ist kein Unbekannter.
Inhaltsübersicht
Die häufigste Form des Glücks besteht darin, nicht zu wissen, daß man unglücklich ist.
Frank und ich traten im Krönungsjahr 1837 vor den Altar. In den darauf folgenden Jahren, die wir in England verbrachten, in London, in Bath oder auf dem kleinen schottischen Besitz der McLeods, Franks Eltern, hatte ich niemals den Eindruck, sehr unglücklich zu sein. Freilich auch nicht sehr glücklich. Aber man meint immer, so gehe es allen, allen Leuten, die man kennt, und mehr noch denen, die man nicht kennt.
Frank mißfiel mir nur ein einziges Mal über alle Maßen. Ich meine selbstverständlich jenen Augenblick, der den Tag beschloß, an dem wir vermählt worden waren. Ich wußte mehr aus Zufall darüber Bescheid, was die Männer mit den Frauen anstellen. Gewisse Freundinnen von mir redeten davon, meist andeutungsweise, manchmal jedoch sehr direkt, als ich im Pensionat war, und meine Mutter hielt es für angebracht, das Thema kurz vor jener verhängnisvollen Nacht anzuschneiden, in der ich plötzlich mit Frank allein war. Das ersparte mir eine allzu große Überraschung. Nichtsdestoweniger mißfiel es mir unsäglich. Wirklich (definitely), so sehr man auch gewarnt worden ist, man macht sich einfach keine Vorstellung von diesen scheußlichen Gesten, dieser Empfindung, dem unvermittelten Grunzen eines Mannes.
Bisher hatte ich Frank immer einigermaßen liebenswert gefunden. Ich mochte seine hohe Gestalt, seine Kavalleristenuniform, den Duft von Leder und Zigarren, den er verströmte. Gern verzieh ich ihm seine kleinen Schwächen, denn sie amüsierten mich. Seit dem Tag unserer Verlobung pflegte er mich auf den Mund zu küssen. Obzwar mich das seltsam beunruhigte, ungefähr so, als sähe mein eigener Vater mich nackt, zog ich es vor, daß er die Lippen dorthin legte, auf meinen Mund. Wenn er mich auf die Wange küßte oder, was er sich gelegentlich herausnahm, auf das kleine Dekolleté, das mein Kleid freiließ, unter dem Hals, benutzte er jedesmal die Gelegenheit, um seine Wange an mir zu reiben. Sein Schnurrbart, seine Koteletten und die Bartstoppeln, die immer wieder nachwuchsen, kitzelten mich und piekten mich, denn meine Haut ist sehr glatt und sehr empfindlich, so daß ich immer meinte, er würde mich wund reiben, Male oder Spuren hinterlassen, und ich verabscheute nichts so sehr wie diesen Kontakt.
Dann ist plötzlich kein Mensch mehr da, ich meine weniger zu meinem Schutz, als um mich von Frank zu trennen, ihn, wenn das deutlicher ist, von mir fernzuhalten. Paradoxerweise ist das Einsamkeit.
Eine große Kammer in einer windumtosten Burg in Schottland. Die fröhlichen Freunde sind gegangen. Franks und meine Eltern haben, als handle es sich um ein Spiel, den Entschluß gefaßt, die Nacht im Landhaus zu verbringen, das eher ein Jagdhaus ist und mehrere Kilometer (miles) von der Burg entfernt liegt. Das Personal schläft ich weiß nicht wo, und ich habe nicht einmal das Recht auf eine Zofe. Ich wasche mich in einem Nebenzimmer und vermeide es wie gewöhnlich, mich dabei zu betrachten, was mir übrigens noch nie Vergnügen bereitet hat. Aber, einem Rat meiner Mutter folgend, so sorgfältig, wie ich kann. Ich verstehe ihren Beweggrund nicht recht, denn ich halte mich immer sehr sauber, was eine Frage der Erziehung ist, doch ich gehorche nichtsdestotrotz. Und jetzt liege ich allein im Bett, ich warte, und da kommt Frank. Ist er es wirklich? Der Kavallerist mit den breiten und kantigen Schultern, den schwarzen, immer gut frisierten Haaren, den großen Zähnen, die nicht die Farbe des Tabaks annehmen, ist er wirklich diese groteske Gestalt in dem Nachthemd, das bis zu den Knien reicht? Ist das Frank? Meine an das Halbdunkel gewöhnten Augen sehen alles. Wo sind die schönen blitzenden Stiefel, die Sporen, wo ist der Degen? Mein Gott, was für ein widerlicher Anblick, die nackten Waden und Füße eines Mannes! Und wo ist es geblieben, jenes Lächeln, das so männlich, offen, einfach und doch geheimnisvoll auf mich wirkt, weil Frank nicht über dieselben Dinge lacht wie ich? Warum grinst er auf einmal?
Er nähert sich dem Bett, stützt ein Knie darauf, wartet genau wie ich. Aber ich kann nichts tun, nichts sagen. Endlich hebt er einen Zipfel der Decke, geht schlafen, als wäre er allein. Das Bett furcht sich unter seiner Last, so daß ich wider Willen zu ihm rutsche, wie zum Ufer eines reißenden Stroms. Ich rühre mich nicht, bin wie versteinert. Wenn er wenigstens reden würde! Aber er sagt nichts. Dann wiederholt er dümmlich meinen Namen: «Stella! Stella! Stella!»
Ich habe den absonderlichen Einfall, er rufe um Hilfe. Mein Gott, wie ich ihn verachte. Ich glaube, die gräßliche und abstoßende Hitze seines Körpers wahrzunehmen, ohne diesen auch nur zu berühren. Frank, der Mann, den ich Frank rief, scheint immer noch zu grinsen. Ich weiß, was er gleich tun wird, und kann es mir doch nicht vorstellen, es ist so, als hätte man mir nie etwas darüber gesagt. Ja, das ist Einsamkeit. Der Mann, Frank, atmet schwer. Aus Furcht und Abscheu, die gleichen Geräusche zu machen wie er, hole ich kaum Luft, so daß ich beinahe ersticke, und die Atemnot und das Fieber summen in meinen Ohren und Schläfen. Doch all diese Angst, alle diese extremen Regungen sind unnütz, denn er, der Mann, weiß, was er will, wohin er geht, träumt nur von seiner kleinen animalischen Zuckung und hat weder die Zeit noch das Einfühlungsvermögen, sich um das Beben eines jungen Mädchens zu kümmern. «Stella! Stella!» Warum wiederholst du diesen Namen, du, der du mich nicht kennst, nicht kennen möchtest? Ebensogut könntest du Mary, Brenda, Grace sagen, ich begreife, daß es dir nicht auf den Namen ankommt. Er ruft mich noch einmal, ohne daß ich ihm antworte. Wie kann ich mich dem anvertrauen, der mich in Besitz nehmen will und mich ängstigt? Da beugt er sich lachend, grinsend über mich, und eine seiner Hände greift wie eine Vogelkralle nach meinem Busen, umklammert brutal meine Brüste. Meine Mutter bemerkte eines Tages mit gespielt gleichgültigem Gesicht (weil es sie verlegen machte), ich hätte sehr niedliche Brüste. Aber habe ich sie, um diese Männerpfote zu erfreuen? Mit der anderen Hand streift Frank mein langes Nachthemd hoch. Ach, wäre ich darunter doch nicht nackt! Ich bin es jedoch, weil ich meinte, kein anderes Kleidungsstück anbehalten zu dürfen. Er streift das Nachthemd über meine Knie, die Schenkel, nun über den Bauch. Wieviel gäbe ich darum, kein Geschlecht zu haben, kein schockierendes Vlies, keine Lippen, keine intime Öffnung, keine Spalte. Ich möchte geschlossen sein und glatt, wie ein Kind. Doch es ist zu spät. Wird Frank mich ausziehen, vollständig entblößen? Nein, er streift das Hemd nur bis zum Nabel hoch, er will nicht mich, nicht einmal meinen Körper, meine schöne und weiche Haut. Er interessiert sich nur für jenes leidige Mißgeschick, an der Stelle, wo die Schenkel sich mit dem Unterleib vereinigen, das aus mir die Sache macht, die ich eigentlich nicht bin, eine Frau wie alle anderen, ein Weibchen. Ich empfinde so viel Scham und Abscheu, daß ich die Beine heftig zusammenpresse, um mich zu verstecken, zu vergessen. Doch eben dort möchte er wühlen, eindringen, mich demaskieren, mich demütigen. Er brummt, macht sich mit der Hand zwischen meinen Schenkeln zu schaffen, bis ich gezwungen bin nachzugeben. Ich bin dort noch verletzlicher als an meinen Brüsten, deren zarte Spitzen sich manchmal so eigenartig verhärten und spannen, als hätten sie Hunger. Aber eben diese Verletzlichkeit erregt den Mann, den ich zu lieben glaubte. Sobald ich wider Willen die Beine ein wenig gespreizt habe, krümmt er die Finger und bohrt sie mir in den Leib, an eben jener Stelle, bricht mich wie eine Blume. Nun hat er den Punkt gefunden, wo ich am wehrlosesten, am schwächsten bin, den Punkt, an dem ich offen bin, und macht sich dort mit einem scheußlichen Eifer zu schaffen. Er weiß nun, daß es unter meinen Kleidern, unter meiner Würde als junges Mädchen und menschliches Wesen, an einer Stelle meines ansonsten untadeligen Körpers einen Punkt gibt, an dem das Fleisch anders, faltig und nachgiebig, empfindlich und vor allem feucht ist. Absichtlich steckt er den Finger ausgerechnet hier hinein, in diese unerträgliche Feuchte, diese unerträgliche Öffnung, bohrt ihn mir in den Leib, als wolle er meine Seele durchbohren, penetriert mich, sondiert mich. Ich versuche mit all meinen Kräften, mich zusammenzuziehen, doch mein Denken und mein Wille sind außerhalb meines Körpers. Der Finger des Mannes stößt auf seinem schändlichen Weg an irgendein Hindernis, irgendeine Schranke, was mir einen solchen Schmerz bereitet, daß ich aufschreien möchte, aber ich wage nicht aufzuschreien, und er, der Mann, grunzt vor Befriedigung, scheint mir, würde am liebsten vor Freude losplatzen. Ich bewege instinktiv eine Hand, um mich zu wehren, um jenes Loch, jene Wunde zu bedecken, zu verteidigen. Der Mann zieht den Finger aus meinem Bauch und packt meine Hand. Sein Finger ist feucht von meinem Unterleib, und ich wäre am liebsten tot. Aber was will er nun? Heftig preßt er meine Hand an seinen Körper, auf sein Hemd, dann auf ein Nest harter Haare und plötzlich auf einen sonderbaren Fortsatz seines Körpers, der nun aufgerichtet und prall ist, heiß, bebend vor Kraft. Jetzt weiß ich, was er, der Mann, unter seiner Kleidung, unter den guten Manieren des feinen Herrn (gentleman) verbirgt. Übelkeit steigt in mir hoch, ich bin entsetzt und erstarre, ich will meine Hand befreien und diesen abstoßenden männlichen Körper nicht länger berühren. Wie häßlich und vulgär all das ist! Aber er lacht nur. Um mich daran zu hindern, die Schenkel wieder zusammenzupressen, fährt er mit einem Knie dazwischen, dann mit dem ganzen Bein. Er legt sich beinahe zur Gänze auf mich, versucht gleichzeitig, sich mit den Unterarmen aufzustützen und wölbt die Lenden, als wolle er mich freigeben. Seine rechte Hand hat sich von meinem Busen gelöst, er verlagert das Gewicht seines Körpers auf den linken Ellbogen, und nun fährt die freie Hand nach unten, scheint dann zu zaudern. Sie begibt sich wie im Fieber zu meinem Bauch, betritt ihn, wie um sich zu vergewissern, daß es mir nicht gelungen ist, mich zu schließen, verläßt ihn, scheint sich nun am Bauch des Mannes zu schaffen zu machen, und plötzlich merke ich, daß selbiger einen anderen Finger zwischen meine Schenkel schiebt, zwischen die Lippen meines Geschlechts, in meinen Bauch, mein Inneres, einen Finger, der angeschwollen, sehr lang, erstickend, riesig ist. Nicht lange bleibt mir verborgen, daß es sich um das Mißgeschick seines eigenen Körpers, um sein eigenes Geschlecht handelt. Niemals wird es ihm gelingen, mich damit zu penetrieren, ich will es nicht, wir beide können es nicht zulassen, ich versuche, ihm den Eintritt zu verwehren, ihn zu vertreiben. Ja, vertreiben, denn es ist schon zu spät, ihm den Eintritt zu verwehren. Der Mann hat es tatsächlich geschafft, die Spitze dieses Fingers in meinen Bauch zu stecken, die Spitze dieses gewaltigen Stabs, der mich erweitert, so daß ich zu bersten meine. Ein Hindernis hält ihn auf, dasselbe, das vorhin seinem Zeigefinger Einhalt gebot. Ich glaube, daß der Mann nachgeben, dieses unsägliche Objekt ebenso aus mir entfernen wird wie den Finger. O Gott, er tut es nicht! Er insistiert, schiebt es im Gegenteil mit aller Kraft, aller Gewalt weiter in mich hinein. Er wird mich zerreißen, ich spüre es, ich bin mir dessen sicher, ich beiße mir heftig in die Lippen, um nicht schreien zu müssen, und da zerreißt er mich tatsächlich brutal, scheint so etwas wie eine innere Explosion auszulösen, die stechend schmerzt und mich im selben Moment zu betäuben scheint. Der Schmerz, den ich empfinde, ist, um die Wahrheit zu sagen, nicht unerträglich, aber so unverdient, so grausam, daß ich vor Abscheu die Zähne zusammenbeiße. Und als hätte er mir nicht im mindesten weh getan, als existierte ich nicht einmal, fährt er, der Mann, das Ungeheuer, fort, sich in mich hineinzubohren, in das Fleisch meines Fleisches, sein Ziel hartnäckig, blindlings weiterzuverfolgen, bis zu meinen Eingeweiden. Er freut sich sicherlich, denn er hat gesiegt, er hat es geschafft, diesen dicken und närrischen Fortsatz seines Männerkörpers ganz in mich, in meinen Leib, mein Innerstes hineinzutreiben. Es verbrennt mich und erstickt mich, es sprengt mich, dieses sonderbare Objekt, es hat mich in zwei Teile zerrissen, die nie wieder zusammenwachsen werden, und er, der Mann, er scheint erleichtert und glücklich zu sein, er spielt. Er tut so, als gäbe er mich frei, aber nur, um erneut in mich hineinzutauchen, gibt dann vor, eine Pause einlegen zu wollen, ereifert sich, wie um die Verzögerung wettzumachen, gibt mich erneut zum Schein frei, penetriert mich abermals, und so geht es weiter, immer schneller, bis er endlich bis zur Wurzel eintaucht, anschwillt, in meinen Eingeweiden zuckt und ebenfalls explodiert, doch mit einer unerklärlichen Inbrunst, einem Röcheln, einem Beben. Er überschwemmt mich innerlich mit ich weiß nicht welchem Blut, welchen Tränen. Mit meinem Blut, meinen Tränen. Der Mann grunzt tierisch. Der Gipfel des Lächerlichen ist, daß er den Anschein erweckt, man hätte seine Seele aus ihm gerissen. Er ist es, der verwundet wird, er ist es, der weint und lacht. «Ach, wäre die Rose – doch noch am Rosenstock – und würde der Rosenstock – ins Meer geworfen.» (Kanadisches Lied, im Manuskript in der französischen Originalfassung zitiert.) Ich bin nur noch ein Fetzen Fleisch, ein Fetzen Seele, der lebende und leidende Rest eines menschlichen Wesens. Währenddessen lastet der entspannte, ruhende Körper des Mannes schwer auf dem meinen. Ich gäbe alles darum, ihn von mir zu wälzen, mich von ihm zu befreien und zur Waschschüssel zu laufen, mich mit Lappen aus Roßhaar und Bürsten aus Eisen zu reinigen. Aber nicht einmal das kann ich. Das Gewicht des Mannes erdrückt mich. Ich glaube, er ist nun, nach vollbrachter Tat, nachdem er abgeschüttelt hat, was ihn belastete, eingeschlafen.
Am nächsten Morgen war Frank wieder bekleidet und ähnelte wieder einem zivilisierten Wesen, dem Mann, den ich vor jenem gräßlichen Augenblick gekannt hatte und den ich zu lieben geglaubt hatte. Er war immerhin vernünftig genug, nicht von der vergangenen Nacht zu sprechen. Zweifellos wußte er, daß sein Benehmen mir mißfallen hatte und daß ich es nicht vergessen würde. Also tat er so, als erinnere er sich nicht mehr daran. Das war, nehme ich an, eine Voraussetzung für unser weiteres Zusammenleben.
In den nächsten Jahren waren wir, wie ich bereits gesagt habe, glücklich, das heißt, es kam mir niemals in den Sinn, daß wir es nicht seien. Ich hatte das Glück, nie ein Kind von Frank zu empfangen. Es hätte mir nicht gefallen, vielleicht hätte ich es nicht ertragen können. Noch mehr von Frank in mir – nein! Sein lächerliches Werkzeug war genug. Frank bestand nämlich in regelmäßigen Abständen darauf, mich aufzusuchen, wenn ich schlafen gegangen war, und es mir zwischen die Schenkel zu stecken. Es bereitete mir wenigstens keinen körperlichen Schmerz mehr, und es störte mich kaum noch. Ich wußte ja sehr gut, daß die meisten verheirateten Leute so verfahren. Außerdem brauchte Frank nie sehr lange. Vielleicht fand er es nicht mehr sehr interessant oder wichtig und tat es nur noch gewohnheitsmäßig. Sobald er mein Schlafzimmer betrat, legte ich mich auf den Rücken. Ich ging nun, vielleicht aus Mitleid mit Frank, so weit, mein langes Nachthemd selbst hochzuziehen und die Beine aus eigenem Antrieb ein wenig zu spreizen. Zuerst tätschelte oder streichelte er mich jedesmal an bestimmten Stellen, mit der linken Hand an meiner linken Brust, mit der rechten zwischen den Schenkeln. Er penetrierte mich mit einem Finger, offenbar immer mit demselben, wie um das Terrain zu erkunden, sich zu vergewissern, daß mein Geschlecht sich nicht auf den Rücken oder hinter ein Ohr verlagert hatte. Dieses Tätscheln, dieses systematische Erkunden erfüllte mich mit einem Grausen. Aber es dauerte nicht zu lange, wirklich nicht. Dem Finger folgte dann der große und brutale Fortsatz. Ich hatte es eines Nachts gesehen, dieses Ding, als es im Zimmer heller war als sonst und Frank sich mir halbnackt wie ein Straßenjunge näherte, im Zwielicht, und es hatte mich an einen Truthahn erinnert, dem in dümmlichem Stolz der rote Kamm schwillt. Frank führte es in mich ein und arbeitete dann mit befremdender Hast, stieß wie besessen, benahm sich wie von Sinnen, keuchte, gab die üblichen stöhnenden Laute von sich und löste sich nach kurzer Zeit erschöpft aus meinem Leib. Ehe er das Zimmer oder auch nur mein Bett verlassen hatte, eilte ich schon in das Badezimmer und wusch alles Unreine von mir. Ich träumte von einer Welt, in der die Männer, die Leute, immer angekleidet waren und sich immer manierlich und zuvorkommend benahmen. Wenn ich wieder zu Bett ging, war Frank bereits in sein Schlafzimmer gegangen. Am nächsten Morgen redeten wir nicht darüber. Wir konnten wieder anfangen, wie normale Menschen zu leben.
Ich habe nie genau erfahren, was dazu führte, daß Frank bei seinem Regiment in Ungnade fiel und warum er auf die fernen Inseln verbannt wurde. Zugegeben, er trank, aber kaum mehr als die anderen Offiziere. Vielleicht hing es mit den Karten zusammen. Er hatte zuviel Geld verloren, oder er hatte ein bißchen zuviel gewonnen! Es war mir von dem Augenblick an gleichgültig, in dem man ihn nicht degradierte. Seine Vorgesetzten behaupteten, sie hätten seine Versetzung beschlossen, weil sich die Eingeborenen (natives) dort unten in Ozeanien aufrührerisch zeigten und ein für allemal zur Ordnung gerufen werden müßten. Außerdem gab man vor, die Franzosen hätten ein Auge auf die neuen Territorien geworfen, und man müsse ihnen zuvorkommen. Gewisse Pflanzer, die sich in einer Liga zusammengetan hatten, welche Neuseeländische Vereinigung (New Zealand Association) hieß, übten in diesem Sinn Druck auf die Regierung aus, und diese wiederum wandte sich an die Armee. Es ist ja bekannt, daß unsere Welt von Krämern gelenkt wird. Was mich betrifft, so gestehe ich, daß ich eine böse Vorahnung hatte, als Frank zum erstenmal in meiner Gegenwart von jenen entlegenen Winkeln des Empire, insbesondere von Australien, sprach. Für mich war es ein Land von Sträflingen (convicts), mehr nicht. Dort unten konnte es einfach keine ehrbare Gesellschaft geben, keine Frau, die eine gute Erziehung genossen hatte, nicht einmal ein Mann aus unseren Kreisen konnte dort leben. Frank erklärte mir, wir würden genaugenommen nicht nach Australien gehen, das übrigens keine Insel, sondern ein Kontinent ist. Unser Ziel seien noch entlegenere, noch verlassenere Gefilde: Neuseeland. Warum auch nicht, wo mein Leben, ja, unser Leben in gewissem Sinne vorbei war? Dort unten, so fern von London, so fern von allem, was menschlich ist, würden wir wenigstens ein Symbol des Fortschritts sein statt eine seiner Schlacken.
Es gibt dort unten keine Städte, nur Niederlassungen, die sich den Anschein von Häfen, Faktoreien, Siedlungen geben. Nach einer strapaziösen und endlosen Reise erreichten wir Australien und einen jener Orte. Die wenigen Weißen, die dort vegetieren, nennen es Sydney. Dann, nach einer zweiten, viel kürzeren Überfahrt, Neuseeland, Wellington. Erheiternd ist, daß der wahre Grund für Franks Versetzung sich bis hierher herumgesprochen hat, was wir fraglos jemandem verdankte, der mit uns reiste, und daß uns die wenigen echten Engländer, die es in diese als Städte bezeichneten Einöden verschlagen hat, recht kühl empfingen. Deshalb brachen wir sehr schnell wieder auf, Frank, ich und eine kleine Eskorte von Kavalleristen, um uns in den Norden der Insel zu begeben. Wellington befindet sich ebenfalls auf der nördlichen Insel, aber wir wollten noch weiter in den Norden, jenseits von Napier, in eine Gegend zwischen dem sogenannten Ostkap und den Niederlassungen Hamilton und Auckland, in einen Landstrich namens Rotorua. Wie man wußte, waren die dortigen Siedler ernstlich mit den Eingeborenen aneinandergeraten. Das genaue Ziel Franks und der Handvoll Soldaten, die er befehligte, habe ich freilich nie erfahren. In den Bergen, mitten in dem dichten Unterholz (brushwood), das sich vom Waikato-Fluß bis zum Rotorua-See erstreckt, kletterte ein Schwarm Maori, die in der Sonne vor Feuchtigkeit glänzten, denn in jenen Gefilden fällt immerzu ein feiner Regen, wie auf den Wink einer unsichtbaren Hand, von den Bäumen und griff unsere kleine Gruppe ungestüm an. Ich kann mich nicht mehr genau an den Kampf erinnern. Halbnackte Männer, Farbige (coloureds), die zuerst einen wilden Wut- oder Trotzschrei ausgestoßen hatten, schwangen stumm, in der grellen Sonne und im Sprühregen, große Keulen und Speere. Der purpurrote Fleck einer Wunde auf dem hellen Rock eines Soldaten. Außerdem sah ich, wie Frank vom Pferd fiel. Einer seiner Stiefelabsätze verfing sich im Steigbügel, und sein Reittier schleifte ihn ein Stück weiter. Dann traf mich selbst ein Schlag, etwas über dem Nacken. Ich verlor das Bewußtsein.
Das goldene Licht Ozeaniens, das vom Dauerregen gebrochen wird und vom üppigen Blattwerk einen grünlichen Schimmer erhält, fand einen Weg durch die Wände der Hütte (whare – neuseeländisches Wort) und fiel auf mich. Das Innere der Behausung teilte sich in Schichten aus Dunkel und der greifbaren Helle der Sonnenstrahlen. Mir war sehr warm, ich kam mir naß und furchtbar schmutzig vor, und in meinem Kopf hallte ein dumpfer, ferner, pochender Schmerz, wie ein Gong. Ich wagte nicht, mich zu bewegen, ohne recht zu wissen warum. Ich lag auf einem Bett oder vielmehr auf einer sehr niedrigen Lagerstatt, die, wie ich mich tastend vergewisserte, auf vier kurzen Pflöcken stand, einen Rahmen aus geraden Ästen oder Stangen und eine Unterlage aus geflochtenen Lianen hatte, auf der eine Matratze aus Blättern ruhte. Ich hätte am liebsten gerufen, irgend etwas geschrien, tat es aber nicht. Gleichzeitig dachte ich daran, daß Frank und die Soldaten entweder ebenfalls gefangen oder aber gefallen seien. Sonst hätte ich ihre Stimmen, die Schüsse, irgendeinen Lärm vernommen. Es schien mir irgendwie unziemlich (improper) zu gestehen, daß ich von einem dringenden Bedürfnis geplagt wurde. Doch ich wagte ebensowenig aufzustehen und ihm Genüge zu tun, wie ich gewagt hatte, die Stimme zu erheben. Überdies hätte ich nicht gewußt, wohin ich gehen sollte.
Andererseits hatte ich großen Durst, und der Schlag oder die Quetschung über meinem Nacken machte sich mit einem brennenden Fieber bemerkbar. Mein Zeitsinn ließ mich im Stich, wie immer, wenn ich in einem solchen Zustand bin. In manchen Augenblicken schienen Stunden in einem schwindelerregenden Punkt zu verschmelzen und von mir kaum wahrgenommen zu werden, und dann wieder zog sich eine einzige Sekunde endlos lange hin, dehnte sich unbarmherzig wie das Fieber oder ein Alptraum. Das kleine, natürliche Bedürfnis, wie meine Nurse gesagt hatte, als ich ein Kind gewesen war, riß mich immer wieder aus jenem Strudel und hielt mich in Atem. Ich bezwang es, unterdrückte es so verzweifelt, daß ich dann und wann ein Brennen im Unterbauch spürte, an eben der Stelle, wo Frank immer mit dem Zeigefinger sondiert hatte. Als ich nicht mehr konnte und wohl oder übel einen Entschluß fassen mußte, verkrampfte sich mein ganzer Körper, und ich vergaß das peinigende Bedürfnis. Ich hatte ein neues Geräusch, ein Schwatzen, Schritte ausgemacht.
«Frank?» sagte ich fragend.
Das Gebilde, das die Öffnung bedeckte, die bei uns in England von einer Tür ausgefüllt worden wäre, eine breite Füllung aus Blattwerk, wurde zur Seite geschoben. Ein großer Lichtbalken stach in die Hütte. In diesem Licht gestikulierten mehrere Geschöpfe, sicher Frauen, denn sie wiesen Brüste auf. Es mochten fünf oder sechs sein, und sie traten alle ohne Zögern oder Scheu in die Hütte. Das Licht, das mich zunächst geblendet hatte, schien mir jetzt gedämpfter, vielleicht weil meine vom Fieber ermüdeten Augen sich daran gewöhnten oder weil der Tag fortschritt, bereits zur Neige ging. Ich erblickte das aschfahle Blau des Himmels und das saftige Grün der Palmen und die üppige Vegetation auf den Hügeln hinter den Frauen. Diese waren, wie die Männer, die uns überfallen hatten, fast nackt. Ein sehr kurzer Schurz, eher ein Streifen aus weißem oder bunt gemustertem Tuch, gürtete ihre Lenden. Alles andere, Oberkörper, Arme, Schenkel, Beine, war nackt. Sie hatten lange schwarze Haare, die sauber wirkten und sehr schön glänzten, sofern man bei einem Eingeborenen irgend etwas als schön bezeichnen kann, und eine bemerkenswert glatte Haut, fraglos dank ihrer Gewohnheit, nackt umherzugehen. Nur ihre Beine waren bis zu den Schenkeln vom Unterholz zerkratzt. Der sehr schmale Lendenschurz, der knapp unter dem Nabel begann, bedeckte kaum ihre Scham. Ich weiß nicht, ob man die Töne, die aus ihren Mündern drangen, als Sprache bezeichnen kann, obgleich es sich, um die Wahrheit zu sagen, um recht angenehme Klänge handelte. Viele Vokale und wenig Konsonanten, wie bei lallenden Babies.
Die Frauen umringten mich plappernd und schwatzend, einige nahmen ohne weiteres auf dem Gestell Platz, das mir als Bett diente, und alle musterten mich, betrachteten mich mit ihren großen schwarzen Augen, die wie Oliven schimmerten. Ich wußte natürlich, daß man solchen Geschöpfen niemals seine Furcht zeigen darf. Die bizarren Wesen schienen Fragen in ihrem Kauderwelsch an mich zu richten. Ich verstand sie nicht und gab mir auch keine diesbezügliche Mühe. Das Lächeln einiger ließ mich ebenso kalt wie die abweisende, strenge und forschende Miene der anderen. Das heißt, ich widerstand beidem.
«Wo ist Frank? Wo ist Hauptmann McLeod?» sagte ich zu ihnen. «Sie würden mir einen Gefallen tun, wenn Sie mir möglichst schnell etwas zu trinken brächten!»
Sie begannen wieder zu plappern, doch jetzt, schien es mir, wandten sie sich nicht mehr an mich, sondern redeten miteinander. In dem Augenblick, in dem ich glaubte, sie beschlössen endlich, mir zu gehorchen, packte mich diejenige, die mir am nächsten saß, an den Schultern, eine andere, die am unteren Ende des primitiven Lagers hockte, an den Füßen, und beide drehten mich auf den Bauch, als wäre ich ein Pfannkuchen (pancake). Ich sagte mir selbstverständlich, daß ich mich eigentlich wehren, kämpfen, mich vielleicht sogar aufrichten und auf sie werfen müßte, um sie zu vertreiben. Aber das Fieber beraubte mich eines Teils meiner Kräfte, und außerdem fürchtete ich, in der Stellung, in die sie mich gebracht hatten, an Würde einzubüßen. Außerdem hatte ich meinen Reithut verloren, und meine zu Zöpfen geflochtenen Haare hatten sich sicher aufgelöst. Hände, kleine Affenpfoten, zupften sie auseinander, ohne Gewalt, aber entschlossen wie eben, als sie mich auf den Bauch gedreht hatten. Ich begriff, daß die Frauen meine Wunde betrachteten. Sie schnatterten, und das Lager schwankte, weil eine von ihnen sich davon erhob. Sie warf einen langen Schatten, während sie die Hütte verließ, und einen Augenblick später, als sie zurückkehrte, abermals. Man legte mir einen Umschlag auf den Nacken, die Quetschung, der mit einer Flüssigkeit getränkt war und zunächst einen brennenden Schmerz hervorrief – wie ein glühendes Eisen, dann jedoch eine köstliche Empfindung der Frische. Eine der Frauen brach in das perlende Lachen eines kleinen Kindes oder eines Vogels aus. Ich hatte nicht einmal mehr das Verlangen, mich umzudrehen, so entspannt und wohl fühlte ich mich. Ich fragte mich sogar, ob ich diesen Wilden nicht danken sollte.