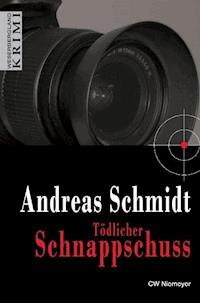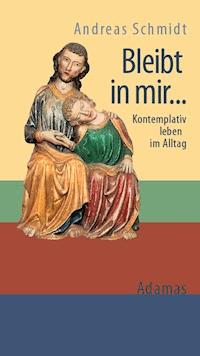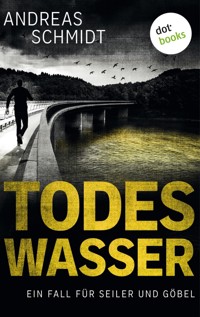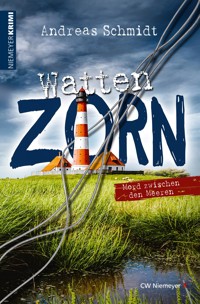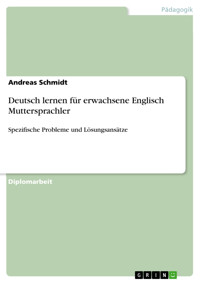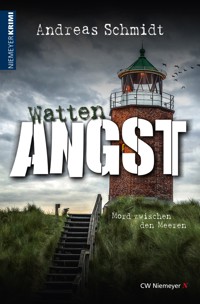Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Das sind Begebenheiten aus meiner Kindheit und Jugend in der DDR. Hier wird die DDR nicht verklärt, aber auch nicht verteufelt. Es soll unseren Landsleuten in Süd, West und Norddeutschland zeigen, dass einiges doch nicht so verschieden war. Und für die Landsleute im Osten soll es zur Erinnerung sein. Es gibt viel zu lachen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 1052
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Jeder hat an seine Kindheit und Jugend schöne Erinnerungen. Egal ob in Ost oder West. In vielem ähnlich und doch verschieden. Alles aus der Sicht der Zeit im Osten betrachtet und erzählt.
Ich verkläre die DDR nicht. Es sind Ereignisse aus den ersten 25 Jahren meines Lebens. Eine Zeit, die mich stark geprägt hat.
Alle die im Buch erzählten Begebenheiten sind so oder so ähnlich passiert, nicht immer mit den angegebenen Personen. Manches ist erfunden, hätte aber genau so passieren können.
Die Namen sind frei erfunden. Sollte eine Namensgleichheit bestehen, ist dies nicht beabsichtigt und ich bitte dies zu entschuldigen.
Für Hasi
die mich zu diesem Buch angestiftet hat.
Inhaltsverzeichnis
Kindheit
Jugend
Erwachsen werden
Epilog
Kindheit
Ich wurde 1964 hinter der Mauer geboren. Auf der roten Seite Deutschlands.
An einem Sonnabend, pünktlich zum Mittagessen. Nach zwei Jungs, sollte ich eigentlich ein Mädchen werden. Der Name, Andrea, stand auch schon fest. Da ich aber nun offensichtlich kein Mädchen war, sagte meine Mutti zur Hebamme: „Streichense hinten ma das A un machense einen Strich über dem E! Den Namen hat auch nicht jeder. Und so wurde ich zu Andrè.
Ich wohnte in einem kleinen Dorf, welches Reußen hieß. Früher gehörte das zur Provinz Sachsen und nun zum Bezirk Halle. Ein Dorf mit etwas mehr als 300 Einwohnern, in dem es fast so viele Kühe wie Menschen gab.
In meinem Dorf gab es nur eine Kopfsteinpflasterstrasse. Alle anderen Strassen waren nur befestigt und stammten noch, wie die Kopfsteinpflasterstrasse, aus der Zeit, wo uns noch ein Kaiser regiert hatte.
Ebenso wie die Kanalisation für Regenwasser. Eine andere Kanalisation gab es nicht. Jedes Haus hatte einen eigenen Brunnen und ein Plumsklo, auch Donnerbalken genannt, oder eine Sicker- oder Klärgrube. Unseren Müll mussten wir selber in eine Müllgrube, außerhalb vom Ort, schaffen. Aber Strom hatten wir schon. Der ging auch manchmal weg. Deshalb hatten wir immer Kerzen und Taschenlampen im Haus.
Jede Familie hatte einen Garten, den sie bewirtschafteten, um Kartoffeln und Gemüse zu haben. Die meisten hatten auch Tiere im Stall. So wie wir. Im Dorf gab es auch eine Kneipe und einen Konsum. Einen Kindergarten und sogar eine Kindergrippe. Einen Bäcker hatten wir auch mal. Aber der war jetzt zu. Ebenso wie die Schule. Dafür hatten wir jetzt einen Jugendclub und ein Gemeindebüro. Da arbeitete unser Bürgermeister. Einen ABV hatten wir auch. Auch einen Fußballverein, der in der 2. Kreisklasse spielte und eine freiwillige Feuerwehr.
Alle zwei Wochen kam ein Fischauto, welches vor dem Konsum hielt. Dort konnte Mutti dann Fisch kaufen.
Ein lustiges Männchen regierte die DDR zu dieser Zeit. Mit einer Zipfelmütze auf dem Kopf, hätte er ausgesehen, wie mein geliebtes Sandmännchen. Sein Bild hing überall und er schaute gütig auf uns herab.
* * *
Ich, der jüngste von drei Brüdern, hatte eine behütete Kindheit. Meine Brüder, damals schon im Jugendalter, mussten sich mit mir abplagen, wenn Vati und Mutti nicht da waren oder einfach mal ihre Ruhe haben wollten.
Das lösten sie auf eine, für sie, elegante Art und Weise. Der kleine Nerventod – ich - wurde irgendwie beschäftigt. Mussten sie mich, zum Beispiel, zum baden mitnehmen, wurde ich in einen Schwimmring gestopft und auf dem Wasser treiben lassen. So hatten sie mich zwar im Auge – wenn sie nicht gerade nach Mädchen guckten - aber dennoch ihre Ruhe vor mir.
Da entdeckte ich meine Liebe zum Wasser. Dort konnte ich in die Hose pullern, ohne dass einer was merkte und schimpfte. Vergessen haben meine Brüder mich nie. Ich wurde immer wieder mit nach Hause genommen.
Meine Brüder und ihre Freunde machten Musik in ihrem Beatschuppen. Da war ich willkommen. Ich hörte immer begeistert zu. Als Fan war ich hoch angesehen. Ich wurde sogar ans Schlagzeug gesetzt, wenn die heimlich eine rauchen gingen. Trommeln war toll. Und so entdeckte ich meine Liebe zum Heavy Metal. Damals noch “Hard Rock“ genannt. Und ich war einer der Protagonisten. Deshalb bekam ich zu Weihnachten von meinem Patenonkel eine Blechtrommel geschenkt. Was hatten meine Eltern ihm getan? Hatte er beim Schlachten eine Wurst zu wenig bekommen oder war es nicht genug Wurstsuppe? Nur ich war begeistert. Nun konnte ich zeigen, was ich konnte.
Mit einem kleinen bisschen Fantasie war ganz deutlich „Born to be wild“ zu hören. Und ich war erst vier Jahre alt.
Ich wäre ganz bestimmt ein ganz großer Trommler geworden, wenn nicht dieser tragische Tag gekommen wäre. Meine Trommel hatte sich wieder mal vor mir versteckt. Diesmal nicht im Kleiderschrank oder im Kohlenkeller, wo sie sich vorher schon mal versteckte und ich sie wieder gefunden hatte.
Diesmal hatte sie sich im Hof hinter der Hausecke versteckt. Als mein Vater von der Arbeit kam, konnte er nicht mehr bremsen und überfuhr mit seiner “Schwalbe“ meine geliebte Trommel. Selbst Wiederbelebungsversuche mit dem großen Hammer konnten nicht mehr helfen. Meine Trommel hatte ihren letzten Ton von sich gegeben.
* * *
Natürlich gehörte zu unserem Haus auch ein großer Garten und Tiere. Ein sehr interessanter Spielplatz. Nur seltsamer Weise verschwanden immer wieder Tiere. Ob die sich versteckt hatten? Ich glaube meine Eltern haben nicht genug gesucht. Andererseits, immer wenn ein Tier verschwand, gab es Sonntags was feines zu essen. Am schönsten war es, wenn das Schwein ausgerissen war. Wenn ich dann aus dem Kindergarten kam, war ein fremder Onkel da. Und der hatte zum Trost den ganzen Vorbau, das Waschhaus und mein Zimmer voll mit Wurst und Fleisch gestellt. Meine Augen leuchteten.
Es war schöner als Weihnachten. Weihnachten? Da wusste ich schon sehr früh Bescheid. Der Weihnachtsmann hat überhaupt keine Geschenke gebracht. Nein – der hat immer die genommen, die meine Eltern im Kleiderschrank versteckt hatten. Und die hat er mir dann geschenkt. Zur Strafe habe ich ihm kein Gedicht aufgesagt oder ein Lied gesungen. Der Osterhase hat es auch genau so gemacht. Und beide kamen immer genau dann, wenn mein Vati gerade im Hof auf dem Donnerbalken saß.
Im Sommer heiratete der Nachbar schräg gegenüber. Da konnte zum Polterabend jeder hingehen der wollte. Auch wir Kinder. Im Hof standen viele Tische. Darauf waren riesige Bleche mit Kuchen und Schüsseln mit Brot und Brötchen. Kein Wunder, der Vater war Bäcker und der Sohn, der heiratete, Konditor. Auf einem anderen Tisch war ein Berg Gehacktes und Würste. Im Waschhaus standen die Getränke. Musik kam vom Tonband.
Fast alle aus dem Dorf kamen um zu poltern und um Glück zu wünschen.
Die meisten Frauen aßen nur Kuchen und tranken Kaffee oder Wein. Die Männer aßen auch Kuchen, aber auch viel Gehacktes und Wurst. Nachdem ich eine alte Schüssel an die Wand geworfen hatte, bekam ich ein großes Stück Pflaumenkuchen und dann noch ein Stück Streuselkuchen und ein Glas Brause. Eigentlich wollte ich viel lieber ein Stück Wurst. Aber der Kuchen schmeckte auch ganz prima. Plötzlich stieß Worsti mich an und nickte mit dem Kopf, dass ich mitkommen sollte. Wir flitzen zum Sportplatz und versteckten uns hinter einer großen Pappel. Dort zog Worsti eine ganze Bratwurst unter seinem Hemd vor. Wir teilten uns die Wurst. Mit den Zähnen zogen wir den Darm ab und ließen sie uns schmecken.
Je später der Abend, umso voller wurde der Hof und lauter die Feier. Da wurden wir Kinder nach Hause geschickt. Jeder bekam zum Dank, dass er da war, ein großes Kuchenpaket mit. In meinem Kuchenpaket war auch noch eine Leberwurst. Da habe ich mich gefreut.
* * *
Wie fast jedes andere Kind auch, ging ich in die Kinderkrippe und danach in den Kindergarten. Da hat mich Oma immer hingebracht, weil Mutti und Vati immer schon morgens sehr früh auf Arbeit mussten. Ich glaube, Oma hat sich immer gefreut, wenn sie mich endlich los war. Kindergarten war toll.
Den ganzen Tag mit meinen Freunden spielen, essen und schlafen.
Kinderherz was willst du mehr.
Schneller als gedacht, begann für uns der Ernst des Lebens - die Schule. Dort sollte aus uns Rabauken ordentliche sozialistische Staatsbürger gemacht werden. Das klappte nicht bei jedem, wie sich später zeigte.
Die letzten Wochen vor der Schule waren spannend. Wir waren die Großen im Kindergarten und durften: „Bald bin ich ein Schulkind und nicht mehr klein“ singen. Dann mussten wir schon mal einen Tag in die Schule. Dorthin fuhren wir mit dem Traktor. Der hatte einen Anhänger mit Dach und Bänken. Damit fuhr auch Mutti früh zur Arbeit.
Der erste Eindruck von der Schule? Da will ich nicht hin. Ich bleibe im Kindergarten. Doch wir wurden mit kleinen Zuckertüten überredet. Den Schulranzen durften wir uns auch noch aussuchen. Wir hatten die Wahl, ein Modell in hell- oder dunkelbraun. Ist in Ordnung, dachte ich mir, da geht viel Spielzeug rein.
Am darauf folgenden Sonntag bekamen wir die großen Zuckertüten. Meine war größer als ich. Aber ich war ja eh der Kleinste und Schmächtigste von allen. Den Schulranzen bekamen wir von unserer Lehrerin überreicht.
Dummerweise war das eine Cousine von meiner Mutti. Die ganze Tragweite meiner verwandtschaftlichen Verhältnisse an der Schule sollte ich später immer mal wieder zu spüren bekommen. Eine andere Cousine war die strengste Lehrerin an der Schule. Und Onkel Kurt war stellvertretender Direktor. Aber den mochten alle. Nun wurden viele schöne Fotos gemacht.
Ich in meinem ersten Anzug und mit ganz kurzen Haaren. Ordentlich gekämmt, mit viel Pomade drin. Danach konnte ich endlich den Inhalt meiner Zuckertüte und des Ranzens prüfen.
Die Zuckertüte machte ihrem Namen alle Ehre. Die Süßigkeiten reichten bestimmt einen Monat. Aber scheinbar hatte das Geld nicht mehr für den Inhalt vom Ranzen gereicht. Den haben sie einfach mit Büchern und Heften voll gemacht. So ein Mist. Hätten sie ein paar Würste reingepackt, hätte ich mich auch gefreut.
In einem unbeobachteten Augenblick, wollte ich heimlich den Inhalt vom Ranzen in einer stillen Ecke im Hof verstecken. Was sollte ich mit dem Zeug? Aber ein kleiner Klaps auf meinen Popo lies mich zu der Überzeug kommen, etwas falsch gemacht zu haben. Also wieder rein mit dem Zeug.
Irgendwie würde ich das schon los werden. Trotzdem war es ein schöner Tag. Es gab Torte zum Kaffee und dann ganz feinen Aufschnitt zum Abendbrot. Jetzt war ich ein Schulkind. Dass die Sache einen ganz gewaltigen Haken hatte, bekamen wir schon zwei Tage später zu spüren.
* * *
Schon frühmorgens wurde ich von Mutti zum Bahnhof gebracht. Da ich in einem Dorf wohnte, wo keine Schule mehr war, musste ich in dem Nachbarort Lohnsdorf zur Schule gehen. Am Bahnhof erwartete uns eine dickbusige Matrone. Sie zog gerade einem von den größeren die Ohren lang.
So was hatte meine Kindergartentante nie mit uns gemacht. Nun bekamen wir unsere Fahrkarten, die wir brav in unsere Jackentaschen steckten. Und dann kam endlich der Zug. Eine gewaltige, schwarze Dampflok schnaufte in den Bahnhof. Nun mussten wir antreten. In Zweier-reihen. Die Kleinen vorne, die Großen hinten und dann langsam auf den Bahnsteig gehen. Immer bewacht von der furchteinflößenden Hortnerin. Wir nahmen uns an den Händen und stiegen ein. Mutti winkte noch mal und los ging es. Kaum hatten wir einen Sitzplatz gefunden, mussten wir auch schon wieder aussteigen.
Den Ranzen aufgesetzt und dann begann der Fußweg zur Schule. Gut einen Kilometer übers freie Land. Bei Wind und Wetter. Dabei hatte ich es noch gut. Andere Kinder mussten zwei bis drei Kilometer mit dem Fahrrad zur Schule fahren. Kein Kind wurde von Mutti oder Vati in die Schule gebracht.
Das hätte für viel Gelächter gesorgt. Keiner wollte, dass über ihn gelacht oder mit dem Finger auf ihn gezeigt wurde. Oder noch schlimmer, dass er als Memme bezeichnet wurde. Eine Memme wollte keiner sein. Härte war angesagt. Der Ranzen war schwer und von dem langen Weg taten bald Rücken und Füße weh. Unsere Lehrerin erwartete uns schon. Sie nahm mich beiseite und erklärte mir, dass sie jetzt nicht mehr Tante Erika, sondern Frau Müller ist. Seltsam. Nun führte man uns in unseren Klassenraum und dann auf unsere Plätze. Sie setzen mich neben ein Mädchen, welches nicht schön roch. Schon nach dem ersten Tag stand für mich fest, hier will ich nicht wieder hin. Das sollte die nächsten 10 Jahre so gehen? Und das 6 Tage in der Woche? Nicht mit mir. Dies teilte ich meinen Eltern mit. Doch die waren anderer Meinung. Und nach Androhung erzieherischer Maßnahmen, auch körperlicher, fügte ich mich in mein Schicksal. Aber Spaß hat mir das nicht gemacht. Der Mensch gewöhnt sich ja an alles. So ging mir das mit der Schule.
Bis auf ein paar Kleinigkeiten.
* * *
Ein altes Sprichwort sagt: „Die Schule prägt einen fürs Leben.“ Das stimmt – aber anders als es gemeint ist. Hast du Wissen, glaubst du nicht daran. Du kommst dir dumm vor und willst mehr wissen. Deshalb lernst du. Hast du kein Wissen, ist es dir scheißegal. Ein Problem weniger, was dir den Tag vermiest. Dies kriegst du schon in der Schule mit. Schule war für mich ein Grauen. Still sitzen, Fahnenappelle und doofe Lieder singen. Richtig hart musste man sein, wenn man mal musste. Da gab es nur das Plumpsklo auf dem Schulhof. Eine ungeheizte Bretterbude mit Türen zum Hof für Jungs und die Türen zum Bach für Mädchen. Die Schüler sagten dazu: “Legebatterie“. Warum? Wir saßen da zu fünft in einer Reihe, ohne Trennwand, auf dem Donnerbalken, wie die Hühner auf der Stange in einer Legebatterie, und legten unser Ei bzw. verrichteten unser Geschäft direkt in eine Grube unter uns. Von der ging ein Überlauf direkt in den Bach. Da mussten schon sehr strenge Winter kommen, damit der Bach auch an dieser Stelle zufror.
Noch bemerkenswerter war die Pinkelbude für die Jungs. Die Wände waren rundherum bis auf halbe Höhe geteert. An den Wänden ging eine Rinne im Fußboden um den Raum herum bis zu einem Loch, welches in die Grube unter dem Donnerbalken mündete. In der Pinkelbude musste man gegen die Wand pinkeln. Und dort lernte ich als Schulanfänger das Wichtigste in den ersten Tagen – die Stärke des Pinkelstrahls musste ein bestimmtes Verhältnis zum Abstand des Pinkelnden zur Wand haben. Sonst waren nicht nur die Schuhspitzen feucht. Einmal im Jahr wurde die Grube geleert und deren Inhalt auf das nächste Feld gefahren. Von da an hatte ich ein sehr gespaltenes Verhältnis zum Gemüse. In meiner kindlichen Fantasie stellte ich mir vor, warum in unseren Breiten der Grünkohl auch Braunkohl hieß.
Ein paar Jahre später bekamen wir ein Innen – WC. Aber auch der Donnerbalken blieb in Betrieb. Den Geruch habe ich heute noch in der Nase. Die Frühstücks- und die Mittagspause waren Hofpausen. Außer bei schlechten Wetter. Sonst musste jeder raus auf den Schulhof. In der Frühstückspause gab es einen viertel Liter Milch. Mal pur oder mit Himbeer- , Vanille- oder Bananengeschmack. Ganz selten gab es mal Kakao. Hin und wieder gab es auch mal Trinkjoghurt. Die Milch kostete 20 Pfennig und das Mittagessen kostete 55 Pfennig. Das Geld dafür wurde in der Woche vorher von der Klassenlehrerin kassiert. Außer der Milch gab es nichts zu trinken. Bei großem Durst, gab es den Wasserhahn im Waschraum.
In unserer Schule gab es auch eine Schulküche. Dort wurde jeden Tag für uns frisch gekocht. Außer Sonnabends. Mir hat das Essen fast immer geschmeckt. Meine Lieblingsessen waren dort: Nudeln mit Tomatensoße, Nudeln mit Gulasch, Spinat mit Ei, Hefeklöße mit Obst oder Mostrichsoße mit Fischstäbchen. Nur die Rohkost mochte ich nicht. Weil ich so klein und dünn war, bekam ich auch immer Nachschlag. Die Küchenfrauen kannten mich und wussten, dass ich immer aufesse. Außer bei Haferschleim und erst recht nicht bei warmen Grießbrei mit Nanamansch. Nanamansch war der kulinarische Alptraum meiner Kindheit. Die anderen waren ganz wild drauf.
Nur ich bekam Würgereiz. Nanamansch war ein Löffelchen voll zerdrückter Banane. Von diesem bräunlichen Glibberbrei gab es einen kleinen Löffel auf den heißen Grießbrei. Das roch schon äußerst widerlich. Wie das faule Obst auf unserem Misthaufen. In späteren Jahren gab es Abbabrei. Das war geriebener Abbel mit Nanamansch. Da es kaum noch Bananen gab, wurde der Nanamansch mit geriebenen Apfel gestreckt. Genauso braun und glibberig, nur noch widerlicher. Zum Glück konnte ich den Fraß immer gegen ein paar Wurstschnitten eintauschen. Nur Panzerfett durfte nicht drauf sein. Mettwurst schmeckte mir überhaupt nicht. Mein großer Bruder hatte mir mal erzählt, dass bei der Armee die Wurst zum schmieren der Panzerketten genommen wurde. Gegessen hat die dort auch kaum einer. Da half auch der schönere Name Teewurst nichts. Oft gab es nach dem Essen Kompott. Am liebsten hatte ich Zappelpudding. Egal ob grün, gelb oder rot, aber immer mit Vanillesoße. Es gab auch kalten Grießbrei mit Sirup, eingewecktes Obst, Apfelmus, was nicht so gut schmeckte, wie das von meiner Mutti. Und Äpfel oder manchmal Birnen. Meistens gab es Äpfel.
* * *
Die erste Zeit in der Schule verging relativ schnell. Wir lernten lesen, schreiben und rechnen. Malen und turnen durften wir auch. Ich musste auch noch das schreiben und malen mit der richtigen Hand lernen. Nur das Fach Spielen gab es nicht. Wir lernten auch mit einem Füllfederhalter umzugehen.
In den ersten zwei Jahren hatte ich immer ein Tintenfäßchen in meinem Ranzen. Wenn mein Füller leer war, steckte ich ihn in das Tintenfäßchen und zog Tinte in den Füller hinein. Meine Finger waren immer ganz blau von der Tinte. Ab der 3. Klasse hatte ich einen Füller mit Tintenpatronen. Das war schon viel bequemer. Ab der 8. Klasse erst, durften wir mit Kugelschreiber schreiben.
Von nun an bekam ich auch Taschengeld. Jeden Montag bekam ich von Mutti 50 Pfennig. Das musste ich mir die ganze Woche einteilen. Aber im Konsum, an dem wir jeden Tag vorbei gehen mussten, gab es so gute Sachen. Zum Beispiel ein Brötchen mit einer fingerdicken Scheibe Leberkäse oder einer großen Ecke Schmelzkäse für 20 Pfennig. Oder eine kleine Tüte Sauerkraut für den gleichen Preis. Einmal in der Woche gab es saure Heringe. Davon konnte ich mir dann auch mal 3 Stück leisten.
Manchmal kaufte ich mir auch Süßigkeiten, wie etwa die großen Gummitiere für einen Groschen, Brausepulver oder Dropse. Sehr beliebt waren die Pfeffistangen für 10 Pfennig. Ich mochte die gelben Pfeffis lieber. Die schmeckten nach Zitrone. Für Schokolade reichte mein Geld nicht. Im Sommer kaufte ich mir gelegendlich eine Flasche rote Brause für 21 Pfennig.
In der Kneipe gab es ein Glas Fassbrause für 15 Pfennig. Oder ein Eis am Stil für 20 Pfennig. Verlockungen waren genug da.
Interessanter als der Unterricht war das, was draussen passierte. Unsere Schule war ein altes Gutshaus. Daran war ein großer Hof mit Ställen und einem riesigen Misthaufen in der Mitte. Ich schaute gerne aus dem Fenster.
Trecker und Kühe waren auf jeden Fall interessanter als mit Stäbchen zu rechnen oder Schönschreiben üben. Allerdings, wer das gut konnte bekam ein Bienchen. Das hieß, da bekam man eine Biene unter die Übung gestempelt und man wurde gelobt, wie fleißig man doch ist. Wie eine Biene eben. Hier wurde die Grundlage für ein elendes Strebertum gelegt.
Schon ab der 1. Klasse hatten wir Werkunterricht, genannt Werken. Der Werkraum war im anderen Schulgebäude im Keller. Dort banden wir uns eine Arbeitsschürze um und stellten uns an die Werkbänke. Onkel Kurt war unser Lehrer in Werken. Basteln mit Holz und Plaste machte mir Spaß. Wir bauten Vögelhäuschen und Nistkästen, Kästchen, Schatullen und Blumenuntersetzer. Wir lernten mit dem heißen Lötkolben Motive in Holz brennen, lackieren und bemalen. Die meisten Sachen durften wir mit nach Hause nehmen.
Nach ein paar Wochen verkündete unsere Lehrerin, dass wir bald zu Jungpionieren würden. Was das hieß, wurde uns mit den schönsten Worten ausgemalt. Nicht nur für mich ein Grauen. Wir mussten ein weißes Hemd mit einem Emblem auf dem Ärmel tragen. Das hieß aufpassen, dass es nicht dreckig wird. Also nicht bewegen. Dazu noch ein blaues Halstuch. Warum das? Ich war doch nicht erkältet. Und als Höhepunkt ein blaues Käppi. Das sah so doof aus. Eine Bommelmütze hätte mir besser gefallen. Da, zum Glück, Käppis Mangelware waren, waren die keine Pflicht. Aber das weiße Pionierhemd und das blaue Halstuch waren an besonderen Tagen Pflichtkleidung. Das gaben die Lehrer vorher bekannt. Zum Fahnenappell mussten wir immer das blaue Halstuch tragen. Natürlich mit einem ordentlichen Pionierknoten geknotet. Wir sollten immer freundlich, fleißig und hilfsbereit, vor allem zu älteren Menschen, sein. Aber bestimmt nicht zu der ollen Frau Krause. Die beschmiss uns immer mit faulen Obst, wenn sie uns in ihrem Garten erwischte. Mich hatte sie auch schon getroffen.
Nun hatten wir auch einmal im Monat, nach der Schule, den Pioniernachmittag. Der wurde von dem Pionierleiter durchgeführt. Wir hatten eine junge Frau als Pionierleiterin. Jede Schule hatte sowas. Mein Bruder sagte mal: „Das sind solche, bei denen es zum Lehrer nicht gereicht hat.“ Beim Pioniernachmittag wurde gemeinsam in der “Frösi“ gelesen. Ich hätte lieber im “Atze“ gelesen. Da waren die Geschichten lustiger. Vor allem die mit Fix und Fax. Jedes Mal mussten wir eine Wandzeitung gestalten, zu sozialistischen Themen oder Feiertagen. Uns wurde erzählt, wie gut und schön der Sozialismus ist und wie schlecht der Kapitalismus. Der große, böse Kapitalist USA führte Krieg im kleinem, sozialistischen Vietnam. Da sollten wir Solidarität zeigen. Zum monatlichen Pionierbeitrag wurden immer 10 Pfennig Solidaritätsbeitrag eingesammelt. Später, ab der 3. Klasse als Thälmannpionier, lernten wir alles über Ernst Thälmann und warum unsere Pionierorganisation seinen Namen trug.
Doch vorher, im Oktober, gab es etwas sehr schönes. Meine ersten Ferien.
Das hieß eineinhalb Wochen spielen. Doch da hatte ich die Rechnung ohne meine Eltern gemacht. Sie schickten mich in die Ferienspiele. Also doch wieder in die Schule. Und von dort ging es ins Theater, Kino, Zoo, baden usw. . Gar nicht mal so schlecht.
Mein Bruder hatte sich vor kurzem ein Mofa gekauft. Daran baute er am Wochenende rum. Weil Vati und Mutti gerade mal nicht da waren und er auf mich aufpassen musste, winkte er mich ran und fragte: „Willste mal fahren?“
Das Mofa sah aus wie ein großes Fahrrad. Und Fahrrad fahren konnte ich.
Das musste man können, bevor man in die Schule kam. Sybille hatte mir das beigebracht. Als ich nickte, erklärte mir mein Bruder, was ich machen sollte.
Dann trat er das Mofa an und ich stellte mich auf die Pedale. Zum draufsetzen war ich zu klein. Die rechte Hand zum Gas geben, linke Hand zu schalten und kuppeln. Dabei half er mir. Ich kam etwa 5 m weit, dann kippte ich um. „Du musst mehr Gas geben“, rief er. Beim zweiten Versuch gab ich mehr Gas. Nun klappte das fahren prima. Allerdings hatte er mir nicht gesagt, wie ich bremsen konnte. So bekam ich die Kurve nicht und fuhr gegen die Stallwand. Nachdem er mir auch noch das mit den bremsen erklärt hatte, klappte das Mofa fahren prima. Ich drehte ein paar Runden im Hof.
Die Hühner rannten wie wild im Hof herrum. Nun kamen Mutti und Vati zurück. Schnell nahm mir mein Bruder das Mofa weg und tat ganz unschuldig. Und ich war stolz, dass ich schon Mofa fahren konnte. Nur erzählen durfte ich das keinem.
In den Ferien musste ich am Sonnabendmorgen zu Frau Kühne gehen. Die wohnte zwei Häuser weiter unsere Strasse runter und war die Milchfrau in unserem Dorf. Bei ihr gab es Milch und Buttermilch, Quark, Butter und Hefe. Oma wollte backen. Sie gab mir 5 Mark. Ich sollte 1 l Milch, 1 Pfund Butter, 2 Pfund Quark und für einen Groschen Hefe holen. Zur Sicherheit hatte sie alles auf einen Zettel geschrieben. Den sollte ich Frau Kühne geben.
Was auf dem Zettel stand konnte ich nicht lesen. Oma schrieb noch mit Sütterlin-Buchstaben.
Ich ging zu Frau Kühne in den Hof und klopfte an das Fenster. Frau Kühne machte das Fenster auf und begrüßte mich freundlich. Ich sagte: „Guten Tag, meine Oma schickt mich. Das soll ich holen.“ „Na, dann gib mal den Zettel her!“, sagte sie. „Oh, deine Oma will Matzkuchen backen. Da freust du dich bestimmt drauf?“ Ich nickte. Ja, das stimmte. Omas Kuchen schmeckten immer gut. Frau Kühne schöpfte mit einer großen Kelle die Milch aus einer Wanne in meine kleine Milchkanne. Der Quark war in einer großen Schüssel. Mit einem großen Holzlöffel tat sie davon einen Haufen auf ein Stück Papier. Von der Butter schnitt sie ein großes Stück ab und tat es auch auf ein Stück Papier. Beides wurde sorgfältig abgewogen. Von der Hefe gab es nur ein kleines Stück, welches auch gewogen wurde. Alles wurde schön in Papier eingewickelt. Ich gab ihr das Geld und bekam sogar noch etwas wieder. Das durfte ich mir bestimmt in meine Sparbüchse stecken.
Als ich wieder zuhause war, freute sich Oma, dass ich alles bekommen hatte.
„Da kann ich ja einen schönen Matzkuchen backen“, sagte sie. Oma sagte immer Matzkuchen und nicht Quarkkuchen. Die hatte noch ein paar andere komische Worte in ihrer Sprache. Aber ich verstand sie. So hieß bei ihr der große Treppenabsatz Sal, das Messer hieß Futtich und die Hülle dazu hieß Ficke. Zum arbeiten, backen und kochen, band sie sich immer eine Zuppschürze über ihre Kittelschürze. Sie hatte immer eine blaue Kittelschürze an. Sonntags waren weiße Blümchen auf der Kittelschürze.
Und immer wenn sie raus ging, band sie sich ihre Kuke um. Im Winter war das Kopftuch aus Wolle. Das musste schon sehr warm sein, dass sie mal keine Kuke umband.
Oma hatte auch noch eine ganz spezielle Aufgabe. Sie kümmerte sich um das Klopapier auf dem Donnerbalken. Dazu riss sie die “Freiheit“, unsere Tageszeitung, akkurat in postkartengroße Stücke und stapelte sie in den dafür vorgesehenen Kasten auf dem Donnerbalken. Nur wenn Gäste da waren, gab es richtiges Klopapier von der Rolle. Mein Bruder sagte mal: „In der “Freiheit“ steht eh nur Scheiße drin. Also kann man sich damit auch den Arsch abwischen.“
Oma kochte auch oft für uns. Sie war früher auf dem größten Bauerngut im Ort die Mamsell gewesen. Sie musste für die Knechte und die Herrschaft kochen. Für die Knechte kochte sie zum Beispiel Reissuppe mit Hühnerklein und Kartoffelklößen, denn die Arbeiter brauchten Kraft zum arbeiten, aber das Essen durfte nicht viel kosten. Die Herrschaft bekam die Keulen und die Brüste der Hühner. Dazu gab es Pertersilienbrühe und Kartoffelklöße. Oma konnte richtig gut kochen. Selbst aus wenigen Zutaten kochte sie ein feines Essen. Etwa im späten Frühjahr. Da war der Schinkenrest steinhart geworden. Den konnte man nicht mehr aufs Brot machen. Oma kochte mit dem Schinkenarsch Graupensuppe. War die gut.
Oder im Herbst. Da gab es ein ganz seltsames Gericht, was trotzdem sehr gut schmeckte. Linsen süß – sauer mit Backpflaumen statt Rotwurst. Von Linsen musste man sowieso schon pupsen. Aber wenn es die Backpflaumen dazu gab, knatterte es dauernd in der Hose. Deshalb gab es das Gericht nur am Wochenende, wenn keiner auf Arbeit und ich nicht in die Schule musste.
Wenn die Schwartenwurst so hart geworden war, dass man sie nicht mehr beißen konnte, nahm mein Vati ein sauberes Eisensägeblatt, sägte von der Wurst fingerdicke Scheiben ab und legte diese in Essigwasser mit Zwiebelwürfeln ein. So wurde die Wurst wieder weich. Geschmeckt hat sie sowieso. Harte Rotwurst wurde in Würfel schnitten und in heiße, süß-saure weiße Bohnen- oder Linsensuppe gelegt. In der heißen Suppe wurde die Wurst ganz weich. Harte Bratwurst wurde über einer Wasserpfanne im Ofenrohr gewärmt und dadurch wieder weich. Dazu gab es Kartoffeln und Sauerkraut. Harter Speck gab Sauerkraut richtig guten Geschmack.
Eine andere Sache gefiel mir nicht so. Oma ließ den Harzer Stinkerkäse unter einer Käseglocke solange liegen, bis der flüssig wie Honig war. Erst dann schmeckte er ihr richtig gut. Der Geruch erinnerte, nicht nur mich, an unseren Donnerbalken.
Ein Lieblingsessen von ihr schmeckte mir überhaupt nicht. Das war Kloß mit Rosinenbrühe und verlorenen Eiern. Die Klöße von gekochten Kartoffeln schmeckten zwar wie immer gut. Aber nicht das andere. Oma machte eine Mehlschwitze, die sie mit heißem Wasser dünn rührte. Mit etwas Salz, Essig und Zucker wurde die Brühe kräftig süß-sauer abgeschmeckt. Da hinein kamen in Wasser eingeweichte Rosinen samt Einweichwasser. Dann brachte Oma in einem großen Topf Wasser zum kochen. Da goß sie einen großen Schluck Essig rein. Dann schlug sie ein Ei in eine Suppenkelle rein und tat das ganz vorsichtig in den Topf mit Essigwasser. Pro Person kochte sie so zwei Eier. Das ging ganz schnell. „Das ist ein Essen für feine Leute“, sagte sie immer. Da wollte ich lieber kein feiner Leut sein.
Bei uns wurde kein Essen weggeworfen. Oma sagte immer: „Versündige dich nicht! Eines Tages wirst du das Essen suchen.“ Wir verwerteten alle Reste. Sachen, die wirklich nicht mehr zu gebrauchen waren, verfütterten wir an die Tiere. So fütterten wir mit unserem Essen unser Essen.
Oma wohnte oben im Haus bei uns, wie unsere Mieter. Sie hatte nur 130 M Rente. Damit musste sie auskommen. Wir freuten uns, dass wir Oma hatten.
Sie nahm meinen Eltern viel Arbeit ab und passte auf mich auf. Da ging es anderen Oma's und Opa's viel schlechter. Viele gingen in ihre ehemaligen Betriebe, in der Woche zum Mittagessen. Da konnten sie für 5 M die ganze Woche Mittag essen. Und Nachschlag bekamen die auch. Einige nahmen sich auch etwas mit nach Hause. Das war oft die einzige Mahlzeit am Tag.
Außer Brot und Margarine gab es da nicht viel mehr. Da hatte es meine Oma besser.
Im Winter kamen oft andere Omas zu meiner Oma. Zum Federn rupfen.
Oder Oma ging zu einer anderen Oma. Ich hatte sie mal gefragt, warum sie das machte. Sie antwortete: „Damit wir schöne weiche Kissen und Decken haben. Wenn wir die Kiele an den Federn lassen würden, könnte man auch gleich Stroh in die Bezüge stecken. Das ist hart und kratzt.“ Das stimmte.
Unsere Kissen und Decken waren schön weich und warm. Die Federn waren von unseren Enten und Gänsen. Aber nur feine und kleine Federn wurden genommen. Und von denen wurden die Kiele abgerupft. Nur das Weiche der Federn wurde gesammelt. Das machten die Omas stundenlang. Da gab es auch Kaffee und Kuchen. Und geschwatzt haben die. Manchmal durfte ich auch in das Zimmer rein. Ich durfte mich nur ganz langsam bewegen. Einmal flitze ich doch durch das Zimmer und stieß einen Sack um. Danach sah das Zimmer aus, als hätte es geschneit. Oma nannte mich wieder „kleener Deiwel“, aber die anderen Omas lachten und sammelten die Federn wieder auf. Danach durfte ich nicht wieder in das Zimmer. Eine Oma schickte ihre gerupften Federn in den Westen. Die sagten dort, dass man so etwas Gutes da nicht bekommt. Die Arbeit machte sich dort keiner.
Oma hatte noch das alte Fernglas von Opa. Damit durfte ich aus dem Dachfenster gucken und Züge beobachten. Opa brauchte das, als er im 1.
Weltkrieg bei Verdun gekämpft hatte. Da wurde er auch schwer verwundet.
Im 2. Weltkrieg musste er an die Ostfront. Er hatte Glück, dass er überlebt hat.
* * *
Jetzt war ich auch groß genug geworden, um beim Müll fahren zu helfen.
Als ich am nächsten Sonnabendmittag aus der Schule kam, stand ein großer Anhänger bei uns im Hof neben der Aschengrube. Ich aß mein Mittagessen und danach bekam ich alte Sachen zum anziehen. Mein Vati und mein Bruder hatten schon fast den ganzen Müll aus der Grube auf den Anhänger geschaufelt. Nun ging es nicht mehr weiter. Jetzt war ich an der Reihe. Auf der Leiter kletterte ich in die Grube. Es war so eng, da hätte sich kein Erwachsener bewegen können. Aber ich. Mit einer Schippe und einer Gabel mit ganz kurzem Stil, schaufelte ich den restlichen Müll in einen Eimer, den mein Vati mit einem Strick hoch zog und auf den Anhänger kippte. Nach einer knappen Stunde hatte ich es geschafft. Der letzte Eimer wurde hoch gezogen und die Leiter herunter gelassen. Ich durfte wieder raus klettern.
Vati freute sich, dass ich so fleißig war und sagte: „Da haben wir es ja rechtzeitig geschafft.“ Es war Hufgeklapper zu hören. Das musste Max sein.
Max war ein gewaltiger Kaltblüter, der sonst im Kuhstall den Mistschlitten zog oder im Herbst Kartoffeln, Getreide und Schrot ausfuhr. Max war aber nicht kalt. Immer wenn ich ihn gestreichelt habe, fühlte sich Max schön warm an. Nur gerochen hat er nicht schön. Allerdings roch ich jetzt auch nicht besser. Max wurde von Thilo, seinem Kutscher, geführt. Thilo hatte viele Sommersprossen im Gesicht und redete nicht viel. Ich hatte meinen Bruder mal gefragt, warum Thilo so viele kleine braune Flecke im Gesicht hat. Er erklärte mir mit ernster Miene, dass ist so, weil Thilo immer hinter Max sitzt. Ganz nah an seinem Popo. Und da Max oft pupsen muss und Thilo nicht so schnell in Deckung gehen kann, na ja, deswegen hat er so viele kleine braune Flecken im Gesicht. Und deswegen redet Thilo auch nicht so viel. Er will die braunen Flecke nicht auch noch auf seinen Zähnen haben. Das leuchtete mir ein. Mein Vati hatte das auch gehört und gab lachend meinem Bruder einen Klaps auf den Hinterkopf. Wieso wurde der bestraft? Das zu wissen war doch wichtig für mich.
Thilo führte Max rückwärts an den Anhänger. Ganz schnell war Max eingespannt. Das war ein ganz Braver. Ich streichelte ihn und das gefiel Max sehr. Thilo kletterte auf den Kutschbock vom Anhänger. Er fragte mich, ob ich mitfahren möchte. Und ob ich wollte. Aber nicht auf dem Kutschbock.
Ich setzte mich hinten auf den Anhänger in den Müll. Wir fuhren quer durch unser Dorf. Dort sah Worsti mich und sprang einfach auf den Anhänger.
Zwei andere Kinder durften vorn mitfahren. Ich flüsterte Worsti die Geschichte zu, welche mir mein Bruder erzählt hatte. Worsti zwängte sich zu mir in die äußerste Ecke. Er wollte auch keine braunen Flecken im Gesicht haben. Den zwei anderen Kindern auf dem Kutschbock haben wir nichts gesagt.
Auf einem Feldweg fuhren wir zu einer alten Kiesgrube. Dort durften alle ihren Müll reinkippen. Thilo dirigierte Max rückwärts an den Rand der Grube. Dann nahm er eine Kurbel und steckte sie in ein Loch unter dem Anhänger rein und kurbelte los. Das ging sehr schwer. Langsam hob sich der Anhänger. Thilo hatte vorher die hintere Planke runter geklappt. Nun rutschte unser ganzer Müll in die Grube. Während dessen hielten wir Ausschau, ob hier noch etwas Brauchbares rum lag. Da fand man oft etwas.
Überhaupt war es schön in der alten Kiesgrube. Der hintere Teil war mit großen Bäumen bewachsen. Es war alles so schön grün. Wenn im späten Frühjahr und im Sommer der hintere Teil unter Wasser stand, konnten wir dort baden. Das Wasser war flach und warm. Dort lag auch kein Müll. Und eine kleine Wiese zum liegen gab es auch. Da konnten wir schön spielen und baden. Auch ohne Erwachsene.
Als der ganze Müll vom Anhänger war, kurbelte Thilo in die andere Richtung. Als der Anhänger nur noch ein bisschen schräg stand, musste ich hinauf klettern. Mit dem Besen musste ich den Rest Müll runter schieben und den Anhänger sauber abkehren. Als ich das geschafft hatte, kurbelte Thilo den Anhänger ganz nach unten und wir durften alle wieder aufsteigen.
Dann fuhren wir zurück.
Als wir wieder im Dorf waren, stand die neugierige Frau Sommer auf der Strasse und winkte uns zu. In dem Moment hob Max seinen Schwanz und viele Äpfel kullerten aus seinem Popo. Es roch auch nicht schön. Ob Thilo jetzt mehr braune Flecken im Gesicht hatte? Frau Sommer rannte in ihren Hof und kam mit Eimer und Schaufel zurück. Sie schippte die Pferdeäpfel in ihren Eimer. „Die sind für ihre Blumen“, sagte Thilo. Zuhause angekommen, hob mich Thilo vom Anhänger. Er hatte keine frischen braunen Flecken im Gesicht. Hatte mein Bruder etwa geschwindelt?
Inzwischen hatte Vati den Badeofen geheizt und nun war das Wasser warm.
Ich wurde in die Wanne gesteckt. Das Wasser war herrlich warm. Ich hatte draussen etwas gefroren. Nun durfte ich ein paar Minuten spielen. In der Wanne spielte ich am liebsten mit meinem kleinen blauen Taucher. Dann kam Mutti und schrubbte mich ordentlich mit Badusan. Ich sollte ja nicht mehr stinken. Danach gab es Abendbrot. Vati hatte zur Feier des Tages Schaschlik gemacht. Mutti hatte in der Woche, in unserem Konsum, eine Flasche Ketchup ergattert. Schaschlik und Ketchup, das war etwas ganz feines. Da ich so viel gearbeitet hatte, durfte ich sogar zwei Stück essen.
Dazu gab es eine trockene Schnitte. Nach dem Abendessen kam das Sandmännchen. Die Geschichten waren schön. Besonders die mit Pittiplatsch oder Herrn Fuchs und Frau Elster. Zum Schluss schmiss das Sandmännchen immer eine Hand voll Schlafsand aus dem Fernseher. Ich hielt mir die Augen zu. Doch er musste mich getroffen haben. Ich wurde ganz doll müde und schlief schon bei der “Schaubude“ ein.
Zwei Wochen später kam unser großer Tag. Wir standen auf der Bühne im Lohnsdorfer Kneipensaal. Alle in dieser doofen Pionieruniform. Und darauf sollten wir auch noch stolz sein. Das Hemd war groß genug, dass es die nächsten zwei Jahre auch noch passte. Das blaue Halstuch war ordentlich mit einem Pionierknoten gebunden. Ein Gelöbnis mussten wir auch noch aufsagen. Alle klatschten, auch die Erwachsenen. Danach führte jede Klasse ein kleines Programm auf, welches sie sich selber ausgedacht hatten. Die meisten Erwachsenen verfolgeten das Programm mit geschlossenen Augen.
Geklatscht haben sie trotzdem. So ging das die nächsten 6 Jahre anlässlich des Pioniergeburtstages. Das Schöne daran war, dass wir an diesem Tag nur drei Stunden Unterricht hatten.
Nun wurden wir jeden Morgen von den Lehrern mit dem Ruf: „Seid bereit“ begrüßt. Wir hoben die Hand zum Pioniergruß und antworteten: „Immer bereit“. Bei den FDJ-lern wurde mit „Freundschaft“ gegrüßt.
* * *
In diesem Jahr bekam ich zu Weihnachten, vom Weihnachtsmann, ein paar neue Skier geschenkt. Das war toll. Nun konnte ich mit den Großen zum Pfarrberg gehen, um vom Berg runter zu fahren. Da musste man aufpassen.
Die Sandgrube war ganz nah am Berg. Und kam man nicht rechtzeitig vor dem Rand der Sandgrube zum stehen, stürzte man in die Sandgrube. Erst etwa 2 m senkrecht, dann etwa 10 m einen steilen Abhang hinunter und dann in den kleinen See. Wenn man Glück hatte, war der See zugefroren. Da blieb man wenigstens trocken. Um wieder aus der Sandgrube raus zu kommen, musste man quer durch die Grube laufen und dann wieder auf den Pfarrberg rauf. Da war man gut 10 Minuten unterwegs. Im vorigen Jahr hatte ich die alten Skier von meinem Bruder kaputt gemacht, als ich, bei meiner ersten Abfahrt, in die Grube stürzte. Deshalb hatte ich dieses Jahr neue bekommen.
Die, die zum ersten Mal mit auf dem Pfarrberg waren und die Stadtkinder, wurden vor dem Abhang nicht gewarnt. Die Großen wollten ja was zu lachen haben. Manches Stadtkind jodelte, vor Entsetzen, wenn es mit dem Schlitten oder den Skiern den Abhang runter in die Sandgrube stürzte. Die meisten Schlitten gingen dabei kaputt. Worsti war auch im vorigen Jahr mit seinem Schlitten in die Grube gefahren. Der Schlitten war hinterher nur noch Feuerholz. Genau wie meine Skier.
Gleich am zweiten Weihnachtsfeiertag bekam ich Gelegenheit meine Skier auszuprobieren. Thilo hatte an Max ein paar Schlitten angebunden. Die zog Max nun durchs Dorf. Ich stand gerade am Teich mit meinen Skiern, als Max und Thilo vorbei kamen. Worsti saß auf dem letzten Schlitten und winkte mir zu. Ich hielt ihm meine Skistöcke hin. Er griff zu und zog mich mit. Aber nicht lange. Nach nur ein paar Metern lag ich auf der Nase.
Jemand hatte etwas Asche auf die Strasse gestreut. Ich stand auf und rannte den Schlitten hinterher. Worsti zog mich wieder ein paar Meter, bevor ich wieder auf der Nase lag. Nach dem nächsten Sturz hatte ich genug. Ich schnallte die Skier ab, stellte sie ans Geländer vom Teich, rannte den Schlitten hinterher und schwang mich bei Worsti mit auf den Schlitten. Dort fuhr ich zwei Runden durchs Dorf mit. War das schön.
In den Winterferien waren viele Stadtkinder bei ihren Großeltern auf dem Dorf. Die wurden natürlich, von anderen Kindern, zum Ski fahren und rodeln auf dem Pfarrberg eingeladen. Auch Worsti, Bobby und ich gingen mit. Mit unseren Schlitten rodelten wir die lange Einfahrt in die Sandgrube runter. Dort setzten wir uns auf unsere Schlitten und warteten, bis das erste Stadtkind angeflogen kam. Sah das lustig aus. Das klappte oft bei zwei, drei Kindern hintereinander.
* * *
Der Rest des Schuljahres verschlich sich in gewohnter Langeweile. Dann kamen die großen Ferien. Vorher gab es Zeugnisse und die ganz Fleißigen bekamen ein Buch geschenkt. Ich bekam keins.
Meine Eltern wollten mit mir in den Urlaub fahren. Was war und wo war Urlaub? Doch vorher musste ich noch ins Schwimmlager. Auch so eine Pflichtveranstaltung von der Schule, wo ich schwimmen lernen sollte. Und das in den ersten zwei Ferienwochen.
Montag früh um 8 Uhr ging es los. Mit dem Fahrrad fuhren wir fünf Kilometer übers Land bis ins Freibad. Die Kleinen vorweg und die Großen hinterher. Und ganz hinten fuhr die furchteinflößende Hortnerin. Am Bad angekommen wurden erstmal die Fahrräder angeschlossen, die Luftpumpen und das Werkzeug abgebaut, damit das keiner klauen konnte. Nun ging es in die Umkleidekabine. In Badehose wurden wir jetzt zur Liegewiese gebracht und in Gruppen aufgeteilt. Erst mussten wir uns aufwärmen. Das hieß Liegestütze, Kniebeugen und den Hampelmann machen. Danach war Trockenschwimmen angesagt. Wie albern. Das war noch doofer als turnen.
Das ist nur was für Mädchen. Richtige Jungen spielen Fußball oder raufen.
Ins Wasser? Fehlanzeige. Doch wir durften uns frei bewegen. Ich folgte den Größeren. Und so lernte ich das Beste im Freibad kennen – den Kiosk. Dort gab es Würstchen, Fischbrötchen und, das war das Allerbeste, rote Fassbrause. Da ich zum Frühstück meine zwei Doppelschnitten schon aufgegessen hatte, war für mich der Kiosk die Oase in der Wüste. Und die rote Fassbrause schmeckte allemal besser, als der kalte Pfefferminztee, den meine Mutti mir mitgegeben hatte. Ein Fischbrötchen und eine Fassbrause kosteten 40 Pfennig. Das konnte ich mir leisten. 50 Pfennig hatte ich ja mit.
Schwimmlager machte doch Spaß.
Nach einer kleinen Ruhepause durften wir endlich ins Wasser. War das kalt.
Ich konnte gar nicht so schnell zittern, wie ich fror. Jetzt sollten wir die gleichen Trockenübungen machen wie an Land. Der dicke Schwimmmeister kam nicht mit ins Wasser. Das war ihm wohl zu kalt. Aber wir mussten rein.
Zum Schluss sollten wir auch noch in dieser milchig – grünlichen und übel riechenden Brühe untertauchen. Nun aber raus aus dem Wasser, abbrausen und in die Sonne gelegt. Damit war der erste Tag geschafft und wir radelten nach Hause. Natürlich in der Gruppe.
Am nächsten Morgen bekam ich einen Schwimmgürtel umgeschnallt.
Allerdings war ich zu klein und zu leicht für das Ding. So trieb ich hilflos, mit dem Popo nach oben im Kinderbecken und versuchte mit aller Kraft meinen Kopf über Wasser zu halten. Ich hätte weinen können und hatte Angst. Nach einer Weile merkte ich, ich gehe ja gar nicht unter. Ein kurzes Nachdenken und schon ging es im Stile unseres Schäferhundes in Richtung Beckenrand. Das war ja einfach. Aber der dicke Schwimmmeister hat geschimpft. Ich solle das so machen, wie in den albernen Trockenübungen.
Ging ja gar nicht. Ich konnte ja nicht stehen und laufend habe ich Wasser geschluckt. Das war einfach nur blöd.
Kurzum, nach ein paar Tagen üben mit dem Schwimmbrett und dann ohne, konnte ich am Ende der zwei Wochen schon ein paar Meter richtig schwimmen. Ich war so stolz.
* * *
Als ich, nach dem letzten Tag im Schwimmlager, nach Hause kam, standen Koffer in unserem Vorbau und Mutti huschte durch die Gegend. Gerade war sie dabei Wurstgläser aus dem Keller hoch zu tragen und in einer großen Tasche zu verstauen. Mein erster Gedanke war: Mutti verschenkt unsere ganze Wurst und ich muss den Rest des Jahres olle Konsumwurst essen. Ich wollte gerade in Tränen ausbrechen, da beruhigte mich Mutti wieder. „Das nehmen wir mit in den Urlaub“, sagte sie. „Morgen musst du ganz früh aufstehen. Da kommt ein Bus und holt uns ab“. Und da war das Wort wieder: Urlaub. Was und wo, verflixt noch mal, war Urlaub? Ich war so aufgeregt und so neugierig, dass ich kaum schlafen konnte.
So früh wie an diesem Sonnabend musste ich noch nie aufstehen. Ich war ja noch so müde. Aber die Neugier hielt mich wach. Und aufgeregt war ich auch. Während ich meine Frühstücksschnitte verdrückte, schaffte Vati die Koffer und Taschen vor unser Hoftor. Mutti wusch noch schnell ab und dann huschten wir zu Vati nach draussen. Er rauchte noch eine Zigarette und unterhielt sich mit unserem neugierigen Nachbarn. Dann kam auch schon der Bus. Ein schmutziger, alter Ikarus. Ich hatte zwar schon Busse gesehen, aber damit gefahren war ich noch nicht. Da saßen schon Leute drin und alle schienen meine Eltern zu kennen. Kinder waren auch dabei. Die machten keinen glücklichen Eindruck. Kannten die Urlaub schon? Machte das etwa keinen Spaß? Die Koffer und Taschen waren schnell verstaut und wir tuckerten in den nächsten Ort. War hier Urlaub? Aber das war doch der Ort, wo ich im Schwimmlager war. Mutti hatte was von baden gehen gesagt.
Betrug? Nein, es stieg nur noch eine Familie zu. Die Fahrt ging weiter und dauerte ewig. Ich schaute aus dem Fenster und sah nur Bäume und Felder.
Wie langweilig. Den Vatis schien die Fahrt zu gefallen. Eine große Flasche ging von Hand zu Hand und jeder von den Vatis nahm einen kräftigen Schluck. Davon wurden die immer lustiger. Den Muttis schien das nicht zu gefallen. Nach einer kleinen Ewigkeit hielt der Bus auf einem Parkplatz. Es wurde auch Zeit, denn ich musste ganz dringend pullern. Die Vatis auch. Wir standen in einer Reihe am Strassenrand und pullerten in den Strassengraben.
Es war wie ein Wettbewerb im Weitpullern. Gewonnen hatte der Vati der zuletzt eingestiegen war. Der schaffte es bis auf die andere Seite. Danach brannten sich fast alle Vatis noch eine Zigarette an und ich bekam eine warme Leberwurstschnitte. Pfui. Aber ich hatte Hunger und Durst. Und was gab es? Nur den ollen, lauwarmen Pfefferminztee. Bäääh. Wenn das Urlaub sein sollte, will ich das nicht wieder haben. Jetzt kam auch noch die Mutti aus dem Bus, die ein ganz kleines Kind bei sich hatte. Sie hielt eine volle Windel weit von sich, rannte zum Strassengraben und schüttelte einen beachtlichen Haufen aus der Windel in den Graben. Nun wusste ich, was im Bus so übel gerochen hatte. Die Windel wurde ordentlich zusammen gefalten, in eine Tüte gesteckt und in der Handtasche verstaut. Die Vatis hatten aufgeraucht und weiter ging die Fahrt.
Nach einer weiteren Pinkelpause und einer unendlich langen Fahrt durch Wälder, vorbei an Feldern, über Alleen und durch kleine Städte, waren wir endlich da. Doch was für eine Enttäuschung. Das soll der Ort Urlaub sein, wo alle hinfahren? Das musste ein anderes Urlaub sein, denn hier war keiner.
Wo denn auch. Auf dem Ortsschild stand Neu Canow. Der Ort bestand aus einer Strasse, die eigentlich nur ein befestigter Weg war und neun Häusern.
Davon war eines auch noch der Konsum und ein anderes ein Urlauberheim.
Ich konnte gar nicht so schnell die Häuser zählen, da waren wir auch schon durch den Ort durch. Wir hielten am Rand eines Waldes an, der nur aus kleinen Bäumen bestand. Endlich waren wir da und konnten aussteigen.
Nun nahm jeder seine Koffer, Taschen und Beutel und lief in den Wald.
Feste Wege gab es hier nicht. Nur Sand, aber davon sehr reichlich. Den hatte ich nach wenigen Schritten schon in den Sandalen und bekam ihn auch nicht wieder raus. Mutti zog mir die Sandalen und Socken aus, so dass ich barfuß laufen konnte. Das ging viel besser und der Sand war schön warm. Es roch wundervoll nach Tannen. Zuerst kamen wir an einer gemauerten Baracke vorbei. Hier, erklärte mir mein Vati, müsse ich zum kacken und waschen her. Noch ein kleines Stück Weg und wir standen vor einem kleinen Haus.
Nein, da waren ganz viele. Vor dem Haus, in das wir einziehen sollten, stand ein kleiner, alter Mann mit seinem vollen Bollerwagen. Da waren Gasflaschen und Bettwäsche drin. Der Mann hieß Willem und schien meinen Vati sehr gut zu kennen. Willem gab jeden Vati einen Schlüssel und zeigte ihnen ihr Haus. Wir bekamen gleich das erste mit einer grossen Terrasse davor. Willem und Vati blieben auf der Terrasse. Mutti sagte, dass Willem jetzt mit uns eine Belehrung mache. Aber zuvor zeigte sie mir mein Zimmer.
Es war zwar winzig, aber ich hatte es für mich allein. Nun gingen auch wir auf die Veranda. Vati hatte für sich und Willem Bier – und Schnapsgläser geholt. Bei Bier und Schnäpschen ging die Belehrung recht schnell vorbei.
Willem schien großen Durst zu haben. Sein Schnapsglas war immer leer. Als er sein Bier alle hatte, verabschiedete er sich und ging zum Nächsten. Ich fragte Vati ganz aufgeregt, wo denn das Boot und der See sei. Er schnappte mich bei den Hüften und hob mich hoch. Vorsichtig stellte ich mich auf seine Schultern. Da sah ich ihn. Über die Wipfel der Bäumen hinweg konnte ich den See sehen. Wie groß der war. Vati sagte: „Jetzt packen wir erstmal aus und dann gehen wir Mittag essen. Und danach machen wir eine Kahnpartie.“ Ich wartete ungeduldig, dass meine Eltern mit auspacken fertig wurden. Plötzlich kam ein anderer Vati angelaufen. Lachend sagte er zu meinem Vati, dass es Willem umgehauen habe und wir ihn mit nach Hause nehmen müssten. Willem saß an einem Baum gelehnt im Schatten und schnarchte. Die Vatis hoben Willem in seinen Bollerwagen und zogen ihn gemeinsam bis zu seinem Haus. Dort stellten sie den Bollerwagen samt Willem in den Schatten und rannten wieder auf die Strasse. Im Hof schimpfte eine Frau ganz fürchterlich. Wir gingen weiter bis zum Urlauberheim. Hinter dem Eingang saß eine dicke, weißgekleidete Frau. Sie begrüßte meinen Vati, den sie auch zu kennen schien, dann meine Mutti und mich. „Also, zwei Erwachsene und ein Kind, macht dann 50 Mark für die zwei Wochen“, sagte sie zu Vati. „Nee, Gerda“, sagte mein Vati, „mach mal drei Erwachsene! Wir müssen den Kleinen doch satt kriegen.“ Da lachte Frau Gerda und sagte zu meinem Vati, dass er wohl zwei Portionen essen wolle. Nachschlag gab es hier nicht. „Nee nee,“ meinte Vati, „das hat schon seine Richtigkeit“. Dann gab sie uns die Essenmarken und Mutti stellte sich an der Essenausgabe an. Vati setzte mich an einen Tisch und ging dann zum Tresen Getränke holen. Endlich kam Mutti mit dem Essen. Es gab für jeden eine große Schüssel Kartoffelsuppe, ein Würstchen und eine dicke Scheibe Brot. Schmeckte das fein. Und die Fassbrause war auch nicht schlecht. Nach dem Essen gingen wir gleich wieder in unser Haus. Ich war auf einmal sehr müde und legte mich freiwillig für ein kleines Mittagsschläfchen hin. Vati und Mutti machten das auch.
Nach dem Kaffeetrinken, für mich gab es Muckefuck und Mutti hatte sogar Kuchen mitgebracht, holte Vati die Ruder und Zwillen aus dem großen Schrank neben der Tür. Dann ging es einen steilen Abhang hinab zum Bootssteg. Vati sagte zu mir: „Pass auf! Wenn du ins stolpern kommst, gullerst du bis in den See.“ Und dann stand ich am Ufer des Sees. Ich kam aus dem Staunen nicht raus. Wie groß der war und mit Wald herum. Nur geraderüber waren ein paar Häuser zu sehen. Vati ging zu einem schmucken Holzboot, steckte die Zwillen ein und legte die Ruder ins Boot. Mutti und ich stiegen ein. Vati schob uns an und sprang ins Boot. Er ruderte am Ufer entlang. Es gab viel zu sehen. Da war auch ein Badestrand. Dort hielten wir an, um ins Wasser zu springen. War das schön. Dann war auch schon Zeit für das Abendbrot und wir fuhren zurück.
Während Mutti die Schnitten machte, versuchte Vati den Fernseher in Gang zu kriegen. Die ganze Zeit meckerte er: „So ein Mist, nur Ostfernsehen. Ich will Sportschau gucken.“ Die anderen Vatis mussten das gleiche Problem haben. Vati besorgte sich ein Stück Draht, machte es an der Antenne vom Fernseher fest und das andere Ende am Gitter vom Heizlüfter. Und siehe da, Westfernsehen und das fünf Minuten vor Beginn der Sportschau. Schnell sprach sich rum, dass wir Westfernsehen hatten und schon kamen die anderen Vatis zu uns. Einige hatten Bier und Schnaps dabei. Die Muttis saßen auf der Veranda und tranken Wein. Ich hatte in der Küche den Teller mit den Schnitten für mich allein. Als ich satt war, guckte ich nach draussen.
Vielleicht waren da ja noch andere Kinder zum spielen da.
Eine Häuserreihe weiter entdeckte ich einen Jungen, der auch schon mit uns im Bus gesessen hatte. Er hieß Detlef und erklärte mir, dass er schon in die 4. Klasse kommt. „Na und,“ sagte ich, „ich komme auch schon in die 2.
Klasse.“ Ich fragte ihn, ob er schon am Bootssteg war und ob wir da mal hingehen wollen. Er schaute mich ganz entsetzt an und sagte, dass er ohne seine Mutti nicht vom Bungalow weg darf und außerdem kommt gleich das Sandmännchen. Danach müsse er ins Bett. Seine Eltern verlassen sich da auf ihn. Ich sagte ihm, dass die alle bei meinen Eltern sind und wir könnten ja da mal los. Er wollte das nicht und außerdem hatte er Angst allein im Wald.
„Da gibt es bestimmt wilde Tiere“, sagte er. Ich meinte, da könne ich ihn beschützen, denn mit Tieren kannte ich mich ja aus. Aber er winkte nur ab, nahm sein “Bummi“- Heft und ging in den Bungalow. So hießen hier die kleinen Häuser. Also ging ich dann eben alleine los. Außer einem Eichhörnchen sah ich keine wilden Tiere. Mir war langweilig und ich trottete nach Hause. Dabei kam mir ein schelmischer Gedanke. Ich fand einen ordentlichen Tannenzweig, so wie ich ihn brauchte. Gerade noch konnte ich sehen, wie Detlef den Fensterladen an seinem Zimmer schloss. Ein Weilchen wartete ich noch. Dann schlich ich mich an sein Fenster und kratze mit dem Zweig an dem Fensterladen. Keine Reaktion. Also jetzt richtig. Noch mal etwas kräftiger kratzen und dabei heulte ich wie ein Wolf. Das hatte ich aus den Indianerfilmen gelernt. Mit einem gellenden MUUUTTI - Schrei rannte Detlef aus dem Bungalow. Jetzt war es Zeit, mich aus dem Staub zu machen. Leider hatte ich vergessen meine Fußspuren zu verwischen, so wie es die Indianer immer machten. So fand mich Detlef's Vati recht schnell. Komisch, er hatte Tränen in den Augen und schimpfte gar nicht. Das sollte mein Vati machen. Auch er hatte Tränen in den Augen, schien aber gar nicht traurig zu sein. Er hielt sich die Hand vor den Mund und sagte kein Wort. Außer einem erhobenen Zeigefinger hat er nichts gemacht. Mir schien, als müsse er sich das Lachen verkneifen. Die anderen Erwachsenen auch. Nur Detlef's Mutti lachte nicht. Sie brachte ihn wieder ins Bett und blieb gleich mit dort. Nun war es auch Zeit für mich schlafen zu gehen. Als ich im Bett lag, hörte ich von der Terrasse Gelächter und Heulen.
Die konnten das nicht so schön wie ich.
Am nächsten Morgen wurde ich durch das Geklapper von Geschirr und Kaffeeduft geweckt. Nach dem Waschen und Anziehen setzte ich mich an den Tisch auf der Terrasse. Draussen essen, so was gab es bei uns zuhause nicht. Bei uns zuhause liefen ja die Hühner im Hof rum. Deshalb bin ich auch immer Sommer nie, oder nur sehr vorsichtig, barfuß im Hof gelaufen.
Die Hühner kackten ja in den Hof. Und wenn man da reintrat, war das eklig.
Meistens hatten wir Sandalen an. Auch wegen den spitzen Steinchen auf den Strassen.
Da die Muttis den restlichen Kuchen gestern Abend aufgegessen hatten, gab es jetzt Brot mit Wurst oder Marmelade und ein Glas mit eingekochten Schinken. So was machte Mutti sonst nur zu besonderen Gelegenheiten auf.
Das schmeckte nämlich ganz, ganz, ganz fein. Ich haute ordentlich rein, denn ich brauchte Kraft. Heute sollte ich rudern. Nachdem Mutti den Abwasch gemacht hatte, liefen wir zum Boot. Vati machte alles fertig und ich nahm stolz auf der Ruderbank platz. Er sagte mir, was ich machen sollte. Die Ruder ins Wasser und kräftig ziehen. Das tat ich. Ging das schwer, aber es ging. Ich war ja stark. Und plötzlich ging das so leicht, dass ich rückwärts von der Ruderbank fiel. Vati und Mutti lachten laut. Vati zeigte mir noch mal wie es richtig geht. Binnen kurzer Zeit konnte ich rudern wie ein Weltmeister. Ich schaffte eine ordentliche Strecke. Dann übernahm Vati das Rudern und Mutti lenkte. Ich ließ von der Spitze des Bootes meine Beine nach aussen baumeln. Es gab wieder viel zu sehen. Da war ein lustiger Vogel, der auf dem Wasser schwamm und uns beobachtete. „Das ist ein Haubentaucher“, sagte Vati. Mal sehen, was es noch so interessantes zu sehen gab. Mir entging nichts. Auch nicht die nackige Frau und der nackige Mann die sich hinter dem Schilf im Gras gabbelten. „Guckst du da nicht hin“, schimpfte Mutti mit mir. „Aber wieso?“, fragte ich. „Wenn Worsti und ich uns raufen sitzt der Sieger doch auch immer auf dem Verlierer.“ Hier hatte die Frau gewonnen.
Nach dem Mittagessen gingen wir zum Strand. Dort war auch Detlef mit seinen Eltern. Er hatte Schwimmflügel an den Armen und einen Schwimmgürtel um. Sah das lustig aus. Aber hatte er mir nicht erzählt, dass er schwimmen konnte und schon die erste Stufe hätte? Ich schnappte mir meinen Ball und stürmte ins Wasser. Das war so schön. Nicht so eisig wie bei uns im Felsenbad zum Schwimmlager. Nach einer Weile ging ich zu Detlef und fragte ihn, ob er mit ins Wasser kommt. Seine Mutter sprach noch einige ermahnende Sätze zu uns. Von wegen tauchen oder Wasser in die Augen kriegen. Da sollte ich auch aufpassen, denn wenn Detlef Wasser in die Augen bekommt, weint er. Und das wollten wir doch nicht. Also passten wir auf, dass Detlefs Kopf nicht nass wurde. Er schwamm mir eine Runde vor. Das sah lustig aus. Den Kopf weit nach oben gereckt, sah er aus wie der Haubentaucher von heute Vormittag. Nur das Detlef nicht abtauchte. Ball spielen im Wasser ging auch nicht. Es hätte ja spritzen können. Das machte Vati mit mir. Es machte mir riesig Spaß nach dem Ball zu hechten. Auch eine Taucherbrille hatten wir mit dabei. Mit der entdeckte ich die Unterwasserwelt. Wie toll das aussah, wie die kleinen Fische schwammen.
Und wie doof die Schwimmbewegungen von Menschen unter Wasser aussahen. Noch doofer als beim Trockenschwimmen. Da entdeckte ich einen Krebs an der Schilfkante. Mit dem wollte ich spielen. Der konnte mir nicht entwischen. Und schwupp hatte ich ihn. Das schien ihm nicht zu gefallen.
Jedenfalls zwickte er mich ganz toll. Ich wollte schreien, nur unter Wasser ging das schlecht. Nach einem kräftigen Schluck vom ollen Seewasser, war der Schmerz fast vergessen. Ich lief schnell zu meiner Mutti. Sie sollte nachschauen, ob der Finger noch dran war. Das ganze Theater bekam auch Detlef mit. Der wollte nun nicht mehr ins Wasser, wegen der bösen Tiere.
Aber ich wollte mich an dem Krebs rächen. Den wollte ich genau so zwicken, wie er mich. Also tauchte ich den ganzen Strand ab. Doch der Feigling war weg. Und Detlef konnte halbwegs beruhigt wieder ins Wasser.
Am nächsten Morgen schwärmten alle zum Einkaufen aus. Da wir etwas spät dran waren, waren alle Fahrräder schon weg. Als Vati vom Brötchen holen aus dem Konsum kam, sagte er: „Es hat keinen Zweck. Wir müssen woanders einkaufen. Da gibt es nichts mehr. Ist ja auch kein Wunder, der Raum ist ja nicht größer als unser Hühnerstall.“ Erstmal wurde mit großem Appetit gefrühstückt. Dabei fasste Vati den Plan, mit dem Boot über den See zu rudern. „Dort gibt es auch einen kleinen Konsum“, sagte er. Gesagt, getan. Auf der anderen Seite des Sees gab es einen großen Bootssteg, wo wir anlegen konnten. Von da aus war es nicht weit bis zum Konsum. Vati blieb als Wache im Boot und rauchte eine. Im Konsum kam Mutti aus dem Staunen nicht raus. Hier gab es ja fast alles. Wir kauften Brot, Brötchen, Butter, Wurst, Käse, Bier und Brause. Mutti nahm die zwei Beutel mit Getränken und ich den Beutel mit dem Essen und so liefen wir zum Boot.
Vati staunte nicht schlecht. „Das dürfen wir keinem erzählen“, sagte er, „sonst ist diese Quelle weg.“ Zuerst ruderten wir zurück und Vati schaffte schnell die Einkäufe ins Bungalow. Derweile passte ich auf unser Boot auf.
Als Vati wieder da war, ruderten wir wieder los. Von unserem See ging es über einen kleinen Kanal unter einer kleinen Brücke hindurch in einen anderen See. Unter der Brücke war das Wasser so flach und klar, dass ich bis zum Grund gucken konnte. Ich sah viele kleine Fische, die sich in dem warmen Wasser scheinbar sehr wohl fühlten. Der andere See war auch sehr groß. Wir ruderten bis in die Mitte und ließen uns eine Weile treiben. Dann ruderten wir wieder zurück, denn es war Zeit zum Mittagessen zu gehen.