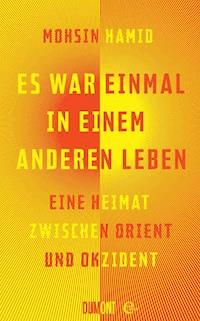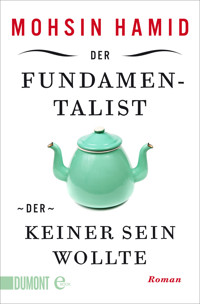8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 7,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: DUMONT Buchverlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
»Absolut unvergesslich« Dave Eggers Eine zeitlose, hinreißende Liebesgeschichte Der Junge weiß genau: Die Liebe stört beim Reichwerden nur. Trotzdem tut er alles, um dem Mädchen zu gefallen. Immer wieder kreuzen sich die Wege, aber das Mädchen verlässt ihn stets auf Neue. Und obwohl der Junge mehr und mehr Geld anhäuft, scheint ihm irgendetwas zu fehlen ... "Ein furioser Roman!" Merten Worthmann, DIE ZEIT "Einer der wunderbarsten Romane aus dem gegenwärtigen Asien (…) einer der besten Roman die ich seit langem gelesen habe.“ Alex Rühle, SÜDDEUTSCHE ZEITUNG "So gnadenlos einfühlsam erzählt, dass es einem das Herz bricht." Hartmut Wilmes, KÖLNISCHE RUNDSCHAU "Das beglückend Irritierende an der Geschichte ist ihre Wärme, ihre Gelassenheit und ihre Würde." Renée Zucker, RBB QUERGELESEN Mohsin Hamids Romane wurden in über 30 Sprachen übersetzt. ›Der Fundamentalist, der keiner sein wollte‹ wurde von Mira Nair verfilmt. Mit ›Der Fundamentalist, der keiner sein wollte‹ und ›Exit West‹ stand Mohsin Hamid auf der Shortlist des Man-Booker-Preises.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 216
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
Der namenlose Held dieser Geschichte kommt in einer riesigen Millionenstadt in Asien zu erstem Geld und baut sich alsbald ein eigenes Imperium auf – mit dem wichtigsten und knappsten Gut, das man sich denken kann: mit Wasser. Sein Herz hat er unterdessen für immer verloren an das hübsche Mädchen, dessen Stern parallel zu seinem aufgeht. Von Zeit zu Zeit kreuzen sich ihre Lebenswege, doch das Schicksal treibt sie immer wieder auseinander.
Tempogeladen, lebhaft und emotional tiefgehend erzählt dieser Roman von zwei unvergesslichen Menschen und von den aufwühlenden gesellschaftlichen Veränderungen in der Jetztzeit. Dabei beruft er sich auf die Art von Selbsthilfebüchern, wie sie im heutigen Asien zu Tausenden von jungen, hoffnungsvollen Männern gelesen werden.
© Jillian Edelstein
Mohsin Hamid, geboren in Lahore, Pakistan, studierte Jura in Harvard und Literatur in Princeton. Heute lebt er mit seiner Familie in Lahore und London. Seine Romane wurden in über 30Sprachen übersetzt. ›Der Fundamentalist, der keiner sein wollte‹ (2007) wurde von Mira Nair verfilmt. Bei DuMont erschienen zuletzt die Romane ›So wirst du stinkreich im boomenden Asien‹ (2013) und ›Exit West‹ (2017) sowie der Essayband ›Es war einmal in einem anderen Leben‹ (2016). Mit ›Der Fundamentalist, der keiner sein wollte‹ und ›Exit West‹ stand Mohsin Hamid auf der Shortlist des Man-Booker-Preises.
Mohsin Hamid
SO WIRST DU STINKREICH IM BOOMENDEN ASIEN
Roman
Aus dem Englischen
von Eike Schönfeld
Die Originalausgabe erschien 2013 unter dem Titel
How to Get Filthy Rich in Rising Asia
bei Riverhead Books, New York.
Copyright © 2013 Mohsin Hamid
eBook 2013
© 2013 für die deutsche Ausgabe: DuMont Buchverlag, Köln
Alle Rechte vorbehalten
Aus dem Englischen von Eike Schönfeld
Umschlag: glanegger.com, München
Umschlagabbildungen: Vesna Cvorovic und Feliks Kogan,
beide ©Shutterstock
Satz: Fagott, Ffm
eBook-Konvertierung: CPI – Clausen & Bosse, Leck
ISBN eBook: 978-3-8321-8747-7
www.dumont-buchverlag.de
1
ZIEH IN DIE STADT
Seien wir ehrlich, ein Selbsthilfebuch ist ein Widerspruch in sich, es sei denn, man schreibt selbst eines. Es ist doch so: Du liest ein Selbsthilfebuch, damit jemand, der nicht du ist, dir helfen kann, und dieser Jemand ist der Autor. Das gilt für das gesamte Selbsthilfegenre. Zum Beispiel für Ratgeberbücher. Und für Selbstverbesserungsbücher. Manche könnten sagen, es gilt auch für religiöse Bücher. Andere wiederum könnten sagen, dass man diejenigen, die das sagen, zu Boden drücken, ihnen mit einer Klinge langsam die Kehle aufschlitzen und sie ausbluten lassen sollte. Es ist daher wohl das Klügste, bei dieser Unterkategorie divergierende Ansichten einfach festzuhalten und schnell weiterzumachen.
Nichts vom bisher Gesagten bedeutet, dass Selbsthilfebücher nutzlos sind. Im Gegenteil, sie können wirklich nützlich sein. Allerdings bedeutet es, dass die Vorstellung vom Selbst im Land der Selbsthilfe glitschig ist. Und glitschig kann gut sein. Glitschig kann angenehm sein. Glitschig kann Zugang zu etwas gewähren, was scheuern würde, ginge man trocken hinein.
Dieses Buch ist ein Selbsthilfebuch. Sein Zweck ist, wie im Titel angegeben, dir zu zeigen, wie man stinkreich werden kann im boomenden Asien. Und dafür muss es dich finden, dort, wo du eines kalten, tauigen Morgens fröstelnd unter der Pritsche deiner Mutter auf der gestampften Erde kauerst. Dein Unglück ist das eines Jungen, dem man seine Schokolade weggeworfen hat, dessen Fernbedienungen die Batterien fehlen, dessen Roller kaputt ist, dessen neue Turnschuhe gestohlen worden sind. Das ist umso bemerkenswerter, als du in deinem bisherigen Leben noch nichts davon gesehen hast.
Das Weiß deiner Augen ist gelb, die Folge eines erhöhten Bilirubinspiegels in deinem Blut. Das Virus, das dich befallen hat, heißt Hepatitis E. Sein typischer Übertragungsweg ist fäkal-oral. Lecker. Es tötet nur ungefähr jeden fünfzigsten, daher wirst du wahrscheinlich wieder gesund. Aber im Moment ist dir, als müsstest du sterben.
Deine Mutter hat solche Zustände schon oft erlebt, jedenfalls ähnliche. Daher glaubt sie vielleicht nicht, dass du sterben wirst. Vielleicht glaubt sie es aber doch. Vielleicht befürchtet sie es. Irgendwann stirbt jeder, und wenn eine Mutter wie deine in einem drittgeborenen Kind wie dir den Schmerz sieht, der dich unter ihrer Pritsche wimmern lässt, dann spürt sie vielleicht, dass dein Tod sich um ein paar Jahrzehnte vorschiebt, sein dunkles, staubiges Kopftuch abnimmt und sich mit offenhaariger Vertrautheit und einem lasziven Lächeln in diesem einen Raum mit seinen Lehmwänden einrichtet, den sie mit ihrem gesamten verbliebenen Nachwuchs teilt.
Sie sagt nur: »Verlass uns nicht.«
Dein Vater hat diese Bitte schon früher von ihr gehört. Aber das macht ihn noch nicht vollständig unempfänglich dafür. Er ist ein Mann von einem gewaltigen sexuellen Appetit, und häufig denkt er, wenn er weg ist, an die schweren Brüste und die festen, ausladenden Hüften deiner Mutter, und noch immer drängt es ihn, sich Nacht für Nacht statt nur bei drei, vier Besuchen jährlich in sie hineinzustoßen. Auch gefallen ihm ihr ungewöhnlich derber Humor und manchmal auch ihre Gesellschaft. Und obwohl er ihren Jungen nicht eben häufig Zuneigung erweist, sähe er es doch gern, dass du und deine Geschwister groß werden. Sein Vater hatte beträchtliche Freude am täglichen Wachstum der Früchte auf dem Feld, und darin ähneln sich die beiden Männer, wenigstens insofern, als es analog zur Entwicklung von Kindern ist.
Er sagt: »Ich kann es mir nicht leisten, euch in die Stadt zu holen.«
»Wir könnten bei dir in deiner Unterkunft wohnen.«
»Ich teile mein Zimmer mit dem Fahrer. Er ist ein masturbierender, kettenrauchender, blähender Schwesterficker. In der Unterkunft gibt es keine Familien.«
»Du verdienst jetzt zehntausend. Du bist kein armer Mann.«
»In der Stadt ist man mit zehntausend ein armer Mann.«
Er steht auf und geht hinaus. Dein Blick folgt ihm, seine Ledersandalen sind hinten offen, die Riemen schlackern herum, seine spröden Fersen voller Schwielen, hart, gleich Krustentieren. Er tritt durch die Tür auf den offenen Hof, der das Zentrum des Compounds deiner Großfamilie bildet. Unwahrscheinlich, dass er dort in Betrachtung des einen schattenspendenden Baums verharrt, der im Sommer labend, aber jetzt, im Frühjahr, noch hart und kümmerlich ist. Möglich, dass er den Compound verlässt und sich zu der Böschung begibt, hinter der er gern seine Notdurft verrichtet, sich hinhockt und kräftig drückt, um den Inhalt seines Darms hinauszupressen. Vielleicht ist er allein, vielleicht aber auch nicht.
Bei der Böschung verläuft eine markante Senke, so tief wie ein Mann hoch, und am Grund dieser Senke fließt ein dünnes Rinnsal. Zu dieser Jahreszeit passen die beiden nicht zusammen, der ausgemergelte Insasse eines Konzentrationslagers im Kittel eines übergewichtigen Konditors. Nur kurz, während des Monsuns, füllt sich die Senke fast bis zum Rand, und selbst dieses Ereignis tritt jetzt weniger regelmäßig auf als in der Vergangenheit, da es von der zunehmend launischen atmosphärischen Zirkulation abhängt.
Die Leute deines Dorfs erleichtern sich etwas weiter flussabwärts von der Stelle, wo sie ihre Kleider waschen, die wiederum flussabwärts von der Stelle liegt, wo sie trinken. Die Dörfer vor dem deinen, weiter flussaufwärts, machen es genauso. Noch weiter aufwärts, wo das Wasser als ein zuweilen sprudelnder Bach aus den Hügeln tritt, wird es teils für die industriellen Verfahren einer alten, rostigen Textilfabrik mit geringer Kapazität verwendet, teils wird das dabei entstehende graue, wie Fürze riechende Abwasser darin eingeleitet.
Dein Vater ist Koch, doch obwohl er sich auf seine Arbeit einigermaßen versteht und vom Lande kommt, ist er nicht eben besessen von der Frische oder Qualität seiner Zutaten. Für ihn ist Kochen ein Handwerk mit Gewürzen und Öl. Seine Speisen verbrennen die Zunge und verstopfen die Arterien. Wenn er hier um sich blickt, sieht er keine stacheligen Blätter, keine behaarten kleinen Beeren für einen spritzigen Salat, keine goldbraunen Weizenähren, steingemahlen, für einen himmlischen Ballon auf der Herdplatte gebackenen Fladenbrotes. Stattdessen sieht er Zeiteinheiten erschöpfender Plackerei. Er sieht Stunden, Tage, Wochen, Jahre. Er sieht die harte Arbeit, mit der ein Bauer seine zugewiesene Zeit in dieser Welt gegen eine andere zugewiesene Zeit in dieser Welt eintauscht. Hier in dem berauschenden Bukett der Speisekammer der Natur riecht dein Vater nur Sterblichkeit.
Die meisten Männer aus dem Dorf, die jetzt in der Stadt arbeiten, kehren zur Weizenernte zurück. Aber dafür ist es noch zu früh im Jahr. Dein Vater ist auf Urlaub hier. Gleichwohl wird er wahrscheinlich seine Brüder begleiten und den Vormittag damit verbringen, Gras und Klee für Futter zu schneiden. Wieder wird er sich hinhocken, diesmal aber mit der Sichel in der Hand, und seine Bewegungen des Packen-Schneiden-Loslassen-Weitertapsen werden sich endlos wiederholen, so wie auch die Sonne ihre ansteigende Bahn am Himmel zieht.
Neben ihm läuft ein schmaler Weg durch die Felder. Sollten der Grundbesitzer oder seine Söhne in ihrem SUV vorbeifahren, legen dein Vater und seine Brüder die Hand an die Stirn, verbeugen sich tief und wenden den Blick ab. Seit Jahrhunderten, vielleicht seit Anbeginn der Geschichte, ist es in dieser Gegend eine riskante Angelegenheit, dem Blick eines Grundbesitzers zu begegnen. In jüngster Zeit haben einige Männer allerdings damit begonnen. Aber sie tragen einen Bart und verdienen sich ihren Unterhalt in den Betschulen. Sie gehen aufrecht, Brust raus. Dein Vater gehört nicht dazu. Er mag sie sogar fast so wenig wie die Grundbesitzer, und aus denselben Gründen. Er findet sie herrisch und faul.
Wie du so auf der Seite liegst, ein Ohr auf der gestampften Erde, siehst du aus deiner Perspektive eines hochgereckten Wurms, wie deine Mutter deinem Vater auf den Hof folgt. Sie füttert die Wasserbüffelkuh, die dort angebunden ist, wirft am Vortag geschnittenes Futter, vermischt mit Stroh, in einen Holztrog und melkt das Tier, während es frisst. Strahlen klatschen hart in einen Blecheimer. Als sie damit fertig ist, führen die Kinder des Compounds, deine Geschwister und Cousins und Cousinen, die Büffelkuh, ihr Kalb und die Ziegen hinaus auf Futtersuche. Du hörst das Zischen der geschälten Zweige in ihren Händen, dann sind sie weg.
Als Nächstes verlassen deine Tanten den Compound, sie tragen Tonkrüge auf dem Kopf, um Wasser zu holen, auch Kleider und Seife zum Waschen. Das sind gemeinschaftliche Aufgaben. Die Verantwortung deiner Mutter dagegen ist einsam. Sie allein, die anderen zusammen. Das ist kein Zufall. Sie hockt sich genauso hin, wie dein Vater es wahrscheinlich tut, statt einer Sichel einen stiellosen Besen in der Hand, und ihr Fegen-Fegen-Tapsen kommt seinen Bewegungen nahe. Hocken spart Energie, ist besser für den Rücken und daher ergonomisch, und es verursacht keine Schmerzen. Aber nach Stunden, Tagen, Wochen, Jahren des Hockens hallen dessen leichte Beschwerden durch den Kopf wie gedämpfte Schreie aus einer unterirdischen Folterkammer. Sie lassen sich endlos aushalten, vorausgesetzt, man gesteht sie sich nicht ein.
Deine Mutter fegt unter den Blicken ihrer Schwiegermutter den Hof. Die alte Frau sitzt im Schatten, das Tuchende in ihrem Mund soll nicht ihre Attribute der Verführung, sondern eher ihre ausgefallenen Zähne verbergen, und sie betrachtet sie mit unstillbarer Missbilligung. Deine Mutter gilt im Compound als eitel, arrogant und dickköpfig, und diese Vorwürfe treffen, denn sie sind alle wahr. Deine Großmutter sagt deiner Mutter, sie habe ein Fleckchen übersehen. Da sie zahnlos ist und das Tuch zwischen den Lippen hält, klingen ihre Worte, als spuckte sie.
Deine Mutter und Großmutter spielen Warten. Die ältere Frau wartet darauf, dass die jüngere altert, die jüngere Frau wartet darauf, dass die ältere stirbt. Zwangsläufig werden beide dieses Spiel gewinnen. Bis es so weit ist, demonstriert deine Großmutter ihre Autorität, wann immer sie kann, und deine Mutter ihre Körperkraft. Die anderen Frauen im Compound hätten Angst vor deiner Mutter, gäben ihnen nicht die anwesenden Männer Sicherheit. In einer rein weiblichen Gesellschaft würde deine Mutter wahrscheinlich einmal Königin werden, einen blutigen Stock in der Hand und zerschmetterte Schädel zu ihren Füßen. Hier aber liegt ihr größter Erfolg darin, von schweren Provokationen weitgehend verschont zu bleiben. So abgeschnitten wie sie ist von ihrem eigenen Dorf, ist das kein kleiner Sieg.
Ungesagt bleibt zwischen deiner Mutter und deinem Vater, dass er es sich bei zehntausend im Monat gerade so eben leisten könnte, deine Mutter und euch Kinder in die Stadt zu holen. Es wäre knapp, aber nicht unmöglich. Im Augenblick kann er den Großteil seines Lohns ins Dorf schicken, wo er zwischen deiner Mutter und dem übrigen Clan aufgeteilt wird. Sollte sie mit euch Kindern zu ihm ziehen, würde der Geldstrom dorthin nur noch tröpfeln und wie das Wasser in der Senke nur in den beiden Festmonaten anschwellen, in denen er vielleicht einen Bonus erwarten könnte und hoffentlich keine Schulden abzahlen müsste.
Du siehst deiner Mutter zu, wie sie einen langen weißen Rettich zerschneidet und über einem offenen Feuer kocht. Die Sonne hat den Tau vertrieben, und selbst dir, so schlecht es dir geht, ist nicht mehr kalt. Dennoch fühlst du dich schwach, und dein Bauch tut so weh, als würde ein Parasit dich von innen auffressen. Daher sträubst du dich nicht, als deine Mutter deinen Kopf vom Boden hebt und dir das Elixier in den Mund schöpft. Es schmeckt wie ein Rülpser, wie die Gase aus einem Männerbauch. Dir steigt die Galle hoch. Aber in dir ist ja nichts, was du erbrechen könntest, und so trinkst du es ohne Zwischenfall.
Wie du danach reglos daliegst, ein kleiner, gelbsüchtiger Dorfjunge, und dir Rettichsaft aus den Mundwinkeln rinnt und ein matschiges Fleckchen auf der Erde bildet, muss es den Anschein haben, dass stinkreich zu werden für dich unerreichbar ist. Aber hab Vertrauen. Du bist nicht so machtlos, wie du wirkst. Deine Zeit kommt noch. Jawohl, dieses Buch wird dir eine Wahl bieten.
Ein paar Stunden später kommt die Zeit der Entscheidung. Die Sonne ist untergegangen, und deine Mutter hat dich auf die Pritsche verlagert, wo du in eine Decke gewickelt liegst, obwohl der Abend warm ist. Die Männer sind von den Feldern heimgekehrt, und die ganze Familie hat, mit deiner Ausnahme, gemeinsam im Hof gegessen. Durch die Tür hörst du das Gurgeln einer Wasserpfeife und siehst, als einer deiner Onkel inhaliert, den Schein der Glut.
Deine Eltern stehen vor dir und blicken herab. Morgen wird dein Vater in die Stadt zurückkehren. Er überlegt.
»Wirst du wieder gesund?«, fragt er dich.
Es ist das Erste, was er dich bei diesem Besuch gefragt, vielleicht der erste Satz, den er seit Monaten an dich direkt gerichtet hat. Du hast Schmerzen und Angst. Daher ist die naheliegende Antwort Nein.
Dennoch sagst du: »Ja.«
Und nimmst dein Schicksal in die Hand.
Dein Vater nimmt dein Krächzen auf und nickt. Er sagt zu deiner Mutter: »Ein kräftiges Kind. Der da.«
Sie sagt: »Er ist sehr kräftig.«
Du wirst nie erfahren, ob deine Antwort die deines Vaters geändert hat. Aber in jener Nacht sagt er deiner Mutter, dass er sich entschlossen hat, sie und euch Kinder zu sich in die Stadt zu holen.
Sie besiegeln den Beschluss mit Sex. Im Dorf ist Verkehr nur dann eine private Handlung, wenn er auf dem Feld stattfindet. Im Haus hat kein Paar einen Raum für sich allein. Deine Eltern teilen sich den ihren mit allen dreien ihrer verbliebenen Kinder. Aber es ist dunkel, daher ist wenig zu sehen. Außerdem bleiben deine Mutter und dein Vater nahezu vollständig bekleidet. Sie haben sich zum Kopulieren in ihrem ganzen Leben noch kein einziges Mal ausgezogen.
Kniend löst dein Vater die Kordel seiner weiten Hose. Den Bauch auf dem Boden, dreht deine Mutter das Becken und tut es ihm nach. Sie langt nach hinten und zieht ihn mit der Hand zu sich, eine feste, direkte Bewegung, dem Melkgriff bei der Wasserbüffelkuh am Vormittag nicht unähnlich, aber er ist schon bereit. Sie erhebt sich auf alle viere. Er dringt in sie ein, stützt sich dabei mit einer Hand ab und legt ihr die andere auf die Brust, um sie zu streicheln, aber abwechselnd auch als Halt, wenn er sich nach vorn zieht. Sie befleißigen sich eines gewissen Maßes von Geräuschunterdrückung, dennoch sind muskuläres Ächzen, prallendes Fleisch, traumatisierte Atmung und hydraulisches Saugen weiterhin hörbar. Ihr schlaft, du und deine Geschwister, oder ihr tut zumindest so, bis sie fertig sind. Dann legen sie sich erschöpft zu dir auf die Pritsche deiner Mutter und sind binnen Sekunden in ihren Träumen versunken. Deine Mutter schnarcht.
Einen Monat später geht es dir schon so gut, dass du mit deinem Bruder und deiner Schwester auf dem Dach des überladenen Busses fahren kannst, der deine Familie und weitere sechzig beengte Personen in die Stadt bringt. Sollte er auf seiner rasenden Fahrt umkippen in seinem irrwitzigen Wettrennen mit anderen, ebenso überfüllten Rivalen, die alle die nächsten und wieder nächsten Gruppen voraussichtlicher Fahrgäste aufnehmen wollen, sind Tod oder mindestens Verstümmelung extrem wahrscheinlich. Solche Dinge geschehen häufig, wenngleich nicht annähernd so häufig, wie sie nicht geschehen. Aber heute ist dein Glückstag.
Du hältst dich an Stricken fest, mit denen Gepäck überwiegend erfolgreich am Fahrzeug festgebunden ist, und erlebst einen Zeitenlauf, der seinem chronologischen Pendant vorauseilt. So wie auf dem Weg ins Gebirge ein kurzer Höhenwechsel einen aus dem subtropischen Dschungel in die halbarktische Tundra schleudern kann, so können auch ein paar Stunden Busfahrt von ländlicher Abgeschiedenheit in städtische Zentralität scheinbar Jahrtausende überspannen.
Auf deinem tintigen Qualm speienden, nach Steuerbord krängenden Gefährt beobachtest du die Veränderungen voller Ehrfurcht. Unbefestigte Straßen weichen befestigten, Schlaglöcher werden seltener und verschwinden bald fast ganz, und der Kamikazeschwall des entgegenkommenden Verkehrs wird ersetzt durch den erzwungenen Frieden der vierspurigen Schnellstraße. Die Elektrizität zeigt sich erst im Vorbeifahren, als ihr unter einer stählernen Parade von Starkstromriesen hindurchhuscht, später in Form von Kabeln, die auf Busdachhöhe zu beiden Seiten der Straße verlaufen, und schließlich als Straßenlampen, Neonschilder und grandiose, prachtvolle Reklametafeln. Die Gebäude sind aus Lehm, dann aus Backstein, dann aus Beton und schießen zu unvorstellbaren vier, dann gar fünf Stockwerken auf.
Bei jedem weiteren Wunder glaubst du, ihr seid jetzt angekommen, dass zu eurem Zielort doch bestimmt nichts mehr als das gehören kann, und jedes Mal bist du widerlegt, bis du das Denken einstellst und dich einfach den Schichten aus Wundern und Visionen ergibst, die dich überspülen wie die Regenwände, die im Monsun schier endlos aufeinanderfolgen, endlos natürlich nur, bis sie enden, ohne Vorwarnung, und dann hält der Bus zitternd an, und ihr seid unwiderruflich da.
Indem du und deine Eltern und Geschwister heruntersteigt, verkörpert ihr eine der großen Veränderungen eurer Zeit. War euer Clan einst zahllos, nicht unendlich, aber von einer großen Zahl, die man nicht ohne weiteres kannte, seid ihr jetzt zu fünft. Die Finger an einer Hand, die Zehen an einem Fuß, ein winziger Zusammenschluss, verglichen mit Fisch- oder Vogelschwärmen oder eben Menschenstämmen. In der Geschichte der Evolution der Familie stellt ihr und die Millionen anderer Migranten wie ihr eine beständige Ausbreitung des Nuklearen dar. Es ist eine explosive Umwandlung, in der die stützenden, erstickenden, stabilisierenden Bindungen ausgedehnter Beziehungen schwächer werden, sich auflösen und Unsicherheit, Furcht, Produktivität und Potenzial hinterlassen.
Der Umzug in die Stadt ist der erste Schritt, um stinkreich zu werden im boomenden Asien. Und du hast ihn getan. Herzlichen Glückwunsch. Deine Schwester schaut dich an. Ihre linke Hand stabilisiert das riesige Bündel mit Kleidern und Besitztümern, das sie auf dem Kopf balanciert. Ihre rechte umfasst den Griff eines rissigen, zerbeulten Koffers, der von seinem ursprünglichen Besitzer wahrscheinlich um die Zeit der Geburt eures Vaters weggeworfen wurde. Sie lächelt, und du erwiderst das Lächeln, eure Gesichter kleine Ovale des Vertrauten in einer ansonsten unkenntlichen Welt. Du glaubst, deine Schwester versuche, dich zu beruhigen. Es kommt dir nicht in den Sinn, jung wie du bist, dass sie diejenige ist, die Beruhigung braucht, dass ihr Blick dich nicht sucht, um dich zu trösten, sondern vielmehr wegen des Trostes, den du, ihr einziger, erst vor kurzem wiedergenesener kleiner Bruder, ihr in diesem Augenblick zerbrechlicher Verletzlichkeit zu spenden vermagst.
2
VERSCHAFF DIR BILDUNG
Es ist beachtlich, wie viele Bücher in die Kategorie Selbsthilfe fallen. Warum liest du beispielsweise diesen hochgelobten, atemberaubend langweiligen ausländischen Roman weiter, kämpfst dich von Seite zu Seite zu Bitte-aufhören-Seite teerträger Prosa und formaler Überspanntheiten, die einem die Röte ins Gesicht treiben, wenn nicht aus dem Drang, ferne Länder zu verstehen, die wegen der Globalisierung das Leben in dem deinen zunehmend beeinflussen? Was ist dieser dein Drang im Kern, wenn nicht ein Wunsch nach Selbsthilfe?
Und was ist mit den anderen Romanen, denen, die du wegen der Handlung, ihrer Weisheit oder häufigem, überflüssigem und drastischem Sex richtig gut findest und mit freudigem Verlangen liest? Auch das sind doch Versionen von Selbsthilfe. Zumindest helfen sie dir, dir die Zeit zu vertreiben, und Zeit ist ja der Stoff, aus dem das Selbst besteht. Dasselbe gilt für erzählende Sachbücher und erst recht für Fachbücher.
Ja, von jedem Buch, jedem einzelnen, das je geschrieben wurde, ließe sich sagen, dass es dem Leser als eine Form von Selbsthilfe angeboten wird. Lehrbücher, diese Huren, gehören natürlich zu denen, die sich am deutlichsten dazu bekennen, und mit einem Lehrbuch gehst du auch jetzt im Moment, nach mehreren Jahren in der Stadt, die Straße entlang.
Deine Stadt ist nicht als einzelliger Organismus angelegt, mit einem reichen Kern, der von einem Morast aus Slums umgeben ist. Es fehlt ihr an genügend Massenverkehrsmitteln, um all ihre Arbeiter zweimal täglich so zu befördern, wie es eigentlich nötig wäre. Auch fehlt es ihr seit dem Ende der Kolonialisierung vor Generationen an einer Regierungsform, die mächtig genug wäre, um Einzelpersonen in genügender Zahl zu enteignen. Folglich leben die Armen nahe den Reichen. Reiche Viertel sind oftmals nur durch einen einzigen Boulevard von Fabriken, Märkten und Friedhöfen getrennt, die ihrerseits von den Unterkünften der Verarmten vielleicht nur durch einen offenen Abwasserkanal, ein Bahngleis oder eine schmale Gasse geschieden sind. Dein eigenes dreieckiges Quartier ist, nicht untypisch, von allen dreien umgrenzt.
An deinem Zielort angekommen, siehst du ein weiß getünchtes Gebäude mit einer Tafel, die dessen Namen und Funktion verkündet. Es ist deine Schule, und sie ist eingekeilt zwischen einer Bude, wo Reifen repariert werden, und einem Eckkiosk, der den Großteil seiner Einkünfte aus dem Verkauf von Zigaretten bezieht. Bis zum Alter von etwa zwölf Jahren, wenn die Opportunitätskosten der Lohnausfälle bedeutsam werden, gehen die meisten Kinder in deiner Gegend tatsächlich zur Schule. Die meisten, keineswegs alle. Ein Junge deiner Größe arbeitet ohne Hemd in der Reifenreparaturbude. Er mustert dich jetzt, als du vorbeigehst.
In deiner Klasse sind fünfzig Schüler und Hocker für dreißig. Die anderen sitzen auf dem Boden oder stehen. Ihr werdet von einem einzigen hohlwangigen, Betelsaft spuckenden, womöglich tuberkulösen Lehrer unterrichtet. Heute nimmt er mit euch die Multiplikationstabellen durch. Das tut er in einem wirren Singsang, denn sein bevorzugtes, ja einziges pädagogisches Mittel ist erzwungenes Auswendiglernen. Teile seiner Gedanken, die für die Beherrschung von Gewebe und Knochen seines Stimmapparats nicht zuständig sind, schweifen weit in die Ferne.
Euer Lehrer leiert: »Zehn mal zehn, hundert.«
Die Klasse leiert es nach.
Euer Lehrer leiert: »Elf mal elf, hunderteinundzwanzig.«
Die Klasse leiert es nach.
Euer Lehrer leiert: »Zwölf mal zwölf, hundertvierunddreißig.«
Eine tollkühne Stimme unterbricht ihn. Sie sagt: »Vierundvierzig.«
Jähes Schweigen. Die Stimme ist deine. Du hast ohne nachzudenken gesprochen oder mindestens, ohne genügend vorauszudenken.
Euer Lehrer sagt: »Was hast du gesagt?«
Du zögerst. Doch es ist passiert. Es gibt kein Zurück mehr.
»Vierundvierzig.«
Die Stimme eures Lehrers ist drohend leise: »Warum hast du das gesagt?«
»Zwölf mal zwölf ist hundertvierundvierzig.«
»Hältst du mich für einen Idioten?«
»Nein, Sir. Ich dachte, Sie hätten hundertvierunddreißig gesagt. Ich habe einen Fehler gemacht. Sie haben hundertvierundvierzig gesagt. Es tut mir leid, Sir.«
Die ganze Klasse weiß, dass der Lehrer nicht hundertvierundvierzig gesagt hat. Vielleicht auch nicht die ganze Klasse. Ein Großteil der Klasse hat gar nicht aufgepasst, sondern von Drachen oder Sturmgewehren geträumt oder Nasenschleim zwischen Daumen und Zeigefinger zu Kügelchen gerollt. Aber ein paar wissen es. Und alle wissen, was nun passiert, wenn auch nicht, welche Form es genau annimmt. Sie schauen jetzt mit fasziniertem Entsetzen zu, ganz wie Seehunde auf einem Fels, wenn ein Weißer Hai nur ein kleines Stück entfernt hinter einem der ihren auftaucht.
Die meisten von euch sind schon einmal von eurem Lehrer bestraft worden. Du als einer der klügsten Schüler der Klasse hast einige der härtesten Strafen bezogen. Du versuchst, dein Wissen zu verbergen, aber immer wieder obsiegt deine Tollkühnheit und kommt zum Vorschein, so wie eben, und dann ist alles zu spät. Heute greift euer Lehrer in die Tasche seines Kittels, wo er etwas groben Sand aufbewahrt, dann packt er dich am Ohr, wobei der Sand an seinen Fingerspitzen zusätzlich zu dem enormen Druck, den er ausübt, noch Schürfungen hinzufügt, sodass dein Ohrläppchen nicht nur gequetscht, sondern auch wund und ein wenig blutig gerieben wird. Du schreist nicht auf, verweigerst deinem Folterer diese Befriedigung und stellst damit sicher, dass die Bestrafung, die du erhalten hast, ausgeweitet wird.
Dein Lehrer wollte gar nicht Lehrer werden. Er wollte beim Elektrizitätswerk die Zähler ablesen. Zählerableser müssen sich nicht mit Kindern herumschlagen, arbeiten vergleichsweise wenig, noch wichtiger aber, ihr Korruptionspotenzial ist größer, weswegen sie wohlhabender sind und in der Gesellschaft größeres Ansehen genießen. Zählerableser zu werden war für deinen Lehrer auch gar nicht unerreichbar. Sein Onkel arbeitete im Elektrizitätswerk. Doch die eine Stelle als Zählerableser, die dieser Onkel vermitteln konnte, ging, wie bei den erstrebenswertesten Dingen im Leben unweigerlich der Fall, an den älteren Bruder deines Lehrers.
Daher konnte sich dein Lehrer, der im Abschlussexamen der weiterführenden Schule nur knapp gescheitert war, aber das Ergebnis hatte fälschen lassen können, mit seinem falschen Ergebnis, einer Bestechungssumme, die sechzig Prozent eines voraussichtlichen Jahresgehalts entsprach, sowie einer guten, wenngleich untergeordneten Verbindung in der Bildungsbürokratie in Gestalt eines Cousins nur die Stelle sichern, die er gegenwärtig innehat. Unterrichten ist nicht gerade sein Lebensinhalt. Es beschämt ihn. Gleichwohl lebt er stets in der kleinen, aber durchaus existenten Furcht, irgendwie überführt zu werden und die Stelle zu verlieren, oder, wenn schon nicht die Stelle zu verlieren, so doch in eine Lage zu geraten, in der er gezwungen ist, eine weitere und noch höhere Bestechungssumme zu bezahlen, um sie zu behalten, und diese Furcht, verstärkt noch durch seine anhaltende Enttäuschung und seine nicht unbegründete Überzeugung, dass die Welt zutiefst ungerecht ist, manifestiert sich in der regelmäßigen Dosis Gewalt, die er den ihm Anvertrauten zukommen lässt. Mit jedem Schlag, so sagt er sich, trägt er dazu bei, dass die Bildung in einen weiteren Dickschädel eindringt.
Eindringen und Bildung, beides ist im Leben vieler um dich herum verwoben. Beispielsweise in dem deiner Schwester. Sie heult, als du nach Hause kommst. In letzter Zeit wechselt sie mit bestürzender Häufigkeit zwischen unterdrückten, aber kugelförmigen Tränen und ruhiger, blasierter Überheblichkeit. Gerade ist Ersteres der Fall.
Du sagst: »Schon wieder?«