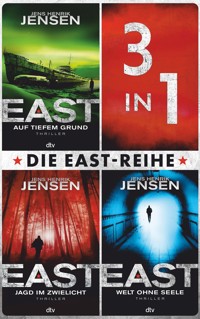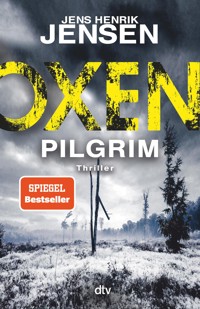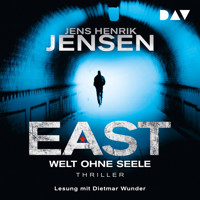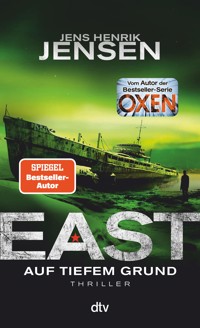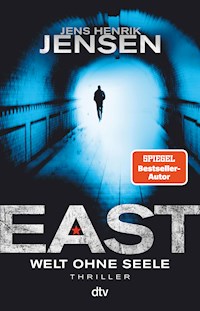9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dtv
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Nina-Portland-Trilogie
- Sprache: Deutsch
Wird Nina Portland siegen oder untergehen? Keine Angst vor Gegenwind: Kapitänstochter Nina Portland in ihrem gefährlichsten Fall Der letzte Teil der SØG-Reihe Bei schwerem Unwetter verunglückt eine Propellermaschine über der dänischen Westküste. Widerwillig übernimmt Nina Portland die Untersuchung der Unfallumstände. Warum lässt man sie nicht in dem Bandenkrieg ermitteln, der Esbjerg erschüttert? Sie ahnt nicht, dass die Maschine der CIA nur als Privatflugzeug getarnt war. An Bord war ein politischer Gefangener, der nun verschwunden ist. Und dann beginnt das Morden … Die Welt, in die Nina Portland in ihrem letzten Fall eintaucht, ist düster, undurchsichtig. Wird es ihr gelingen zu verteidigen, woran sie glaubt und was sie liebt? Für Leser:innen von Jussi Adler-Olsen, Stieg Larsson und Fans von skandinavischen Krimis und Thrillern. Alle Bände der SØG-Reihe: Band 1: Dunkel liegt die See Band 2: Schwarzer Himmel Band 3: Land ohne Sicht Von Jens Henrik Jensen sind bei dtv außerdem die skandinavischen Thriller-Serien OXEN und EAST erschienen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 736
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Über das Buch
Nach einem langen heißen Sommer suchen Herbstunwetter die dänische Küste heim. Seit Nina die polizeiinterne Fortbildung aus politischer Überzeugung geschmissen hat, darf sie keine wichtigen Ermittlungen mehr leiten: Wellen schlagen nur die Fälle der Kollegen. Traut ihr Chef Birkedal Nina nichts mehr zu? Während in der Stadt ein brutaler Bandenkrieg entbrennt, wird sie gegen ihren Willen zu einer Routineuntersuchung außerhalb entsandt. In Strandnähe ist ein Privatjet verunglückt. Obwohl alles nach einem tragischen Unfall aussieht, lässt Nina der Anblick des Wracks nicht los. Hier muss etwas Anderes, Größeres geschehen sein. Ihre Ermittlungen führen sie in eine düstere und undurchsichtige Welt. Es ist die Kehrseite der Zivilgesellschaft – wo Menschen keine Namen haben, Tod und Folter nur Teile eines Plans sind.
Von Jens Henrik Jensen sind bei dtv außerdem erschienen:
OXEN – Das erste Opfer
OXEN – Der dunkle Mann
OXEN – Gefrorene Flammen
OXEN – Lupus
OXEN – Noctis
OXEN – Pilgrim
SØG – Dunkel liegt die See
SØG – Schwarzer Himmel
SØG – Land ohne Licht
EAST – Welt ohne Seele
EAST – Auf tiefem Grund
Jens Henrik Jensen
SØG
Land ohne Licht
Thriller
Aus dem Dänischen von Justus Carl
Danke, Mai
1
Die letzte Phase der Transformation war die Dusche.
Nachdem er sich exakt acht Minuten lang sorgfältig gewaschen und abgeduscht hatte, drehte er den einen Hahn nach rechts und den anderen nach links. Die Reaktion folgte unmittelbar. Er keuchte auf, als das kalte Wasser auf seinen Körper traf und eine Schockwelle von seinem jetzt glattrasierten Scheitel über den Rücken bis in Schenkel und Beine jagte. Ein Blick auf die Armbanduhr. Drei Minuten und dreißig Sekunden würde er so stehen bleiben.
Die Kälte kannte keine Gnade, doch in diesem Moment beachtete er sie nicht. Sie war lediglich ein Werkzeug, mit dem er sämtliche Zellen seines Körpers weckte, um seine Sinne zu schärfen und sich bereit zu machen.
Die zweihundertzehn Sekunden unter dem eiskalten Strahl vollbrachten die Verwandlung.
Er schaute erneut auf die Uhr, drehte den Wasserhahn zu, trat aus der Dusche im Schlafzimmer und trocknete sich ab. Nackt ging er die wenigen Schritte zur Toilette und wieder zurück. Allein durch die Art, wie sich die Luft um seinen Körper schmiegte, spürte er sie – die Transformation.
Er stellte sich vor den Spiegel und begutachtete das Resultat. Am meisten stach natürlich sein blank rasierter Schädel ins Auge. Er fühlte nach.
Weiche, glatte Haut, wo vorher dichtes Haar gewesen war. Einen Bürstenschnitt hatte er schon einmal getragen, eine Glatze hingegen noch nie. Seine Hände glitten über die haarlose Brust, weiter über die rasierten Pobacken, Schenkel und Schienbeine und zurück zum Schritt. Alles fühlte sich so sonderbar entblößt an.
Eigenartig … So sah er wohl aus, aber er wusste sehr genau, was er tat. Er war einfach äußerst vorsichtig.
DNA-Spuren waren unsichtbar – und logen nie. Davon hatte er gelesen und viele Sendungen darüber gesehen, vor allem auf seinem Lieblingskanal, National Geographic. Es gab unzählige True-Crime-Formate über leichtsinnige Idioten, denen DNA-Spuren zum Verhängnis wurden, selbst noch Jahre nach dem eigentlichen Verbrechen.
Von ihm würde niemand auch nur die geringste Spur finden. Abgesehen davon war die Mission, die er an diesem Abend durchführen würde, kein Verbrechen. Sie war eine gute Tat. Im Grunde half er, die Welt zu einem besseren Ort zu machen. Aber so würde die Gesellschaft die Sache nicht bewerten. Deshalb traf er seine Vorkehrungen.
Die digitalen Ziffern seiner Armbanduhr zeigten 21:17 Uhr an. Um 22:00 Uhr würde die Mission beginnen. Genau in dem Moment, in dem er sich im Hinterhof aufs Rad schwang.
Auf dem Bett vor ihm lag die Ausrüstung, ordentlich in Reihen sortiert. Die erste Reihe bestand aus der Bekleidung: Socken, Unterhose, ein enganliegendes Set aus langer Unterhose und Langarmshirt aus Nylonmaterial, ein T-Shirt, Regenjacke und Regenhose, alles komplett in Schwarz. Dazu eine ebenfalls schwarze Sturmhaube, ein Modell mit besonders schmalen Sehschlitzen.
Die gesamte Ausrüstung hatte er in Hamburg gekauft, und noch immer war jedes Teil in eine Plastikverpackung eingeschweißt. Er würde die Kleider später in einem leeren Kellerraum anziehen, wo keine Gefahr bestand, dass Haare und anderes DNA-Material aufgewirbelt wurden und sich an der Ausrüstung festsetzten.
In der zweiten Ausrüstungsreihe lagen ein Paar dünne schwarze Lederhandschuhe, ein Paar billiger Stoffschuhe mit glatter Sohle, die man wohl Chinaschuhe nannte, sowie die beiden selbstgenähten schwarzen Schnürbeutel, ebenfalls aus dünnem Leder. Diese Beutel wollte er über die Schuhe ziehen, sobald er vor Ort war, um zu verhindern, dass er den Polizeitechnikern auch nur den Hauch eines brauchbaren Fußabdrucks hinterließ.
In der dritten Reihe hatte er die Hardware bereitgelegt, sie bestand aus nur drei Dingen: einer gebrauchten Walther P1 mit vollem Magazin und dazugehörigem Schalldämpfer. Dieses Modell wurde früher bei der westdeutschen Polizei und der deutschen Bundeswehr eingesetzt und war vor einigen Jahren bei einem Besuch in einem der eher zwielichtigen Stadtteile Berlins in seinen Besitz gelangt.
Selbstverständlich hatte er die Waffenkomponenten gereinigt, desinfiziert und in jeweils eine Plastiktüte gelegt. Ebenfalls in einer Plastiktüte befand sich ein spezieller Schlüssel, den er bei einem Hamburger Schlüsselservice hatte anfertigen lassen, wo man keine Zeit mit überflüssigen Fragen verschwendete.
Es war ein Standardschlüssel der alten Art, der sich spielend einfach hatte kopieren lassen, nachdem die Bezahlung geregelt gewesen war. Als Schablone hatten zwei Abdrücke in Modellierwachs gedient, und eine Woche nach seinem ersten Besuch hatte er den fertigen Schlüssel abgeholt. Mit der Post hätte er ihn sich auf keinen Fall schicken lassen können, denn eine solche Spur hätte ihn direkt mit dem Tatort in Verbindung gebracht.
Er ließ den Blick über die drei Ausrüstungsreihen schweifen. Alles war bereit. Er hatte an jedes Detail gedacht. Nicht einmal während seiner Einkaufstouren in Hamburg war er nachlässig gewesen. Hatte Perücke, Sonnenbrille und Kappe getragen, um sich vor eventuellen Sicherheitskameras in den Geschäften zu schützen. Wie bei dem Schlüssel sollte ihn niemand jemals mit den Einkäufen in Deutschland in Verbindung bringen können. Was ohnehin niemals geschehen würde, denn er hatte vor, die gesamte Ausrüstung nach der Mission zu verbrennen. Aber trotzdem schadete es nicht, sorgfältig zu sein.
Der Schlüssel und die Pistole würden in einem kleinen Moor in einem Waldstück außerhalb der Stadt landen. Auch hier ging er kein Risiko ein. Außerdem besaß er ja noch weitere Waffen.
Wieder sah er auf die Uhr. 21:23 …
In siebenunddreißig Minuten würde er Mission Delete – Part One einleiten.
Unablässig prasselte der Regen nieder, und der Wind vom Meer blies so kräftig, dass er die Blätter von den Bäumen riss. Sie wirbelten durch die Luft, ehe sie auf den nassen Straßen und Gehwegen kleben blieben.
Es war längst dunkel geworden. Das Wetter war sein Verbündeter. Wäre es besser gewesen, hätte er mit der Mission bis zum nächsten Mittwoch gewartet. Jetzt minimierte der schwere Regen das Risiko, unterwegs anderen Menschen zu begegnen.
Seine Recherchen und Aufzeichnungen über das Verhalten des Zielobjekts wiesen ein deutliches Muster auf: Aus einem ihm unbekannten Grund kehrte Objekt A mittwochs ziemlich pünktlich vom Krafttraining zurück, zwischen 21:30 und spätestens 22:00 Uhr. Schon bald würde er wissen, ob das auch an diesem Mittwoch zutraf, denn der schwarze und tiefergelegte BMW mit Heckschürze und getönten Scheiben parkte stets auf dem Stellplatz direkt neben dem Treppenhaus.
Sein Fahrrad stellte er etwa vierhundert Meter von den Wohnblocks entfernt hinter einem Gebüsch ab. Dann streifte er die schwarzen Ledersäckchen über die Schuhe und zog die Kapuze der Regenjacke zu, sodass sie seinen Kopf dicht umschloss.
Er hatte seine Route sorgfältig durch Niemandsland geplant, wo er sich hinter Hecken und Sträuchern ungesehen nähern konnte. Erst kurz vor dem dritten Häuserblock bahnte er sich einen Weg durch den triefnassen Streifen aus Büschen und Geäst und blieb stehen. Mit einem Knopfdruck ließ er die Uhranzeige aufleuchten. 22:23, alles lief nach Plan.
Auf den Parkplätzen zwischen den Blocks war niemand zu sehen. Der schwarze BMW stand glücklicherweise genau dort, wo er sollte. Sein Blick wanderte über die Häuserfronten. Menschen streckten sich auf den Sofas vor den Fernsehgeräten, während Regentropfen die gelb erleuchteten Fenster hinabrannen.
Mit ruhigen Schritten überquerte er einen Rasenstreifen und betrat einen Weg aus Steinplatten. Wachsam blickte er sich um. Noch immer keine Menschenseele zu entdecken. Er nahm einen Lappen aus der Hosentasche und wischte die Ledersäckchen damit sorgfältig ab. Dann ging er auf das zweite Treppenhaus zu, öffnete die Tür und glitt lautlos hinein.
Im Schutz des dunklen Treppenschattens machte er sich bereit. Zog die Handschuhe an, montierte den Schalldämpfer, entsicherte die Waffe und streifte sich die Sturmhaube über. Dann fischte er den kopierten Schlüssel aus der rechten Jackentasche.
Dass er die zeitaufwendige Prozedur einer Schlüsselkopie in Kauf genommen hatte, war seiner extremen Vorsicht geschuldet. Natürlich hätte er es darauf ankommen lassen und einfach an der Tür klopfen können, aber was, wenn Objekt A sich ebenso vorsichtig verhielt wie er und einen Fremden spätabends nicht ohne Weiteres hereinbat?
Ein derart großes Risiko konnte er nicht eingehen. Also hatte er im Fitnessstudio den einfachen Spint, in dem das Zielobjekt während des Trainings Kleider und Wertsachen aufbewahrte, mit einem Dietrich geknackt. Es war ein Montag gewesen, als das Objekt sehr spät trainierte und nur wenige andere Gäste das Studio besuchten. Innerhalb weniger Sekunden hatte er sich Zugang zu dem Spint verschafft, den Wohnungsschlüssel in ein kleines Kästchen mit Modellierwachs gedrückt – und alles wieder verschlossen.
Während seines kurzen Besuchs hatte er eine Perücke, einen falschen Vollbart, Brille und eine Kappe getragen und sich außerdem eine Sporttasche über die Schulter gehängt. Zu dieser Zeit waren die Mitarbeiter des Studios wie üblich mit Putzen beschäftigt gewesen, und niemand hatte Notiz von ihm genommen. Aber vielleicht gab es dort ja Überwachungskameras? Man konnte nie vorsichtig genug sein.
Jetzt schlich er mit dem Schlüssel in der Hand die Treppe in den dritten Stock hinauf. Vor der Tür atmete er tief ein und lauschte eine Sekunde, ehe er den Schlüssel langsam ins Schloss steckte und ihn herumdrehte.
Die Lautstärke des Fernsehers stieg an, als er die Tür gerade so weit öffnete, dass er sich in den dahinterliegenden Flur schieben konnte. Objekt A telefonierte hörbar, und es kam ihm wie eine Ewigkeit vor, bis das Gespräch mit einem »See you …« beendet wurde.
Bereits vor fünf Tagen war er einmal in der Wohnung gewesen, um den Schlüssel zu testen und sich wesentliche Details einzuprägen. Daher wusste er, dass das Wohnzimmer am Ende des kleinen Flurs auf der rechten Seite lag.
Durch den Spalt zwischen Rahmen und Tür erhaschte er einen Blick auf sein Zielobjekt, das in Unterhemd und Jogginghose auf dem Ledersofa saß, die Beine auf den gläsernen Tisch davor gelegt.
Er steckte den Schlüssel zurück in die Tasche und nahm die Pistole in die rechte Hand. Das Gewicht der Waffe fühlte sich gut in den Lederhandschuhen an. Eine vollkommene Ruhe durchdrang ihn.
Dann stieß er die Tür zum Wohnzimmer mit einem heftigen Ruck auf und trat ein. Die Pistole hielt er am ausgestreckten Arm direkt auf die Stirn des Objekts gerichtet, während er mit der freien Hand die Tür hinter sich schloss.
Das Objekt schreckte vom Sofa hoch.
»Keine Bewegung!«
Sein kurzes Kommando lähmte Objekt A. Der Mund stand offen, die Kiefer bebten, und die Augen waren vor Angst weit aufgerissen.
Er ging bis zum Couchtisch, um dem Objekt von Angesicht zu Angesicht gegenüberzustehen, achtete aber trotzdem darauf, Abstand zu halten. Die Waffe mit dem Schalldämpfer lag sicher in seiner Hand. Dann setzte das ein, worauf er sich während seiner Observation des Objekts vorbereitet hatte. Objekt A war nämlich geschwätzig.
»Was ist denn jetzt los? Hey, was ist los, Mann? Warum? Wer bist du? Was willst du? Geld? Ja, du willst Geld! Okay, das ist okay für mich. Sag einfach, wie viel …«
Objekt A zitterte am ganzen Körper, die kräftigen Oberarme bebten, und um Mund- und Augenwinkel zuckte es unkontrolliert.
»Hey, sag, wie viel du willst, Mann. Aber lass mich leben. Ich will nicht sterben. Warum, warum? Jetzt sag doch was, verdammt! Eine Million? Zwei Millionen?«
Er hielt die Pistole weiter auf sein Ziel gerichtet. Objekt A setzte zu einer neuen verzweifelten Tirade an. Mit dem ausgestreckten Zeigefinger vor seinem vermummten Gesicht zischte er ein leises Psst.
Er registrierte einen großen, dunklen und feuchten Fleck, der sich schlagartig auf der Jogginghose von Objekt A abzeichnete und sich über die Schenkel ausbreitete. Die Augen schienen vor Furcht beinahe aus den Höhlen zu treten.
Es gab keinen Grund, die Sache in die Länge zu ziehen. Er genoss es nicht sonderlich, verspürte allerdings auch nicht das geringste Unbehagen. Er spannte den Finger um den Abzug und vollbrachte eine gute Tat.
Delete … Mission accomplished.
Esbjerg, 2010
2
Wer ist schneller? Ein Gedanke oder eine Kugel?
Schafft es das menschliche Gehirn im Fall eines prämortalen Wettlaufs gegen eine Pistolenkugel, eine Bestandsaufnahme der aktuellen Situation zu erstellen, mit der offensichtlichen Erkenntnis, dass das Ende nah ist, während die Augen auf die Mündung gerichtet sind, sich der Finger um den Abzug spannt und das Projektil aus dem Lauf gefeuert wird?
Nicht unbedingt als konkreten ausformulierten Gedanken, vielleicht nur als kurzes Aufblitzen im Bewusstsein?
Und was begleitet diese Erkenntnis?
Ist es Reue, Verdruss, Fatalismus, ein Hauch von Höllenflammen oder gar Harfenklang?
Unmöglich, darauf eine Antwort zu erhalten.
In einer physikalischen Formel bestünden die entscheidenden Faktoren dieser Rechnung wahrscheinlich aus dem Abstand zwischen Waffe und Gehirn sowie der Mündungsgeschwindigkeit der Kugel.
Außerdem ist die ganze Sache stark situationsabhängig. Erhält das Gehirn nur eine oder zwei Sekunden, um sich einen Überblick zu verschaffen, nur einen winzigen Vorsprung, um die Warnung loszuwerden – »Die Kugel ist auf dem Weg …« –, dann wäre es durchaus möglich, dass ein sinnvoller Gedanke als Erster ins Ziel kommt, oder?
Die Kugel trifft Merzuk »Muscles« Osmanović an einem verregneten Mittwochabend mitten in die Stirn.
Das Einschussloch ist ein deutlich abgegrenzter rosafarbener Fleck. Nachdem sie die Schädeldecke durchstoßen hat, schlägt die Kugel eine Schneise durch das Hirn, bevor sie die Schädelwand erneut durchbricht und ein großes Loch in den Hinterkopf des Opfers sprengt.
In den aufgerissenen Augen, die leer an die Decke starren, finden sich keine Anzeichen für irgendwelche Gedanken. Selbst wenn der Gedanke die Kugel besiegt hätte, könnte niemand einen sichtbaren Unterschied im Gesichtsausdruck erwarten. Es blinkt kein Brief-Symbol in den Pupillen auf, um anzuzeigen, dass Osmanović eine Mail von sich selbst empfangen hat, bevor die Kugel ihr Ziel erreicht.
Circa drei Meter beträgt die Distanz, auf der sich Gedanke und Kugel ein Wettrennen lieferten. So groß war der Abstand von Osmanovićs Position zwischen Sofa und Glastisch bis zu der Waffe am ausgestreckten Arm des Eindringlings. Ungefähr dreihundert Zentimeter zwischen einem Opfer, das sich vor Angst einnässte, und seinem Henker.
Dreitausend Millimeter zwischen Leben und Tod.
Er liegt, wie er fiel. Schief. Auf dem Ledersofa. Rücklings. Halb heruntergerutscht. Die Knie gebeugt und die Arme ein wenig zur Seite gestreckt. 105 Kilogramm verteilt auf 183 Zentimeter, ein Stamm, an der Wurzel gefällt.
Der massige Brustkorb ragt empor, Muskeln umspielen die Arme, und der breite Rückenmuskel, latissimus dorsi, der seinem Oberkörper die Form eines Vs verleiht, sorgt dafür, dass das weiße Unterhemd an den Achselhöhlen spannt. Unreine und vernarbte Haut, von dem teigigen Gesicht bis zu den Schultern. Aus den Beinen der blauen Adidas-Jogginghose lugen nackte Füße hervor.
Auf der gelben Tapete Blutspritzer und Überreste von Hirnmasse. Dort steckt neben dem kitschigen Supermarktgemälde auch der wahrscheinliche Sieger des Wettlaufs – die Kugel. Um das Loch in der Wand hat jemand einen weißen Kreidekreis gezeichnet.
Nina sammelte die Fotos, die sie auf ihrem Schreibtisch ausgebreitet hatte, wieder ein und legte sie zurück in die Mappe.
Im Grunde genommen spielte es keine Rolle, ob der Kerl noch einen Gedanken gehabt hatte oder nicht. Sie war einfach nur neugierig.
Das Klingeln des Telefons unterbrach ihre Spekulationen. Sie hob ab.
»Nina Portland.«
»Ich rufe aus dem Auto an. Bin erst auf halbem Weg über Fünen, also schaffe ich es heute nicht mehr zurück. Wie ist es heute Nachmittag gelaufen? Irgendwelche neuen Anhaltspunkte?«
Es war ihr Chef, Birkedal. Im Hintergrund hörte sie eine Stimme, unter Garantie Paul Potts.
»Keiner will etwas sagen. Oder sie wissen nichts. Potts?«
»Ja … Gut, wir besprechen die Situation morgen, Portland.«
»Okay, tschüss.«
Hmm, immer noch »Portland« und nicht »Nina«. Ihr Chef war so einfach zu lesen wie eine Leuchtreklame in der Nacht. »Portland« bedeutete, dass er gerade nicht zum Plaudern aufgelegt war. Keine Vertrautheit, nur Chef und Angestellte, ich-frage-du-antwortest. Es herrschten also noch immer arktische Verhältnisse zwischen ihnen. So wie seit Langem.
Birkedal war wohl kaum in Spekulationen vertieft. Der Gedanke brachte sie zum Schmunzeln: Polizeiinspektor Erik Birkedal, der Chef der Ermittlungsabteilung, mit einer Hand am Steuer, das Fenster vielleicht ein wenig heruntergelassen und die graue Löwenmähne im Wind flatternd, wahrscheinlich bei gemächlichen einhundert Stundenkilometern auf dem Heimweg in Richtung Esbjerg, gemeinsam mit seinem Begleiter Paul Potts. Wenn sie nichts Interessantes über den Fall zu berichten hatte, zog er es vor, mit dem singenden Glückspilz allein zu sein.
Nichts für ungut. In ihrem CD-Regal zu Hause stand er ebenfalls, Potts. So weit war es schon gekommen. Ein wohlüberlegter Sympathiekauf, nachdem sie sich den alten Clip von Paul Potts’ erstem Fernsehauftritt bei der britischen Talentshow angesehen hatte, deren Namen ihr gerade nicht einfiel. Susan Boyle würde immer wie ein billiger Abklatsch dessen wirken.
Der kleine, unansehnliche Mann mit den schiefen Schneidezähnen hatte ihr Herz berührt, das mit jedem Jahr zusehends weichmütiger wurde. Jetzt stand Paul Potts im Regal unterhalb ihrer kompletten U2-Sammlung und lebte in einer eigenartigen musikalischen WG mit Bono.
Ihr Blick fiel auf ein Foto, das sie noch nicht zurück in die Mappe gelegt hatte. Eine Nahaufnahme von den Überbleibseln des kurzgeschorenen Hinterkopfs in der Blutlache auf dem Sofa.
Abgesehen von Familie und Freunden gab es sicher niemanden, der Merzuk »Muscles« Osmanović vermissen würde. Der junge Ex-Jugoslawe, oder genauer gesagt Bosnier, stammte aus dem muslimischen Bevölkerungsteil Bosnien-Herzegowinas und hatte alles dafür getan, sein neues Heimatland zu schikanieren und die primitivsten und abscheulichsten Instinkte seiner Bewohner ans Tageslicht zu befördern.
Trotz seines fehlenden Hinterkopfs – tatsächlich konnte man sich sogar fragen, ob er überhaupt jemals einen solchen gehabt hatte – diente Osmanović als Beispiel für eine besorgniserregende Entwicklung in Dänemark. Unter Einwanderern und ihren Nachkommen war die Kriminalitätsrate drastisch angestiegen. Mit einem Alter von sechsundzwanzig passte Osmanović genau ins Raster. Denn im Vorjahr war fast jeder vierte Mann nicht-westlicher Herkunft zwischen zwanzig und neunundzwanzig für eine Straftat belangt worden.
Diese Überrepräsentation hallte sogar bis in die Ministerien nach. Und dass die Gruppe nicht-westlicher Bürger für gut sechzig Prozent aller Gewalttaten verantwortlich war, machte die Sache nicht besser.
Viel näher war Merzuk Osmanović einer Bezeichnung als »Musterbeispiel« wohl nie gekommen. Nur war es leider das falsche Muster.
Sein Leben hatte aus einer wahren Flut kürzerer Gefängnisaufenthalte bestanden. Mehrere Fälle von schwerer Körperverletzung hatten ihn dorthin gebracht, wie auch eine anscheinend recht zielstrebige Karriere im Verkauf von allerlei Betäubungsmitteln – inklusive eines Nebengeschäfts, das sich der Versorgung seiner hantelstemmenden Bruderschaft mit Steroiden widmete.
Nina war ihm schon mehrmals begegnet, bevor die Pistolenkugel ihn im Wohnzimmer niederstreckte. Selbst in Handschellen behielt er sein Grinsen bei, nur um gelegentlich aus der Haut zu fahren und mit netten Bezeichnungen wie »Drecksfotze« oder »Scheißrassisten« um sich zu werfen. Einmal hatte sie ihm ihr Knie in den Schritt stoßen müssen und es, um ehrlich zu sein, genossen, ihn einknicken und wie einen kleinen Jungen winseln zu sehen.
Manchmal fühlte es sich an, als steckte sie bis zum Hals in der Scheiße. Als würde selbst der größte Einsatz keine Veränderung zum Positiven bewirken. Vielleicht hatte sie an diesem Abend mit Paul Potts deshalb Rotz und Wasser geheult …
Erst vor Kurzem hatte sie darüber nachgedacht. Wenn sie in der Zeit zurückging, kam es ihr vor, als sei mit Josef Fritzl etwas ernsthaft ins Rutschen gekommen. Seit der Entlarvung des alternden österreichischen Monsters und seiner Schreckensherrschaft im Keller war es, als würde die Welt immer verrückter und gestörter.
Auf jeden wahnsinnigen Fall folgte ein weiterer, noch schlimmerer, sowohl in Dänemark als auch im Rest der Welt. Irgendwann wären alle immun gegen Dinge, die eigentlich schockieren sollten.
In solch bizarren Zeiten sehnte man sich nach der Reinheit des Märchens. Man sehnte sich nach Paul Potts und dem Triumph seiner banal schiefen Hauer mit Nessun Dorma.
Dafür würde diesem Mistkerl Osmanović niemand auch nur eine Träne nachweinen.
Die Hinrichtung, anders konnte man den Mord nicht nennen, hatte an einem Mittwochabend in der letzten Woche stattgefunden. Jetzt war Freitag, und offen gesagt waren sie bei den Ermittlungen keinen Schritt weitergekommen.
Hatte das Opfer seinen Mörder gekannt? Das war immer die große Frage. Bei weit mehr als der Hälfte aller Morde gab es eine irgend geartete Beziehung zwischen Opfer und Täter.
Anonyme Morde waren die schwereren Fälle. Wie sollte man einen Täter ausfindig machen, der quasi aus dem Nichts kam?
Im Fall von Merzuk Osmanović erschien es naheliegend, dass es sich um einen Mord unter Bekannten handelte. Nur hatte der Mistkerl einen so riesigen Bekanntenkreis – aus Freunden und Feinden –, dass es unfassbar mühsam war, diejenigen einzugrenzen, die möglicherweise ein Motiv gehabt haben könnten. Die eine deftige Rechnung mit Osmanović zu begleichen hatten. Noch dazu gab es keine Zeugen. Und in Osmanovićs Milieu dürfte niemand große Lust haben, der Ordnungsmacht behilflich zu sein.
Nina lehnte sich im Bürostuhl zurück und schloss die Augen. Die zentralen Passagen aus den Berichten von Kriminaltechnik und Rechtsmedizin konnte sie ohne Weiteres aufsagen. Selten waren sie derart spartanisch ausgefallen.
Die Spurentechniker hatten nichts gefunden. Keine Fingerabdrücke, keine Anzeichen für einen Einbruch oder Diebstahl, keine Kampfspuren, nur eine unverschlossene Wohnungstür. Und natürlich die üblichen Haarspuren, die von allem und jedem stammen konnten. Nicht einmal einen brauchbaren Abdruck von nassen oder schmutzigen Schuhen auf der Treppe konnten sie in direkte Verbindung mit der Erschießung bringen.
Soweit sie sich erinnern konnte, war die Spurenlage in all den Jahren, die sie mit Mordfällen zu tun hatte, noch nie so dürftig gewesen.
Und auch beim rechtsmedizinischen Institut in Århus hatte niemand einen Schreibkrampf erleiden müssen. Im Gutachten stand nicht mehr als das, was man schon im Vorhinein am Tatort hatte ablesen können.
Ein paar Schmauchspuren im Gesicht. Da es sich um eine Dum-Dum-Kugel handelte, oder Hohlspitzgeschoss, wie es im Fachjargon hieß, hatte das Projektil Osmanović den halben Hinterkopf weggepustet. Im Prinzip konnte man solche Patronen zu Hause am Küchentisch selbst herstellen, indem man die Spitze flach feilte oder ein kleines Kreuz hineinsägte, oder aber man kaufte fertige Munition, zum Beispiel mit einem kleinen Hohlraum in der Spitze. Diese Art von Munition nutzte man nur, wenn das Ziel von vornherein feststand: Zerstörung.
Auch beim eigentlichen Tatverlauf gab es keine großen Überraschungen. Drei Möglichkeiten standen zur Auswahl:
1. Osmanović hatte seine Tür nicht abgeschlossen.
2. Osmanović hatte den Täter selbst hereingelassen.
3. Der Täter war im Besitz eines Schlüssels gewesen.
Nichts davon brachte sie in diesem verfluchten Fall weiter. Ihr fiel auf, wie klinisch das Ganze war. Als hätte jemand bloß auf einen Knopf gedrückt und Osmanović damit von der Erdoberfläche getilgt.
Nina öffnete die Augen, lehnte sich nach vorn und loggte sich aus. Es war erst drei Uhr, aber sie hatte Überstunden gemacht, seit ein Familienangehöriger Merzuk Osmanović am letzten Donnerstagvormittag auf dem Sofa gefunden hatte. Das leise Brummen des Computers erstarb.
Nina lehnte sich wieder zurück, legte die Beine auf die Schreibtischkante und schloss erneut die Augen.
Damit war auch diese Woche vergangen. Es war Freitag, vor ihr lag ein langes, herrliches Wochenende. Und eines war sicher: Sie hegte keinerlei Absichten, auch nur eine einzige Sekunde über einen zutiefst unsympathischen, vermutlich Drogen vertickenden, mit Steroiden vollgepumpten Bodybuilder nachzudenken, der sie obendrein noch als »Drecksfotze« bezeichnet hatte. Erst am Montag hatte das Präsidium wieder Anspruch auf ihren Kopf und ihre Gedanken.
Schritte näherten sich auf dem Flur, sie hielten an der Tür inne, aber Nina reagierte nicht.
»Schläfst du?«
Thøgersens Stimme klang scherzend.
»Ja, tue ich.«
»Worüber denkst du nach, Nina?«
»Wer sagt, dass ich nachdenke?«
»Du grübelst …«
»Nee.«
»Über den Osmanović-Fall.«
Sie schlug die Augen auf, drehte sich auf dem Stuhl herum und sah zu dem stellvertretenden Polizeiinspektor Gunnar Thøgersen, der am Türrahmen lehnte. Er grinste.
»Ein nerviger Fall, oder?«
»Ja, einer von der schweren Sorte.«
»Und das, obwohl die Sequenzen deutlich sind«, merkte Thøgersen leise an.
»Wir sind in anderthalb Wochen keinen Zentimeter vorangekommen. Jetzt brauche ich einfach mal ein Wochenende zum Verschnaufen. Wie sieht’s bei dir aus?«
»Wir laufen einen Halbmarathon – in Kiel.«
»Deine Frau und du?«
»Ja … Im Anschluss werden wir dort unten einen älteren Herrn besuchen. Er verkauft ein kleines Ding.«
»Bist du wieder in Sachen Schwarzpulver unterwegs?«
»Hmm, die herrlichste Steinschlosspistole, die ich je gesehen habe. Fantastischer Zustand, Holz und Messing glänzen geradezu. Gebaut von J.G. Jagenberg aus Solingen, einem wahren Meister seines Fachs. Baujahr 1791 … Die hätte ich gern, Nina.«
Er seufzte.
Sie gluckste.
»Ah, deshalb nimmt man also mehrere Hundert Kilometer Autofahrt auf sich, um zwanzig Kilometer zu rennen.«
»Wir nehmen uns ein gutes Hotel und bleiben bis Sonntag dort.«
»Du bist gewieft.«
Sie konnte Gunnar Thøgersen gut leiden, Vize-Thøgersen, Thøger. Ihr stellvertretender Chef war Ermittlungsleiter und ein angenehmer Zeitgenosse, Mitte fünfzig, außerdem besaß er einen herrlich trockenen Humor. Früher war er ein abgehetzter Kettenraucher gewesen. Bis zu dem Tag, als sein Arzt einen warnenden Zeigefinger erhoben hatte. Daraufhin hatte Thøgersen sein Leben in die Hand genommen und es kräftig umgekrempelt. Heute kamen Gemüse und fettarmes Essen auf den Tisch. Die Verwandlung hatte ihn schon diverse Paare Laufschuhe gekostet, denn in den letzten Jahren hatte er bereits mehrere Marathons absolviert, manche davon gemeinsam mit seiner Frau.
Der zweite Vorsitzende der Waffenhistorischen Gesellschaft Dänemarks hatte die perfekte Balance zwischen Job und Freizeit gefunden. Vor zehn bis zwölf Jahren hätte er vermutlich selbst im Schlaf über den Osmanović-Fall gegrübelt. Laut ratternd hätte sein Hirn alles in die berühmt-berüchtigten Thøgersen’schen Sequenzen unterteilt, da ihm das Zerstückeln der Realität dabei half, Dinge zu sehen, die andere übersahen.
»Genieß erst mal dein Wochenende, Nina. Entspann dich – lass den Fall ruhen. Bis Montag!«
»Klar doch. Halt das Pulver trocken …«
Sie hob eine Hand zum Gruß, doch Thøgersen war bereits von dannen geritten. Ein strammer Freitagsgalopp den Flur hinab, die Duellpistole zum Schuss gegen jedweden Missetäter erhoben, der ihn womöglich aufhalten wollen könnte.
Draußen war es bereits dunkel geworden. Mit einem Mal war es Herbst. Nina ließ den Blick über die Arbeitsplatte schweifen, wo die Deckenlampe auf Lauchstangen, Maiskolben, eine dünne Soße, Kartoffeln und Hacksteaks schien, und musste an Thøgersen und seinen gesunden Lebensstil denken. Sie und Jonas waren ebenfalls nicht ungeschoren davongekommen. Seit sechs Monaten hielt ihr Haushalt in der Kirkegade 23 einen stabileren Kurs als der Dow Jones. Im Großen und Ganzen gab es jeden Tag gesundes, selbst zubereitetes Essen. Ihre drei täglichen Zigaretten hatte sie schrittweise auf zwei, dann eine – und schließlich auf null reduziert. Damit war der Countdown beendet, und sie hatte sich von der Startrampe in ein rauchfreies Dasein katapultiert, das unbestritten seine Vorteile hatte – nur eben auch Nachteile.
»Woran denkst du, Mama?« Jonas sah sie fragend an.
»An nichts Besonderes. Schneidest du die bitte klein?«, sagte sie und deutete mit dem Kopf auf die Schüssel mit den Lauchstangen.
»Okay, ich teile sie in Sequenzen.«
Sie lachten vertraut, wie schon millionenfach zuvor. Im Portland’schen Heim im ersten Stock gab es keine Scheiben, Stücke oder Würfel, nur Thøgersens Sequenzen. Jonas wusste immer, was auf dem Präsidium vor sich ging, und er kannte alle ihre Kollegen, auch wenn er bisher nur wenige von ihnen getroffen hatte.
Sie aßen zu Abend, wie meistens schweigend. Draußen die Dunkelheit, in ihrer Küche Licht und Behaglichkeit. Nina entzündete die beiden Kerzen auf dem Tisch, die sie in der Eile vergessen hatte. Das war das wahre Leben, einfach hier zu sitzen, mit ihrem großgewachsenen, wunderbaren Jungen zu Abend zu essen und die Wärme, die Zusammengehörigkeit zwischen ihnen zu spüren. Zu wissen, dass eine dreizehn Jahre alte Nabelschnur aus dem stärksten Tauwerk der Welt bestand und niemals reißen würde, bis zu dem Tag, an dem sie endgültig Lebewohl sagen müsste.
Sie streckte sich über den kleinen Tisch und fuhr ihm durch die Haare.
»Was ist los, meine kleine Schmalzlocke? Hattest du einen schönen Tag?«
»Mama, lass das …«
Jonas lächelte, so gut er es mit vollgestopftem Mund hinbekam. Sein Appetit war gigantisch, aber er hatte im letzten halben Jahr auch einen wahnsinnigen Schuss gemacht. Inzwischen war er wohl genauso groß wie sie.
Es brauchte schon sehr viel Liebe oder einen Arbeitshandschuh, um dem Jungen durch die Haare zu wuscheln. Früher war es herrlich gewesen, mit der Hand über die weichen, kurzen Stoppeln zu fahren, aber jetzt war die Mähne länger und mit irgendeinem wachsartigen Zeug beschmiert, damit die Frisur auch cool und trendy aussah. Auf die Sache mit der »Schmalzlocke« war sie in den ersten Wachstagen gekommen. In seinen guten Momenten sah Jonas darüber hinweg und ließ sich nicht aufziehen, die meiste Zeit war er jedoch davon genervt.
»War’s ein guter oder ein schlechter Tag?«
»Er war okay, würde ich sagen.«
»Und was ist mit dem Dänisch-Aufsatz?«
»War okay. Anscheinend habe ich ›ein großes Erzähltalent‹. Und als sie die Aufsätze zurückgegeben hat, hat sie gesagt, dass ich es sogar noch besser könnte, wenn ich nicht so faul wäre. Sie meinte, ich hätte es plötzlich sehr eilig gehabt, die Geschichte zu Ende zu bringen.«
Der Gedanke daran ließ sie schmunzeln. Er konnte wirklich gut erzählen. Kreatives Schreiben, hieß das früher nicht so? Seine Lehrerin war bei Elterngesprächen schon mehrfach darauf zu sprechen gekommen. Auch darauf, dass er es besser könnte, wenn er sich ein bisschen mehr Mühe gäbe, sich auf den Unterricht zu konzentrieren.
»Aber sie hat doch recht, oder? Du hast zu spät angefangen, mein Lieber, und dann lief auf einmal Fußball im Fernsehen. Das sollten wir in Zukunft lieber anders machen, meinst du nicht auch?«
»Wie läuft’s mit dem Affen?«
»Was denn für ein Affe?«
»Der, dem in den Kopf geschossen wurde.«
Ihr fiel ein, dass sie Merzuk Osmanović tatsächlich als »Affe« bezeichnet hatte, als sie Jonas das erste Mal von dem Fall erzählte. Nicht gerade besonders pädagogisch, entsprach aber der Wahrheit.
»Ach so, der … Er ist immer noch tot.«
»Oh, Mama, jetzt tu nicht so doof. Gibt’s was Neues in dem Fall?«
Typisch, Jonas ließ nicht locker. Bei jedem größeren Fall geriet sie beinahe in ein Kreuzverhör. Er wollte alles wissen, und normalerweise gab sie ihm eine ausführliche, aber leicht zensierte Zusammenfassung.
»Tatsächlich gibt es da überhaupt nichts, Jonas. Leider … Es sieht so aus, als wäre das ein Fall, mit dem wir noch richtig viele Probleme haben werden. So was ist im Einwanderermilieu immer schwierig. Manche wollen uns nicht helfen, manche haben keine Lust – und manche haben sogar Angst vor der Polizei.«
»Wieso das?«
»Vielleicht, weil sie aus einem Land kommen, in dem man der Polizei nicht trauen kann. Vielleicht haben sie erlebt, dass die Polizei Leute verprügelt, dass Beamte bestechlich sind, dass Leute verfolgt werden, wenn sie die falsche Religion haben oder aus der falschen Gesellschaftsschicht kommen …«
»Vielleicht sind seine Familie und Freunde selbst kriminell und wollen deshalb nicht helfen?«
»Genau. Er kam aus einem kriminellen Umfeld, war schon mal im Gefängnis, und wir sind beinahe sicher, dass er Drogen verkauft hat, konnten es aber nicht beweisen. Wenn die Polizei die Hilfe von Verbrechern braucht, wird es wahnsinnig schwer. Es ist gut möglich, dass jemand weiß, ob er Feinde hatte. Aber niemand sagt etwas.«
»Er hatte keinen Job, ist aber trotzdem in einem teuren BMW rumgefahren. Dann muss er doch kriminell gewesen sein?«
»Allem Anschein nach, ja.«
»Wird der Fall jemals aufgeklärt, Mama?«
»Es ist noch zu früh, um etwas dazu zu sagen. Wenn man es am allerwenigsten erwartet, kann sich plötzlich etwas Neues ergeben, und dann kommt wieder Schwung in die Ermittlungen …«
Auf der Arbeitsfläche gab ihr Handy einen Piepton von sich. Sie kippelte auf dem Stuhl nach hinten und griff danach.
»Hi Nina – viel los hier, habe mehrere Termine übers Wochenende – alles gut bei mir – fliege wahrscheinlich in einer Woche heim – mach dir keine Sorgen – hoffe, bei dir ist alles okay? Kuss Tim«
»Wer war das?« Jonas beobachtete sie.
»Ach, nur ein Kollege. Nichts Besonderes.«
Um Jonas’ Lippen spielte ein füchsisches Lächeln.
»Keine Kappen oder Kapuzen am Tisch – und kein SMS-Theater, wenn wir essen …« Er versuchte, die barschen Ermahnungen nachzuahmen, die er so oft zu hören bekam.
Sie legte das Handy wieder zurück.
»Gut, mein Schatz, wenigstens hast du zugehört. Und entschuldige, bitte. Ich dachte, es wäre vielleicht etwas Wichtiges.«
Sie schob den Schaukelstuhl vors Fenster, holte ein Glas und ein Bier aus der Küche, löschte das Licht im Wohnzimmer, machte es sich im Schaukelstuhl bequem und legte die Füße auf der kleinen Kommode ab.
So hatte sie schon Hunderte Male dagesessen. Im Dunkeln, vor dem großen Fenster. Die Vor Frelsers Kirke auf der gegenüberliegenden Straßenseite wie ein vertrauter Freund.
Behutsam in das weiche Licht der Lampen auf dem mit Kopfstein gepflasterten Platz getaucht, ragte die Kirche dort drüben empor. Oder vielleicht lud sie sie nickend zum Abendplausch ein?
Wie oft sie sich hier schon ihren Gedanken hingegeben hatte. Manchmal waren sie ein chaotisches Universum voller Angst, Schwermut, berauschender Freude oder sprudelnder Energie. Andere Male saß sie einfach nur hier, weil es angenehm war, feste Routinen zu haben.
So wie an diesem Abend. Freitagabendgemütlichkeit nach einer hektischen Woche. Sie schenkte das Bier ins Glas. »Fanø Lyng« hieß die Sorte der ortsansässigen Brauerei. Andächtig ließ sie den ersten Schluck im Mund hin- und herschwappen, und sie bildete sich ein, leichte Nuancen von Spätsommer und Honig von ihrer Heimatinsel zu erschmecken.
Heute Abend gab es keine wichtigen Dinge mit der Kirche zu besprechen. Das war nicht einfach so dahergesagt, sie schaffte es anscheinend tatsächlich, den Osmanović-Fall loszulassen. Der Mistkerl war es nicht wert.
Vor ihr lag nichts als ein ganz normales Wochenende in einem ganz normalen Leben. Der morgige Tag würde aus Putzen und Wäschewaschen bestehen. Jonas war den ganzen Nachmittag bei einem Fußballspiel, und abends wollten sie ins Kino und einen Film anschauen, von dem Jonas schon eine ganze Weile redete, dessen Titel sie sich aber einfach nicht merken konnte. Am Sonntag würden sie Onkel und Tante in Sønderho einen Besuch abstatten. Sie wollten gemeinsam mit ihrem Vater dorthin radeln. Und in der Küche mit der niedrigen Decke im reetgedeckten Haus auf Sønderland würden sie sich von Astrids traditionellen Kochkünsten verwöhnen lassen. Wenn sie alle um den Tisch saßen, würde Nina jeden von ihnen heimlich anschauen – und froh sein, dass es sie gab.
Und schon wäre es wieder Montag.
Nina hatte gerade erst registriert, dass sie an rein gar nichts dachte, da ließ sie mit dem ihr eigenen Talent selbst die Schlange in den Paradiesgarten der vor sich hinschlummernden Kriminalkommissarin. Schon beim Abendessen hatte sie es gemerkt.
»Hi«? Schrieb man so etwas eigentlich nicht an Freunde und Familie? Eine gewöhnliche und völlig unpersönliche Begrüßung. Sie griff nach dem Handy. Ein Knopfdruck und die Nachricht leuchtete im Dunkeln auf. Sie las sie erneut. »Hi« war ein Minuspunkt, »Kuss« ein Plus. Das eine hob das andere auf, also immer noch derselbe Status quo. Aber wo war das »ich vermisse dich«? Wie konnte er das nur vergessen? Das heißt … Es sei denn, dass er sie schlicht und ergreifend gar nicht vermisste. Was er vor drei SMS aber noch getan hatte. Zum Teufel damit …
Dieses Fernbeziehungs-Kommunikations-Hickhack lag ihr einfach nicht. Immer suchte sie nach versteckten Andeutungen und Stimmungen oder interpretierte einzelne Wörter, als wäre jede SMS ein Beweisstück in einer komplizierten Ermittlung. Womöglich war es nur ein Hirngespinst, aber ihr kam es so vor, als seien seine Nachrichten immer häufiger von einem nüchternen Ton geprägt.
Er erlebte dort drüben sicher eine Menge. Bei ihr passierte dagegen nicht das Geringste. Rührte das Missverhältnis zwischen ihren Worten daher?
Sie vermisste Tim Wejse. Und es gefiel ihr überhaupt nicht, dass er sich irgendwo im höllisch gefährlichen Islamabad herumtrieb, wohin ihn der Nachrichtendienst der Polizei, PET, entsandt hatte. Genau an den Ort, wo ein Mitarbeiter des Dienstes bei dem großen Terrorangriff auf das Marriott Hotel ums Leben gekommen war. Der Gedanke daran löste Beklemmungen in ihr aus.
Früher hätte ihr das keine nennenswerten Sorgen bereitet, jetzt allerdings schon. Waren sie zusammen? Allein die Frage klang nach Schulhofgetuschel. Nein, waren sie nicht. Aber was dann? Ein Liebespaar? Nein. Hoffentlich nicht. Die hatten doch einen Hang zu tragischen Toden, oder? So wie Elvira Madigan und Sixten Sparre, oder das junge Paar, das während des Bürgerkriegs in Sarajevo auf einer Brücke erschossen wurde.
Ein Liebespaar also auf keinen Fall. Vielleicht waren sie einfach nur erwachsene – sehr erwachsene Menschen, die inmitten prallgefüllter Terminkalender eine kleine gemeinsame Oase gefunden hatten. Aber sollte es für immer so bleiben? Waren sie dazu verdammt, immer nur ein wenig Zeit zu stehlen, so wie Kinder Lakritze stibitzten?
Sie wollte wissen, woran sie waren, wollte ihre Beziehung in die richtige Schublade stecken können. Und dabei war sie nicht einmal sicher, ob sie nicht vielleicht sogar selbst schuld an der unklaren Lage zwischen ihnen war.
Jonas wusste nichts. Mit Absicht. Er hatte Tim erst ein einziges Mal getroffen – als Tim und sie für eine kurze Zeit Kollegen gewesen waren. Nach der Sache mit Martin, dem Zimmermeister, hatte sie vorerst keine Lust gehabt, den Versuch zu wiederholen.
Nein, es gab keinen Grund, irgendetwas zu erzwingen. Und es war vergeudete Zeit, sich den Kopf über eine SMS zu zerbrechen – eine SMS aus Islamabad …
3
Er war ein schwarzer Panther. Ein geschmeidiges Raubtier in der Nacht.
Er machte ein paar Schritte ins Gebüsch neben der Eisenbahnbrücke und spürte, wie er eins mit der Dunkelheit wurde. Er fühlte sich gut. Beim Gedanken an das, was nun unmittelbar bevorstand, überkam ihn kein nervöses Zittern. Sein Kopf blieb kühl, er hatte den Überblick, das Timing war perfekt – all das konstatierte er bloß, ließ sich davon nicht ablenken. Er hatte einen Job. Und er war vorbereitet.
Dies war die zweite Mission. Die letzte Mission. Mission Delete – Part Two.
Über mehrere Wochen hatte er das Objekt observiert und seine Beobachtungen sorgfältig in eine Tabelle eingetragen, sodass er die Mission schon früher hätte ausführen können. Aber die Bedingungen waren nicht gut genug gewesen. Bei trockenem Wetter hatte der Mond viel zu hell geleuchtet. Jetzt war alles perfekt. Wind, Regen und eine dichte Wolkendecke.
Er drückte auf seine Armbanduhr, und die aufleuchtenden Ziffern zeigten an, dass er nur noch drei Minuten warten musste. Den Zeitplan kannte er auswendig. Das Objekt, logischerweise Objekt B, joggte jeden Dienstag und Donnerstag – mit seltenen Abweichungen – den Kiesweg entlang, wobei Regen kein Faktor zu sein schien, der jemanden im Haus hielt, den es fünfmal pro Woche ins Fitnessstudio trieb. Auch an diesem Abend gab es keine Unregelmäßigkeiten, denn er hatte überprüft, dass Objekt B seine Wohnung planmäßig verlassen und die Joggingrunde begonnen hatte. Objekt B trug sogar eine neonorange reflektierende Sportjacke, was ebenfalls sehr hilfreich war.
Um seine Schuhe hatte er ein neues Paar schwarzer Ledersäckchen geschnürt, die er jetzt noch einmal zurechtzog. Der Regen war zwar ein guter Verbündeter, aber er hatte nicht vor, den Polizeitechnikern auch nur ansatzweise das Geschenk einer hinterlassenen Spur zu machen. Seine Vorbereitungen waren eine exakte Wiederholung derjenigen der ersten Mission gewesen. Disziplin und Vorsicht bedeuteten Überleben.
Zuerst die Dusche. Acht Minuten plus drei Minuten und dreißig Sekunden unter eiskaltem Wasser. Danach, Körper und Schädel sorgfältig rasiert, hatte er sich im Keller angezogen. Ein komplett neuer Satz schwarzer Kleidung von seiner Einkaufstour in Hamburg. Die Kleider der ersten Mission hatte er längst in einer Kiesgrube weit außerhalb der Stadt verbrannt.
Schwarze Socken, schwarze Unterhose, lange Funktionsunterwäsche, ein schwarzes T-Shirt, schwarze Regenbekleidung, eine schwarze Sturmhaube und schwarze Handschuhe.
Er war der Panther.
Regen tropfte vom Rand seiner Kapuze, als er im Dunkel vor der Hecke einen entfernten Schatten wahrnahm. Konzentriert starrte er in die Richtung der Bewegung. Tatsächlich … Der Schatten färbte sich orange, als Objekt B in die schwachen Scheinwerferstrahlen der oberhalb des Kieswegs gelegenen Industrieanlage lief. Auf einem knapp einhundert Meter langen Streifen waren die krummen Bäumchen auf dem Feld in ein fahles Licht getaucht, wie auf einem Schlachtfeld, das er einmal überquert hatte.
Jetzt hatte Objekt B den Lichtstreifen hinter sich gelassen. Nur noch dreihundert Meter.
Er hob sein Fahrrad an und trug es die wenigen Stufen bis zu dem kleinen gewölbten Tunnel hinunter, durch den der Weg unter der Eisenbahnbrücke hindurch und weiter ins Grüne führte. Hier kannte er sich gut aus, war den Rundweg schon selbst unzählige Male gelaufen. Im Tunnel war es stockfinster. Der Boden bestand aus massiven Holzplanken, da unter ihnen ein kleiner Bach floss.
Er legte das Fahrrad quer in die schmale Passage, kniete sich auf die Bretter und schaltete die starke Taschenlampe ein, die er so platzierte, dass sie die kleine Szene möglichst gut beleuchtete.
Mit der rechten Hand griff er unter die Regenjacke, und seine Finger schlossen sich fest um den Pistolenschaft. Der Schalldämpfer war zwar nicht besonders lang, aber er machte die Waffe trotzdem ein wenig unhandlich. Jetzt lag sie schwer und ruhig in seiner Hand.
Er war bereit.
Als Erstes registrierte er das Geräusch von knirschendem Kies und aufspritzendem Wasser aus den Pfützen auf dem Weg. Ein schwerer und fester Lauf, der sich jetzt verlangsamte. Objekt B wusste, dass man auf den Stufen zum Tunnel im Dunkeln vorsichtig sein musste. Eilige Schritte ertönten, also war das Licht seiner Taschenlampe jetzt zu sehen.
Er blieb weiter knien und hielt sich die rechte Schulter mit der linken Hand, so als hätte er sich verletzt.
»Was soll das denn?«
Er hörte die tiefe Stimme von Objekt B, ehe er aufsah.
»Was ist los mit dir, verdammt? Du versperrst den ganzen Tunnel!«
Objekt B blieb auf der anderen Seite des Fahrrads stehen – wie geplant. Er selbst rappelte sich unter schmerzvollem Stöhnen langsam auf.
»Sorry … So ein Mist, ich bin gestürzt …«
»Heb dein Scheißfahrrad auf und fahr ins Krankenhaus, wenn es so schlimm ist.«
»Ja …«
Er griff nach der Taschenlampe und richtete sich ganz auf. Blitzschnell hielt er den Lichtkegel direkt in das Gesicht von Objekt B, zog die Pistole, streckte den Arm und zielte.
»Du Idiot! Du …«
Die Zeit blieb stehen.
Es war, als liefe alles in einzelnen, wie festgefrorenen Bildern ab. Dunkel. Grelles Licht. Erstaunen. Plopp, das dumpfe Knallen des Schalldämpfers. Große, weiße Augen. Ein Punkt. Rosa. Die Stirn.
Objekt B kippte nach hinten. Als Letztes schlug sein zerstörter Hinterkopf auf dem Bretterboden auf.
Er schwenkte den Strahl der Taschenlampe über den orangegekleideten Körper. Dann machte er einen großen Schritt über das Fahrrad, richtete die Waffe auf das Herz und spannte den Finger ein zweites Mal um den Abzug.
Delete … Mission accomplished.
Erst als er die Wohnungstür hinter sich verschlossen hatte, erlaubte er sich, die Wachsamkeit herunterzufahren. Zwischen dem Punkt, an dem er mit dem Rad losgefahren war, und seiner Rückkehr zum Fahrradständer im Hinterhof lagen sechsundsiebzig Minuten Arbeit unter höchster Konzentration.
Er ließ sich aufs Sofa sinken, lehnte sich zurück und schloss die Augen. In Gedanken ging er nochmals alles detailliert durch, hielt sich aber nicht mit der eigentlichen »Liquidierung« des Objekts auf, sondern befasste sich mit allem anderen rund um die Mission.
Er hatte keine Spuren bei der Observierung des Hauses von Objekt B in Kvaglund hinterlassen, und der Regen hatte sämtliche Reifenabdrücke des Fahrrads auf dem Kiesweg weggespült. Sicherheitshalber hatte er das Fahrrad trotzdem bis zur asphaltierten Straße an der Berufsschule getragen, deren weiträumiges Gelände zwischen dem Spangsbjerg Møllevej und dem Waldstreifen mit den Rundwegen lag. Dort hatte er seinen kleinen Rucksack in einem Busch versteckt und war auf dem festen Untergrund in Gummistiefel gestiegen, hatte die Sturmhaube gegen eine normale Mütze getauscht und war dann, die Kapuze der Regenjacke fest ums Gesicht gezurrt, in Richtung Stadtzentrum gefahren. Keine Menschenseele war unterwegs gewesen. Kurz danach hatte es zu stürmen begonnen.
Morgen früh wartete lediglich eine letzte Aufgabe auf ihn: Waffe und Ausrüstung loswerden. Letztere würde er wieder verbrennen. Die Pistole, eine Makarow 9 mm, die Standardwaffe der ehemaligen Länder des Warschauer Pakts, würde in einem Weiher landen.
Er öffnete die Augen wieder und starrte an die Decke. Leere … War es nicht das, was ihn gerade erfüllte? Er fühlte sich voller – Leere. Es war kein schlechtes Gefühl, eher wie Erleichterung. Erlösung nach vielen Monaten der Planung. Die beiden Aufgaben, die er sich selbst gestellt hatte, waren perfekt gelöst. Jetzt musste er einfach abwarten, welche Wendung das Leben nehmen würde.
In jedem Fall hatte er sich selbst weiter erforscht. Er konnte sich noch immer fokussieren, alles andere ausblenden und ein Ziel verfolgen.
Nach der ersten Mission hatte er geglaubt, er würde sich für einige Tage treiben lassen. So wie früher – hemmungsloser Rausch und schlafende Dämonen. Aber so war es nicht gekommen. Er hatte keinen Tropfen angerührt, weder Whisky noch etwas anderes. Denn die zweite und letzte Mission hatte den gesamten Raum eingenommen.
Er hatte den Fokus aufrechterhalten.
Langsam stand er auf und ging zum Regal neben dem Fernseher. An der Wand waren mit Reißbrettstiften zwei Fotos befestigt. Links prangte das Konterfei von Objekt A. Das Bild war in der Mitte in zwei Streifen gerissen, die übereinandergelegt an der Wand hingen. Er nahm Objekt B herunter, riss das Foto durch, legte die Hälften übereinander und presste den Reißbrettstift mitten hindurch.
Entzweigerissene Gesichter. Abschaum, von der Erde getilgt. Ausgelöscht.
Darunter hingen drei kleine gerahmte Fotos. Sie waren kostbar. Mit dem Feuerzeug aus dem Regal zündete er die drei Teelichter an. Dann setzte er sich wieder aufs Sofa.
Reglos saß er in der dunklen Wohnung und schaute sie einfach nur an. Draußen hörte er den Wind heulen.
Es kam ihm vor, als stünden die drei Flammen ruhiger als sonst. Ihr rastloses Flackern war verschwunden.
4
Er flog seinem eigenen Untergang entgegen, gefesselt in einem Flugzeug, das ihn im Dunkeln an ein unbekanntes Ziel brachte.
Er wusste nur, dass vor ihm Gesetzlosigkeit, Einsamkeit und schlimmere körperliche und seelische Schmerzen lagen, als ein Mensch sich jemals vorzustellen vermochte.
Nein, er wusste mehr als das. Er wusste auch, dass sich sein Leben dem Ende näherte und dass er seine Liebsten mit großer Wahrscheinlichkeit nie wieder sehen würde.
Wie war es so weit gekommen?
Er hatte keine Antwort darauf. Wirklich belastbare Fakten hatte er in den letzten Tagen nicht sammeln können, aber immerhin konnte er abschätzen, dass die Maschine einem östlichen oder südöstlichen Kurs folgte. Sie waren in Keflavík abgehoben, und ausgehend von der Platzierung der Gebäude unter ihnen glaubte er zu wissen, dass sie zunächst in südlicher Richtung an Höhe gewannen, um anschließend einen Knick nach Osten zu machen. Aber sicher war er nicht. Vielleicht hatte er auch deshalb ein Gefühl für den Kurs der Maschine, weil er ahnte, was ihm bald widerfahren würde.
Denn das, was ihm bevorstand, geschah in der Regel an einem weit entfernten und unwahrscheinlichen Ort – zum Beispiel in einem abgelegenen Gebiet in Polen, Rumänien, Bulgarien – oder im Nahen Osten. Zumindest war es das, woran er sich aus den Medien erinnerte.
Inzwischen waren dreizehn Tage vergangen. Es kam ihm so surreal vor. Gerade war er noch fröhlich und zufrieden an einem sonnigen Nachmittag auf dem Weg zum Einkauf im ICA-Supermarkt gewesen, und im nächsten Augenblick saß er isoliert in einem kleinen Zimmer auf Island. War die Welt komplett verrückt geworden? Oder war er derjenige, der den Verstand verloren hatte? Wie war so etwas in einer zivilisierten Welt überhaupt möglich?
Immerhin waren sie höflich und korrekt gewesen, die Amerikaner, die sich im Team um ihn gekümmert und ihn befragt hatten. Ihm wurde kein Schaden zugefügt, aber offensichtlich hatte er nicht die Antworten geliefert, auf die sie aus waren. Sonst säße er nicht hier.
Es kam ihm vor, als sei das Ganze nur eine Art Vorspiel, eine vorbereitende Phase gewesen. Ein einleitendes Manöver, förmlich und routiniert, und als es nicht zu den gewünschten Ergebnissen führte, schickte man ihn in die Hölle, um zu beobachten, wie er die dortigen Prüfungen meisterte.
Er hatte noch nie Angst gehabt zu sterben. Bis heute. Seine Frau und die beiden Kleinen machten den großen Unterschied aus. Er musste den Glauben in seinem Herzen bewahren. Dafür beten, dass sie eines Tages wieder vereint wären, inschallah.
Zwei Begleiter flogen mit ihm. Den einen hatte er im Lauf der vergangenen dreizehn Tage studieren können, aber der andere, ein stämmiger und rotwangiger Mann mit rotblondem Haar, hatte nicht an den Sitzungen im Verhörzimmer mitgewirkt. Jetzt saß dieser Kerl auf dem Platz ganz vorne rechts, der Sitz links von ihm sowie die beiden Plätze in der mittleren Sitzreihe waren leer. Er selbst und der Begleiter, den er bereits kannte, ein jüngerer Kerl mit schwarzem Bürstenschnitt, befanden sich in der hintersten Sitzreihe. Er links vom schmalen Mittelgang, sein Bewacher rechts davon. Der Mann gähnte, schaltete das Leselicht ein und schlug eine Zeitung auf.
Wahrscheinlich würde das Flugzeug zwischenlanden, um Treibstoff nachzutanken. Trotz allem war es ein weiter Weg von Island bis nach Rumänien, falls sie also wirklich dorthin flogen.
Sein Körper protestierte, die vornübergebeugte Sitzhaltung strengte ihn an. Die Handschellen waren um einen Metallbügel geführt, der mit der Wand und dem Boden des Flugzeugs fest verschraubt war. Deshalb war es ihm nicht möglich, sich zurückzulehnen und auszuruhen.
Bei der Ankunft hatten sie ihm einen Baumwoll-Jogginganzug und ein Paar Hausschuhe ausgehändigt. Jetzt hatte er seine eigene Kleidung und Schuhe wieder zurückbekommen, sonderbarerweise. Trugen Leute wie er sonst nicht immer Overalls? Hmm, vielleicht war das nur im Fernsehen so …
Was war das? Sein Blick fiel auf einen kleinen Gegenstand unter dem Vordersitz, der im Licht der Lampe über ihm ein wenig glänzte. Anscheinend steckte der Gegenstand dort unten fest.
Er schielte nach rechts. Der Mann mit dem Bürstenschnitt hatte den Mund leicht geöffnet, und der Kopf neigte sich ein wenig auf die Schulter. Für einen kurzen Moment hob sich der Kopf, dann sank er wieder nach unten. Offensichtlich kämpfte sein schwarzhaariger Bewacher gegen den Schlaf an.
Nach vorne behinderten die Handschellen seine Bewegungsfreiheit kaum, also rutschte er auf dem Sitz vor, beugte sich nach unten und steckte eine Hand in den Spalt zwischen dem Boden und dem Vordersitz. Seine Finger schlossen sich um ein Stück Metall, und er zog die Hand zurück. Rechts von ihm schlief sein Bewacher mit offenem Mund.
Was jetzt in seiner Hand lag, war ein Messer. Ein solides Buttermesser aus Edelstahl. Er studierte es genau, die Form, die Materialdicke, er fühlte das Gewicht, die Stärke und die Schwächen. Plötzlich hob der Mann rechts von ihm ruckartig den Kopf, und er verbarg das Messer schnell wieder.
Es war kein richtiges Messer, und erst recht kein Schraubenzieher – einfach nur ein Messer, mit dem man aß. Vielleicht hatte sich jemand damit an Bord ein Butterbrot geschmiert und es dann fallen lassen. Es konnte schon seit Jahren dort gelegen haben.
Womöglich hatte der Chef der Firma auf dem Weg zu Geschäftsverhandlungen im Ausland hier gesessen und Kaffee getrunken. Der Chef von … Er versuchte, sich an den Namen zu erinnern, der diskret auf der Seite des Fliegers stand. Er beugte sich vor und zog eine Serviette mit dem Firmenlogo aus der Sitztasche vor ihm. Der Name darauf war derselbe wie auf dem Flugzeug. »Skúlason Constructions International«. Er saß in der Maschine einer isländischen Baufirma – oder gehörte sie ihr gar nicht?
Er legte die Hände um den Metallbügel und blickte wieder aus dem Fenster ins große Nichts. Der Gedankenstrom in seinem Kopf rauschte weiter. Deutlich sah er ihre Gesichter … Drei Menschen – sein ganzes Leben.
Vorsichtig rüttelte er am Bügel. Der schwarzhaarige Bewacher neben ihm wurde nicht wach. Ein wenig gab der Bügel nach. Nicht am Boden, aber dort, wo er an der Bordkabinenwand befestigt war. Der Bügel musste eigens zu diesem Zweck hier angebracht worden sein, denn etwas so Hinderliches gehörte nicht zur Standardausstattung eines Passagierjets. Und Skúlason Constructions International transportierte wohl kaum angekettete Bausklaven mit dem Flugzeug.
Eine Plastikmuffe verdeckte die Stelle, an der der Bügel mit der Bordwand verschraubt war. Er steckte das Messer darunter und versuchte, sie aufzuhebeln. Nach ein paar Versuchen knackte etwas, und er konnte die Muffe auf den Bügel schieben. Er war mit drei Schrauben befestigt, drei Schrauben mit ganz gewöhnlichen Schlitzen. Eine saß sogar ein wenig schief.
Im Dunkeln vor dem Fenster tauchten wieder ihre Gesichter auf. Seine geliebte Britt, der kleine Mats und die kleine Annika … Sie lächelten ihm zu.
Er sah auch das kleine, grelle Licht auf dem Flügel. Es gab ihm Halt. Das Licht war real, das Flugzeug war real, die Handschellen, der Bügel, der Schmerz.
Er wog das Buttermesser in der Hand. War es möglich? Und wenn ja, was passierte danach? Er versuchte, sich die vielen verschiedenen Handlungsmöglichkeiten und ihre wahrscheinlichen Konsequenzen vorzustellen. Das Leben bestand aus Entscheidungen. Manchmal blieb einem viel Bedenkzeit, andere Male nur wenig. Aber entscheiden … musste man sich immer.
La ilaha illa Allah, wa Muhammad rasul Allah. Es gibt keinen Gott außer Allah, und Mohammed ist sein Prophet.
Dann traf er seine Entscheidung.
5
Er schraubte mit dem leichten Schnarchen seines Bewachers um die Wette, dessen Kopf inzwischen wieder schlaff auf der Schulter ruhte. Es hatte eine halbe Ewigkeit gedauert, bis der Mann erneut eingeschlafen war; zuerst war er aufgestanden und hatte sich weiter vorn mit seinem rotblonden Kollegen unterhalten, dann hatte er noch eine Weile Zeitung gelesen, bevor er wieder eingeschlafen war.
Sein Blick wanderte im Dreieck zwischen dem Bewacher neben ihm, dem breit gebauten, rotblonden Mann vorne rechts – und dem Buttermesser, das er so fest umklammerte, dass ihm die Kanten in die Finger schnitten.
Die Armbanduhr hatten sie ihm nicht zurückgegeben. Daher ahnte er nicht, wie lange er sich schon mit den drei Schrauben abmühte. Er schien beinahe selbst in dem Dreieck zu verschwinden, das er durch seine immense Konzentration formte. Es gab nur die beiden Bewacher und seine angeketteten Hände mit dem Messer. Alles andere hatte das Dreieck verschluckt. Verschwanden auf diese Weise nicht auch Dinge im Bermudadreieck? Als er sich dazu entschloss, den Versuch zu wagen, endete sein innerer Dialog über die Optionen, Konsequenzen und Risiken. Und auch die Bilder von Britt, Mats und Annika lösten sich in Luft auf.
In diesem Moment waren seine arbeitenden, schweißnassen Hände und das glatte Edelstahlmesser alles, was existierte. Und die Schrauben … Jetzt gab auch die dritte und letzte nach. Sie saß am festesten in der Bordwand.
Er beugte sich nach links und nutzte sein Körpergewicht. Sein linker Daumen schmerzte höllisch vom Drücken gegen die Messerschneide, damit das Messer nicht aus dem Schraubenschlitz sprang, während er es mit der rechten Hand fest umschlossen hielt und immer weiter drehte. Der Messergriff bildete den Hebel, der die ganze Operation erst möglich machte. Mit jeder Drehung ragte der Schraubenkopf ein kleines Stück weiter heraus.
Zuletzt lag sie in seiner Hand, die Schraube. Er hatte sie alle drei bewältigt, mit einem einfachen Messer, das tiefrote Striemen auf seiner Haut hinterlassen hatte.
Ohne Probleme bog er den Metallbügel nach hinten und führte die Kette der Handschellen durch die entstandene Lücke. Für einen kurzen Augenblick lehnte er sich im Sitz nach hinten, sodass er endlich seinen Rücken entspannen konnte.
Ein letztes Mal ging er in Gedanken die nächsten Sekunden durch. Er wollte keinen tödlichen Schlag abgeben, aber jetzt war er schon so weit gekommen … Lieber schlug er zu fest zu als zu sanft. Es galt er oder sie. Er holte tief Luft.
Bis zur hinteren Wand der Kabine waren es nur wenige Schritte, dort hing ein kleiner Feuerlöscher. Vorsichtig stand er auf, schlich nach hinten und löste den roten Metallzylinder. Er lag schwer in seiner rechten Hand.
Der Schlag gegen den Hinterkopf der Wache war präzise und hart. Noch bevor der Körper des Mannes zur Seite kippte, eilte er weiter nach vorn. Sein zweiter Bewacher schaffte es gerade so, den Kopf zu drehen, ehe er ihm den Feuerlöscher mit Gewalt gegen die Schläfe rammte. Ohne innezuhalten oder auch nur für den Bruchteil einer Sekunde zu zögern, riss er die Tür zum Cockpit auf, zerrte dem Piloten das Headset vom Kopf, zog den Stecker und hielt den Feuerlöscher drohend über ihn, bereit zuzuschlagen.
»Sitzen bleiben! Fliegen Sie weiter! Und tun Sie, was ich sage!«
Angst flackerte in den Augen des Piloten auf, doch er nickte.
»Der Transponder. Wo ist er?«
»Transponder? Ich verstehe nicht … Wovon reden Sie?« Der Pilot rang um Luft.
Er stieß dem Piloten den Feuerlöscher seitlich in die Rippen. Der Mann heulte vor Schmerzen auf.
»Ich frage noch einmal. Wo sitzt der Transponder?«
Auch wenn er ihn nicht unmittelbar lokalisieren konnte, schätzte er sich glücklich über sein Flugzeugwissen.
Der Pilot deutete auf eine der vielen Knopfreihen zwischen den Instrumenten und Anzeigen im Cockpit.
Er beugte sich über den Mann hinter dem Steuer und drückte selbst auf »Off«. Damit verschwand das Flugzeug vom Radarschirm all derer, die es momentan beobachteten. Und damit war auch die Gefahr gebannt, dass der Pilot den Hijacking-Code eingab, mit dem er den Signalmodus ändern und der Welt mitteilen konnte, dass jemand das Flugzeug gekapert hatte.
»Lassen Sie den Autopiloten angeschaltet, stehen Sie langsam auf und gehen Sie vor mir her. Eine falsche Bewegung und ich zertrümmere Ihnen den Schädel!«
Der Mann gehorchte und ließ sich aus dem Cockpit in den hinteren Teil des Flugzeugs bringen. Er machte einen gequälten Eindruck, so als wären mehrere seiner Rippen gebrochen.
»Stehen bleiben, keine Bewegung!«
An der vordersten Sitzreihe machten sie Halt, und er durchsuchte die Taschen des rotblonden Bewachers, in denen er zum Glück schnell fand, was er brauchte: Die Handschellenschlüssel. Nach einigem Herumhantieren schaffte er es, seine Hände zu befreien. Er befühlte den Hals der Wache. Ja, der Mann hatte Puls. Dann nahm er die Pistole aus dem Schulterholster unter der Jacke und richtete sie auf den Piloten.
»Sie verhalten sich ganz ruhig, verstanden?«
Der Pilot nickte. Die Augen des Mannes waren schmal vor Schmerzen.
Er schnallte das Holster des Bewachers ab, zog das Notizbuch aus der Innentasche des Jacketts und sah es durch. Falls es einen offiziellen Ausweis enthielt, würde er ihn einstecken, aber natürlich gab es kein solches Dokument.
Dann ging er hinüber zu dem anderen bewusstlosen Mann, rollte ihn auf den Bauch, zog ihm das Tweedsakko aus, löste das Schulterholster und kontrollierte alle Taschen. Mit demselben Ergebnis. Mehrere Kreditkarten und andere Ausweise – aber nichts, das irgendetwas über einen Auftraggeber verraten hätte. Er legte dem Mann zwei Finger an den Hals. Sein Schlag mit dem Feuerlöscher war zwar hart gewesen, aber auch dieser Kerl lebte noch.
Eine Reihe von Erschütterungen ließ das Flugzeug beben, und er musste sich auf den Boden setzen, um nicht das Gleichgewicht zu verlieren. Der Pilot umklammerte eine Sitzlehne und hielt sich auf den Beinen.
»Zurück ins Cockpit, schnell!«, zischte er und hob drohend die Pistole.
Er ging dicht hinter dem Piloten und blieb an der Tür stehen, um ihn von dort in Schach zu halten. Alles war so schnell gegangen – und viel einfacher, als er sich vorzustellen gewagt hatte. Alles, was er bislang unternommen hatte, war gut gegangen, und es kam ihm beinahe so vor, als sei es in einer einzigen großen und fließenden Bewegung geschehen.
Aber was nun? Die Frage traf ihn mit der Macht einer inneren Erschütterung. Das Flugzeug wurde von Neuem durchgerüttelt.
»Was passiert da?«
Er musste sich auf den Platz neben dem Piloten setzen, auf dessen Gesicht ein verbissener Ausdruck prangte.
»Wir sind auf dem Weg in ein Unwetter. Eines von der heftigen Sorte. Was zur Hölle haben Sie sich dabei gedacht? Sind Sie verrückt, oder was?«
Anscheinend hatte der Pilot den ersten Schock überwunden.
»Verrückt? Gut möglich … Beziehungsweise, ich hoffe, es zu vermeiden. Wohin fliegen wir?«
»Rumänien.«
»Wohin in Rumänien?«
»In die Nähe von Brașov, Transsilvanien.«
»Dracula. Wie passend. Wo sind wir jetzt?«
»Über der Nordsee.«
»Treibstoff?«
»Geplant war eine Zwischenlandung zum Tanken in Esbjerg, Dänemark.«
»Wann?«
»Voraussichtliche Landung in fünfunddreißig Minuten.«
»Haben Sie eine Karte? Eine Landkarte?«
Der Pilot nickte, kramte in einer Seitentasche und reichte ihm eine Kartenauswahl, als das Flugzeug erneut zu tanzen begann und eine Reihe von Blitzen links von ihnen aufflammte.
»Und was in aller Herren Namen haben Sie jetzt vor? Wo wollen Sie hin?«, rief der Pilot.
»Fliegen Sie einfach«, antwortete er schulterzuckend.
»Sie haben keine Chance. Stoppen Sie diesen Wahnsinn, solange noch die Möglichkeit besteht, lebend aus der Sache rauszukommen. Sie können nicht …«
»Halten Sie den Mund!«
Ratlos blätterte er durch die Karten. Er war an einem Punkt, an dem er zwar zu einer Handlung in der Lage war, aber die daraus folgenden Konsequenzen konnte er unmöglich überblicken. Einige der Karten besah er sich genauer, während das Flugzeug erneut in heftige Turbulenzen geriet.
Er studierte drei der Landkarten noch einmal, minutiös und