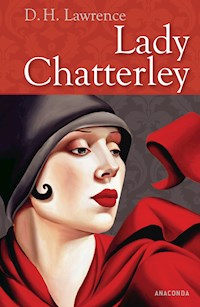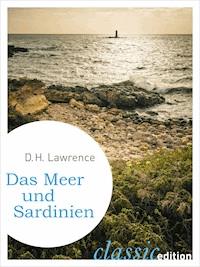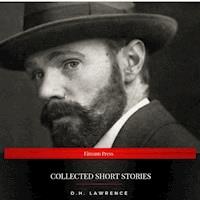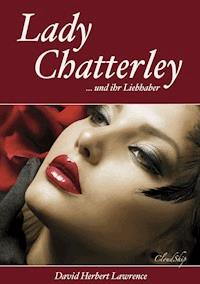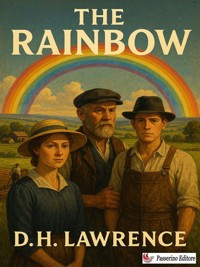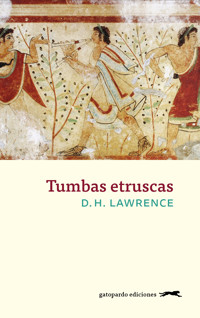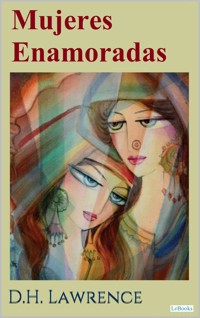9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Reclam Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Reclam Taschenbuch
- Sprache: Deutsch
Nottinghamshire, England, gegen Ende des 19. Jahrhunderts: Die aus besseren Kreisen stammende Gertrude Coppard heiratet den Bergmann Walter Morel, in den sie sich bei einer Weihnachtsfeier verliebt hat. Ein erster Sohn, William, wird geboren, dann die Tochter Annie, schließlich, als die Liebe schon erkaltet ist, Paul. Gertrude wendet sich ganz ihren Söhnen zu. William, der eine vielversprechende Karriere begonnen hat, stirbt früh. Umso intensiver wird die Beziehung zu dem künstlerisch begabten Paul, den die Mutter mit ihrer Liebe zu erdrücken droht … Einer der besten englischsprachigen Romane des 20. Jahrhunderts. – Mit einer kompakten Biographie des Autors.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 912
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
D. H. Lawrence
Söhne und Liebhaber
Reclam
Englischer Originaltitel: Sons and Lovers
2022 Philipp Reclam jun. Verlag GmbH, Siemensstraße 32, 71254 Ditzingen
Covergestaltung: Philipp Reclam jun. Verlag GmbH
Coverabbildung: akg-images
Gesamtherstellung: Philipp Reclam jun. Verlag GmbH, Siemensstraße 32, 71254 Ditzingen
Made in Germany 2022
RECLAM ist eine eingetragene Marke der Philipp Reclam jun. GmbH & Co. KG, Stuttgart
ISBN978-3-15-962003-9
ISBN der Buchausgabe 978-3-15-020663-8
www.reclam.de
Inhalt
Teil I
1: Die frühen Ehejahre der Morels
2: Pauls Geburt und noch ein Streit
3: Abwendung von Morel, Hinwendung zu William
4: Pauls Jugendjahre
5: Pauls Eintritt ins Leben
6: Tod in der Familie
Teil II
7: Jungen- und Mädchenliebe
8: Streit in der Liebe
9: Miriams Niederlage
10: Clara
11: Miriams Prüfung
12: Leidenschaft
13: Baxter Dawes
14: Die Erlösung
15: Unbehaust
Anhang
Zu dieser Ausgabe
Anmerkungen
Nachwort
Zeittafel
Teil I
Kapitel 1
Die frühen Ehejahre der Morels
Die Bottoms folgten auf die Hell Row. Diese bestand aus einer Gruppe geduckter, strohgedeckter Hütten am Bachufer in der Greenhill Lane. Hier wohnten die Bergleute, die in den kleinen, zwei Felder entfernten Gruben arbeiteten. Der Bach floss unter Erlen dahin, kaum verschmutzt durch die kleinen Gruben, deren Kohle Esel zutage förderten, die erschöpft um einen Rundganggöpel trotteten. Die Landschaft war übersät mit solchen Gruben, von denen einige schon zu Zeiten Karls II betrieben worden waren; die wenigen Knappen und die Esel wühlten sich wie Ameisen ins Erdreich und warfen zwischen Getreidefeldern und Wiesen sonderbare Hügel und kleine schwarze Abraumhalden auf. Zusammen mit vereinzelten Gehöften und den Katen der Strumpfwirker, die sich über die ganze Gemeinde erstreckten, bildeten die Hütten dieser Bergleute – meist in Gruppen, hier und dort auch in Paaren – das Dorf Bestwood.
Dann, vor rund sechzig Jahren, setzte ein jäher Wandel ein. Die Gruben wurden von den riesigen Bergwerken der Kapitaleigner verdrängt. In Nottinghamshire und Derbyshire entdeckte man Kohle- und Eisenvorkommen. Carston, Waite & Co. traten auf den Plan. Unter gewaltiger Begeisterung eröffnete Lord Palmerston in Spinney Park am Rande des Sherwood Forest feierlich die erste Zeche der Gesellschaft.
Um diese Zeit wurde die berüchtigte Hell Row, die sich mit zunehmendem Alter einen üblen Ruf erworben hatte, niedergebrannt und mit ihr eine Menge Unrat beseitigt.
Carston, Waite & Co. merkten, dass sie auf eine Goldgrube gestoßen waren, und so wurden in den Bachtälern unterhalb von Selby und Nuttall neue Schächte niedergebracht, bis bald darauf sechs Kohlezechen in Betrieb waren. Von Nuttall, hoch oben auf dem Sandstein zwischen den Wäldern, führte eine Gleisanlage an der verfallenen Kartäuserpriorei und Robin Hood’s Well vorbei hinunter nach Spinney Park, dann weiter nach Minton, einem großen Bergwerk inmitten von Getreidefeldern, und von Minton durch das Ackerland auf der Talseite nach Bunker’s Hill; dort zweigte sie ab und verlief in nördlicher Richtung nach Beggarlee und Selby, von wo aus man nach Crich und auf die Hügel von Derbyshire blickt; sechs Zechen, die wie schwarze Sargnägel aus der Landschaft ragten, verbunden durch einen dünnen Kettenstrang, die Eisenbahn.
Um die Regimenter von Kumpeln unterzubringen, bauten Carston, Waite & Co. am Berghang von Bestwood die Squares, große viereckige Häuserblocks, und danach errichteten sie in der Bachsenke, auf dem Gelände der Hell Row, die Bottoms.
Die Bottoms bestanden aus sechs Blocks, zwei Zeilen zu je drei Blocks, wie die Punkte auf einem einfachen Sechser-Dominostein, und jeder Block wies zwölf Bergarbeiterhäuser auf. Diese Doppelzeile Wohnhäuser lag am Fuße des ziemlich steilen Berghangs von Bestwood, und zumindest von den Dachfenstern aus hatte man einen Blick auf das mählich nach Selby hin ansteigende Tal.
Die Häuser selbst waren solide gebaut und sehr anständig bemessen. Wenn man um sie herumspazierte, sah man in den Schattenlagen des untersten Blocks kleine Vorgärten mit Aurikeln und Steinbrech, im sonnigen obersten Block solche mit Bart- und Landnelken; man sah saubere Vorderfenster, kleine Vorbauten, niedrige Ligusterhecken und die Mansardenfenster der Dachkammern. Allein, das war von draußen; das war der Blick auf die unbewohnten guten Stuben aller Bergmannsfrauen. Der eigentliche Wohnraum, die Küche, lag auf der Rückseite des Hauses, und von dort ging der Blick auf den Hof zwischen den Blocks, auf einen schäbigen Hintergarten und weiter auf die Abtritte. Und zwischen den Häuserzeilen, zwischen den langen Reihen von Abtritten, verlief die Gasse, wo die Kinder spielten, die Frauen schwatzten und die Männer rauchten. So waren die tatsächlichen Lebensbedingungen in den Bottoms, solide gebaut und so hübsch anzusehen, doch recht unzuträglich, denn die Menschen mussten in ihren Küchen wohnen, und die Küchen führten auf die schmutzige Gasse mit den Abtritten.
Mrs Morel war durchaus nicht darauf versessen, in die Bottoms zu ziehen, die nun bereits zwölf Jahre alt waren und zusehends verfielen, als sie von Bestwood herabstieg. Aber etwas Besseres konnte sie sich nicht leisten. Überdies hatte sie ein Haus am Ende eines der obersten Blocks, somit nur einen Nachbarn und auf der anderen Seite einen zusätzlichen Streifen Garten. Und da sie ein Endhaus bewohnte, stand sie bei den Frauen in den »Zwischenhäusern« in dem Geruch, etwas Vornehmeres zu sein, betrug ihre Wochenmiete doch fünfeinhalb Shilling statt fünf. Freilich bot dieser Rangunterschied Mrs Morel nur geringen Trost.
Sie war einunddreißig Jahre alt und seit acht Jahren verheiratet. Eine eher kleinwüchsige Frau, von zartem Körperbau, aber entschlossener Haltung, scheute sie vor der ersten Begegnung mit den Frauen der Bottoms ein wenig zurück. Im Juli war sie gekommen, und im September erwartete sie ihr drittes Kind.
Ihr Mann war Bergarbeiter. Sie waren erst drei Wochen in ihrem neuen Zuhause, als die Kirmes, oder der Jahrmarkt, begann. Morel, das wusste sie, würde sich bestimmt freinehmen. Am Montag, dem Tag des Jahrmarkts, ging er frühmorgens aus dem Haus. Die beiden Kinder waren in heller Aufregung. William, der Siebenjährige, riss gleich nach dem Frühstück aus, um auf dem Rummelplatz herumzustrolchen, und ließ Annie zurück, die erst fünf war und den ganzen Vormittag über quengelte, weil sie unbedingt mitgehen wollte. Mrs Morel verrichtete ihre Arbeit. Mit ihren Nachbarinnen hatte sie noch keine rechte Bekanntschaft geschlossen und wusste nicht, wem sie die Kleine anvertrauen konnte. Daher versprach sie ihr, sie nach dem Mittagessen zur Kirmes mitzunehmen.
William tauchte um halb eins wieder auf. Er war ein sehr lebhafter Junge, hellhaarig, sommersprossig, und sah ein wenig wie ein Däne oder Norweger aus.
»Kann ich mein Essen kriegen, Mutter?«, rief er, als er, die Mütze auf dem Kopf, hereinstürzte. »Weil um halb zwei geht’s los, hat der Mann gesagt.«
»Du kannst dein Essen kriegen, wenn’s so weit ist«, erwiderte die Mutter.
»Isses denn noch nich so weit?«, rief er und starrte sie aus seinen blauen Augen entrüstet an. »Dann geh ich eben ohne.«
»Das lässt du hübsch bleiben. In fünf Minuten ist es so weit. Es ist erst halb eins.«
»Aber die fangen gleich an«, rief der Junge. Fast brüllte er.
»Du wirst schon nicht gleich sterben, wenn sie anfangen«, sagte die Mutter. »Außerdem ist es erst halb eins, du hast also noch eine gute Stunde.«
Hastig begann der Junge den Tisch zu decken, und dann setzten die drei sich hin. Gerade aßen sie Yorkshire Pudding mit Marmelade, als der Junge von seinem Stuhl aufsprang und vollkommen reglos stehen blieb. Aus der Ferne konnte man das erste leise Geschmetter eines Karussells hören und das Tröten eines Horns. Sein Gesicht zitterte, als er seine Mutter ansah.
»Hab ich’s dir nich gesagt?«, rief er und rannte zum Geschirrschrank, auf dem seine Mütze lag.
»Nimm den Pudding in die Hand – es ist erst fünf nach eins – hast dich also geirrt – hast ja noch gar nicht deine zwei Pence«, rief die Mutter in einem Atemzug.
Bitter enttäuscht kam der Junge zurück, um seine zwei Pence in Empfang zu nehmen, dann ging er wortlos davon.
»Ich will auch hin, ich will auch hin«, sagte Annie und begann zu weinen.
»Du kannst ja hin, du kleiner Brüllaffe«, sagte die Mutter. Und später am Nachmittag stapfte sie mit ihrem Kind an der hohen Hecke entlang den Hügel hinauf. Auf den Wiesen wurde das Heu eingebracht, das Vieh auf die Stoppelfelder getrieben. Es war warm, friedlich.
Mrs Morel mochte die Kirmes gar nicht. Es gab zwei Ringelspiele, eines dampfbetrieben, das andere von einem Pony gezogen; drei Drehorgeln plärrten, und von dort drüben ertönten vereinzelt krachende Pistolenschüsse, die gräulich schnarrende Rassel des Kokosnussmannes, das Gebrüll des Wurfbudenbesitzers, das gellende Geschrei der Guckkastendame. Die Mutter sah ihren Sohn, wie er vor der Bude des Löwen Wallace hingerissen die Bilder dieser berühmten Bestie betrachtete, die einen Schwarzen zerfleischt und zwei Weiße zeitlebens zu Krüppeln gemacht hatte. Sie ließ ihn stehen und ging weiter, um Annie Karamellbonbons zu kaufen. Mit einem Mal stand der Junge hellauf begeistert vor ihr.
»Hast ja gar nich gesagt, dass du kommst – hier is vielleicht was los – der Löwe da hat drei Männer umgebracht – meine zwei Pence hab ich schon ausgegeben – guck mal hier –«
Er zog zwei Eierbecher mit aufgemalten rosa Moosröschen aus der Tasche.
»Die hab ich von der Bude, wo du so Murmeln in so Löcher rollen musst – die beiden hab ich schon nach zwei Versuchen gewonnen – ’n halben Penny pro Versuch – da sind Moosröschen aufgemalt, guck mal! Die wollt ich haben.«
Sie wusste, dass er sie für sie haben wollte.
»Hm!«, sagte sie erfreut. »Die sind aber hübsch!«
»Kannst du sie tragen? Ich hab Angst, sie kaputtzumachen.«
Jetzt, wo sie gekommen war, zappelte er vor Aufregung, führte sie über den Rummelplatz, zeigte ihr alles. Vor dem Guckkasten erklärte sie ihm die Bilder mit Hilfe einer Art Geschichte, der er gebannt zuhörte. Die ganze Zeit über wich er nicht von ihrer Seite, strotzte vor Stolz auf sie, dem Stolz eines kleinen Jungen. Denn keine der anderen Frauen sah so damenhaft aus wie sie, in ihrem kleinen schwarzen Hut und ihrem Mantel. Sie lächelte, wenn sie Frauen begegnete, die sie kannte.
Als sie ermüdete, sagte sie zu ihrem Sohn:
»Na, kommst du jetzt schon mit oder erst später?«
»Willst du denn schon gehen?«, rief er mit vorwurfsvollem Blick.
»›Schon‹? – Es ist nach vier, das weiß ich.«
»Wieso willst du denn schon gehen?«, jammerte er.
»Du brauchst ja nicht mitzukommen, wenn du nicht willst«, sagte sie.
Und langsam ging sie mit ihrer kleinen Tochter davon, während ihr Sohn stehen blieb und ihr nachsah. Es zerriss ihm das Herz, sie ziehen zu lassen, und doch konnte er der Kirmes nicht den Rücken kehren. Als sie über den freien Platz vor dem Moon & Stars ging, hörte sie lärmende Männerstimmen und roch das Bier, und sie beschleunigte ihre Schritte ein wenig, da sie ihren Mann in der Schenke vermutete.
Gegen halb sieben kam ihr Sohn nach Hause, inzwischen müde, recht blass und ein wenig bekümmert.
»Siehst du«, sagte sie und tat so, als sei sie leicht böse auf ihn, »wenn du fünf Minuten später gekommen wärst, hätte ich schon alles abgeräumt. Zu anderen Zeiten wärst du mir schon vor Stunden verhungert –«
Und sie setzte ihm sein Abendessen vor. Ihm war elend zumute, auch wenn er es nicht wusste, denn er hatte sie allein ziehen lassen. Seit sie fort war, hatte ihm die Kirmes keinen Spaß mehr gemacht.
»War mein Papa schon da?«, fragte er.
»Nein«, antwortete seine Mutter.
»Er hilft im Moon & Stars beim Bedienen. Hab ihn durchs Fenster gesehen, durch die schwarzen Blechdinger mit den Löchern drin, er hatte die Ärmel aufgekrempelt –«
»Ha!«, rief die Mutter barsch. »Er hat doch gar kein Geld. Aber er wird schon zufrieden sein, wenn er sein Freibier bekommt, ob sie ihm nun etwas mehr geben oder nicht.«
Im Schlafzimmer ihrer Mutter durften die Kinder sich ans Fenster setzen und zuschauen, wie die Leute mit Spielzeug vom Basar nach Hause kamen, und sie lauschten dem Geschmetter der Musik, dem Geschrei, dem Krachen der Schüsse, dem schwachen Peng der dünnen eisernen Zielscheibe. Dann wurden sie endlich schläfrig und gingen zu Bett.
Als es zu dunkeln begann und Mrs Morel ihre Näharbeit nicht mehr sehen konnte, stand sie auf und ging zur Tür. Überall herrschte aufgeregter Lärm, die Rastlosigkeit des Festtages, von der zuletzt auch sie sich anstecken ließ. Sie trat in den Seitengarten hinaus. Frauen kamen von der Kirmes nach Hause, Kinder drückten ein weißes Lamm mit grünen Beinen an die Brust oder ein hölzernes Pferd. Hin und wieder stolperte ein sturzbetrunkener Mann vorbei. Zuweilen kam ein braver Ehemann friedlich mit den Seinen daher. Aber gewöhnlich waren die Frauen und Kinder allein. Die zu Hause gebliebenen Mütter standen, die Arme unter ihren weißen Schürzen verschränkt, in der sinkenden Dämmerung an den Ecken der Gasse und schwatzten.
Auch Mrs Morel war allein, aber das war sie gewohnt. Oben schliefen ihr Sohn und ihre kleine Tochter, und so hatte sie das Gefühl, als läge ihr Zuhause fest und sicher hinter ihr. Aber das künftige Kind machte sie elend. Die Welt schien ein trister Ort, an dem ihr nichts mehr bevorstand – jedenfalls nicht, solange William nicht erwachsen war. Aber für sie selbst gab es nichts als dieses triste Erdulden – bis die Kinder erwachsen wären. Und die Kinder! Dieses dritte konnte sie sich gar nicht leisten. Sie wollte es nicht. Der Vater schenkte in einem Wirtshaus Bier aus und soff sich dabei voll, bis er sturzbetrunken war. Sie verachtete ihn und war doch an ihn gefesselt. Dieses künftige Kind war zu viel für sie. Wären nicht William und Annie gewesen, der ständige Kampf gegen Armut, Hässlichkeit und Gemeinheit hätte sie angeekelt.
Sie trat in den Vorgarten, zu bedrückt, um auszugehen, aber außerstande, im Haus zu bleiben. Die Hitze erstickte sie. Und wenn sie ihr zukünftiges Leben bedachte, hatte sie das Gefühl, lebendig begraben zu sein.
Der Vorgarten war ein kleines Viereck mit einer Ligusterhecke. Dort stand sie nun und versuchte, sich mit dem Duft der Blumen und dem schwindenden schönen Abend zu besänftigen. Gegenüber der kleinen Pforte lag der Zauntritt, der zum Hügel hinaufführte, entlang der hohen Hecke und durch die leuchtende Glut der gemähten Wiesen. Über ihr flimmerte und pulste der Himmel vor Licht. Rasch sank die Glut von den Wiesen, Erde und Hecken verströmten Abenddämmer. Als es immer dunkler wurde, legte sich ein rötlicher Glanz auf die Kuppe, und aus dem Glanz drang der abklingende Lärm des Jahrmarkts.
Mitunter kamen Männer durch die düstere Mulde, die der Pfad unter den Hecken bildete, nach Hause geschwankt. Auf dem steilen Gefälle, mit dem der Hügel endete, geriet ein junger Mann ins Rutschen und schlug krachend gegen den Zauntritt. Mrs Morel schauerte zusammen. Er rappelte sich auf und stieß heftige Verwünschungen aus, aber eher kläglich, als glaube er, dass der Zauntritt ihm absichtlich weh tun wollte.
Sie trat wieder ins Haus und fragte sich, ob sich denn nie etwas ändern würde. Allmählich begriff sie, dass es sich so verhielt. Ihre Mädchenzeit schien in weiter Ferne zu liegen, so dass sie sich fragte, ob diejenige, die jetzt schweren Herzens durch den Hintergarten in den Bottoms ging, und diejenige, die zehn Jahre zuvor so leichtfüßig über den Wellenbrecher in Sheerness gehüpft war, wirklich ein und dieselbe Person waren.
»Was habe ich damit zu schaffen?«, fragte sie sich. »Was habe ich mit alledem zu schaffen? Selbst mit dem Kind, das ich bekommen werde? Ich zähle anscheinend gar nicht.«
Manchmal packt einen das Leben, reißt den Leib mit sich fort, vollendet die eigene Geschichte und ist doch nicht wirklich, sondern lässt das Ich so zurück, als wäre es verwischt.
»Ich warte«, sagte sich Mrs Morel. »Ich warte, und das, worauf ich warte, tritt niemals ein.«
Dann räumte sie die Küche auf, zündete die Lampe an, bedeckte das Kaminfeuer mit Asche, suchte die Wäsche für den nächsten Tag zusammen und weichte sie ein. Anschließend setzte sie sich wieder an ihre Näharbeit. Lange Stunden flitzte ihre Nadel gleichmäßig durch den Stoff. Ab und zu seufzte sie und dehnte sich, um sich Erleichterung zu verschaffen. Und die ganze Zeit überlegte sie, wie sie mit dem, was sie hatte, zurechtkommen konnte, den Kindern zuliebe.
Um halb zwölf kam ihr Mann. Seine Wangen waren gerötet und glänzten stark über dem schwarzen Schnauzbart. Sein Kopf nickte leicht. Er war sehr mit sich zufrieden.
»Oh! – Oh! – Haste auf mich gewartet, Mädchen? Hab Anthony geholfen, und was glaubste, was der mir gegeben hat? Nur ’ne lumpige halbe Krone, und nich ’n Penny mehr –«
»Der denkt sich, dass du den Rest in Bier gekriegt hast«, sagte sie barsch.
»Hab ich nich – hab ich nich – glaub mir, hab heut ganz wenig getrunken, nur ganz wenig.« Seine Stimme wurde zärtlich. »Hier, hab dir ’n Ingwerröllchen mitgebracht und ’ne Kokosnuss für die Kinder.« Er legte das Ingwerröllchen und die Kokosnuss, ein haariges Ding, auf den Tisch. »Na, hast wohl noch nie im Leben für was danke gesagt, oder?«
Um ihm entgegenzukommen, hob sie die Kokosnuss hoch und schüttelte sie, um zu prüfen, ob sie Milch enthielt.
»Is ’ne gute, kannste dein Leben drauf verwetten. Hab sie von Bill Hodgkisson. ›Bill‹, sag ich, ›die drei Nüsse brauchste doch nich, oder? – Kannste mir nich eine abgeben für meinen Buben und mein Mädel?‹ ›Mach ich, Walter, mein Junge‹, sagt er, ›such dir eine aus, die du magst.‹ Da hab ich mir eine genommen und mich bedankt. Ich wollt sie nicht vor seinen Augen schütteln, aber er sagt: ›Sieh zu, dass es ’ne gute is, Walt‹ – Und siehste, da wusst ich, dass es ’ne gute war. – ’n netter Kerl, der Bill Hodgkisson, ’n netter Kerl.«
»Ein Mann trennt sich von allem, solange er betrunken ist, und du bist genauso betrunken wie er«, sagte Mrs Morel.
»Ach, du kleines Drecksluder, wer is ’n hier betrunken, möcht ich mal wissen?«, sagte Morel. Er war überaus zufrieden mit sich, weil er heute im Moon & Stars beim Bedienen geholfen hatte, und schwadronierte immer weiter.
Mrs Morel war sehr müde und hatte sein Gebabbel satt. Während er die Glut zusammenscharrte, ging sie so schnell wie möglich zu Bett.
Mrs Morel entstammte einer guten alten Bürgerfamilie, berühmten Independenten, die noch mit Oberst Hutchinson gefochten hatten und stramme Kongregationalisten geblieben waren. Ihr Großvater hatte Bankrott gemacht, als der Markt für Spitze zusammengebrochen war und viele Spitzefabrikanten in Nottingham zugrunde gerichtet hatte. Ihr Vater, George Coppard, war Maschinenschlosser gewesen, ein großer, schöner, hochmütiger Mann, stolz auf seine helle Haut und seine blauen Augen, noch stolzer aber auf seine Rechtschaffenheit. Mit ihrem kleinen Wuchs ähnelte Gertrude ihrer Mutter. Doch ihr stolzes und unnachgiebiges Temperament hatte sie von den Coppards.
George Coppard haderte bitterlich mit seiner Armut. Er wurde Vorarbeiter der Maschinenschlosser auf der Werft von Sheerness. Mrs Morel – Gertrude – war seine zweite Tochter. Sie glich ihrer Mutter, liebte ihre Mutter über alles, hatte aber die klaren, trotzig blauen Augen und die breite Stirn der Coppards. Sie erinnerte sich, wie sehr sie das anmaßende Auftreten ihres Vaters gegenüber ihrer sanftmütigen, humorvollen, gutherzigen Mutter gehasst hatte. Sie erinnerte sich, wie sie über den Wellenbrecher in Sheerness gelaufen war und das Boot gefunden hatte. Sie erinnerte sich, wie sie von all den Männern verhätschelt und umschmeichelt worden war, wenn sie auf die Werft kam, denn sie war ein zartes, wenn auch ziemlich stolzes Kind gewesen. Sie erinnerte sich an die verschrobene alte Lehrerin, deren Helferin sie geworden und der sie in ihrer Privatschule so gern zur Hand gegangen war. Und die Bibel, die John Field ihr geschenkt hatte, besaß sie noch immer. Als sie neunzehn Jahre zählte, war sie nach dem Gottesdienst immer mit John Field nach Hause gegangen. Er war Sohn eines wohlhabenden Kaufmanns, hatte in London die höhere Schule besucht und sollte sich dem Geschäft widmen.
In allen Einzelheiten war ihr ein Sonntagnachmittag im September in Erinnerung, als sie unter der Weinrebe hinter dem Haus ihres Vaters gesessen hatten. Die Sonne drang durch die Lücken zwischen den Weinblättern und bildete wunderhübsche Muster, als fiele auf ihn und sie ein Kopftuch aus Spitze herab. Einige der Blätter waren ein reines Gelb, wie flache gelbe Blumen.
»Bleiben Sie still sitzen«, hatte er gerufen. »Ihr Haar, ich weiß nicht, wie es überhaupt aussieht! Es leuchtet wie Kupfer und Gold, so rot wie gebranntes Kupfer, und wo die Sonne draufscheint, hat es Goldfäden. Stellen Sie sich nur vor, dabei sagt man, es wäre braun. Ihre Mutter nennt es mausfarben.«
Sie hatte den Blick seiner glänzenden Augen aufgefangen, doch ihr klares Antlitz verriet kaum die freudige Erregung, die in ihr emporstieg.
»Aber Sie sagen doch immer, Sie machen sich nichts aus dem Geschäft?«, fuhr sie fort.
»Tu ich auch nicht – der Gedanke ist mir zuwider«, rief er hitzig.
»Und dass Sie gern ein geistliches Amt bekleiden würden«, beschwor sie ihn.
»Würde ich auch – würde ich sehr gern, wenn ich das Gefühl hätte, einen ausgezeichneten Prediger abzugeben.«
»Warum tun Sie es dann nicht – warum tun Sie es dann nicht?« Ihre Stimme klang herausfordernd. »Wenn ich ein Mann wäre, nichts sollte mich daran hindern.«
Sie hatte den Kopf erhoben – fast fürchtete er sich vor ihr.
»Aber mein Vater ist so halsstarrig. Er will mich ins Geschäft stecken, und ich weiß, er wird’s tun.«
»Aber wenn Sie ein Mann wären –!«, rief sie.
»Ein Mann zu sein ist nicht alles«, entgegnete er und runzelte verwirrt und ratlos die Stirn.
Nun, da sie in den Bottoms ihrer Arbeit nachging und ihre Erfahrungen damit hatte, was es hieß, ein Mann zu sein, verstand sie, dass es tatsächlich nicht alles war.
Mit zwanzig hatte sie Sheerness ihrer Gesundheit wegen verlassen. Ihr Vater war wieder nach Nottingham gezogen, John Fields Vater ruiniert, der Sohn Lehrer in Norwood geworden. Sie hörte nichts mehr von ihm, bis sie zwei Jahre später entschlossen Nachforschungen anstellte. Er hatte seine Wirtin geheiratet, eine Frau von vierzig Jahren, eine vermögende Witwe.
Dennoch hatte Mrs Morel John Fields Bibel aufgehoben. Sie glaubte nicht mehr daran, dass er – nun, sie verstand recht gut, was er hätte werden können und was nicht. So hatte sie seine Bibel aufgehoben, und um ihrer selbst willen bewahrte sie ihm ein Andenken in ihrem Herzen. Fünfunddreißig Jahre lang, bis an ihr Lebensende, sprach sie nie wieder von ihm.
Als sie dreiundzwanzig Jahre alt war, begegnete sie auf einer Weihnachtsfeier einem jungen Mann aus dem Erewash Valley. Damals war Morel siebenundzwanzig Jahre alt, gutgewachsen, kerzengerade und sehr gepflegt. Er hatte gewelltes, glänzend schwarzes Haar und einen kräftigen schwarzen Bart, der noch nie gestutzt worden war. Seine Wangen waren gerötet, und sein feuchter roter Mund fiel auf, weil Morel so oft und herzlich lachte. Er besaß etwas Seltenes: ein volltönendes Lachen. Fasziniert hatte Gertrude Coppard ihn beobachtet. Er war so munter und lebhaft, seine Stimme wechselte so mühelos ins Komisch-Groteske, gegen jedermann war er so schlagfertig und vergnüglich. Ihr Vater besaß einen nie versiegenden Vorrat an Humor, aber der war bissig. Der Humor dieses Mannes war ganz anders: weich, unintellektuell, warm, eine Art Possenreißerei.
Sie war das genaue Gegenteil: ein neugieriger, empfänglicher Geist, der viel Freude und Vergnügen daran empfand, anderen Menschen zuzuhören. Sie verstand es, die Leute zum Reden zu bringen. Sie liebte Ideen und galt als sehr intelligent. Den größten Spaß machten ihr Streitgespräche über Religion, Philosophie oder Politik mit irgendeinem gebildeten Mann. Allerdings war dazu nur selten Gelegenheit. Deshalb sorgte sie dafür, dass die Leute ihr von sich erzählten, und fand daran Freude.
Was ihr Äußeres betraf, so war sie eher klein und zierlich, mit einer hohen Stirn und einer Fülle herabfallender seidig-brauner Locken. Ihre blauen Augen blickten ganz offen, ehrlich und forschend. Sie hatte die schönen Hände der Coppards. Ihre Kleidung war stets dezent. Sie trug dunkelblaue Seide, dazu eine eigentümliche Silberkette mit silbernen Muscheln. Diese und eine schwere Brosche aus geflochtenem Gold waren ihr einziger Schmuck. Sie war noch gänzlich unberührt, zutiefst religiös und von wunderbarem Freimut.
Walter Morel schien vor ihr dahinzuschmelzen. Für den Bergmann war sie jenes geheimnisvolle, zauberhafte Wesen: eine Dame. Wenn sie mit ihm redete, dann mit südenglischer Aussprache und einem reinen Englisch, das ihn elektrisierte. Sie beobachtete ihn. Er tanzte gut, als habe er eine natürliche Freude am Tanzen. Sein Großvater war ein französischer Flüchtling gewesen, der eine englische Serviererin geheiratet hatte – falls man von einer Heirat sprechen konnte. Gertrude Coppard beobachtete den jungen Bergmann beim Tanz: Auf seinen Bewegungen lag wie ein Glanz eine Art zarter Jubel, das gerötete Gesicht, in das ihm das schwarze Haar fiel, war die Blüte seines Leibes, und immerfort lachte er, zu welcher Partnerin er sich auch herabbeugte. Sie fand ihn herrlich, denn einem wie ihm war sie noch nie begegnet. Für sie hatte ihr Vater alles Männliche verkörpert. Und George Coppard, von stolzer Körperhaltung, gutaussehend und ziemlich verbittert, ein Mann, der am liebsten in theologischen Büchern las und sich seelisch nur zu einem Menschen, dem Apostel Paulus, hingezogen fühlte, der im Hause ein hartes Regiment führte und bei Vertraulichkeiten spöttelte, der sich jedes sinnliche Vergnügen versagte – er war so ganz anders als dieser Bergmann. Gertrude selbst verachtete das Tanzen eher, sie verspürte nicht die geringste Neigung zu dieser Kunst und hatte nicht einmal den Roger de Coverly gelernt. Sie war Puritanerin wie ihr Vater, hochgesinnt und äußerst streng. Daher erschien ihr die dunkle, goldene Weichheit der sinnlichen Lebensflamme dieses Mannes, die seinem Körper entströmte wie einer Kerze die Flamme und die, anders als ihr eigenes Leben, nicht von Geist und Gemüt verwirrt und zum Glühen gebracht wurde, wie etwas Wundervolles, Rätselhaftes.
Er kam und beugte sich zu ihr herab. Eine Wärme durchstrahlte sie, als habe sie Wein getrunken.
»Nun kommen Sie schon, tanzen Sie mit mir«, sagte er zärtlich. »Ist ganz leicht, wissen Sie. Ich würde Sie zu gern tanzen sehen.«
Schon vorher hatte sie ihm gesagt, sie könne nicht tanzen. Sie sah seine Demut und lächelte. Ihr Lächeln war sehr schön. Es rührte den Mann so sehr, dass er alles andere vergaß.
»Nein, ich tanze nicht«, sagte sie leise. Ihre Worte klangen makellos.
Ohne zu wissen, was er tat – oft tat er instinktiv das Richtige –, setzte er sich neben sie und verneigte sich ehrerbietig.
»Aber Sie dürfen Ihren Tanz nicht versäumen«, tadelte sie ihn.
»Nee, den mag ich nich tanzen – aus dem mach ich mir nichts.«
»Aber eben haben Sie mich doch noch aufgefordert.«
Darüber musste er herzlich lachen.
»Hatte ich ganz vergessen. Sie brauchen nich lange, um mir auf die Schliche zu kommen.«
Jetzt war es an ihr, rasch aufzulachen.
»Sie sehen mir nicht so aus, als würden Sie schleichen«, sagte sie.
»Na ja, ’n Schleicher bin ich nich, ich schleich nur, wo ich nich tanzen kann«, lachte er ziemlich ausgelassen. »Haben Sie denn gar nichts zu trinken?«, fragte er dann.
»Nein, danke – ich habe überhaupt keinen Durst.«
Er zögerte – erriet, dass sie Abstinenzlerin war – und fühlte sich zurückgewiesen.
Dann stellte er eine Reihe höflicher, interessierter Fragen. Sie antwortete ihm fröhlich. Er schien drollig.
»Und Sie sind Bergmann!«, rief sie überrascht aus.
»Jawohl. Bin schon mit zehn eingefahren.«
Verwundert, bestürzt sah sie ihn an.
»Schon mit zehn! War das nicht sehr anstrengend?«, fragte sie.
»Da gewöhnt man sich schnell dran. Man lebt wie die Mäuse, und nachts steckt man den Kopf raus, um zu sehn, was vor sich geht.«
»Ich fühle mich jetzt schon blind«, sagte sie stirnrunzelnd.
»Wie ’n Maulwurf!«, lachte er. »Jawohl, und ’s gibt Burschen, die laufen rum wie die Maulwürfe.« Er streckte das Gesicht vor wie die Schnauze eines blinden Maulwurfs, der schnüffelnd und blinzelnd nach dem Weg sucht. »Tun sie wirklich!«, beteuerte er naiv. »Wie die sich reinwühln, so was haste noch nich gesehn. Aber ich muss dich mal mit runternehmen, dann kannste’s mit eignen Augen sehn.«
Erschrocken blickte sie ihn an. Plötzlich tat sich ein ganz neuer Lebensraum vor ihr auf. Sie sah das Leben der Bergleute vor sich, sah Hunderte von ihnen unter der Erde arbeiten und abends wieder nach oben kommen. Er schien ihr erhaben. Täglich setzte er frohgemut sein Leben aufs Spiel. Sie blickte ihn an, und in ihrer reinen Demut lag etwas Flehendes.
»Hättste nich Lust?«, fragte er zärtlich. »Vielleicht ja nich, da würdste dreckig bei.«
Noch nie zuvor war sie gleich geduzt worden.
Weihnachten darauf heirateten sie, und drei Monate lang war sie vollkommen glücklich, sechs Monate lang sehr glücklich.
Er hatte das Gelübde unterschrieben und trug das blaue Band der Temperenzler; er prahlte gern. Sie glaubte, dass sie in seinem eigenen Haus wohnten. Es war klein, aber zweckdienlich und recht hübsch eingerichtet, mit soliden, haltbaren Möbeln, die ihrem ehrlichen Gemüt zusagten. Ihre Nachbarinnen waren ihr ziemlich fremd, und Morels Mutter und Schwester neigten dazu, über ihr damenhaftes Wesen zu spotten. Doch solange sie ihren Mann in der Nähe wusste, konnte sie sehr wohl allein leben.
Manchmal, wenn sie das Liebesgeflüster leid hatte, versuchte sie, ihm ernstlich ihr Herz zu öffnen. Sie sah, wie er ihr rücksichtsvoll, aber ohne jedes Verständnis zuhörte. Das erstickte ihr Bemühen um tiefere Vertrautheit, und dann blitzte Furcht in ihr auf. Manchmal wurde er gegen Abend unruhig, und sie merkte, dass ihre Gegenwart ihm nicht genügte. Sie war froh, wenn er sich kleineren Arbeiten zuwandte.
Er war ein bemerkenswert geschickter Mann, alles konnte er selbst basteln oder ausbessern. So sagte sie etwa:
»Das Schüreisen deiner Mutter gefällt mir – so klein und hübsch.«
»Wirklich, Mädchen? Hab ich selbst gemacht, kann dir also auch eins machen.«
»Was? – Aber das ist doch aus Stahl –!«
»Na und? – Kriegst auch so eins, auch wenn’s nich genau das gleiche is.«
Das Durcheinander störte sie nicht, ebenso wenig das Hämmern und Lärmen. Er war beschäftigt, und er war glücklich.
Im siebenten Monat jedoch, als sie seinen Sonntagsrock ausbürstete, fühlte sie in der Brusttasche Papiere, und von plötzlicher Neugier gepackt, zog sie sie hervor, um sie zu lesen. Den Gehrock, in dem er getraut worden war, trug er nur selten, und bislang war ihr nie in den Sinn gekommen, wegen dieser Papiere Neugier zu verspüren. Es waren die Rechnungen für den Hausrat, noch unbezahlt.
»Sieh mal«, sagte sie am Abend, als er sich gewaschen und gegessen hatte. »Die hab ich in der Tasche deines Hochzeitsrocks gefunden. Hast du die Rechnungen denn noch nicht bezahlt?«
»Nein – hatte noch keine Gelegenheit.«
»Aber du hast mir doch gesagt, es wäre alles bezahlt. Am Samstag fahre ich besser nach Nottingham und bezahle sie, ich sitze nicht gern auf Stühlen, die einem anderen gehören, und esse nicht gern von einem unbezahlten Tisch.«
Er antwortete nicht.
»Ich kann doch dein Sparbuch haben?«
»Das kannste haben, wenn’s dir was nützt.«
»Ich dachte –«, begann sie. Er hatte ihr erzählt, er habe eine hübsche Stange Geld zurückgelegt. Aber sie merkte, dass es keinen Zweck hatte, Fragen zu stellen. Starr vor Bitterkeit und Empörung saß sie da.
Am nächsten Tag ging sie hinunter zu seiner Mutter.
»Hast du nicht die Möbel für Walter gekauft?«, fragte sie.
»Ja, das habe ich«, erwiderte die ältere Frau schneidend.
»Und wie viel hat er dir dafür gegeben?«
Die ältere Frau war ungehalten und entrüstet.
»Achtzig Pfund, wenn du’s unbedingt wissen willst«, antwortete sie.
»Achtzig Pfund! Aber zweiundvierzig Pfund stehen noch offen!«
»Daran kann ich auch nichts ändern.«
»Aber wo ist das ganze Geld denn hin?«
»Ich denke, du wirst die Papiere schon noch alle finden, wenn du nachsiehst – außer den zehn Pfund, die er mir schuldet, und den sechs Pfund, die die Hochzeit hier unten gekostet hat.«
»Sechs Pfund!«, wiederholte Gertrude Morel. Es kam ihr ungeheuerlich vor, dass auf Walters Kosten in seinem Elternhaus sechs Pfund für Essen und Trinken verprasst worden waren, nachdem doch schon ihr Vater so viel für die Hochzeit ausgegeben hatte.
»Und wie viel hat er in seinen Häusern angelegt?«, fragte sie.
»In seinen Häusern – was für Häusern?«
Gertrude Morel erbleichte bis in die Lippen. Er hatte ihr erzählt, das Haus, in dem er wohne, gehöre ihm ebenso wie das Nachbarhaus.
»Ich dachte, das Haus, in dem wir wohnen –«, setzte sie an.
»Das sind meine Häuser, alle beide«, sagte die Schwiegermutter. »Und noch nicht abbezahlt. Ich kann gerade mal die Hypothekenzinsen abstottern.«
Blass und stumm saß Gertrude da. Jetzt war sie ganz ihr Vater.
»Dann sollten wir dir Miete zahlen«, sagte sie kalt.
»Walter zahlt mir ja Miete«, erwiderte die Mutter.
»Und wie viel?«, fragte Gertrude.
»Sechseinhalb Shilling die Woche«, gab die Mutter zurück.
Das war mehr, als das Haus wert war. Gertrude hatte den Kopf gehoben und sah gerade vor sich hin.
»Du kannst von Glück reden«, sagte die ältere Frau bissig, »dass du einen Mann hast, der dir alle Geldsorgen abnimmt und dir freie Hand lässt.«
Die junge Ehefrau schwieg.
Zu ihrem Mann sagte sie nur sehr wenig, aber ihr Benehmen ihm gegenüber hatte sich gewandelt. Etwas in ihrer stolzen, rechtschaffenen Seele hatte sich zu Stein verhärtet.
Als es Oktober wurde, dachte sie nur noch an Weihnachten. Weihnachten vor zwei Jahren hatte sie ihn kennengelernt. Letzte Weihnachten hatte sie ihn geheiratet. Diese Weihnachten würde sie ihm ein Kind gebären.
Dank ihres freundlichen Wesens lernte sie alsbald ihre Nachbarinnen kennen, oft stand sie mit ihnen im Gespräch beisammen und hatte nur Angst, sie könnten sie wegen ihrer andersartigen Sprechweise für dünkelhaft halten, so wie seine Angehörigen es taten. Sie ließen sie immer zuerst reden, aber sie mochten sie.
»Sie selbst tanzen wohl nicht, Missis, oder?«, fragte die Nachbarin von nebenan, als im Oktober davon die Rede war, dass in Bestwood über dem Brick & Tile ein Tanzkurs eröffnet werden sollte.
»Nein – habe nie die geringste Neigung dazu verspürt«, antwortete Mrs Morel.
»Sieh einer an! Ulkig, dass Sie da ausgerechnet Ihren Mann geheiratet haben. Sie wissen doch, dass er ein ziemlich berühmter Tänzer ist.«
»Ich wusste nicht, dass er berühmt ist«, entgegnete Mrs Morel lachend.
»Doch, ist er! Über fünf Jahre hat er den Tanzkurs im Vereinsraum des Miners’ Arms geleitet.«
»Ach?«
»Aber ja.« Die andere Frau wurde immer kecker. »Und jeden Dienstag, Donnerstag und Samstag war’s brechend voll – und was man so hört, gab’s allerhand Techtelmechtel.«
So etwas war bittere Galle für Mrs Morel, und sie bekam genug davon ab. Anfangs ersparten die Frauen ihr nichts, denn sie war etwas Besseres, auch wenn sie nichts dafürkonnte.
Er fing an, ziemlich spät nach Hause zu kommen.
»Die arbeiten jetzt wohl sehr lange?«, sagte sie zu ihrer Waschfrau.
»Nicht länger als sonst auch, glaub ich. Aber bei Ellen’s halten sie eben an, trinken ’n Bier und fangen an zu reden, und dann hat man die Bescherung! – Essen eiskalt – geschieht ihnen recht.«
»Aber Mr Morel trinkt doch gar nicht.«
Die Frau ließ die Wäsche fallen und sah Mrs Morel an, dann fuhr sie wortlos mit ihrer Arbeit fort.
Gertrude Morel war sehr krank, als der Junge zur Welt kam. Morel war gut zu ihr, kreuzbrav. Aber Meilen von den Ihren entfernt, fühlte sie sich sehr einsam. Auch bei ihm fühlte sie sich jetzt einsam, und seine Gegenwart verstärkte dieses Gefühl nur noch.
Zu Beginn war der Junge klein und gebrechlich, doch er entwickelte sich rasch, ein schönes Kind mit dunkelgoldenen Ringellöckchen und dunkelblauen Augen, die allmählich in Hellgrau übergingen. Seine Mutter liebte ihn leidenschaftlich. Er kam in dem Augenblick zur Welt, als sie die Bitternis ihrer Enttäuschung kaum noch ertragen konnte, als ihr Glaube an das Leben erschüttert war und ihre Seele sich trüb und einsam fühlte. Sie machte viel Wesens um das Kind, und der Vater wurde eifersüchtig.
Schließlich verachtete Mrs Morel ihren Mann. Sie wandte sich dem Kind zu, vom Vater wandte sie sich ab. Er hatte angefangen, sie zu vernachlässigen, der Reiz des Neuen, eines eigenen Heims, war verflogen. Er hat keinen Schneid, sagte sie sich verbittert. Was er im Augenblick empfindet, gilt ihm alles. Er kann nicht bei einer Sache bleiben. Hinter all dem Getue steckt nichts.
So brach ein Kampf aus zwischen Mann und Frau, ein schrecklicher, blutiger Kampf, der erst mit dem Tod des einen endete. Sie kämpfte darum, dass er seiner Verantwortung nachkam, seine Verpflichtungen erfüllte. Aber er war so ganz anders als sie. Seine Natur war rein sinnlich, und sie trachtete danach, ihn moralisch, ihn religiös zu machen. Sie wollte ihn dazu zwingen, der Wirklichkeit ins Auge zu sehen. Das konnte er nicht ertragen – es brachte ihn um den Verstand.
Solange das Baby noch klein war, geriet der Vater so leicht in Wut, dass kein Verlass mehr auf ihn war. Das Kind brauchte nur für etwas Unruhe zu sorgen, und schon tobte der Mann. Etwas mehr, und die harten Bergmannsfäuste schlugen den Jungen. Dann hasste Mrs Morel ihren Mann, hasste ihn tagelang; und er ging aus dem Haus und trank; und ihr war es gleichgültig, was er trieb. Aber wenn er zurückkehrte, ließ sie ihn ihren vernichtenden Hohn spüren.
Die Entfremdung zwischen ihnen veranlasste ihn, sie, ob wissentlich oder nicht, auch da schwer zu beleidigen, wo er es sonst nicht getan hätte. William, der Kleine, war gerade ein Jahr alt, lernte eben laufen und hübsche Dinge sagen. Er war ein reizendes Kind und hatte noch immer die wuscheligen Knabenlocken, die mittlerweile nachdunkelten. Er hing sehr an seinem Vater, der, wenn ihm der Sinn danach stand, liebevoll, nachsichtig und einfallsreich sein konnte, um das Kind zu amüsieren. Die beiden spielten zusammen, und Mrs Morel fragte sich, wer von beiden das wahre Kind sei.
Morel stand, ob Feier- oder Arbeitstag, immer beizeiten auf, gegen fünf oder sechs Uhr früh. Sonntagmorgens erhob er sich und machte Frühstück. Das Kaminfeuer ließ er nie ausgehen. Erst zur Schlafenszeit wurde es mit Asche bedeckt. Das heißt, ein großes Stück Kohle wurde daraufgelegt, das bis zum Morgen fast durchgebrannt war. Sonntagmorgens stand das Kind immer zusammen mit seinem Vater auf, während die Mutter noch eine Stunde oder so im Bett liegen blieb. So war sie, wenn Vater und Kind unten plauderten und spielten, ausgeruhter als zu jeder anderen Zeit.
William war also erst ein Jahr alt, und seine Mutter war stolz auf ihn, so hübsch sah er aus. Sie hatte nicht viel Geld, aber der Junge wurde von ihren Schwestern eingekleidet. Mit seinem kleinen weißen Hütchen, auf dem eine Straußenfeder wippte, und seinem weißen Mantel, mit den Ringellöckchen, die seinen Kopf dicht umrahmten, war er ihre ganze Freude. Eines Sonntagmorgens lag Mrs Morel im Bett und lauschte dem Geplapper der beiden. Dann schlummerte sie wieder ein. Als sie nach unten kam, glühte ein großes Feuer auf dem Rost, das Zimmer war warm, das Frühstück nachlässig aufgedeckt. Morel saß leicht verängstigt auf seinem Lehnstuhl vor dem Kamin, zwischen seinen Beinen stand – geschoren wie ein Schaf, mit seltsam rundem Schädel – das Kind und sah sie verwundert an, und auf einer Zeitung, die auf dem Kaminvorleger ausgebreitet war, lagen im rötlichen Schein des Feuers unzählige sichelförmige Locken verstreut, wie die Blütenblätter einer Ringelblume.
Reglos stand Mrs Morel da. Es war ihr erstes Kind. Sie wurde kreideweiß und konnte nicht sprechen.
»Na, was hältste von ihm?« Morel lachte unbehaglich.
Sie ballte beide Fäuste, hob sie und trat auf ihn zu. Morel wich zurück.
»Ich könnte dich umbringen!«, rief sie. Sie erstickte vor Wut, hatte noch immer die Fäuste gehoben.
»Du willst doch wohl kein Mädchen aus ihm machen?«, fragte Morel in erschrockenem Tonfall und senkte den Kopf, um seine Augen vor ihr zu schützen. Das Lachen war ihm vergangen.
Die Mutter blickte auf den zerklüfteten, kurzgeschorenen Schädel ihres Kindes. Sie legte ihm die Hände aufs Haar und streichelte und liebkoste seinen Kopf.
»Ach – mein Junge! –« Sie stockte. Ihre Lippen bebten, ihr Gesicht zerfiel fast, und sie riss das Kind an sich, vergrub das Gesicht an seiner Schulter und weinte schmerzlich. Sie war eine jener Frauen, die nicht weinen können, denen das Weinen ebenso weh tut wie einem Mann. Ihr Schluchzen hörte sich an, als würde ein Stück von ihr herausgerissen. Morel saß da, die Ellbogen auf die Knie gestützt, die Hände so verkrampft, dass die Knöchel weiß anliefen. Er stierte ins Feuer und fühlte sich wie gelähmt, als könne er nicht atmen.
Sogleich verstummte sie, beschwichtigte das Kind – und räumte den Frühstückstisch ab. Die mit Locken übersäte Zeitung ließ sie ausgebreitet auf dem Kaminvorleger liegen. Schließlich hob ihr Mann sie auf und legte sie aufs Feuer. Ganz still, mit zusammengepresstem Mund, ging sie ihrer Arbeit nach. Morel war kleinlaut. Kläglich schlich er umher, und seine Mahlzeiten an diesem Tag waren eine Qual. Sie sprach höflich mit ihm, und nie wieder erwähnte sie, was er getan hatte. Aber er spürte, dass sich etwas Endgültiges ereignet hatte.
Hinterher sagte sie sich, sie sei albern gewesen, früher oder später hätten dem Jungen die Haare ohnehin geschnitten werden müssen. Zu guter Letzt rang sie sich dazu durch, ihrem Mann zu sagen, es sei schon recht, dass er den Friseur gespielt habe. Aber sie wusste doch, und Morel wusste es auch, dass diese Tat etwas Folgenschweres in ihrer Seele ausgelöst hatte. Ihr ganzes Leben lang erinnerte sie sich an die Szene als diejenige, unter der sie am stärksten gelitten hatte.
Diese aus männlicher Taktlosigkeit geborene Tat war die Lanze in ihrer Seite, das Ende ihrer Liebe zu Morel. Mochte sie zuvor erbittert gegen ihn angekämpft haben, so hatte sie sich doch seinetwegen gequält, so als wäre er nur auf Abwege geraten. Nun hörte sie auf, sich seiner Liebe wegen zu quälen: Er war ihr fremd geworden. Auf diese Weise wurde das Leben viel erträglicher.
Dennoch rang sie auch weiterhin mit ihm. Noch immer hatte sie ihr hohes moralisches Bewusstsein, das Erbteil ganzer Generationen von Puritanern. Inzwischen war es ein religiöser Instinkt, und Morel gegenüber führte sie sich wie eine Fanatikerin auf, da sie ihn liebte oder doch einmal geliebt hatte. Wenn er sündigte, marterte sie ihn. Wenn er trank oder log, oft eine Memme, manchmal ein Schuft, schwang sie gnadenlos die Peitsche.
Ein Jammer, dass sie das genaue Gegenteil von ihm war. Mit dem wenigen, was er sein konnte, wollte sie sich nicht zufriedengeben, wollte ihn so haben, wie er sein sollte. Und in dem Bemühen, ihn edler zu machen, als er sein konnte, zerstörte sie ihn. Sie selbst schädigte sich, kränkte sich und entstellte sich, verlor aber nichts von ihrem Wert. Außerdem hatte sie ja die Kinder.
Er trank reichlich, wenn auch nicht mehr als viele andere Bergleute und immer nur Bier, so dass seine Gesundheit zwar angegriffen, aber nicht wirklich untergraben war. Die meisten Gelage fanden an den Wochenenden statt. Jeden Freitag-, Samstag- und Sonntagabend saß er bis zur Sperrstunde im Miners’ Arms. Montags und dienstags musste er schon gegen zehn Uhr aufstehen und widerwillig den Saal räumen. An Mittwoch- und Donnerstagabenden blieb er manchmal zu Hause oder ging nur auf ein Stündchen aus. Aber so gut wie nie versäumte er infolge seiner Trinkerei die Arbeit.
Dennoch nahm sein Lohn ab, obwohl er sehr zuverlässig arbeitete. Er war ein Schwätzer, ein Zungenwetzer. Autorität war ihm verhasst, daher konnte er die Grubenaufseher nur beschimpfen. So schwadronierte er etwa im Palmerston:
»Heut Morgen kommt doch der Steiger zu uns in den Arbeitsstand und sagt: ›Hör mal, Walter, das geht nich. Was is mit den Stempeln hier?‹ Da sag ich zu ihm: ›Wovon redste da? Was soll denn sein mit den Stempeln?‹ ›Der hier taugt nichts‹, sagt er. ›Eines Tages stürzt dir noch das Dach ein.‹ Da sag ich: ›Dann stell dich doch auf den Tonklumpen da und stütz es mit dem Kopf ab.‹ Da isser vielleicht fuchtig geworden, hat gewettert und geflucht, und die andern Jungs ham gelacht.« Morel war ein guter Stimmenimitator. Er äffte die fette, quäkige Stimme des Aufsehers nach und sein Bemühen, gepflegtes Englisch zu sprechen.
»›Das dulde ich nicht, Walter. Wer versteht mehr davon, ich oder du?‹ Da sag ich: ›Hab nie rausgefunden, wie viel du davon verstehst, Alfred. Vielleicht trägt dich ja dein Verstand grad mal bis ins Bett und wieder zurück.‹«
Und so schwatzte Morel weiter, zur Belustigung seiner Zechkumpane. Und manches traf auch wirklich zu. Der Steiger war kein gebildeter Mann. Er war zusammen mit Morel Schlepperjunge gewesen, so dass sich die beiden zwar nicht leiden konnten, einander aber doch als selbstverständlich hinnahmen. Doch Alfred Charlesworth verzieh dem Hauer die Redensarten im Wirtshaus nicht. Daher bekam Morel, obwohl er ein tüchtiger Bergmann war und bei seiner Heirat mitunter bis zu fünf Pfund die Woche verdiente, immer schlechtere Stollen zugewiesen, in denen die Flöze dünn waren, schwer abzubauen und wenig ergiebig.
Ein Hauer ist ein Unternehmer. Zwei oder drei Hauer erhalten eine bestimmte Kohleschicht zugeteilt, die sie auf eine bestimmte Länge abbauen. Für jede Tonne Kohle, die sie zutage fördern, werden ihnen drei bis vier Shilling ausbezahlt. Davon müssen sie nicht nur die Tagelöhner bezahlen, Schrämer und Belader, sondern auch Werkzeug, Pulver und so weiter. Wenn es sich um einen guten Stollen handelt und die Grube rund um die Uhr in Betrieb ist, so fördern sie ein-, zweihundert Tonnen Kohle und verdienen gutes Geld. Falls aber nicht, bekommen sie sehr wenig, mögen sie noch so hart arbeiten. In dreißig Lebensjahren hatte Morel noch nie einen guten Stollen erhalten. Aber daran war er, wie seine Frau sagte, selbst schuld.
Außerdem herrscht sommers in den Bergwerken Flaute. An hellen, sonnigen Morgen sieht man die Männer oft schon um zehn, elf oder zwölf Uhr wieder nach Hause strömen. Dann stehen keine leeren Grubenhunte am Schachteingang. Wenn die Frauen vom Hang am Zaun die Kaminvorleger ausklopfen, blicken sie hinüber und zählen die Hunte, die die Lokomotive talauf zu den Gruben zieht.
»Sieben«, sagen sie zueinander, »entweder für Minton oder für Spinney Park. Das reicht nicht, um ’ne Grube in Gang zu halten.«
Und wenn die Kinder um die Mittagszeit aus der Schule kommen, über die Felder blicken und sehen, dass die Räder der Fördertürme stillstehen, sagen sie:
»Minton macht Feierabend. Mein Papa ist bestimmt zu Hause.«
Und über alle, Frauen und Kinder und Männer, legt sich eine Art Schatten, denn am Ende der Woche wird das Geld knapp werden.
Morel gab seiner Frau wöchentlich dreißig Shilling, wovon sie alles bestreiten musste: Miete, Nahrungsmittel, Kleidung, Vereine, Versicherung, Ärzte. Gelegentlich, wenn er gut bei Kasse war, gab er ihr auch fünfunddreißig. Diese Gelegenheiten machten jedoch keineswegs jene wett, da er ihr nur fünfundzwanzig gab. Im Winter mochte der Bergmann in einem anständigen Stollen fünfzig oder fünfundfünfzig Shilling die Woche verdienen. Dann war er glücklich. Freitagabend, Samstag und Sonntag gab er fürstlich Geld aus und wurde im Handumdrehen einen Sovereign los. Und von alldem behielt er kaum einen Penny für die Kinder übrig oder kaufte ihnen ein Pfund Äpfel. Alles wurde durch die Gurgel gejagt. In schlechten Zeiten war es noch beunruhigender, aber dann war er wenigstens nicht so oft betrunken, so dass Mrs Morel zu sagen pflegte:
»Ich bin mir nicht sicher, ob ich nicht lieber knapp bei Kasse bin, denn wenn er gut bei Kasse ist, herrscht nicht eine Minute Frieden.«
Verdiente er vierzig Shilling, so behielt er zehn für sich; von fünfunddreißig fünf, von zweiunddreißig vier, von achtundzwanzig drei, von vierundzwanzig zwei, von zwanzig anderthalb, von achtzehn einen Shilling, von sechzehn einen halben. Nie legte er einen Penny beiseite und gönnte auch seiner Frau keine Möglichkeit zum Sparen; stattdessen musste sie mitunter seine Schulden begleichen, nicht etwa Wirtshausschulden, denn die wurden nie an die Frauen weitergereicht, sondern Schulden, wenn er sich einen Kanarienvogel oder einen ausgefallenen Spazierstock gekauft hatte.
Während der Kirmes arbeitete Morel nur wenig, und Mrs Morel versuchte, das Geld für ihr Wochenbett zusammenzusparen. Daher erfüllte sie der Gedanke, dass er seinem Vergnügen nachging und Geld verjubelte, während sie von Sorgen gequält zu Hause saß, mit großer Bitterkeit. Es gab zwei freie Tage. Am Dienstagmorgen stand Morel früh auf. Er war bester Laune. In aller Frühe, schon vor sechs Uhr, hörte sie ihn unten vor sich hinpfeifen. Er hatte eine angenehme Art zu pfeifen, lebhaft und wohlklingend. Fast immer pfiff er Kirchenlieder. Er war Chorknabe gewesen und hatte eine so schöne Stimme gehabt, dass er im Dom zu Southwell allein vorsingen durfte. Das war selbst seinem morgendlichen Pfeifen noch anzuhören.
Seine Frau lag im Bett und lauschte, wie er im Garten hantierte. Während er sägte und hämmerte, ertönte sein Gepfeife. Ihn, wenn sie im Bett lag und die Kinder noch schliefen, am hellen frühen Morgen so zu hören, glücklich nach Männerart, gab ihr jedes Mal ein Gefühl von Wärme und Ruhe.
Um neun Uhr, die Kinder saßen mit nackten Beinen und Füßen auf dem Sofa und spielten, die Mutter wusch ab, kam er mit aufgerollten Ärmeln und offener Weste von seiner Schreinerarbeit herein. Er war noch immer ein stattlicher Mann, mit gewelltem schwarzem Haar und einem mächtigen schwarzen Schnauzer. Sein Gesicht war vielleicht allzu gerötet und zeigte ein geradezu übellauniges Aussehen. Jetzt aber war er vergnügt. Schnurstracks steuerte er auf den Spülstein zu, wo seine Frau den Abwasch besorgte.
»Was, du hier?«, polterte er. »Rutsch mal ’n Stück, dass ich mich waschen kann.«
»Du kannst warten, bis ich fertig bin«, sagte seine Frau.
»Ach, kann ich das? – Und was is, wenn ich nich will?«
Die gutmütige Drohung erheiterte Mrs Morel.
»Kannst ja gehen und dich in der Regentonne waschen.«
»Ha! Und ob ich das kann, du kleines Drecksluder.«
Er blieb einen Moment stehen und sah ihr zu, dann ging er und wartete, bis sie fertig war.
Wenn er wollte, konnte er noch immer den »Galan« spielen. Gewöhnlich zog er es vor, nur mit einem Halstuch auszugehen. Jetzt hingegen machte er richtig Toilette. Die Art, wie er beim Waschen prustete und planschte, verriet so viel Genuss, die Art, wie er zum Küchenspiegel eilte und sich, weil dieser so niedrig hing, in gebückter Stellung peinlich genau sein nasses schwarzes Haar scheitelte, so viel Eifer, dass es Mrs Morel verdross. Er band einen Umlegekragen und eine schwarze Schleife um und zog seinen Sonntagsschoßrock an. Richtig geschniegelt sah er aus, und was seine Kleider nicht hergaben, das besorgte sein Gespür dafür, wie er aus seinem guten Aussehen das Beste machen konnte.
Um halb zehn kam Jerry Purdy, um seinen Kumpan abzuholen. Jerry war Morels Busenfreund, und Mrs Morel konnte ihn nicht leiden. Er war ein hoch aufgeschossener, dürrer Mann mit einem Fuchsgesicht, einem jener Gesichter, in denen die Wimpern zu fehlen scheinen. Mit steifer, spröder Würde stolzierte er einher, als säße sein Kopf auf einer hölzernen Feder. Sein Wesen war kalt und berechnend. Großzügig, wo er großzügig sein wollte, schien er Morel herzlich zugetan und ihn mehr oder weniger unter seine Fittiche zu nehmen.
Mrs Morel hasste ihn. Sie hatte seine Frau gekannt, die an der Schwindsucht gestorben war und am Ende eine so heftige Abneigung gegen ihren Mann gefasst hatte, dass sie Blut spucken musste, wenn er nur in ihr Zimmer trat. Jerry hatte sich offenbar nicht daran gestört. Und jetzt führte ihm seine älteste Tochter, ein Mädchen von fünfzehn Jahren, den ärmlichen Haushalt und kümmerte sich um die beiden jüngeren Kinder.
»Ein gemeiner, hartherziger Kerl!«, sagte Mrs Morel von ihm.
»Hab Jerry mein Lebtag noch nich gemein erlebt«, wandte Morel ein. »Einen freigebigeren und großzügigeren Burschen kannste meines Wissens nich finden.«
»Freigebig dir gegenüber«, erwiderte Mrs Morel. »Aber bei seinen Kindern, den armen Würmern, bleibt seine Faust fest geschlossen.«
»Arme Würmer? – Möcht mal wissen, wieso das arme Würmer sind.«
Doch was Jerry betraf, ließ Mrs Morel sich nicht besänftigen.
Der Gegenstand ihres Streits wurde sichtbar, wie er seinen dürren Hals über den Vorhang des Spülküchenfensters reckte. Er fing Mrs Morels Blick auf.
»Morgen, Missis! – Der Mann zu Haus?«
»Ja – er ist da.«
Jerry trat unaufgefordert ein und blieb in der Küchentür stehen. Sie lud ihn nicht ein, Platz zu nehmen, und so stand er einfach da und machte kühl die Rechte von Männern und Gatten geltend.
»Ein schöner Tag«, sagte er zu Mrs Morel.
»Ja.«
»Herrlich heut Morgen – herrlich für einen Spaziergang.«
»Heißt das, Sie wollen einen Spaziergang machen?«, fragte sie.
»Ja. Wir wollen nach Nottingham laufen«, antwortete er.
»Hm!«
Die beiden Männer begrüßten einander, beide erfreut, Jerry freilich voller Selbstbewusstsein, Morel dagegen eher kleinlaut, ängstlich darauf bedacht, in Gegenwart seiner Frau nicht allzu fröhlich zu wirken. Aber rasch, in gehobener Stimmung, schnürte er sich die Stiefel. Sie wollten zehn Meilen querfeldein nach Nottingham wandern. Von den Bottoms erkletterten sie den Berghang und stiegen lustig in den Morgen hinaus. Im Moon & Stars tranken sie das erste Glas, dann ging’s weiter zum Old Spot. Darauf folgte eine fünf Meilen lange Durststrecke, bis sie nach Bulwell gelangten, wo sie einen herrlichen Pint Bitterbier hinunterstürzten. Doch dann verweilten sie auf einer Wiese bei einigen Heumachern, deren Fünfliterflasche noch gefüllt war, so dass Morel, als Nottingham in Sicht kam, ganz schläfrig war. Vor ihnen, in mittäglichem Glanz, erstreckte sich die Stadt, leicht in Rauch gehüllt, der Hügelkamm im Süden mit Türmen, Fabrikhallen und -schloten gespickt. Auf der letzten Wiese legte sich Morel unter eine Eiche und schlief über eine Stunde lang den Schlaf des Gerechten. Als er wieder aufstand, um weiterzugehen, war er ganz benommen.
Im Meadows aßen die beiden mit Jerrys Schwester zu Mittag, dann zogen sie weiter in die Punch Bowl, wo sie in die Aufregung eines Taubenwettflugs hineingerieten. Morel hatte noch nie in seinem Leben Karten gespielt, denn er glaubte, dass ihnen eine geheime, böswillige Macht innewohne: »Teufelsbilder« nannte er sie. Doch im Kegeln und im Dominospiel war er Meister. Von einem Mann aus Newark ließ er sich zum Wettkegeln herausfordern. Sämtliche Männer in der alten, langgestreckten Schenke schlugen sich auf die eine oder die andere Seite und schlossen Wetten ab. Morel zog seinen Rock aus. Jerry hielt den Hut mit dem Geld. Die Männer an den Tischen sahen zu. Einige standen mit dem Krug in der Hand. Morel wog sorgsam seine große hölzerne Kugel, dann warf er sie. Er wütete schrecklich unter den Kegeln und gewann eine halbe Krone, was seine Zahlungsfähigkeit wiederherstellte.
Um sieben Uhr waren die beiden guter Dinge. Sie erreichten den Sieben-Uhr-dreißig-Zug.
An dem Tag fühlte Mrs Morel sich niedergedrückt und elend. So gut sie konnte, erledigte sie die Wäsche, aber das Durchrühren mit dem Bleuel war zu viel für sie. William räumte im Haus für sie auf.
»Soll ich noch was tun, Mutter?«, fragte er.
»Nein, es gibt nichts mehr für dich zu tun – außer mit Annie hinauszugehen.«
»Ich will aber nicht.«
»Ob du’s willst oder nicht, du musst.«
So ging der Junge, behindert von seiner Schwester, aus dem Haus, während seine Mutter arbeitete. Er war ärgerlich, weil sie ihm diese Bürde aufgehalst hatte, und doch grämte er sich um sie, denn er wusste, dass irgendetwas nicht stimmte. Die Liebe zu seiner Mutter quälte den Jungen, und so machte er das Beste daraus.
Nachmittags war es in den Bottoms nicht auszuhalten. Jeder noch verbliebene Bewohner stand im Freien. Die Frauen, zu zweien oder dreien, barhäuptig und in weißer Schürze, schwatzten in der Gasse zwischen den Blocks. Männer, die sich ein Päuschen zwischen ihren Bieren gönnten, hockten da und plauderten. Die Siedlung roch schal, die Schieferdächer blitzten in der trockenen Hitze.
Mrs Morel brachte das kleine Mädchen zum keine zweihundert Meter entfernten Wiesenbach. Hurtig eilte das Wasser über Steine und zerbrochene Töpfe dahin. Mutter und Kind lehnten sich gegen das Geländer der alten Schafbrücke und blickten umher. An der Badestelle am anderen Ende der Wiese sah Mrs Morel die nackten Knaben um das tiefe gelbe Wasser spurten oder hin und wieder eine hell glitzernde Gestalt über die stille schwärzliche Wiese sausen. Sie wusste, dass William sich an der Badestelle aufhielt, und es war die Angst ihres Lebens, er könnte ertrinken. Annie spielte unter der hohen alten Hecke und las Erlenzapfen auf, die sie »Beeren« nannte. Das Kind musste dauernd beaufsichtigt werden, und die Fliegen waren lästig.
Um sieben Uhr wurden die Kinder zu Bett gebracht. Dann arbeitete sie noch eine Weile.
Als Walter Morel und Jerry in Bestwood ankamen, fühlten sie sich sehr erleichtert: Es stand ihnen keine Eisenbahnfahrt mehr bevor, und so konnten sie den prächtigen Tag zu einem krönenden Abschluss bringen. Mit der Genugtuung heimgekehrter Reisender betraten sie das Nelson. Mrs Morel behauptete immer, das Jenseits halte für ihren Mann keine Überraschung mehr bereit: Wenn er von der Grube nach Hause komme, steige er aus der Unterwelt ins Fegefeuer und fahre im Palmerston Arms zum Himmel auf.
Wenn es in den Bottoms kühler wurde, duftete der kleine Garten angenehm. Mrs Morel ging hinaus, um die Blumen zu betrachten und die Abendluft einzuatmen. Ihre Nachbarin, Mrs Kirk, war nicht zu Hause, sonst hätten die beiden sich unterhalten können. So aber war sie allein. Über ihr flitzten die schwarzen Mauersegler, von den Kindern »Teufelchen« genannt, wie schwarze Pfeilspitzen hin und her, schwenkten um die Hausecke, flogen in die breiten Dachtraufen, schlüpften wieder heraus und stürzten sich mit leisen Schreien, die aus dem Licht, nicht von den geräuschlosen Vögeln zu stammen schienen, durch die Lüfte. Jemand hatte den Mauerpfeffer zertrampelt, der mit herabgefallenen weißen Rosenblättern übersät war. Sie bückte sich und strich ihn glatt, damit sich seine kleinen gelben Blüten wieder aufrichten konnten.
Der nächste Tag war ein Arbeitstag, und der bloße Gedanke daran setzte der Stimmung der Männer einen Dämpfer auf. Außerdem hatten die meisten ihr Geld schon ausgegeben. Einige trotteten bereits missgelaunt heimwärts, um sich für den kommenden Tag auszuschlafen. Mrs Morel, die ihrem düsteren Gesang lauschte, trat wieder ins Haus. Es wurde neun, dann zehn, und das »Paar« war noch immer nicht zurück. Irgendwo auf einer Türschwelle sang ein Mann laut und schleppend »Führ, liebes Licht«. Mrs Morel empörte sich stets darüber, dass Betrunkene, wenn sie rührselig wurden, ausgerechnet immer dieses Kirchenlied singen mussten.
»Als wenn ›Genevieve‹ es nicht auch täte«, meinte sie.
In der Küche roch es nach gekochten Kräutern und Hopfen. Auf dem Herd dampfte ein großer schwarzer Tiegel. Mrs Morel nahm eine große, dicke Schale aus gebranntem rotem Ton, schüttete einen Haufen weißen Zucker hinein und goss dann, sich mit dem Gewicht abmühend, die Flüssigkeit zu.
In diesem Augenblick kam Morel herein. Im Nelson war er noch sehr vergnügt gewesen, auf dem Heimweg aber reizbar geworden. Das Gefühl der Reizbarkeit und des Schmerzes, das sich eingestellt hatte, nachdem er in der Hitze auf dem Erdboden eingeschlafen war, hatte er noch nicht recht überwunden; und als er sich dem Haus näherte, plagte ihn sein schlechtes Gewissen. Ihm war gar nicht bewusst, dass er wütend war. Doch als die Gartenpforte seinen Versuchen, sie zu öffnen, widerstand, trat er danach und zerbrach den Riegel. Er trat in dem Augenblick ein, als Mrs Morel den Kräuteraufguss aus dem Tiegel goss. Leicht schwankend, taumelte er gegen den Tisch. Der kochende Sud schwappte über. Mrs Morel zuckte zurück.
»Grundgütiger«, rief sie, »kommt er wieder betrunken nach Hause!«
»Kommt er wieder wie nach Hause – ?«, knurrte er, den Hut über die Augen geschoben.
Da schoss ihr das Blut ins Gesicht.
»Sag bloß, du bist nicht betrunken!«, brach es aus ihr heraus.
Sie hatte den Tiegel abgesetzt und verrührte den Zucker im Bier. Er ließ beide Hände schwer auf den Tisch fallen und reckte ihr das Gesicht entgegen.
»›Sag bloß, du bist nicht betrunken!‹«, wiederholte er. »Auf so ’n Gedanken kann nur so ’n fieses kleines Miststück wie du kommen.«
»Du hast doch den ganzen Tag gesoffen, wenn du da nicht um elf Uhr nachts sternhagelvoll bist –«, entgegnete sie, immer noch rührend.
»Ich hab nich den ganzen Tag gesoffen – ich habe nicht den ganzen Tag gesoffen – genau da irrst du dich«, sagte er knurrend.
»Es sieht so aus, als hätte ich mich geirrt«, erwiderte sie.
»Ach ja – ach ja – allerdings – und ob!«
»Geht morgens um neun aus und kommt um Mitternacht nach Hause getorkelt. Außerdem wissen wir sehr wohl, was du treibst, wenn du mit deinem schönen Jerry ausgehst.«
»›Mit deinem schönen Jerry‹ – wie? – was redest du da, Frau? – He? – Wie?«
Wieder reckte er ihr das Gesicht entgegen.
»Zum Bechern ist immer genug Geld da, für anderes nie.«
»Keine zwei Shilling hab ich heut ausgegeben«, sagte er.
»Von nichts wird man nicht sternhagelvoll«, antwortete sie. »Und falls du dich von deinem geliebten Jerry hast aushalten lassen«, rief sie in einem plötzlichen Wutausbruch, »der sollte sich lieber um seine Gören kümmern, die haben’s bitter nötig.«
»›Der sollte sich lieber um seine Gören kümmern.‹ – Ich würd gern mal wissen, wer sich besser um seine Kinder kümmert als der.«
»Mein Verehrtester, wenn du dich kümmern müsstest. – Ein Mann, der es sich leisten kann, sich von morgens bis abends die Hucke vollzusaufen –«
»Das ist gelogen, gelogen ist das«, rief er aufbrausend und schlug auf den Tisch.
»– kann es sich nicht leisten, für seine Gören zu sorgen«, fuhr sie fort.
»Was hat das mit mir zu tun?«, brüllte er.
»›Was hat das mit mir zu tun?‹ – Na, ’ne ganze Menge. – Gibt mir elende fünfundzwanzig Shilling, wovon ich alles bezahlen muss, macht einen Tagesausflug und kommt um Mitternacht nach Hause gewankt –«
»Das ist gelogen, Frau, gelogen ist das!«
»Und bildet sich ein, ich würde weiter knapsen und knausern und klügeln, während er kübelt und bechert und nach Nottingham wandert, um zu zechen –«
»Das ist gelogen, gelogen ist das – halt’s Maul, Alte.«