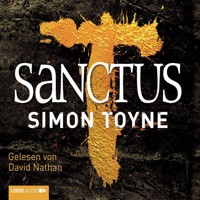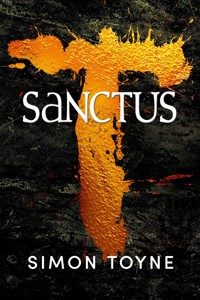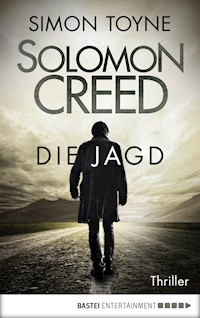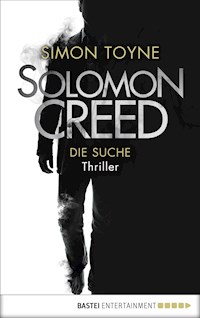
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bastei Lübbe
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Creed-Reihe
- Sprache: Deutsch
In der Wüste von Arizona läuft ein Mann über die einzig vorhandene Straße - ein Albino, der einen Anzug, aber keine Schuhe trägt. Er weiß weder, wer er ist, noch, woher er kommt. Sein einziger Anhaltspunkt ist ein Buch in seiner Jackentasche, das einem Solomon Creed gewidmet ist. Heißt er so? Vermutlich. Der Name kommt ihm bekannt vor. Als er sich umdreht, entdeckt er in der Ferne ein brennendes Flugzeugwrack. War er in dem Flugzeug? Vielleicht. Solomon Creed wird es herausfinden - und auch, wer die Männer sind, die ihn jagen und töten wollen ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 700
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Inhalt
Cover
Über den Autor
Titel
Impressum
Widmung
Teil 1
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
Teil 2
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
Teil 3
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
19. Kapitel
20. Kapitel
21. Kapitel
Teil 4
22. Kapitel
23. Kapitel
24. Kapitel
25. Kapitel
26. Kapitel
Teil 5
27. Kapitel
28. Kapitel
29. Kapitel
30. Kapitel
31. Kapitel
32. Kapitel
33. Kapitel
34. Kapitel
35. Kapitel
36. Kapitel
37. Kapitel
38. Kapitel
39. Kapitel
40. Kapitel
Teil 6
41. Kapitel
42. Kapitel
43. Kapitel
44. Kapitel
45. Kapitel
46. Kapitel
47. Kapitel
48. Kapitel
49. Kapitel
50. Kapitel
51. Kapitel
Teil 7
52. Kapitel
53. Kapitel
54. Kapitel
55. Kapitel
56. Kapitel
57. Kapitel
58. Kapitel
59. Kapitel
60. Kapitel
61. Kapitel
62. Kapitel
Teil 8
63. Kapitel
64. Kapitel
65. Kapitel
66. Kapitel
67. Kapitel
68. Kapitel
69. Kapitel
70. Kapitel
Teil 9
71. Kapitel
72. Kapitel
73. Kapitel
74. Kapitel
75. Kapitel
76. Kapitel
77. Kapitel
78. Kapitel
79. Kapitel
80. Kapitel
81. Kapitel
82. Kapitel
83. Kapitel
84. Kapitel
85. Kapitel
86. Kapitel
87. Kapitel
88. Kapitel
89. Kapitel
90. Kapitel
91. Kapitel
92. Kapitel
Teil 10
93. Kapitel
94. Kapitel
95. Kapitel
96. Kapitel
97. Kapitel
Epilog
Danksagung des Autors
Über den Autor
Simon Toyne arbeitete über zwanzig Jahre lang als Produzent und Regisseur für das britische Fernsehen, bis seine Leidenschaft für spannende Geschichten ihn auf die Idee brachte, eigene Thriller zu schreiben. Heute erscheinen seine Bücher in 27 Sprachen und in mehr als 50 Ländern. SOLOMON CREED – DIE SUCHE ist der 1. Band um Solomon Creed, den Mann ohne Gedächtnis. Weitere Informationen erhalten Sie auf www.simontoyne.net
Simon Toyne
SOLOMONCREED –DIE SUCHE
Thriller
Aus dem Englischen vonHolger Hanowell
BASTEI ENTERTAINMENT
Vollständige eBook-Ausgabe
des in der Bastei Lübbe AG erschienenen Werkes
Bastei Entertainment in der Bastei Lübbe AG
Deutsche Erstausgabe
Für die Originalausgabe:Copyright © 2015 by Simon ToyneTitel der englischen Originalausgabe: »Solomon Creed«Originalverlag: HarperCollinsPublishers
Für die deutschsprachige Ausgabe:Copyright © 2017 by Bastei Lübbe AG, KölnLektorat: Judith MandtTextredaktion: Dr. Arno Hoven, DüsseldorfGestaltung: © HarperCollinsPublishers Ltd 2015;Foto: © Henry SteadmanUmschlaggestaltung: Massimo Peter
eBook-Erstellung: Urban SatzKonzept, Düsseldorf
ISBN 978-3-7325-2986-5
www.bastei-entertainment.de
www.lesejury.de
Teil 1
»… ich weiß, dass ich nichts weiß.«
Sokrates
1. Kapitel
Am Anfang ist die Straße – und ich gehe auf ihr.
Ich habe keine Erinnerung daran, wer ich bin oder woher ich komme. Auch nicht daran, wie ich hierhergekommen bin.
Es gibt nur die Straße und die Wüste, die sich unter einem flammenden Himmel in alle Richtungen erstreckt.
Und es gibt mich.
Angst wallt in mir hoch, und meine Beine schreiten aus, drängen mich vorwärts durch die heiße Luft, als wüssten sie etwas, von dem ich keine Ahnung habe. Ich habe das Gefühl, ihnen sagen zu müssen, dass sie langsamer gehen sollen. Doch selbst in meinem verwirrten Zustand weiß ich, dass man nicht mit den eigenen Beinen spricht – es sei denn, man ist durchgeknallt. Aber ich glaube nicht, dass ich das bin … Nein, das glaube ich nicht.
Ich lasse den Blick schweifen über das flimmernde Band des Asphalts, das mal ansteigt und mal abfällt in der leicht hügeligen Wüstenlandschaft. Die geraden Seitenränder der Teerdecke verschwimmen in der extremen Hitze: Dadurch entsteht der Eindruck, dass die Straße unwirklich und die vor mir liegende Strecke ungewiss ist. All das lässt meine Angst nur noch stärker aufflammen. Ich spüre, dass es hier irgendetwas Wichtiges zu erledigen gibt und dass ich derjenige bin, der das tun muss. Aber ich kann mich nicht erinnern, was das sein soll.
Ich versuche, langsam zu atmen. Eine unbestimmte, tief in mir verankerte Erinnerung scheint mir weismachen zu wollen, dass dies eine beruhigende Wirkung hat. In der trockenen Wüstenluft nehme ich unterschiedliche Gerüche wahr: den teerartigen Geruch eines abgebrochenen Kreosotbuschzweigs, den süßlich-faulen Geruch der heruntergefallenen Früchte von Saguaro-Kakteen, das trockene Aroma von Agaven-Pollen – all dies kann ich genau voneinander unterscheiden. Ich irre mich nicht; dessen bin ich mir absolut sicher. Und mit all diesen Dingen, die ich gerade genannt habe, verbinde ich augenblicklich weitere Informationen: botanische Fachbegriffe, Anwendungsgebiete in der Medizin, alltagssprachliche Bezeichnungen – und das Wissen, welche Pflanzen essbar und welche giftig sind. Und das Gleiche passiert, wenn ich einen Blick nach links oder rechts werfe. Was auch immer ich wahrnehme, sofort blitzen weitere Begriffe in meinem Bewusstsein auf, und eine wahre Flut von Fakten erfasst mich, bis mir der Kopf von all den Eindrücken und Kenntnissen schwirrt. Wie es scheint, weiß ich alles über die Welt, die mich umgibt, und dennoch weiß ich nichts über mich selbst. Ich weiß nicht einmal, wo ich bin. Ich weiß nicht, warum ich hier bin. Ich kenne nicht einmal meinen eigenen Namen.
Plötzlich weht ein kräftiger Wind von hinten, drückt mich vorwärts und bringt einen neuen Geruch mit sich, der meine innere Unruhe in nackte Angst verwandelt. Ich rieche Rauch, beißenden Qualm, und in diese Wahrnehmung schleicht sich eine vage Erinnerung: Auf der Straße hinter mir hat sich etwas Schreckliches ereignet – etwas, vor dem ich fliehen muss.
Ich beginne zu laufen, starre geradeaus nach vorn, weil ich mich nicht traue, danach Ausschau zu halten, was hinter mir ist. Die schwarze Asphaltschicht fühlt sich hart und heiß an meinen Fußsohlen an. Ich blicke nach unten und bemerke erst jetzt, dass ich keine Schuhe trage. Beim Laufen blitzen meine Füße hell auf, meine Haut leuchtet weiß im grellen Sonnenlicht. Ich halte eine Hand hoch, und auch sie ist so weiß, dass ich die Augen zusammenkneifen muss, um nicht geblendet zu werden. Ich spüre, dass sich meine Haut bei der starken Sonnenstrahlung rötet, und ich weiß, dass ich irgendwie die Wüste verlassen muss. Ich muss raus aus der Sonne und fort von dem Unaussprechlichen, das sich hinter mir auf der Straße ereignet hat. Ich konzentriere mich auf die nun leicht ansteigende Straße und hoffe, in Sicherheit zu sein, wenn ich die kleine Anhöhe vor mir erreiche. Ja, ich hoffe, dass danach der Rest des Weges klarer sein wird.
Der heftige Wind lässt nicht nach und weht erneut den Geruch von Qualm herbei, der sich wie ein giftiges Tuch über alle anderen Gerüche legt. Schweiß durchnässt mein Hemd und den dunkelgrauen Stoff meines Jacketts. Ich müsste die Sachen ausziehen, damit es mir nicht ganz so heiß ist, aber der Stoff schützt mich vor der brennenden Sonne; deshalb schlage ich den Kragen hoch, während ich weiterlaufe. Ein Schritt folgt auf den anderen – vorwärts und weg von hier, vorwärts und weg von hier –, und zwischen den Schritten stelle ich mir selbst Fragen: Wer bin ich? Wo bin ich? Warum bin ich hier? Diese Worte wiederhole ich immer und immer wieder, bis sich etwas in der Leere meines Geistes herausformt. Eine Antwort. Ein Name.
»James Coronado.« Keuchend stoße ich den Namen aus, spreche ihn laut, auf dass ich ihn nicht gleich wieder vergesse. Gleichzeitig durchzuckt Schmerz meine linke Schulter.
Ich bin von meiner eigenen Stimme überrascht. Sie klingt leise, seltsam und ungewohnt, aber der Name scheint mir etwas zu sagen. Er kommt mir bekannt vor, und ich spreche ihn erneut aus: »James Coronado, James Coronado …« Immer und immer wieder – in der Hoffnung, dass es sich um meinen eigenen Namen handelt. Ich bilde mir ein, ich könnte mehr über mich erfahren und meinem stummen Gedächtnis auf die Sprünge helfen, wenn ich den Namen nur oft genug wiederhole. Aber je öfter ich ihn ausspreche, desto fremder wirkt er auf mich, und nach einer Weile bin ich mir sicher, dass dies nicht mein Name ist. Trotzdem scheint es eine Verbindung zu diesem Namen zu geben, als hätte ich jemandem, der so heißt, ein Versprechen gegeben, das ich halten muss.
Ich erreiche die Kuppe der leichten Anhöhe und sehe die weiteren Ausläufer der Wüstenlandschaft vor mir. In der Ferne erahne ich ein Ortsschild, und dahinter liegt eine Stadt, die sich wie ein dunkler Fleck auf den unteren Hängen einer Bergkette aus rotem Felsgestein ausbreitet.
Mit einer Hand schirme ich die Augen gegen das Sonnenlicht ab, weil ich mir einbilde, ich könnte so den Namen der Stadt auf dem Schild lesen. Doch es ist zu weit entfernt, und in der glühenden Hitze flirren die Buchstaben. Auf einer Straße am Rande der Stadt nehme ich Bewegungen wahr.
Ja, das sind Wagen.
Sie fahren in meine Richtung. Auf den Autodächern blitzen rote und blaue Lichter auf.
Das Heulen von Sirenen mischt sich in die lauten Geräusche des rauchgeschwängerten Windes, und plötzlich habe ich das Gefühl, zwischen beiden in der Falle zu sitzen. Ich schaue nach rechts und überlege, ob es nicht besser wäre, die Straße zu verlassen und in der Wüste abzutauchen. Doch in diesem Augenblick gelangt ein anderer Geruch zu mir. Er kommt von irgendwoher aus der sonnenverbrannten, ausgedörrten Wildnis, und er scheint mir vertrauter zu sein als alles andere. Es ist der Geruch von Verwesung. Ich kann zwar nichts erkennen, aber irgendein Wesen liegt da draußen tot herum und verrottet in der Hitze. Ich nehme den süßlich-faulen Geruch wahr, und auf einmal kommt es mir wie eine Warnung vor: Kommst du von der Straße ab, wird dich das gleiche Schicksal ereilen!
Von vorne nähern sich Sirenen, zu beiden Seiten der Straße lauert der Tod – und was ist hinter mir?
Ich muss es jetzt wissen.
Langsam drehe ich mich um und schaue auf das, wovor ich weggelaufen bin. Die ganze Welt steht in Flammen.
Auf der Straße liegt ein zerstörtes, brennendes Flugzeug. Die Tragflächen ragen abgewinkelt nach oben, sehen aus wie die angelegten Schwingen eines riesigen, brennenden Ungeheuers. Rund um das Wrack breiten sich die Flammen rasend schnell aus, springen von einer Pflanze zur nächsten und züngeln an den großen Saguaro-Kakteen empor, die, wie es scheint, ihre brennenden Arme zum Zeichen der Unterwerfung hochheben. Das Innere dieser riesigen Wüstengewächse zerplatzt und zischt, während das Wasser darin kocht und sich explosionsartig in heißen Dampfwolken entlädt.
Ein großartiger Anblick. Majestätisch und doch furchterregend.
Das Heulen der Sirenen kommt näher, und das Flammenmeer prasselt laut. Eine der Tragflächen beginnt abzubrechen. Sie zieht Flammen mit sich nach unten, als sie abknickt, und die Luft ist erfüllt vom gequälten Knarren sich verbiegenden Metalls. Dumpf schlägt der Flügel auf dem Boden auf, und eine Feuersäule schießt in den Himmel, wird dann vom Wind zu Boden gedrückt und sieht plötzlich wie ein Tentakel aus, der sich in meine Richtung reckt, um mich zurückzuholen.
Ich taumele ein paar Schritte zurück, mache auf der Hacke kehrt und laufe los.
2. Kapitel
Bürgermeister Ernest Cassidy schaute von dem offenen Grab auf und sah über die Schar der Trauernden hinweg in die Ferne. Das dumpfe Dröhnen hatte er nicht nur gehört, sondern als Vibration bis in die Fußspitzen gespürt. Es war wie ein Donnergrollen gewesen, das aus der Wüste herüberkam. Andere hatten es auch mitbekommen. Cassidy sah, dass einige Leute, die eben noch mit gesenkten Köpfen ins Gebet vertieft gewesen waren, aufblickten und in Richtung Wüste schauten, die sich weiter unten im Tal bis zum Horizont erstreckte.
Der Friedhof befand sich hoch oben an einem Hang in den Chinchuca Mountains, von denen die Stadt wie von einem Hufeisen umschlossen wurde. Heißer Wind stieg aus dem Tal empor und fuhr in die schwarzen Kleidungen der Trauergemeinde. Einzelne Böen wehten Steinchen gegen die leicht verwitterten Holzkreuze der älteren Gräber, auf denen die Namen der Menschen verewigt waren, die in den harten Zeiten der Stadtgründung ihr Leben gelassen hatten. Nüchtern protokollierten die kurzen Inschriften auf den Kreuzen die Einzelschicksale:
»Kutscher. Getötet von Apachen. 1881«
»China Mae Ling. Selbstmord. 1880«
»Susan Goater. Ermordet. 1884«
»Junge. 11 Monate. Verhungert. 1882«
An diesem Tag wurde die Liste der Toten um einen weiteren Namen ergänzt, und fast die gesamte Stadt hatte sich eingefunden, um dem Verstorbenen die letzte Ehre zu erweisen. Viele Geschäfte hatten an diesem Morgen geschlossen, um den Leuten die Möglichkeit zu geben, der ersten Beerdigung seit sechzig Jahren auf diesem historischen Friedhof beizuwohnen. Es war das Mindeste, was sie unter diesen Umständen tun konnten. Die Zukunft der Stadt wurde an diesem Tag gefestigt, so sicher wie in jenen Tagen am Ende des neunzehnten Jahrhunderts, als die Leichen der Ermordeten, Gehängten, Skalpierten und Verdammten hier zur letzten Ruhe gebettet worden waren.
Als das Donnergrollen verhallt war, beruhigte sich die Gemeinde wieder. Bürgermeister Cassidy, der an diesem Tag seinen Priesterhut trug, ließ eine Handvoll Staub in das offene Grab fallen. Die winzigen Staubkörner rieselten auf den Deckel des schlichten, altmodischen Sargs aus Kiefernholz, ehe Cassidy mit feierlicher Stimme die Beerdigung fortsetzte.
»Denn Staub bist du«, sagte er in einem leisen, respektvollen Tonfall, den er sich speziell für Anlässe wie diesen vorbehielt, »und zum Staub wirst du zurückkehren. Amen.«
Die Gemeinde griff das Amen auf, das von Mund zu Mund ging, ehe sich Schweigen herabsenkte, unterbrochen von dem böig auffrischenden Wind. Cassidy warf einen verstohlenen Blick auf die Witwe, die unmittelbar am Rand des Grabes stand, wie eine Selbstmörderin, die jeden Augenblick von der Klippe in den Abgrund springen würde. Ihr Haar glänzte im Sonnenlicht, und ihre Augen leuchteten dunkler als die im Wind flatternde Trauerkleidung der Anwesenden. Sie wirkte schön in ihrer Trauer – so wunderschön und jung. Cassidy wusste, dass sie ihren Mann sehr geliebt hatte, was den Verlust gewiss noch tragischer erscheinen ließ. Aber da die Witwe jung war, bliebe ihr noch genügend Zeit im Leben, neue Wege einzuschlagen, und bei dieser Gewissheit empfand Cassidy ein wenig Trost. Die Frau würde die Stadt verlassen und irgendwo anders ein neues Leben anfangen. Zudem hatten sie und der Tote weder einen Sohn noch eine Tochter. Und damit ließ sich ebenfalls etwas Positives verbinden: Auf diese Weise war ausgeschlossen, dass die Witwe durch den Anblick eigener Kinder, deren Gesichtszüge womöglich Ähnlichkeiten mit dem Verstorbenen aufgewiesen hätten, immer wieder an den schmerzvollen Verlust erinnert würde. Bisweilen war es ein Segen, keine Kinder zu haben. Manchmal jedenfalls.
Plötzlich kam Unruhe in die Menge. Cassidy schaute auf und beobachtete, wie sich der Polizeichef den Hut auf das kurz geschorene, grau melierte Haar setzte und schnellen Schrittes dem Ausgang zustrebte. Im nächsten Moment sah Cassidy den Grund für die Eile des Chiefs.
Eine dunkle Rauchsäule stand über der Straße, die aus der Stadt in die Wüste führte. Also war das vorhin kein Donnergrollen gewesen, das eine Regenfront ankündigte.
Der Rauch verhieß vielmehr weiteres Unheil.
3. Kapitel
Chief Morgan verließ so schnell wie möglich den Friedhofsparkplatz, ohne beim Anfahren die anderen Besucher der Beerdigung, die gleich nach ihm zu ihren Autos eilten, in eine Staubwolke zu hüllen.
Auch er hatte das dumpfe Donnern gehört und sofort gewusst, dass es kein herkömmliches Gewitter sein konnte. Dieser dumpfe Knall hatte ihn an eine Zeit erinnert, als er in eine andere Uniform als heute gekleidet gewesen war. Damals hatte er das Mündungsfeuer der Artillerie vor dem Nachthimmel gesehen, während mit gewaltigen Detonationen Mörsergranaten auf eine fremde Stadt in einer anderen Wüste niedergegangen waren. Der Knall von eben konnte nur bedeuten, dass etwas Großes am Boden zerschellt war, und bei diesem Gedanken bekam Morgan einen ganz trockenen Mund.
Auf der abschüssigen Straße beschleunigte er und drückte auf die Sprechtaste im Lenkrad, um über die Wechselsprechanlage mit der Leitstelle in Kontakt zu treten. »Morgan hier. Bin unterwegs in Richtung Norden. Drei Meilen vor der Stadt steigt eine Rauchsäule in den Himmel. Ist bei euch schon eine Meldung eingegangen?«
Morgan nahm ein Schlagloch mit und bog mit quietschenden Reifen auf die Hauptstraße, als er die knisternde Stimme von Rollins in der Leitstelle aus dem Lautsprecher hörte. »Können wir bestätigen, Chief. Hatten vorhin einen Anruf von Ellie drüben von der Tucker-Ranch. Sie sagte, sie habe weiter südwestlich eine Explosion gehört. Fünf Einsatzwagen sind auf dem Weg dorthin: zwei Löschzüge, ein Wagen der Highway Patrol, ein Krankenwagen aus dem County und ein weiterer aus dem King Community Hospital. Mit Ihnen sechs Fahrzeuge insgesamt.«
Morgan warf einen Blick in den Rückspiegel und sah rot-blaue Lichter hinter sich auf der Straße. Dann schaute er wieder auf die Rauchsäule, die ihm inzwischen noch gewaltiger vorkam als Augenblicke zuvor – und das nicht nur, weil er sich ihr mit hohem Tempo näherte. »Wir brauchen Verstärkung«, sagte er.
»Verstanden, Chief. Was ist dort draußen passiert?«
Morgan versuchte, sich einen ersten Eindruck zu verschaffen, und reckte den Hals. »Bin noch nicht nah genug dran, aber der Qualm nimmt ziemlich schnell zu und steigt verdammt hoch. Da verbrennt etwas bei starker Hitze, Benzin vermutlich. Es hat auf jeden Fall eine Explosion gegeben.«
»Yeah, haben wir hier auch gehört.«
»Was? Sogar auf der Wache?«
»Ja, Sir. Man konnte selbst die Druckwelle spüren.«
Die Leitstelle der Polizeiwache lag noch eine Meile weiter vom Geschehen entfernt als der Friedhof, den Morgan gerade verlassen hatte. Also musste es eine sehr starke Explosion gewesen sein. »Können Sie den Rauch schon sehen?« Morgan lauschte auf das Knistern des Lautsprechers und stellte sich vor, wie Rollins sich in seinem Stuhl zurücklehnte und einen Blick aus dem schmalen Fenster der Leitstelle warf.
»Yeah, hab ihn gesehen, Chief.«
»Schätze, der Wind drückt die Flammen in eure Richtung. Wir sollten auf alles gefasst sein. Setzen Sie alle Hebel in Bewegung, Rollins. Rufen Sie beim Flughafen an, wir brauchen das Löschflugzeug. Wir müssen das eindämmen, bevor es aus dem Ruder läuft.«
»Ich kümmere mich darum, Chief.«
Morgan schaltete die Sprechtaste aus und beugte sich ein wenig vor. Der Rauch schoss mehrere Hundert Fuß in den Himmel und stieg noch immer; das Feuer bekam offenbar ständig neue Nahrung. Morgan konnte es bald vage erkennen: Wann immer er nun eine Senke im Straßenverlauf hinter sich ließ, erhaschte er einen Blick auf das Flammenmeer in der Ferne. Er war so sehr darauf fixiert, dass er den Mann, der ihm mitten auf der Straße entgegenkam, erst im allerletzten Augenblick sah.
Morgan erschrak und reagierte instinktiv. Er riss das Lenkrad nach rechts und wappnete sich gegen den bevorstehenden Aufprall – der jedoch ausblieb. Dann wirbelte er das Lenkrad in die entgegengesetzte Richtung. Als die Hinterreifen auf dem Schotter-Untergrund am Straßenrand durchdrehten, geriet der Wagen ins Schleudern. Morgan stieg kurz in die Eisen, ehe er wieder Gas gab, damit die Reifen nicht komplett blockierten. Doch im nächsten Moment brach das Heck aus; der Wagen schlitterte seitwärts weiter, und die Hinterreifen schleuderten Schotter in die Luft. Morgan trat erneut aufs Bremspedal, klammerte sich ans Lenkrad und versuchte noch einmal gegenzulenken. Dann aber prallte der Wagen gegen einen Busch und kam abrupt zum Stehen. Morgan knallte mit dem Kopf gegen die Windschutzscheibe.
Einen Augenblick lang verharrte er reglos auf dem Sitz, die Hände immer noch am Lenkrad, und hörte seinen eigenen Herzschlag, der ihm so laut vorkam, dass er ihn trotz des prasselnden Feuers draußen in der Wüste hörte. Kleine Steine rieselten über die Windschutzscheibe. Als Nächstes raste der erste Löschzug auf der Straße an ihm vorbei und wirbelte noch mehr Rollsplitt gegen Morgans Wagen.
Der Lautsprecher knisterte wieder. »Chief? Sind Sie noch da, Chief?«
Morgan atmete tief durch, ehe er die Sprechtaste betätigte. »Yeah, Rollins, bin noch da.«
»Wie sieht es aus bei Ihnen?«
Der zweite Löschzug donnerte vorbei. Morgan blickte in die Richtung, in die das Einsatzfahrzeug fuhr – geradewegs in das Zentrum des Feuers. Jetzt erst konnte Morgan das Flugzeugwrack erkennen, das dort in Flammen stand. »Wie das Ende der Welt«, erwiderte er leise.
Er blickte wieder zur Straße und war überrascht, als er den Mann entdeckte, dem er zuvor ausgewichen war und der sich offenbar noch rechtzeitig mit einem Sprung hatte retten können. Mühsam rappelte sich der Fremde am Straßenrand auf. Er sah eigenartig aus, außergewöhnlich – sein Haar war genauso weiß wie seine Haut.
Morgan kannte all die Geschichten darüber, wie diese Straße auf einem uralten Planwagenpfad errichtet worden war, und all die Erklärungen, weshalb es entlang der Wegstrecke spuken sollte. Viele Leute behaupteten, merkwürdige Dinge hier draußen gesehen zu haben. Diese unheimlichen Begegnungen geschahen insbesondere nachts, also zu einer Zeit, wenn die Kälte wie ein gigantischer Hammer auf die Wüste niederschlug, wie Morgan nur zu gut wusste. Im Zuge der plötzlichen Temperaturstürze kam es oft zu Luftverwirbelungen, die einem im Lichtkegel von Autoscheinwerfern seltsame Dinge vorgaukelten. All das beflügelte die Fantasie von Leuten, denen die gleichen Storys zu Ohren gekommen waren wie Morgan. In den »Augenzeugenberichten« war oft die Rede von geisterhaften Pferden oder führerlosen Planwagen, die einen Fuß hoch über dem Boden dahinschwebten. Doch derartige Erscheinungen hatte Morgan bislang nie mit eigenen Augen gesehen. Jetzt allerdings fragte er sich beim Anblick des seltsamen Fremden, ob er nicht ebenfalls eine Spukgestalt erblickte.
»Chief? Sind Sie noch da, Chief?«
Morgan registrierte die Stimme aus dem Lautsprecher; den Fremden behielt er jedoch weiterhin im Auge. »Ja, bin noch da. Was gibt’s Neues über die Löschflugzeuge?«
»Die Einheit vom Flughafen ist auf dem Weg. Zwei weitere sind angefordert und sollen aus Tucson kommen. Lassen sich allerdings ein bisschen Zeit, aber ich bleibe dran. Wenn sie die Starterlaubnis haben, müssten sie in etwa zwanzig Minuten bei Ihnen sein.«
Morgan nickte stumm und dachte kurz nach. In zwanzig Minuten würde die Feuersbrunst sich auf eine Fläche ausgedehnt haben, die doppelt so groß war wie im Augenblick. Weitere Sirenen waren jetzt zu hören. Die Stadt schickte alles, was sie aufzubieten hatte, aber es würde nicht reichen.
»Alarmieren Sie so viele Stellen wie möglich!«, befahl er. »Wir brauchen Straßensperren an allen Zufahrtsstraßen der Stadt. Ich will nicht, dass Schaulustige herkommen und sich in unmittelbarer Nähe tummeln. Außerdem brauchen wir Brandschneisen. Jeder Kollege, der eine Schaufel schwingen kann, soll sich am Ortsausgang einfinden und bereithalten. Wenn es unsere Stadt noch bis Sonnenuntergang geben soll, brauchen wir jeden Freiwilligen.«
Er beendete das Gespräch und kramte in der Hosentasche nach seinem Handy. Nachdem er es hervorgeholt hatte, rief er die Kontaktliste auf, wählte einen bestimmten Namen und schrieb eine SMS. Seine Finger zitterten beim Tippen. »Bin unterwegs. Beerdigung vorzeitig verlassen. Irgendwas gefunden?«
Er drückte auf »Senden« und betrachtete erneut den Fremden. Der Mann stand stocksteif da und konnte den Blick nicht von dem Inferno wenden, aber auf seinem Gesicht lag ein eigenartiger Ausdruck. Morgan hielt sein Handy hoch, machte ein Foto und schaute es sich genau an. Inmitten des Staubs und Wüstensands schien ein Leuchten von dem Fremden auszugehen. Sofort musste Morgan an all die Fotos denken, die er in einschlägigen Büchern und auf speziellen Websites gesehen hatte, in denen sich Autoren mit den Geistererscheinungen in dieser Gegend beschäftigten. Allerdings hatte er bislang jedes dieser Fotos für einen Fake gehalten. Doch was er hier sah, war kein Fake. Dort drüben stand der Fremde, ganz real und lebensgroß, und starrte auf das Flugzeugwrack. Der Mann hatte blassgraue Augen, die an die Farbe hellen Schiefergesteins erinnerten. Unverwandt blickte er in die Flammen.
Das Handy summte in Morgans Hand. Die Antwort: »Nichts. Brechen jetzt auf.«
Gottverdammt. Heute läuft aber auch nichts so, wie ich es mir wünsche. Alles geht schief.
Als er nach dem Hut griff und die Fahrertür öffnete, drangen das laute Prasseln der Flammen und die Hitze der Wüste mit aller Macht auf ihn ein. Im selben Moment drehte sich der hellhäutige Mann um und lief davon.
4. Kapitel
Ich starre in das Herz des Feuers und habe das Gefühl, als würde es meinen Blick erwidern. Aber das kann nicht sein. Das weiß ich. Die Luft wirbelt um mich herum; sie klagt und brüllt, als leide die Welt großen Schmerz.
Der erste Löschzug hält am Rand des Flammenmeers, und Leute springen aus dem Wagen. Sie ziehen die Schläuche aus dem Bauch des großen Fahrzeugs, als würden sie die Innereien eines Tiers herausnehmen, um einer brennenden Gottheit ein Opfer darzubringen. Die Menschen dort wirken so klein im Vergleich zu der hohen Feuerwand. Der Wind fegt in die Flammen hinein, und der Brand frisst sich gierig vorwärts, entlang der Straße, in Richtung der Feuerwehrleute – in meine Richtung. Furcht überfällt mich, und ich wende mich ab und will davonlaufen, doch um ein Haar stoße ich mit einer Frau in einer dunkelblauen Uniform zusammen. Sie muss hinter mir die Straße heraufgekommen sein.
»Sind Sie okay, Sir?«, höre ich sie sagen. Ihr Blick ist voller Mitgefühl. Ich verspüre das Verlangen, sie in den Arm zu nehmen oder mich von ihr in den Arm nehmen zu lassen, aber ich habe zu viel Angst vor dem Feuer. Daher will ich nur weg von dem Flammenmeer. Ich weiche der Frau aus, entziehe mich ihr und laufe weiter; doch dann stoße ich mit einem Mann zusammen, der auch so eine dunkelblaue Uniform trägt. Als er mich am Arm packt, versuche ich, mich loszureißen, aber ich schaffe es nicht. Er ist zu kräftig, was mich erstaunt, denn irgendeine blasse Erinnerung sagt mir, dass ich es nicht gewohnt bin, der Schwächere zu sein.
»Ich muss fort von hier«, sage ich mit meiner leisen, für meine Ohren fremdartigen Stimme und werfe einen angsterfüllten Blick zurück über die Schulter, weil ich spüre, dass der Wind die Flammen in meine Richtung treibt.
»Sie sind jetzt in Sicherheit, Sir«, erwidert der Mann mit einer professionellen Gelassenheit, die mir noch mehr Angst einjagt. Woher will er wissen, dass ich in Sicherheit bin? Ja, woher will er das wissen?
Ich schaue über seine Schulter hinweg in Richtung Stadt und möchte das Ortsschild lesen, aber ein geparkter Krankenwagen verstellt mir nun die Sicht darauf. Auch das steigert meine Angst.
»Ich muss fort von hier«, wiederhole ich und befreie meinen Arm aus dem Griff des Mannes. Zugleich versuche ich, ihm begreiflich zu machen, was ich befürchte. »Ich glaube, das Feuer ist wegen mir hier.«
Er nickt und tut so, als würde er verstehen, aber da sehe ich, dass er die andere Hand nach mir ausstreckt, als wolle er mich erneut packen. Ich reagiere sofort, ergreife seine Hand, ziehe sie kräftig zu mir und bringe den Mann gleichzeitig mit einem blitzschnellen, sichelförmig durchgeführten Fußfeger zu Fall. Dem zu Boden stürzenden Uniformierten weiche ich mit einer geschickten Körperdrehung aus. Dieser Bewegungsablauf kommt mir so natürlich vor wie ein Atemzug und gelingt mir so leicht und geschmeidig, als vollführe ich einen einstudierten Tanzschritt. Wie es scheint, funktioniert bei mir immerhin noch das Muskelgedächtnis. Ich blicke hinab auf den Mann, der vor mir am Boden liegt und mich mehr als erschrocken ansieht. »Tut mir leid, Lawrence«, entschuldige ich mich bei ihm und benutze dabei den Namen, den ich auf dem kleinen Schild an seiner Uniform lese. Dann drehe ich mich um und will wieder wegrennen – in Richtung Stadt, fort von der Feuersbrunst. Mir gelingt jedoch nur ein Schritt, denn der Mann bekommt mich am Bein zu fassen. Seine kräftigen Finger schließen sich wie eine eiserne Fessel um meinen Knöchel.
Ich gerate ins Stolpern, finde aber sofort mein Gleichgewicht wieder, drehe mich halb zu dem Mann um und hebe meinen Fuß an. Ich will ihn nicht treten, aber ich muss es offenbar tun. Ja, ich werde ihm wohl ins Gesicht treten müssen, wenn ich ihm nur auf diese Weise klarmachen kann, dass er mich loslassen soll. Bei dem Gedanken, dem Mann mit meiner harten Ferse die Nase zu brechen, sodass Blut spritzen wird, verspüre ich eine Empfindung, als würde ich in einem warmen Luftstrom stehen. Und es ist ein angenehmes Gefühl. Wieder bin ich ein wenig verwirrt, weil ich merke, dass mir Dinge wie diese seltsam vertraut sind – wie es bereits bei dem Geruch des Todes der Fall gewesen ist. Ich lenke meine Aufmerksamkeit auf etwas anderes und versuche, meine intuitiven Reaktionen unter Kontrolle zu halten und meinen Fuß daran zu hindern, brutal zuzutreten. Und genau in diesem Moment des Zögerns prallt etwas Großes und Festes gegen mich, sodass ich umgerissen werde und der Mann mein Bein loslassen muss.
Ich stürze zu Boden, und etwas Weißes flammt hinter meinen Lidern auf, als ich mit dem Kopf auf dem Asphalt aufschlage. Unbändiger Zorn erfasst mich. Mit aller Macht versuche ich, mich gegen denjenigen zu wehren, der mich angegriffen hat und mich nun festhält. Heißer Atem streift meine Wange, und ich nehme den Geruch von Kaffee und beginnender Zahnfäulnis wahr. Ich drehe den Kopf ein wenig zur Seite und sehe in das Gesicht des Polizisten, der mich vorhin beinahe überfahren hätte. »Ganz ruhig«, sagt er und drückt mich mit seinem ganzen Körpergewicht zu Boden. »Wir wollen Ihnen nur helfen.«
Aber das wollen sie nicht. Wollten sie mir helfen, würden sie mich laufen lassen.
In einem entlegenen Winkel meines Gedächtnisses schlummert die Erinnerung, dass ich jetzt meine Zähne einsetzen könnte, um dem Mann in die Wange oder Nase zu beißen. Ich könnte ihn so heftig attackieren, dass er nichts lieber tun würde, als mich loszulassen. Dieser Gedanke fasziniert und erschreckt mich zugleich. Mir wird klar, dass ich in der Lage bin, mich aus diesem Griff zu befreien, mir ist aber gleichzeitig bewusst, dass mich irgendetwas davon zurückhält. Da ist etwas in mir, das mich daran hindert, meine Fertigkeiten einzusetzen.
Ich spüre, dass noch mehr Hände mich ergreifen und hart zu Boden drücken. Am Arm fühle ich einen Stich, als hätte mich ein riesiges Insekt gestochen. Ich drehe den Kopf: Eine Rettungssanitäterin hockt neben mir, und ihr Augenmerk ist starr auf die Spritze gerichtet, die in meinem Arm steckt.
»Unfairer Kampf«, versuche ich zu sagen, aber ich bringe die Worte nur noch undeutlich heraus.
Die Welt um mich herum verschwimmt, und ich spüre, wie mein Körper langsam erschlafft. Jemand hält meinen Kopf und legt ihn vorsichtig auf den Boden. Ich will mich dagegen wehren, versuche krampfhaft, meine Augen offen zu halten. Ich nehme die Stadt in der Ferne wahr, sehe die Straße und den Himmel. Ich will all diesen Leuten sagen, dass sie sich beeilen sollen, weil das Feuer kommt. Dass sie sich alle in Sicherheit bringen müssen. Aber mein Mund und meine Zunge gehorchen mir nicht mehr. Mein Sichtfeld verkleinert sich, und ich schaue wie durch einen Tunnel. An den Rändern meiner visuellen Wahrnehmung ist es dunkel, nur in der Mitte bleibt ein heller Kreis, als würde ich rücklings in einen tiefen Brunnen stürzen. Jetzt kann ich das Schild sehen, das vorhin ganz von dem Krankenwagen verdeckt war, und auch den Schriftzug darauf. Ich lese die Wörter, deren Buchstaben in der flirrenden Luft ungewöhnlich klar zu erkennen sind. Es ist das Letzte, was ich wahrnehme, ehe mir die Lider zufallen und die Welt um mich herum schwarz wird:
»HERZLICH WILLKOMMEN IN REDEMPTION«
5. Kapitel
Mulcahy lehnte an dem Jeep und blickte auf die Reihen unterschiedlich langer Tragflächen auf der anderen Seite des Maschendrahtzauns. Von der Stelle aus, an der er stand, konnte er einen B-52-Bomber sehen, der in Vietnam zum Einsatz gekommen war: Die Aufkleber auf dem Flugzeugrumpf verrieten, dass der Bomber bis zu dreißig Einsätze geflogen war. Daneben standen ein Bomber aus dem Zweiten Weltkrieg, ein bauchiges Transportflugzeug, dessen Form an einen Wal erinnerte, und einige gefährlich aussehende Kampfjets aus verschiedenen Ländern mit jeweils spitz zulaufendem Cockpit, darunter eine MiG mit einem roten Sowjet-Stern am Rumpf. Unterhalb ihres Cockpit-Fensters befanden sich zwei weitere, kleinere Sterne, die für feindliche Abschüsse standen.
Jenseits der aufgereihten Militärflieger erstreckte sich eine Startbahn ins Herz der Wüste. Flirrende Hitze lag über der Schicht aus Asphalt. Weiter nördlich waren einige Bussarde am Himmel zu sehen, die über irgendeinem Aas oder sterbenden Wesen kreisten. Ansonsten war nichts am Himmel zu entdecken, nicht einmal eine einzelne Wolke, obwohl Mulcahy vorhin ein Donnergrollen gehört hatte. Ein bisschen Regen wäre jetzt vielleicht nicht schlecht. Sie könnten weiß Gott Wasser von oben gebrauchen.
Er warf einen Blick auf seine Uhr.
Kommt zu spät.
Mulcahy verspürte ein Kribbeln, als in der sengenden Hitze des Tages der Schweiß in seinen Haaren und an seinem Rücken herunterzulaufen begann. Der silberfarbene Grand Cherokee, an dem er lehnte, hatte schwarz getönte Scheiben, kühle Ledersitze und eine super Klimaanlage, die dafür sorgte, dass die Temperatur im Innern des Wagens stets bei angenehmen achtzehn Grad blieb. Mulcahy hörte, wie sich das Rauschen der Anlage in das leise Brummen des Motors mischte. Dennoch zog er es vor, draußen in der Gluthitze zu stehen, denn er wollte nicht drinnen bei den beiden Trotteln sitzen, auf die er aufpassen musste. Er hatte einfach keine Lust, sich ihre dämlichen Gespräche anhören zu müssen.
Hey, Mann, was glaubst du, wie viele Nazis hat der Vogel dort erledigt?
Wie viele Schlitzaugen sind wohl verbrannt, als der da angriff?
Aus irgendeinem Grund meinten die beiden, dass er, Mulcahy, früher beim Militär gewesen war. Daher glaubten sie in ihrer drogenumnebelten Vorstellung auch, er würde sich bestens mit allen Kriegen auskennen, die je stattgefunden hatten, und wüsste über sämtliche Kampfbomber Bescheid. Schon mehrmals hatte er ihnen gesagt, dass er nicht bei der Armee gewesen war und deswegen genauso viel oder wenig von Militärmaschinen verstand wie sie. Trotzdem nervten sie ihn immer wieder mit ihren Fragen und hörten nicht auf, bei den Opferzahlen der Bombenabwürfe zu übertreiben.
Er schaute erneut auf die Uhr.
Sobald die Lieferung einträfe, könnte er sich wieder auf den Weg machen. Dann würde er lange und ausgiebig duschen und sich den Schweiß des Tages abschrubben. Surrend öffnete sich das Fenster unmittelbar neben ihm. Kalte Luft entwich aus dem Wageninnern nach draußen.
»Wo bleibt der Flieger, Mann?« Das war Javier, der kleinere, reizbarere der beiden Typen, ein entfernter Verwandter von Papa Tío, dem Big Boss auf mexikanischer Seite.
»Ist noch nicht da«, erwiderte Mulcahy.
»Scheiße, Mann, erzähl mir was, was ich nicht weiß.«
»Wo soll ich da anfangen?«
»Was?«
Mulcahy entfernte sich ein paar Schritte von dem Jeep und streckte sich, bis er die Wirbel im Rücken knacken hörte. »Keine Sorge«, meinte er. »Wenn was schiefgelaufen wäre, hätte ich eine Info darüber bekommen.«
Javier schien einen Moment darüber nachdenken zu müssen und nickte schließlich. Er hatte etwas von der prahlerischen Art des Big Boss, aber bestimmt nicht dessen Grips, soweit Mulcahy das beurteilen konnte. Schon rein äußerlich ließ sich erkennen, dass Javier zur Familie des Big Boss gehörte, was sehr zum Nachteil des Jungen war. Er war klein und untersetzt, wie fast alle in seiner Familie; und mit der fettigen, pockennarbigen Haut und den wulstigen Lippen sah er nicht wie ein Mensch, sondern eher wie eine missmutige Kröte in Jeans und T-Shirt aus.
»Mach das Fenster zu, Mann, ist ein verdammter Backkasten da draußen.« Das war Carlos, der andere Idiot, der auf der Rückbank saß. Kein Blutsverwandter, soweit Mulcahy wusste. Aber offenbar respektierte man ihn innerhalb des Kartells, denn sonst hätte man ihm nicht erlaubt, an diesem Ausflug teilzunehmen.
»Hey, ich unterhalt mich gerade, Mann«, entgegnete Javier gereizt. »Ich mach das Fenster zu, wenn’s mir passt, verstanden?«
Mulcahy drehte sich langsam um die eigene Achse und schaute hinauf zum Himmel.
»Auf was für’n Flieger warten wir eigentlich? Einer dieser dicken Bomber mit Atomraketen? Mann, das wär doch krass.«
Mulcahy zog es in Erwägung, auf diesen Mist nicht einzugehen. Allerdings wusste er zumindest in diesem Punkt genau Bescheid, denn bei der Besprechung hatte man ihm den Flugzeugtyp genannt. Außerdem – je länger er sich mit Javier unterhielt, desto länger blieb die Scheibe unten und desto mehr kalte Luft drang nach draußen.
»Ist eine Beechcraft«, antwortete er.
»Was ist ’ne Beechcraft?«
»Ein altes Flugzeug, schätze ich.«
»Was für eins? Ein Privatjet, oder was?«
»Propellermaschine, denke ich.«
Javier nickte, und als er seine wulstigen Lippen vorschob, sah er aus wie ein Boxer, der einen harten Treffer hatte hinnehmen müssen. »Egal, hört sich trotzdem cool an. Als ich die Biege machen musste, bin ich in irgendeinem lahmen Kahn mitten in der Nacht heimlich über’n Fluss geschippert.«
»Aber du hast es geschafft, oder nicht?«
»Klar, denk schon.«
»Und nur das zählt.« Mulcahy beugte sich leicht vor. In der Ferne war ein dunkler Fleck am Horizont zu sehen, genau über den großen Abraumhalden weitab der Landebahn. »Es kommt nicht darauf an, wie du es schaffst, sondern dass du es schaffst.«
Der Fleck nahm Konturen an und wurde zu einer schwarzen Rauchsäule, die in den Himmel stieg. Mulcahy hörte Sirenengeheul in der Ferne. Im selben Moment vibrierte sein Handy in der Hosentasche.
6. Kapitel
Schaukelnde Bewegungen holten ihn in die Realität zurück.
Seine Lider flatterten auf, und er starrte zu einer niedrigen weißen Decke hoch. Über ihm hing ein Tropf, von dem ein Schlauch wie eine durchsichtige Schlange herabbaumelte, der bei jedem Schlenkern des Krankenwagens leicht wackelte.
»Hey, da sind Sie ja wieder.« Das Gesicht der Rettungssanitäterin kam in sein Blickfeld. Sie leuchtete ihm mit irgendetwas ins linke Auge. Er verspürte einen stechenden Schmerz und versuchte, die Hand zu heben, um sich vor dem grellen Licht zu schützen, doch sein Arm wollte nicht gehorchen. Dann schaute er an sich herab, und bei der Bewegung seines Kopfes fühlte er sich so benommen, als stünde er unter Drogen. Dennoch konnte er erkennen, dass man ihn an Armen und Beinen mit dicken blauen Nylonbändern an die Trage gefesselt hatte.
»Ist zu Ihrer eigenen Sicherheit, damit Ihnen während der Fahrt nichts passiert«, erklärte sie, als wäre es selbstverständlich, die Patienten festzubinden. Doch er kannte den wirklichen Grund. Sie hatten ihn sedieren müssen, um ihn überhaupt in den Krankenwagen zu bekommen. Vorsichtshalber hatten sie ihn gefesselt, damit er ihnen nichts tun konnte.
Er hasste es, auf diese Weise in der Bewegung eingeschränkt zu sein. Diese Erfahrung rüttelte tief in seinem Innern an einer verschlossenen Tür, hinter der eine stark emotionsgeladene Erinnerung eingesperrt war – ganz so, als wäre er schon einmal gegen seinen Willen irgendwo festgehalten worden und als hätte er gehofft, dies nicht noch einmal erleben zu müssen. Er richtete seine Aufmerksamkeit auf diese Empfindung und versuchte sich zu erinnern, woher sie kam, aber sein Gedächtnis war wie ausgelöscht.
Bei den schaukelnden Bewegungen des Krankenwagens wurde ihm schlecht, aber auch vom Gestank der Substanzen, die hier drinnen oft zum Einsatz kamen – Jod, Natriumhydrogencarbonat, Naloxon. All diese Gerüche vermischten sich mit dem von Schweiß und Qualm und dem ekelhaften synthetischen Kokosnuss-Duft des Lufterfrischers, der von der Fahrerkabine nach hinten wehte. Er wollte wieder den Boden unter den Füßen spüren, den frischen Wind im Gesicht. Er wollte genug Zeit und Muße haben, um in Ruhe nachzudenken und zu überlegen, warum er überhaupt hierhergekommen war. Der Schmerz in seinem Arm flammte wieder auf, und der Griff der Trage rappelte, als er versuchte, ihn zu umfassen.
»Könnten Sie das Band losmachen?« Er bemühte sich, ruhig und entspannt zu sprechen, als wäre es für ihn keine große Sache, sich besonnen zu verhalten. »Nur damit ich meinen Arm bewegen kann.«
Die Rettungssanitäterin kaute auf der Unterlippe und nestelte an ihrem Halskettchen herum, auf der in goldenen Lettern »Gloria« stand. »Okay«, meinte sie. »Aber wenn Sie Schwierigkeiten machen, schicke ich Sie gleich wieder ins Reich der Träume, verstanden?« Sie hielt ihre schmale Taschenlampe hoch. »Und Sie müssen mich meinen Job machen lassen.«
Er nickte. Sie hielt seinen Blick länger gefangen als nötig, als wollte sie ihm klarmachen, wer hier am längeren Hebel saß. Dann löste sie eines der Bänder an der Trage. Als das Nylonband nachgab, hob er den Arm und rieb sich die Schulter.
»Tut mir leid«, sagte Gloria, beugte sich über ihn und leuchtete ihm wieder ins Auge. »Ist die beste Möglichkeit, jemanden zu beruhigen, bevor noch jemand verletzt wird.« Das Licht stach, doch diesmal hielt er es aus.
»Wie heißen Sie, Sir?« Sie leuchtete kurz in sein anderes Auge.
Sie war ihm so nah, dass er ihren Atem auf seiner Haut spüren konnte. Er wollte die Hand nach ihr ausstrecken, wollte in Erfahrung bringen, wie sie sich anfühlte. Es lag ihm etwas daran, auf sanfte Weise mit jemandem Kontakt aufzunehmen, anstatt Gewalt anzuwenden. »Das weiß ich nicht mehr«, antwortete er. »Ich kann mich an nichts erinnern.«
»Wie wäre es mit Solomon?«, schlug jemand anders vor. Es war die Stimme eines Mannes – eine eher hohe, die aber trotzdem den Anflug von einem rauen Unterton besaß. »Solomon Creed. Klingelt’s da bei Ihnen?«
Gloria beugte sich derweil über ein Clipboard und kritzelte ein paar Notizen auf ein Formular. Erst da sah er den Polizisten, mit dem er es vorhin zu tun bekommen hatte. Der Mann saß am Fußende der Trage, halb verdeckt hinter Gloria.
»Solomon«, wiederholte er, und es klang vertraut, wie ein Paar Stiefel, die er eingelaufen hatte. »Solomon Creed.« Er starrte den Beamten an, in der Hoffnung, dass der Mann mehr von ihm wusste als nur diesen Namen. »Sie kennen mich also?«
Der Polizist schüttelte den Kopf und hielt ein kleines Buch hoch. »Habe ich in der Innentasche Ihres Jacketts gefunden. Darin ist eine persönliche Widmung an einen gewissen Solomon Creed, daher nehme ich an, dass Sie das sind. Der Name steht auch in Ihrem Jackett.« Mit einem Kopfnicken wies er auf ein gefaltetes graues Jackett, das auf der Trage lag. »Die Buchstaben sind mit Goldfaden auf das Label gestickt, und zwar in französischer Schrift.« Er betonte »französischer Schrift«, als verspürte er einen bitteren Geschmack im Mund.
Solomons Blick galt dem Buch. Auf dem Cover war ein altes sepiafarbenes Foto von einem Mann zu sehen. Der Titel war in altmodischem Schrifttyp gesetzt:
Reichtümer und Redemption
Die Entstehung einer Stadt
Memoiren
Von Reverend Jack »King« Cassidy
Gründer und Ehrenbürger der Stadt
Er verspürte den Wunsch, dem Polizisten das Buch wegzunehmen, weil er wissen wollte, was sonst noch drinstand. Dieses Buch erkannte er nicht wieder, und er konnte sich nicht erinnern, es jemals gesehen zu haben. Er konnte sich an gar nichts erinnern. Aber offenbar war das Buch von Bedeutung. Frustrierend. Er würde noch wahnsinnig, wenn das so weiterginge. Und wieso hatte der Bulle seine Taschen gefilzt? Bei dem Gedanken ballte er unwillkürlich die Hände zu Fäusten.
»Also, Mr Creed«, fuhr der Polizist fort, »haben Sie irgendeine Ahnung, weshalb Sie von dem brennenden Flugzeug weggerannt sind?«
»Ich kann mich nicht erinnern, was der Grund dafür war«, erwiderte Solomon. Das Namensschild am Hemd des Bullen wies ihn als Chief Garth B. Morgan aus, was auf eine walisische Abstammung hindeutete. Das würde die rosige, von Sommersprossen übersäte Haut erklären, die gar nicht zu dem Klima hier passte – genauso wenig wie seine.
Was, zum Teufel, machte er hier eigentlich?
»Denken Sie, dass Sie möglicherweise ein Passagier an Bord der Maschine waren?«, fragte Morgan.
»Nein.«
Morgan zog die Stirn in Falten. »Was macht Sie da so sicher, wenn Sie sich an nichts erinnern können?«
Solomon blickte aus dem Heckfenster des Krankenwagens und sah das brennende Flugzeug. Im selben Moment schossen ihm weitere Informationen durch den Kopf und lieferten ihm eine plausible Erklärung. »Das sehe ich an der Art und Weise, wie die Tragflächen stehen.«
Morgan folgte Solomons Blick. Tatsächlich war eine der Tragflächen im Herzen des Feuers zu erkennen. Sie ragte schräg in die Höhe. »Was hat es damit auf sich?«
»An der Position der Tragflächen kann man ablesen, dass das Flugzeug mit der Nase voran am Boden zerschellte. Alle Passagiere wären im Rumpf nach unten geschleudert worden, nicht seitlich nach draußen – und zwar mit einer solchen Gewalt, dass niemand überlebt haben könnte. Bei einem Aufprall wie diesem ist zu erwarten, dass die Tanks bersten und das Kerosin Feuer fängt. Kerosin verbrennt im Freien bei einer Temperatur von drei- bis vierhundert Grad Celsius – heiß genug also, dass sich in Sekundenschnelle das Fleisch von den Knochen löst. Wenn ich das alles berücksichtige, kann ich nicht im Flieger gewesen sein, denn sonst würde ich mich jetzt nicht mit Ihnen unterhalten.«
Morgans Mundwinkel zuckten, als hätte ihm jemand an die Nase geschnippt. »Woher sind Sie dann gekommen, wenn Sie nicht im Flugzeug gesessen haben?«
»Ich kann mich nur an die einsame Straße und das Feuer erinnern«, antwortete Solomon und rieb sich die Schulter, die ihm immer noch schmerzte.
»Lassen Sie mich mal sehen«, sagte Gloria und trat näher heran, sodass sie ihm die Sicht auf Morgan versperrte.
Solomon knöpfte sein Hemd auf und betrachtete dabei seine Finger, die so weiß waren wie das Hemd.
»Da draußen haben Sie zu mir gesagt, das Feuer wäre ihretwegen hier«, rief ihm Morgan in Erinnerung. »Haben Sie eine Ahnung, was Sie mir damit sagen wollten?«
Solomon entsann sich des Gefühls panischer Angst. Er hatte das überwältigende Verlangen verspürt, vor dem Feuer zu fliehen. »Das war mehr ein Gefühl als eine Erinnerung«, erwiderte er. »Als gäbe es irgendeine Verbindung zwischen mir und dem Feuer. Aber was für eine das ist, kann ich Ihnen auch nicht erklären.« Er knöpfte seine Manschetten auf, schlüpfte mit dem Arm aus dem Hemd und spürte sogleich, wie sich die Blicke von Gloria und Morgan veränderten.
Die Rettungssanitäterin beugte sich vor und starrte auf Solomons Oberarm. Auch Morgan konnte den Blick nicht von der freigelegten Stelle wenden. Als Solomon vorsichtig den Kopf zur Seite drehte, sah er den Grund für die anhaltenden Schmerzen. Seine ansonsten makellose weiße Haut war an dieser Stelle von einem hässlichen roten Mal verunstaltet.
»Was ist das?«, entfuhr es Gloria leise.
Doch Solomon wusste auch darauf keine Antwort.
7. Kapitel
»Abgestürzt? Wie meinst du das – abgestürzt?«
Der Cherokee wirbelte Staub auf. Mulcahy saß hinter dem Steuer und wandte den Blick nicht von der Rauchsäule im Westen ab, während sie die Landebahn an dem ausgedienten Hangar verließen. »Flugzeuge stürzen eben ab«, entgegnete er lapidar. »Das wisst ihr doch, oder? Ist eine der Eigenschaften von Fliegern.«
Ungläubig stierte Javier auf die Qualmwolke und schien nicht begreifen zu können, was sich dort in der Ferne abspielte. Vor Staunen bekam er den Mund nicht zu und schob die wulstige Unterlippe ein wenig vor. Auf der Rückbank machte Carlos sich klein und sagte kein Wort. Doch er hatte große Augen und wirkte desorientiert, und Mulcahy wusste auch, warum. Denn Papa Tío stand in dem Ruf, Exempel an Leuten zu statuieren, die in seinen Augen versagt hatten. Falls die Lieferung bei dem Absturz verbrannt war – ausgerechnet diese spezielle Lieferung –, hatten sie ein echtes Problem. Niemand wäre mehr sicher: Carlos nicht, er selbst nicht, wahrscheinlich nicht mal Cousin Schlauchbootlippe vorne auf dem Beifahrersitz.
»Nur keine Panik«, sagte Mulcahy und versuchte, sich selbst ebenso wie seine beiden Begleiter zu beruhigen. »Wir wissen doch nur, dass es einen Flugzeugabsturz gegeben hat. Wir wissen aber nicht, ob das überhaupt unsere Maschine ist oder wie schlimm es für uns steht.«
»Also wenn du mich fragst, sieht das verdammt mies aus!«, rief Javier und starrte unverwandt auf die rasch größer werdende Qualmwolke.
Allmählich taten Mulcahy die Finger weh, weil er das Lenkrad so fest umklammert hielt. Er zwang sich, den Griff ein wenig zu lockern, und ging vom Gas runter. »Warten wir’s einfach ab«, meinte er und versuchte, ruhig zu sprechen. »Momentan verhalten wir uns immer noch so, wie es der Plan vorsieht. Das Flugzeug ist nicht gekommen, also fahren wir zu dem vereinbarten Ort, um uns neu zu formieren. Dort erstatten wir Bericht und warten auf weitere Instruktionen.«
Mulcahys Bauchgefühl riet ihm jedoch, die Flucht zu ergreifen. Er könnte jedem seiner Begleiter eine Kugel in den Kopf jagen und die zwei in der Wüste liegen lassen, um für sich einen Vorsprung herauszuholen. Er wusste, dass es nicht von Belang war, ob der Absturz der Maschine nun seine Schuld war oder nicht – Papa Tío würde wahrscheinlich jeden liquidieren, der an der Operation beteiligt war, als Warnung für alle anderen. Wenn er, Mulcahy, jetzt allerdings Javier und Carlos beseitigte und dann abtauchte, würde Papa Tío mit absoluter Sicherheit davon ausgehen, dass er für den Absturz verantwortlich war. Und dann würde der Big Boss ihn gnadenlos verfolgen. Ohne Unterlass, für immer und ewig. Trotz seines wenig ehrenvollen Rufs mochte Mulcahy es im Grunde jedoch nicht, andere Leute umzubringen. Ebenso wenig schmeckte es ihm, ständig auf der Flucht zu sein. Immerhin führte er ein ganz angenehmes Leben. Er hatte ein nettes Haus und ein paar Frauen mit Kindern hier und da, die nicht mehr von ihm verlangten, als er aufbringen konnte, und denen es gleich war, was er machte. Sie fragten ihn auch nicht, was es mit all den Narben auf seinem Körper auf sich hatte. Bislang hatte er nicht groß über dieses Leben nachgedacht, aber als er sich jetzt vorstellte, alles hinter sich lassen zu müssen, ging ihm auf, wie sehr er an diesem Leben hing.
»Wir halten uns an den Plan«, sagte er. »Wem das nicht passt, der soll aussteigen.«
»Und wer hat dir das Kommando gegeben, pendejo?«
»Tío. Reicht dir das? Er hat mich persönlich angerufen und mich gebeten, ihm einen Gefallen zu tun und diese Lieferung für ihn abzuholen. Außerdem sollte ich euch zwei mitnehmen, und ich Schwachkopf habe auch noch ›In Ordnung‹ gesagt. Wenn du das Kommando haben willst – bitte sehr. Du solltest dir allerdings klarmachen, dass dann die Verantwortung für alles bei dir liegt. Ansonsten halt dein dickes Maul und lass mich nachdenken.«
Javier hockte daraufhin wie ein schmollender Teenager auf dem Beifahrersitz und schwieg.
Mulcahy sah Flammen im Westen aufschießen. Eine Feuerwand breitete sich in der Wüstenlandschaft aus. Jetzt bemerkte er auch die Einsatzfahrzeuge, was bedeutete, dass die Cops eine Weile alle Hände voll zu tun hatten.
»Da, ein Flugzeug!«, rief Javier und deutete nach hinten – in die Richtung, aus der sie kamen.
Mulcahy spürte aufkeimende Hoffnung. Vielleicht würde alles doch noch gut ausgehen. Vielleicht könnten sie einfach kehrtmachen, wie vereinbart die Lieferung in Empfang nehmen und sich später bei einem kühlen Bier über all das hier kaputtlachen. Vielleicht könnte er sein nettes, unkompliziertes Leben weiterleben wie bisher. Er nahm den Fuß vom Gaspedal, ließ die leere Straße einen Moment lang aus den Augen und wandte das Gesicht in die Richtung, in die Javier gezeigt hatte. In beträchtlicher Höhe entdeckte er ein leuchtend gelbes Flugzeug. Rasch drehte er seinen Kopf wieder nach vorn, konzentrierte sich wieder auf die Straße und trat aufs Gaspedal, um den Zeitverlust wettzumachen.
»Was machst du da, verdammte Scheiße?«, empörte sich Javier und sah ihn entgeistert an.
»Das ist nicht das Flugzeug, auf das wir warten«, erklärte Mulcahy und spürte, dass die schlimmen Befürchtungen ihn wieder einholten. »Außerdem landet es nicht, sondern startet, Mann. Ist ein Löschflugzeug, wahrscheinlich ein MAFFS.«
»MAFFS? Was soll MAFFS sein, verdammt?«
»Seit der anhaltenden Trockenperiode reden die in den Nachrichten von nichts anderem. MAFFS steht für Modular Airborne Fire Fighting System. Mit diesen Maschinen versuchen sie, Waldbrände zu bekämpfen.«
Als die Maschine direkt über sie hinwegflog, waren die charakteristischen Geräusche der Propeller zu hören. Mulcahy spürte ein dumpfes Dröhnen in der Brust.
Javier schüttelte den Kopf, hatte die Arme wie ein trotziges Kind vor der Brust verschränkt und sog zischend die Luft ein. »MAFFS«, fluchte er, als wäre es das schlimmste Schimpfwort, das er je gehört hatte. »Hab’s ja immer gewusst, dass du so’n scheiß Army-Kerl bist.«
8. Kapitel
Von Solomons weißer Haut, die im künstlichen Licht des Krankenwagens fast zu leuchten schien, hob sich das Mal auf dem Oberarm sehr stark ab. Es war rot, ein wenig erhöht und ungefähr so lang und breit wie ein ausgestreckter Zeigefinger. Bei genauerem Hinsehen fielen die kleinen, dünnen Querstriche am Kopf und am Fuß der dicken roten Linie auf: Das Mal ähnelte dem Großbuchstaben »I«.
»Sieht aus wie ein Brandzeichen«, sagte Morgan und beugte sich vor. »Oder vielleicht wie …« Er sprach den Gedanken nicht aus und holte das Handy aus der Tasche.
Derweil untersuchte Gloria vorsichtig mit behandschuhten Fingern die Haut unmittelbar neben dem erhöhten Striemen. »Können Sie sich denn erinnern, wie Sie daran gekommen sind?«
Solomon rief sich den heftigen, brennenden Schmerz ins Gedächtnis, den er gespürt hatte, als der Name James Coronado zum ersten Mal in seinem Geist aufgeblitzt war. Es hatte sich angefühlt, als würde ihm glühendes Metall auf die Haut gedrückt, doch zu diesem Zeitpunkt hatte er Hemd und Jackett getragen. Und so hatte er geglaubt, das Glühen käme von innen. »Nein«, antwortete er nur; diese vage Erinnerung wollte er weder mit Morgan noch mit Gloria teilen.
Fachmännisch tupfte Gloria die gerötete Stelle mit einem Antiseptikum ab.
»Sie waren schon einmal in unserer Stadt, Mr Creed?«, fragte Morgan.
Solomon verneinte mit einem Kopfschütteln. »Ich denke, ich war noch nie hier.«
»Sind Sie sicher?«
»Nein, bin ich nicht.« Er suchte Morgans Blick. »Warum fragen Sie das?«
»Wegen des Kreuzes, das Sie da um den Hals tragen. Wissen Sie, woher Sie es haben?«
Zum ersten Mal nahm Solomon den Anhänger wahr, den er an einem Lederband um den Hals trug. Verwundert umfasste er das kleine, unförmige Kreuz und versuchte, das Gewicht zu erfühlen. »Diesen Anhänger kenne ich nicht«, sagte er und drehte das Kreuz langsam zwischen den Fingern, in der Hoffnung, diese intensive Betrachtung würde seinem Gedächtnis vielleicht auf die Sprünge helfen. Das Kreuz bestand aus alten Hufeisennägeln, die zusammengeschweißt und ineinander verdreht waren. Obwohl der Anhänger auf den ersten Blick unförmig wirkte, wohnte ihm doch eine gewisse Ausgewogenheit und Symmetrie inne, ganz so, als hätte der Künstler versucht, die präzise Fertigung zu vertuschen, indem er Altmetall verwendete und nicht polierte. »Was soll dieses Ding mit der Frage zu tun haben, ob ich schon mal hier in der Gegend war?«
»Weil das dort eine kleine Replik des Kreuzes ist, das auf dem Altar unserer Gemeindekirche steht. Außerdem hatten Sie eine Ausgabe unserer Stadtgeschichte in Ihrer Jackentasche. Ich vermute, dass Ihnen jemand von hier dieses Buch geschenkt hat.«
Jemand von hier. Jemand, der mich womöglich kennt und mir sagen könnte, wer ich bin.
»Darf ich es mir mal anschauen?«, fragte Solomon.
Morgan musterte ihn wie ein Pokerspieler, der herauszufinden versuchte, was für ein Blatt sein Gegenüber auf der Hand hielt. Solomon spürte Wut in sich hochsteigen, da er sich einmal mehr machtlos fühlte. Sein ganzer Körper spannte sich an, als wollte er aus eigenem Antrieb vorschnellen und dem Chief das Buch entreißen. Aber Solomon war sich bewusst, dass er das Buch auf diese Weise nicht bekommen würde, zumal seine Beine immer noch mit den Nylonbändern gefesselt waren. Nein, er wäre nicht schnell genug. Und selbst wenn es ihm gelänge, würde Gloria ihm wieder eine Kanüle in den Arm jagen und ihn mit irgendeinem Zeug ausknocken – mit Propofol wahrscheinlich, denn er hatte sich erstaunlich schnell erholt …
Aber woher wusste er solche Dinge?
Warum fielen ihm all diese Informationen mühelos ein, während er nichts über sich selbst wusste?
Man hat mir ein »I« – das englische Wort für »Ich« – in die Haut gebrannt, und trotzdem habe ich keinen Schimmer, wer »Ich« bin.
Er atmete tief und langsam ein.
Antworten. Das war es, wonach er sich sehnte, mehr noch als nach einem Ventil für seine Wut. Antworten würden seinen Zorn bändigen und Ordnung in dieses Chaos bringen, das in ihm brodelte. Und diese Antworten standen vermutlich in dem Buch, das Morgan in der Hand hielt.
Der Chief blickte auf den Einband, als überlegte er, ob er ihm das Buch aushändigen sollte. Schlussendlich beschloss er, es ihm nicht zu geben. Stattdessen hielt er es ihm aufgeschlagen hin. Solomons Blick fiel auf die Seite, die für eine Widmung vorgesehen war – ein vorgedruckter Text, der Leute dazu animieren sollte, das Buch zu verschenken, denn hier brauchte man nur noch die jeweiligen Namen einzutragen.
Und dort stand:
EIN GESCHENK DERAMERIKANISCHENGESCHICHTE
FÜR – Solomon Creed
VON – James Coronado
Schmerz flammte wieder in seinem Arm auf, als er den Namen las. Und erneut verspürte er das, was er vorhin auf der Straße erlebt hatte: Ein vages Bauchgefühl suggerierte ihm, dass er diesem Mann gegenüber eine Pflicht zu erfüllen hatte, obwohl er sich nicht an ihn erinnerte. Doch offenbar kannte ihn dieser Coronado näher, denn er hatte ihm immerhin dieses Buch geschenkt.
»Haben Sie wirklich keine Ahnung, woher Sie Jim kennen?«, fragte Morgan.
Jim, nicht James … Morgan kannte diesen Mann, der offenbar in diesem Ort wohnte. »Ich denke, ich bin seinetwegen hier«, erwiderte Solomon und spürte sogleich eine neue Gefühlsregung.
Das Feuer ist wegen mir ausgebrochen.
Aber ich bin hier wegen James Coronado.
Morgan neigte den Kopf leicht zur Seite. »Wie meinen Sie das?«
Solomons Blick wanderte wieder zu dem Feuer in der Ferne. Ein gelbes Flugzeug zog tief am blauen Himmel seine Bahn. Es erreichte die östliche Flanke des Infernos und versprühte über dem schwarzen Qualm eine rötliche nebelartige Substanz, die zu Boden sank. Doch es war nicht genug, denn das Löschmittel bedeckte nicht einmal die Hälfte der Feuerwand. Die Flammen rasten weiter, in Solomons Richtung, in Richtung Stadt … und bedrohten somit jeden, der dort lebte. Das Feuer war eine Bedrohung, eine riesige, alles verschlingende Bedrohung. Zerstörerisch. Reinigend. Genau wie er selbst. Und da hatte er die Antwort, die er brauchte.
»Ich denke, ich bin hier, um ihn zu retten«, antwortete er und wandte sein Gesicht wieder Morgan zu. Solomon war sich jetzt sicher, dass dies stimmte. »Ich bin gekommen, um James Coronado zu retten.«
Ein Schatten huschte über Morgans Züge. Er musterte Solomon mit einem Blick, der nichts Gutes verhieß. »James Coronado ist tot«, sagte er nüchtern und schaute dann durch das Seitenfenster auf die Bergkette jenseits der Stadt. »Wir haben ihn heute Morgen bestattet.«
Teil 2
»Was hinter uns liegt und was vor uns liegt,sind kleine Angelegenheiten verglichen mit dem,was in uns liegt.«
Ralph Waldo Emerson
Auszug aus
Reichtümer und RedemptionDie Entstehung einer Stadt
Die veröffentlichten Memoiren des ReverendJack »King« Cassidy,Gründer und Ehrenbürger der Stadt Redemption, Arizona(geb. 25.12.1841 – gest. 24.12.1927)
All diejenigen, die einen außergewöhnlichen Schatz finden, empfinden es wohl, wie ich annehme, als Fluch, wenn sie den Rest ihres Daseins damit verbringen müssen, anderen zu erzählen, wie sie auf diesen Schatz gestoßen sind. Deshalb hoffe ich, dass die Leute – da ich diese Geschichte nunmehr zu Papier bringe – mich fortan in Ruhe lassen werden, denn ich bin es leid, von dem Schatz zu sprechen. Mein Leben war in düsteren Farben gezeichnet, bevor Reichtum es golden erstrahlen ließ, und wenn ich zu meinem alten, eintönigen und wenig bemerkenswerten Leben zurückkehren könnte, würde ich es tun. Aber man kann nichts ungeschehen machen, und sind die Töne einer Glocke erst einmal verhallt, erklingen sie nicht mehr.
Es ist eine lange und tragische Geschichte, wie ich zu meinem Vermögen kam und meine Mittel einsetzte, um eine Kirche zu errichten und die Stadt zu gründen, die ich Redemption nannte. Und doch wohnt dieser Geschichte etwas Göttliches inne. Denn der Herr lenkte mich in meinem Unterfangen, so wie er alle Geschicke lenkt, und führte mich zu meinem Schatz. Aber der Allmächtige führte mich nicht mithilfe einer Karte oder eines Kompasses dorthin, nein, Er bediente sich der Werkzeuge, die Er für richtig befand: Bibel und Kreuz.
Die Bibel kam zuerst in meinen Besitz. Als Pater Damon O’Brien, der sein Heimatland aufgrund von Verfolgung hatte verlassen müssen, im Sterben lag, vermachte er mir seine Bibel. Ich lernte den Pater in Bannack, Montana, kennen. Die Aussicht, dort Gold zu finden, hatte ihn in diese Gegend gelockt – wie auch mich. Doch er musste feststellen, dass es dort so gut wie nichts mehr zu holen gab. Damals stand er bereits an der Schwelle des Todes, als sich unsere Wege kreuzten. Das Glück hatte mich verlassen, und ich war knapp bei Kasse und nahm das Bett neben ihm, da es niemand sonst haben wollte. Denn alle fürchteten sich vor den Anfällen des wahnsinnigen Priesters, wie es hieß, und vor seiner entsetzlichen Angst vor Schatten, die nur er und niemand sonst sehen konnte. Er war davon überzeugt, dass die Leute darauf aus waren, ihm seine Bibel zu entwenden, die, wie er mir später im Vertrauen sagte, den Besitzer zu einem Schatz führen würde. Mit diesem Schatz sollten die Errichtung einer großen Kirche und die Gründung einer Stadt in der westlichen Wüste finanziert werden.
»Die Grundlage dafür ist hier«, sagte er dann immer und drückte das große, abgegriffene Buch an seine Brust, als wäre es sein Kind. »Hier ist der Same, der eingepflanzt werden muss, denn der Herr ist der wahre Weg und das Licht.«