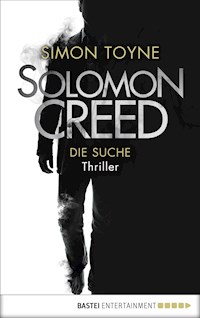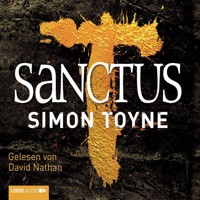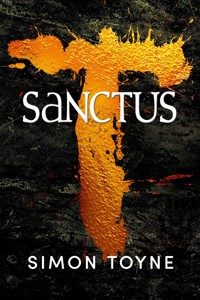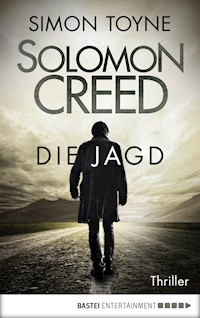
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bastei Entertainment
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Creed-Reihe
- Sprache: Deutsch
Wer ist Solomon Creed? Ein gefährlicher Psychiatrie-Patient, dem die Flucht geglückt ist, oder ein Unschuldiger, der sein Gedächtnis verloren hat?
Die Suche nach Antworten führt Solomon, den Mann ohne Gedächtnis, in die südfranzösische Stadt Cordes. Dort stößt er auf den bizarren Fall eines ermordeten Schneiders. Dieser wurde nicht nur grausam zugerichtet, sein Blut diente dem Mörder auch als "Tinte" für eine rätselhafte Botschaft, die er auf die Wand des Ateliers schrieb: DAS BEGONNENE VOLLENDEN. Solomon ahnt, dass auch der Familie des Schneiders Gefahr droht und er sie retten muss. Gemeinsam verlassen sie die Stadt. Auf der Flucht vor ihren Verfolgern kommt Solomon einer Verschwörung auf die Spur, die bis in die Zeit des Holocaust zurückreicht und ganz Europa vernichten könnte ...
Der neue Thriller des internationalen Bestsellerautors Simon Toyne
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 673
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Inhalt
Cover
Über den Autor
Titel
Impressum
Widmung
Teil 1
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
Teil 2
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
Teil 3
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
19. Kapitel
20. Kapitel
21. Kapitel
22. Kapitel
Teil 4
23. Kapitel
24. Kapitel
25. Kapitel
26. Kapitel
27. Kapitel
28. Kapitel
Teil 5
29. Kapitel
30. Kapitel
31. Kapitel
32. Kapitel
33. Kapitel
34. Kapitel
35. Kapitel
36. Kapitel
37. Kapitel
38. Kapitel
39. Kapitel
Teil 6
40. Kapitel
41. Kapitel
42. Kapitel
43. Kapitel
44. Kapitel
45. Kapitel
46. Kapitel
47. Kapitel
48. Kapitel
49. Kapitel
Teil 7
50. Kapitel
51. Kapitel
52. Kapitel
53. Kapitel
54. Kapitel
55. Kapitel
56. Kapitel
57. Kapitel
58. Kapitel
59. Kapitel
60. Kapitel
61. Kapitel
62. Kapitel
63. Kapitel
64. Kapitel
65. Kapitel
66. Kapitel
Teil 8
67. Kapitel
68. Kapitel
69. Kapitel
70. Kapitel
71. Kapitel
72. Kapitel
73. Kapitel
74. Kapitel
75. Kapitel
76. Kapitel
77. Kapitel
78. Kapitel
79. Kapitel
Teil 9
80. Kapitel
81. Kapitel
82. Kapitel
83. Kapitel
84. Kapitel
85. Kapitel
86. Kapitel
87. Kapitel
88. Kapitel
89. Kapitel
90. Kapitel
Teil 10
91. Kapitel
92. Kapitel
93. Kapitel
94. Kapitel
95. Kapitel
96. Kapitel
97. Kapitel
98. Kapitel
99. Kapitel
100. Kapitel
101. Kapitel
102. Kapitel
103. Kapitel
104. Kapitel
105. Kapitel
106. Kapitel
107. Kapitel
108. Kapitel
109. Kapitel
110. Kapitel
111. Kapitel
112. Kapitel
Epilog
Über den Autor
Simon Toyne arbeitete über zwanzig Jahre lang als Produzent und Regisseur für das britische Fernsehen, bis seine Leidenschaft für spannende Geschichten ihn auf die Idee brachte, eigene Thriller zu schreiben. Heute erscheinen seine Bücher in 27 Sprachen und in mehr als 50 Ländern. SOLOMON CREED – DIE JAGD ist der 2. Band um Solomon Creed, den Mann ohne Gedächtnis. Weitere Informationen erhalten Sie auf www.simontoyne.net.
Simon Toyne
SOLOMONCREED –DIE JAGD
Thriller
Aus dem Englischen vonHolger Hanowell
BASTEI ENTERTAINMENT
Vollständige eBook-Ausgabe
des in der Bastei Lübbe AG erschienenen Werkes
Bastei Entertainment in der Bastei Lübbe AG
Deutsche Erstausgabe
Für die Originalausgabe:Copyright © 2017 by Simon ToyneTitel der englischen Originalausgabe: »The Boy Who Saw«Originalverlag: HarperCollinsPublishers
Für die deutschsprachige Ausgabe:Copyright © 2018 by Bastei Lübbe AG, KölnLektorat: Judith MandtTextredaktion: Dr. Arno Hoven, DüsseldorfTitelillustration: © shutterstock/Krivosheev Vitaly;© shutterstock/Carlos Caetano; © shutterstock/Nejron PhotoUmschlaggestaltung: Massimo Peter-Bille
eBook-Erstellung: Urban SatzKonzept, Düsseldorf
ISBN 978-3-7325-4995-5
www.bastei-entertainment.de
www.lesejury.de
Für meine Schwester Becky, ihren Mann Joe undden kleinen William Quinn Francesco Pingue(geboren am 16. November 2016).
Teil 1
»Drei Menschen können ein Geheimnis bewahren,wenn zwei von ihnen tot sind.«
Benjamin Franklin
1. Kapitel
Der Geruch von Blut ist einzigartig.
Und der von Blut, gemischt mit Angst, hat noch einmal eine etwas andere Note. Josef Engel hatte das seit über siebzig Jahren nicht mehr gerochen – siebzig Jahre, und er erinnerte sich immer noch daran, als bedeuteten all diese Jahre nichts. Diesmal allerdings kam der Geruch von ihm selbst.
Er sah auf seinen eingefallenen Körper hinunter. Sein Kopf war so schwer, dass er ihn nicht heben konnte, und seine schlaffe, alte Haut hing wie faltige Leinwand von seinen Rippen herab. Das herabrinnende Blut hob sich deutlich von diesem weißen Hintergrund ab. Es lief aus den Schnitten in seiner Brust, die einen Davidsstern bildeten. Andere Wunden kribbelten, während das Blut aus ihnen hervorquoll: aus Striemen auf seinem Rücken, wo er ausgepeitscht worden war; aus kleinen Stichverletzungen, wo etwas seine Haut brutal zusammengequetscht und ihm erneut Schmerzen bereitet hatte, als er der Meinung gewesen war, schon alle Arten von Schmerz gefühlt zu haben, die es gab. Der Schmerz war jetzt allumfassend und brannte wie Feuer in seinem Fleisch, das immer noch seltsam schlaff und nutzlos war.
Der Mann war kurz vor Ladenschluss gekommen. Er war in das Geschäft getreten und hatte Josef umarmt wie einen alten Freund. Verblüfft über die Geste des Mannes, der ganz in Schwarz gekleidet war wie ein Schatten, hatte Josef die Umarmung erwidert. Dann hatte er den Nadelstich am Hals gespürt und versucht, sich loszureißen. Er war jedoch von dem Schattenmann festgehalten worden, und rasch hatte sich von der Einstichstelle aus ein kaltes, taubes Gefühl in seinem ganzen Körper ausgebreitet. Er hatte versucht, um Hilfe zu rufen, aber nur Speichel und ein Stöhnen hervorgebracht, und sein Kopf war nach vorn gesackt, weil seine Nackenmuskeln das Gewicht seines Schädels nicht mehr tragen konnten. Ohnehin war niemand in der Nähe, der ihn hätte hören können. Das musste der Mann gewusst haben, denn seine Bewegungen waren weder fahrig noch rasch gewesen, als er Josef zwischen den kopflosen Schneiderpuppen hindurch gelassen in die Mitte des Ateliers bugsiert hatte. Dort war Josef in sich zusammengesackt und hart zu Boden gestürzt, wobei das Krachen seiner arthritischen Knie wie Schüsse geklungen hatte – noch so eine siebzig Jahre alte Erinnerung.
Josef hatte beobachtet, wie sich der von den Oberlichtern geworfene Schatten des Mannes über den polierten Holzboden bewegte, während der Eindringling Josef das Hemd auszog. Eine Klinge war dicht vor seinen Augen aufgetaucht und hatte sich langsam gedreht, sodass das Licht auf die scharfe Schneide fiel, und dann hatte sie sich zu seiner Brust bewegt und sein weißes Fleisch bis auf die Knochen durchschnitten. Zu beiden Seiten des Messers war Blut hervorgequollen und vor Josef auf den Boden getropft. Das alles hatte er mit angesehen und wegen der furchtbaren Schmerzen, die ihm durch die Klinge zugefügt wurden, immer wieder aufkeuchen müssen. Auch war er erstaunt darüber gewesen, dass sein alter Körper noch so entsetzliche Qualen empfinden konnte, und hatte sich gefragt, warum die Drogen, die seine Muskeln lähmten, nicht auch den Schmerz betäubten. Er war wie ein Gefangener in seinem eigenen Körper: Er spürte alles, war aber unfähig, etwas dagegen zu unternehmen. Überall auf seiner Haut breitete sich Wärme aus, als zuerst sein Blut an ihm herunterlief und sich schließlich seine Blase und sein Darm entleerten. Als er den Gestank wahrnahm, hatte er zu weinen begonnen, denn auch die Demütigung schmerzte.
So viel Angst hatte Josef seit dem Krieg nicht mehr empfunden, als in den Arbeitslagern Schmerz und Tod Alltag gewesen waren. Damals war er dem Tod entronnen – doch jetzt hatte der ihn eingeholt. Er sah, wie sich der Schatten des Todes über den polierten Holzboden bewegte. Dann hörte er, wie die Haustür aufgeschlossen wurde, und hoffte, dass der Schattenmann vielleicht gehen würde. Aber die Tür wurde wieder abgeschlossen. Der Schatten kehrte zurück, und dann stellte er etwas auf dem Boden vor ihm ab.
Tränen schossen Josef in die Augen, als er die verblassten goldenen Buchstaben auf dem hölzernen Aufbewahrungskasten für eine Nähmaschine las: Pfaff. Die gleiche Marke wie die jener Maschine, auf der er nähen gelernt hatte, bevor der Krieg gekommen und die Welt finster geworden war – damals, als er sich nichts mehr gewünscht hatte, als dem schnellen Rattern der Nadel zu lauschen und mit ihrer Hilfe schöne Dinge zu erschaffen. Löcher waren in die gewölbte Oberseite des vor ihm stehenden Kastens gebohrt worden, und auf einer Seite befand sich eine kleine, mit einem Riegel verschlossene Klappe. Aus dem Innern des Gehäuses war leises Kratzen zu hören.
»Du weißt, warum dir das jetzt passiert, nicht wahr?«
Der Mann sprach deutsch mit Akzent. Josef konnte die Stimme keiner ihm bekannten Person zuordnen. Wieder versuchte er, nach oben zu schauen, aber sein Kopf war immer noch zu schwer, um ihn zu heben.
Der Mann wiederholte seine Frage, und dann tauchte ein Handy vor Josefs Gesicht auf. Im düsteren Licht der Abenddämmerung wirkte der Bildschirm viel zu hell.
»Erinnerst du dich daran?«, verlangte die Stimme zu wissen.
Mit zusammengekniffenen Augen sah Josef in das helle Licht, das vom Handy ausgestrahlt wurde, und betrachtete das Schwarz-Weiß-Foto auf dem Display.
»Erinnerst du dich daran?«, wiederholte die Stimme. »Erinnerst du dich?«
Und ob Josef sich erinnerte.
Eine Hand wischte über den Bildschirm, und weitere Fotos erschienen. Es waren bedrückende Bilder von Gräueln, die Josef mit eigenen Augen gesehen hatte: Leichenberge in Massengräbern. Ausgemergelte Gestalten hinter Stacheldrahtzäunen, die wie lebende Skelette aussahen und auf den Knien im Schlamm lagen, weil sie zu schwach zum Stehen waren. Die gestreiften Sträflingskleidungen schlackerten von ihren abgemagerten Schultern herab, und sie ließen die kahl rasierten Köpfe hängen. Daneben standen Männer, die graue Uniformen und Lederhandschuhe trugen. In ihren Händen waren Peitschen und Gewehre oder die Enden von straff gespannten Leinen, mit denen sie knurrende Hunde festhielten.
»Du hättest im Lager sterben sollen«, erklärte die Stimme. »Wir hätten dich damals, als wir die Gelegenheit dazu hatten, wie einen Schmutzfleck wegwischen sollen.«
Josef sah in die tief eingesunkenen Augen von totenschädelhaften Gesichtern und stellte sich vor, wie sich knochige Hände über siebzig verlorene Jahre hinweg nach ihm ausstreckten und in seine Brust eindrangen.
»D-der b-bleiche Mann«, flüsterte er auf Deutsch; mit seiner tauben Zunge konnte er nur leise und stammelnd sprechen.
Der Schatten auf dem Boden rückte näher heran. »Erzähl mir von ihm. Erzähl mir von dem bleichen Mann.«
»Er kommt«, antwortete Josef. Es war mühsam, sich in einer Sprache zu artikulieren, die er seit Jahrzehnten nicht gesprochen hatte. »Er kommt.« Seine Gedanken begannen jetzt zu verschwimmen, wurden vernebelt von dem heftigen Schmerz, der von seiner Brust ausging und sich immer weiter ausbreitete. »Er wird mich und die anderen retten … Comme la dernière fois. Wie beim letzten Mal: Er wird kommen und uns abermals retten.«
»Die anderen«, wiederholte die Stimme. »Erzähl mir von den anderen. Erzähl mir, was damals im Lager passiert ist. Nenn mir deinen Namen, und leg dein Geständnis ab.«
Kurz zögerte Josef, bevor er zu sprechen begann. Dann aber flossen die Worte in einem stetigen Strom aus ihm heraus. Die Droge löste ihm die Zunge; außerdem hatte er das Gefühl, man würde ihn am Leben lassen, solange er redete. »Ich habe sie sicher aufbewahrt«, betonte Josef, als er seine Beichte beendet hatte. Die Wirkung des Gifts ließ nach, und seine Hände begannen zu prickeln. Er griff sich ans Herz, an dem immer noch die Skelettfinger zerrten, und der Schmerz dort wurde stärker.
»Was hast du sicher verwahrt?«
»Die Liste«, keuchte Josef.
»Erzähl mir von der Liste.«
»Der weiße Anzug.« Josef drückte die Hand fest an seine Brust und kämpfte gegen den Schmerz an. »Wir haben versprochen, den Anzug aufzubewahren, und das haben wir getan. All die Jahre war er bei uns in Sicherheit.«
Endlich gelang es Josef, den Kopf ein wenig zu heben, und er sah zu der Silhouette seines Mörders auf, die sich vor den Oberlichtern abhob. Der Mann beugte sich vor, und Josef schloss die Augen und wappnete sich gegen einen neuen Schmerz, doch dann berührte etwas sein Gesicht. Er schlug die Lider wieder auf und sah in der Hand des Mannes ein weißes Papiertuch, mit dem er ihm rund um die Augen so sanft das Blut abtupfte, wie eine Mutter einem Kind Marmelade vom Mund wischte. Angesichts dieser unerwarteten freundlichen Geste begann Josef zu weinen. Er roch Desinfektionsmittel an der Hand des Mannes und erkannte erst jetzt, dass sein Peiniger dünne, hautfarbene OP-Handschuhe trug.
»Erinnerst du dich an das Lager?«, fragte der Mann. »Weißt du noch – ganz am Ende, als sich all die Leichen auftürmten und niemand mehr da war, um sie zu begraben?« Er trat an den Holzkasten und drückte das Papiertuch zusammen, bis Blut zwischen seinen in Latex gehüllten Fingern hervorquoll. »Erinnerst du dich an die Ratten?« Er bückte sich und steckte das zu einer Spitze gedrehte Ende des Tuchs durch eins der größeren Löcher; sogleich wurde das Kratzen im Innern des Gehäuses lauter. »All diese wandelnden Skelette … Aber die Ratten litten keinen Hunger, was?« Der Mann ließ das Papiertuch los. Es bewegte sich heftig und wurde unter hektischem Quieken und Kratzen in den Kasten gezogen. »Die Ratten hier habe ich vor fast einer Woche in der Nähe einer Hühnerfarm gefangen. Seitdem haben sie nicht viel zu essen gehabt – nur einander. Ich frage mich, wie viele noch übrig sind. Soll ich mal nachschauen?« Er streckte die Hand nach dem Riegel aus, der die Klappe verschloss, und Josef fühlte, wie sich Panik und ein erneuter Schmerz explosionsartig in seiner Brust ausbreiteten. »Oder du erzählst mir mehr von dem weißen Anzug. Dann lasse ich den Kasten geschlossen.«
Tränen liefen Josef über das Gesicht, und es brannte, als das salzige Nass in die Wunden auf seinem Oberkörper tropfte. Der Schmerz in seiner Brust war jetzt unerträglich. Er war dem Lager nie entronnen, nicht wirklich jedenfalls. Er hatte es all die Zeit mit sich getragen, und jetzt barst es wieder aus ihm heraus.
»Erzähl mir von dem Anzug.« Der Mann schob den Riegel zurück, hielt die Tür aber zu.
»Der bleiche Mann«, sagte Josef. Er zitterte jetzt unkontrolliert und atmete flach. »Wir haben den Anzug für ihn genäht.« Er riss den Blick von dem Kasten los und sah verzweifelt zur Tür, als hoffte er, jener Mann könnte dort stehen. »Er hat gesagt, er werde ihn abholen kommen. Er hat gesagt, der Anzug würde uns beschützen. Wir haben eine Abmachung getroffen. Er wird …«
Ein entsetzlicher Schmerz durchfuhr Josef plötzlich – wie eine Detonation von scharfen Glasscherben und Feuer in seinem Innern, die ihm alle Luft aus den Lungen presste. Er riss die Augen weit auf, sackte zu Boden und rang nach Luft, bekam aber keine. Auf der Seite liegend, entdeckte er einen Fingerhut, der unter einen der Arbeitstische gerollt und dort ganz nach hinten gekullert war. Er war abgewetzt und vertraut und hatte sich im Laufe vieler Arbeitsjahre an die Form seines Fingers angepasst: derselbe Fingerhut, den er schon damals im Lager, in jenem Keller, getragen hatte. Vor ungefähr einem Monat hatte er ihn verloren und überall danach gesucht. Und da lag er nun. Und hier lag er, Josef. Jetzt verzehrte der Schmerz ihn völlig. Schluckte ihn vollkommen. Zog ihn immer tiefer in sich hinein. Sein Mörder kniete sich auf den Boden und versperrte ihm den Blick auf den verlorenen Fingerhut. Josef spürte einen Druck am Hals und roch Latex und Desinfektionsmittel, als Finger nach seinem Puls tasteten. Dann veränderte sich Josefs Blickwinkel; der Mann hatte ihn auf den Rücken gewälzt. Als Nächstes vernahm Josef einen dumpfen Aufprall und spürte, wie eine Faust auf die Mitte seines Brustkorbs hämmerte. Er hörte, wie eine Rippe brach, spürte aber nichts, weil der Schmerz in seinem Innern schon zu stark war.
An der Silhouette des Mannes vorbei sah Josef zum Himmel auf. Dünne weiße Wolken zogen über den dämmrigen dunkelblauen Himmel. Seit über vierzig Jahren arbeitete er in diesem Raum, aber er konnte sich nicht erinnern, jemals zuvor nach oben geblickt zu haben. Auch im Lager hatte er nie zum Himmel emporgeschaut; er hatte es immer für zu schmerzvoll gehalten, zu einer so schlichten, unendlichen Schönheit aufzusehen, während er selbst überall von Hässlichkeit und Grauen umgeben war.
Der Mann presste ihm rhythmisch die Hände auf die Brust, doch Josef wusste, dass es sinnlos war. Jetzt gab es keine Rettung mehr für ihn. Der Mann im weißen Anzug würde nicht kommen. Ein zweites Mal würde es Josef nicht gelingen, dem Tod ein Schnippchen zu schlagen. Er tat einen letzten, stockenden Atemzug. Blickte starr zu dem indigoblauen Himmel auf und schloss dann die Augen.
Er hörte auf, mit der Faust auf die eingefallene Brust zu schlagen, und blickte auf den leblosen Körper des Schneiders hinunter. Unter dem dunklen Blut und der papierdünnen Haut konnte er die Umrisse der Rippen erkennen und schaute eine Weile darauf, um zu sehen, ob sie sich bewegten. Sie taten es nicht.
Er zog ein weiteres Papiertuch aus der Tasche, ballte es zusammen und wischte damit an den feuchten Rändern des Sterns entlang, den er mit dem Messer in die Brust geschnitten hatte. Dann stand er auf und ging durch die stille, kopflose Ansammlung von Kleiderpuppen zu einem kahlen Stück Wand auf der gegenüberliegenden Seite des Ateliers. Er drückte das blutige Gewebe gegen die Wand, tupfte damit auf die gekalkte Oberfläche und kehrte zu der Leiche zurück, sobald das Tuch getrocknet war. Dies wiederholte er mehrmals. Es war bereits vollständig dunkel geworden, als er damit fertig war, dennoch konnte er sehen, was er an die Wand geschrieben hatte. Der Tod war nicht genug für die anderen – sie sollten außerdem wissen, dass er zu ihnen kam, und seinen Schatten im Rücken spüren, genau wie einst in den Lagern.
Er begann, das Atelier zu durchsuchen. Bis morgen früh würde niemand herkommen, daher ließ er sich Zeit, arbeitete langsam und stetig und durchkämmte das gesamte Gebäude nach der Liste und dem Anzug, von denen Josef Engel gesprochen hatte. Er fand nichts.
Als er schließlich fertig war, stand er wieder mitten im Atelier, sah hinab auf die reglose Gestalt am Boden und lauschte den kratzenden und quiekenden Ratten sowie der Uhr, die in der Diele Mitternacht schlug. Er fragte sich, ob Josef die Uhr heute Morgen aufgezogen hatte, ohne zu ahnen, dass sie noch weiterticken würde, nachdem sein Herz zu schlagen aufgehört hatte. Die Zeit des alten Mannes war abgelaufen gewesen, so wie es am Ende jedem ergehen würde – bei ihm selbst würde es auch bald so weit sein.
Er fühlte sich müde und leer, und seine Kopfschmerzen wurden stärker. Aber er war hier noch nicht fertig, nicht ganz … Er trat zu dem Holzkasten und hob die Klappe an der Seite, und dunkle Schatten quollen heraus: kleine schwarze Umrisse, die mit scharrenden Geräuschen über die polierten Bodendielen eilten, immer dem Blutgeruch nach. Sie schwärmten über den Körper, rangelten quiekend und beißend miteinander, schlugen die Zähne in das schon abkühlende Fleisch und verfielen in einen wahren Fressrausch.
Der Mann sah ihnen lange zu. Dabei lauschte er dem Ticken der Uhr und dachte über die Liste nach – und über das, was er ausgelassen hatte, und alles, was er noch tun musste, bis diese ganze Sache vorüber sein würde.
2. Kapitel
Madjid Lellouche schnitt eine weitere verdorrte Weinranke ab und blickte auf. Er wusste, er würde Probleme bekommen, wenn man bemerkte, dass er seine Arbeit auch nur einen Augenblick lang unterbrach. Doch irgendetwas bewog ihn dazu, innezuhalten und sich umzudrehen – und dann sah er ihn.
Der Mann war jetzt vielleicht fünfzehn, zwanzig Meter entfernt. Er tauchte zwischen den Platanen an der römischen Straße auf, die zur selben Zeit errichtet worden war wie die Weingärten, und verschwand dann wieder aus Madjids Sicht; dies wiederholte sich einige Male. Die Straße verlief direkt hinter der Stelle, an der Madjid arbeitete, allerdings weiter unten an der Hügelflanke, sodass ihm zuvor keine Bewegung aufgefallen sein konnte. Der Fremde war auch so weit weg gewesen, dass der Klang von Schritten nicht zu ihm gedrungen sein konnte, selbst wenn der Wind richtig gestanden hätte, was nicht der Fall war. Ohnehin wehte heute kein Wind – nichts als Sonne und sich auflösender Bodennebel und die Aussicht auf einen weiteren erbarmungslos heißen Tag. Die Hitze würde Madjid bei der Arbeit niederdrücken, als hinge ihm ein Mühlstein am Hals, und die Erde zwischen den grünen Reihen der Weinstöcke austrocknen und in Staub verwandeln.
Madjid beschattete seine Augen, um sie vor der grellen Morgensonne zu schützen, und schaute weiterhin zu, wie der Mann zwischen den Bäumen immer wieder in Sicht kam und verschwand und sich durch den Nebel bewegte, der sich weiter unten im Tal sammelte. Der Fremde war blass, schlank und hochgewachsen und trug ein leichtes Jackett, das förmlich und altmodisch wirkte. Sein Haar war weiß, dennoch sah er recht jung aus und bewegte sich mit der geschmeidigen Eleganz eines Tänzers und nicht mit der Steifheit eines Mannes fortgeschrittenen Alters. Madjid lauschte jetzt angestrengt und versuchte, trotz des lauten Sirrens der Insekten das Geräusch der Schritte zu vernehmen. Doch stattdessen hörte er plötzlich hinter sich einen Zweig knacken und einen Stock durch die Luft sausen; und im nächsten Moment spürte er einen jähen, scharfen, brennenden Schmerz.
»Wofür zum Henker bezahle ich dich?«
Madjid drehte sich um und hob die Arme, um sich vor dem nächsten Schlag zu schützen. »Désolé!«, rief er – Tut mir leid! – und wich vor dem Mann mit dem Stock in der Hand zurück. »Désolé, monsieur.« Madjid stieß gegen einen der Weinstöcke, und eine Handvoll Trauben fiel mit einem klatschenden Laut in den Staub. Ihre Haut war runzlig und mit braunen Flecken übersät.
»Von ›Tut mir leid‹ wird die Arbeit nicht getan.«
Wieder sauste der Stock heran, und Madjid spürte das Brennen auf dem Unterarm, bevor er auf die Knie fiel. Durch die Lücke zwischen seinen weiterhin erhobenen Armen blickte er zu der massigen, schweißüberströmten Gestalt von Michel LePoux auf und sah den glühenden Zorn in dessen Schweinsaugen, die ihn aus dem knallrot angelaufenen Gesicht anstarrten. »Désolé, Monsieur LePoux«, entschuldigte er sich abermals.
Wieder hob LePoux den Stock. Madjid schloss die Augen und senkte den Kopf, um sein Gesicht vor dem Schlag zu schützen. Hörte, wie der Stock erneut zischend heranfuhr, und dann das Klatschen, mit dem er auf Haut traf – nur dass er dieses Mal keinen Schmerz spürte. Er öffnete die Augen und sah auf. Vor dem Hintergrund des wie ausgewaschen wirkenden blauen Himmels stand LePoux direkt vor ihm – und auch der Mann von der Straße.
»Autsch«, sagte der Fremde mit einer Stimme, die tief wie fernes Donnergrollen und trotzdem so leise wie der Wind zwischen den Rebstöcken war. »Ça fait mal.«Das tut weh. Er zog das Wort mal in die Länge wie die Hiesigen, sodass es eher wie mel klang.
LePoux zerrte an seinem Stock und versuchte ihn aus dem Griff des Mannes zu befreien. Doch obwohl LePoux doppelt so viel wog wie der Fremde, hielt dieser ihn anscheinend mühelos fest. LePoux hörte auf zu ziehen und starrte den Mann wütend an. »Sie befinden sich unbefugt auf Privatbesitz.«
»Und Sie begehen Körperverletzung«, entgegnete der Unbekannte. »Was meinen Sie – welches Verbrechen ist wohl das größere?«
»Verbrechen?« LePoux spuckte auf den Boden. »Es gibt kein Verbrechen. Dieser Mann gehört mir, und was ich auf meinem Land mit meinem Eigentum anstelle, ist ganz allein meine Angelegenheit.«
Wieder riss er an dem Stock, und der Fremde ließ los, sodass LePoux nach hinten stolperte. Er versuchte, sich an Weinstöcken festzuhalten, doch es war vergebens; und so fiel er zusammen mit weiteren verschrumpelten Trauben laut zu Boden. Der Unbekannte ging in die Hocke, um eine davon aufzuheben. »In Ihrem Land ist Sklaverei seit 1831 verboten.« Er zerdrückte die Traube, roch an dem rosa Saft, leckte seine Fingerspitze ab und sah zu LePoux auf. »Wie kann dann dieser Mann Ihr Eigentum sein?«
LePoux stand auf und zog sich das schweißfeuchte Hemd vom Oberkörper weg. »Ich weiß nicht, wer Sie sind, Monsieur. Ihr Akzent ist von hier, aber ich weiß, dass Sie selbst nicht aus unserer Gegend kommen. Ich kenne hier jeden – die Polizisten, Anwälte, Richter, alle. Aber ich kenne Sie nicht, und Sie haben unbefugt mein Land betreten. Wenn ich Sie also mit einem Stock oder einer Flinte verjage, würde niemand hier etwas dagegen sagen.«
Wieder hob er den Stock, doch der Fremde rührte sich nicht. »Wie lange ist das schon Ihr Land?«, fragte er.
»Meine Familie lebt seit fünf Generationen hier«, antwortete LePoux und warf sich in die Brust.
Der Unbekannte starrte LePoux an und schüttelte langsam den Kopf. »Schade, dass sie es nicht bis zur sechsten schaffen wird.«
LePoux’ Gesicht lief rot an, und seine Knöchel färbten sich weiß. Er holte aus und ließ den Stock mit aller Kraft niederfahren, um den Fremden brutal zu schlagen. LePoux war schnell, aber der Unbekannte war schneller. Im Bruchteil einer Sekunde trat er beiseite, und das Stockende knallte dort auf den Boden, wo der Mann gerade noch gestanden hatte. LePoux, der durch die Wucht des Schlags das Gleichgewicht verloren hatte, taumelte nach vorn, und der Fremde trat mitten auf den Stock und brach ihn mit einem Geräusch entzwei, das wie das Knacken eines brechenden Knochens klang. Dann wirbelte er rasch herum und verpasste LePoux einen so kräftigen Tritt, dass der Weingartenbesitzer durch die Ranken hinter ihm flog und in einem Gewirr aus Draht und Blättern in der nächsten Reihe von Rebstöcken landete.
Der Fremde strich sein Jackett glatt und streckte die Hand nach Madjid aus, der die Kraft darin spürte, als er auf die Füße gezogen wurde. Die Hand des Mannes war fest wie Marmor und stark wie die eines Schmieds, obwohl sie nicht rau vom Arbeiten war, und er wirkte sowohl alt als auch jung. Sein weißes Haar machte ihn älter, doch seine glatte Haut ließ ihn jung aussehen. Er hätte jedes Alter zwischen zwanzig und sechzig haben können; seine Augen allerdings wirkten alt, schwarz und tief, als blickte man in einen Brunnenschacht hinein.
»Die nächste Stadt …«, sagte der Mann mit seiner leisen Stimme. »Wie heißt sie?«
»Cordes«, antwortete Madjid. »Cordes-sur-ciel.«
Der Fremde nickte. »Lebt dort ein Schneider?«
»Monsieur Engel.«
»Kennen Sie einen Menschen oder einen Ort namens Magellan?«
Madjid runzelte die Stirn und durchsuchte sein Gedächtnis. Er wollte dem Mann helfen, der ihm zu Hilfe gekommen war, aber der Name sagte ihm nichts. »Tut mir leid«, erwiderte er schließlich. »Ich habe diesen Namen noch nie gehört.« Er spürte, dass ein schlechtes Gewissen in ihm aufkam, als hätte er den anderen irgendwie enttäuscht.
Der Fremde nickte und zog die Stirn kraus. »Danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben«, sagte er und wandte sich dann wieder an LePoux. »Ihr Weinberg ist dem Verfall preisgegeben«, erklärte er, pflückte ein Blatt von einem Zweig und hielt es in die Höhe, sodass die Sonne die orangefarbenen und schwarzen »Tigerstreifen« auf dem grünen Blatt aufleuchten ließ. »Alle ihre Rebstöcke haben die Esca-Krankheit. Und angesichts des heruntergekommenen Zustands ihres Landes und der Art, wie Sie Ihre Arbeiter behandeln, kann ich mir vorstellen, dass Sie weder über die finanziellen Mittel noch den Ruf verfügen, um sich die Hilfe zu besorgen, die Sie brauchen, um die Esca-Krankheit auszumerzen. Ihre Ernte wird ausfallen, und Sie werden eher früher als später verkaufen müssen.« Er ließ das Blatt fallen und sprach wieder Madjid an. »Sie sollten fortgehen«, sagte er. »Hier gibt es für Sie nichts außer Leid.« Dann nickte er höflich und schritt davon.
Madjid sah ihm nach, wie er durch den Weinberg zurück zur Straße ging. Hinter sich hörte er knackende Geräusche und ein Schnaufen. LePoux rappelte sich mühsam wieder auf.
»Geh wieder an die Arbeit«, befahl er, hob die Hälften seines zerbrochenen Stocks auf, starrte sie an und warf sie dann zu Boden.
Madjid betrachtete die Rebstöcke um sich herum. An fast jeder Pflanze entdeckte er orangefarben leuchtende Blätter mit einem Tigerstreifen-Muster. Der Unbekannte hatte recht, die Pflanzen waren schon jetzt verloren. Und wenn die ganze Ernte verdorben war, würde LePoux ihm die Schuld geben, ihn einen Faulenzer schimpfen, ihn schlagen und ohne Lohn von seinem Land verjagen. Er musste von hier fortgehen. Dies war so offensichtlich, dass er das Gefühl hatte, unter einem Bann gestanden zu haben, der nun von ihm genommen war. Seine fehlenden Optionen und sein unbedingtes Vertrauen in harte Arbeit hatten ihn blind für den Zustand der Weinstöcke gemacht. Er schaute abermals dem Unbekannten hinterher, der ihm die Augen geöffnet hatte. Jetzt hatte der Fremde die Straße fast erreicht. »Wie lautet Ihr Name, Monsieur?«, rief er ihm nach.
»Solomon«, antwortete der Mann, ohne sich umzusehen. Seine Stimme war so leise wie vorhin, konnte aber so deutlich gehört werden, als hätte er das Wort geschrien. »Ich heiße Solomon Creed.«
3. Kapitel
Commandant Benoît Amand von der Police Nationale fühlte den Vibrationsalarm eines eingehenden Anrufs in seiner Tasche. Er ignorierte ihn, streckte stattdessen die Hand aus und fuhr mit einem Finger über das Hakenkreuz, das jemand an die jüdische Gedenkstätte gesprüht hatte. Die dicke schwarze Farbe tropfte auf die in Granit gehauenen Namen: Sie erinnerten an jene, die man in der Nacht des 26. August 1942 zusammengetrieben und in die Todeslager transportiert hatte. Von der anderen Seite des Boule-Platzes hörte er knirschende Schritte und das Schwappen von Wasser in einem Eimer.
»Wollen Sie zuerst Fotos machen?«, fragte der Mann.
»Nein«, erwiderte Amand, trat an ihm vorbei und begann, über die Place du 26 Août zum Café Belloq auf der gegenüberliegenden Seite des Platzes zu gehen. »Ich will, dass Sie alles abschrubben; nicht die geringste Spur soll davon zurückbleiben.«
Die Frühstücksgäste saßen im Schatten einer breiten roten Markise, tranken ihren Kaffee und starrten in ihre Handys und Zeitungen. Ein paar sahen zu ihm hinüber. Auch Jean-Luc Belloq blickte zu ihm. Seit Amand eingetroffen war, polierte er mit seiner Schürze ständig ein und dasselbe Glas.
Amand griff in seine Tasche, schob die Hand an seinem jetzt schweigenden Handy vorbei und ertastete das Fläschchen mit den Nitroglyzerin-Kapseln. Sein Medikament holte er jedoch nicht hervor, sondern schraubte in der Tasche einhändig den Deckel ab, damit Belloq es nicht sah. Er schritt an der halb fertigen Bühne vorbei, die Teil der geplanten Feierlichkeiten zum siebzigsten Jahrestag des Endes des Zweiten Weltkriegs war. Die Fahnen waren noch nicht gehisst, sonst hätte dieser Vandale sie vielleicht auch beschmiert. Ansonsten war der Platz verlassen; die Schachtische und Boule-Spielfelder waren noch nicht von den alten Männern besetzt, die den Bereich hier als ihr Open-Air-Freizeitzentrum benutzten. Amand holte eine der Nitroglyzerin-Kapseln heraus und ergriff sie so, dass niemand sie in seiner Hand sehen konnte. Dann tat er, als müsste er husten. Er hielt sich die Hand vor den Mund, nahm die Tablette ein, schob sie unter die Zunge und spürte sofort, wie das Engegefühl in seiner Brust nachließ. Wieder summte sein Telefon und klapperte dabei an dem Tablettenfläschchen. Aber er ließ es klingeln und konzentrierte sich stattdessen auf seinen Atem, wie sein Arzt es ihn gelehrt hatte. Er stieg die Steinstufen zum Café hinauf und nickte den wenigen Gästen, die keine Touristen waren, grüßend zu.
»Commandant«, sagte Belloq und polierte das Glas, als könnte es niemals sauber werden. »Ich kann mich immer noch nicht daran gewöhnen, wie Sie aussehen. Lassen Sie sich einen Kaffee bringen.« Er wollte sich schon umdrehen, hielt dann aber inne und schlug sich theatralisch mit der Handfläche an die Stirn. »Tut mir leid. Keine anregenden Substanzen, stimmt’s? Muss sehr frustrierend sein, so viel abzunehmen und immer noch das Herz eines Sumoringers zu haben.«
Das Telefon in Amands Tasche hörte auf zu summen, und die Kapsel unter seiner Zunge fuhr fort, seine Adern zu weiten. »Um wie viel Uhr haben Sie heute Morgen geöffnet?«, fragte er.
»Gegen sechs, wie immer.«
»Ist Ihnen etwas Verdächtiges aufgefallen?«
»Verdächtig in welcher Hinsicht?«
»Zum Beispiel, ob jemand drüben bei der Gedenktafel zu sehen war, der ein Hakenkreuz daraufgesprüht hat?«
Belloq schüttelte den Kopf.
»War sonst jemand hier in der Nähe?«
Amand erhielt als Antwort abermals ein Kopfschütteln.
»Was ist mit dem Café – ist jemand schon vor Ihnen reingekommen?«
»Ich bin immer der Erste.«
»Wann haben Sie die Schmiererei bemerkt?«
»Ich bin das nicht gewesen, der sie zuerst gesehen hat.« Mit einer Kopfbewegung wies Belloq auf eine Kellnerin, die auf dem hinteren Teil der Terrasse ein paar Tische abwischte. »Das war sie. Sie hat mir Bescheid gesagt. Und ich habe Sie dann angerufen.«
»Hat sie auch einen Namen?«
»Höchstwahrscheinlich. Bei uns gibt es recht häufig Personalwechsel, und ich bin nicht gut darin, mir Namen zu merken.«
Amand nickte. Das Café Belloq war berüchtigt dafür, seine Angestellten bis zur Erschöpfung arbeiten zu lassen und ihnen Hungerlöhne zu bezahlen. »Etwas dagegen, wenn ich mit ihr rede?« Er setzte sich in Bewegung, und Belloq folgte ihm. Amand blieb stehen und drehte sich zu ihm um. »Allein, wenn Sie nichts dagegen haben.«
Belloq sah aus, als hätte er tatsächlich Einwände, aber im Café begann das Telefon zu läuten. Das schnarrende Klingeln wirkte wie ein Echo aus der Vergangenheit. Das alte Bakelit-Modell sah so antik aus, dass es inzwischen wieder als modisch galt; allerdings war das hier eher das Resultat von Geiz als von vorausschauendem Denken oder Stilbewusstsein.
»Sollten Sie nicht drangehen?«, fragte Amand. Belloq starrte die Kellnerin mürrisch an, drehte sich dann aber um und marschierte davon. Amand wartete, bis er im Innern des Cafés verschwunden war, und ging dann hinüber zu der Kellnerin.
»Mademoiselle?«, sprach er sie an und blieb an ihrem Tisch stehen. »Ich bin Benoît Amand von der Police Nationale.« Erschrocken blickte sie von den Croissantkrümeln auf, die sie gerade auf einen Teller fegte. »Keine Sorge, Sie stecken nicht in Schwierigkeiten. Wie heißen Sie?«
Ihr Blick huschte zum Café, wo Belloq durch ein Fenster zu sehen war. Er telefonierte, schaute jedoch in ihre Richtung. »Mariella«, murmelte sie.
»Mariella, Monsieur Belloq sagt, Sie hätten die Schmierereien auf der Gedenktafel entdeckt.«
Sie nickte kaum wahrnehmbar.
»Um wie viel Uhr war das?«
»Als ich die Tische nach draußen gestellt habe. Gegen halb sieben vielleicht«, antwortete sie; ihr Französisch war nicht ganz akzentfrei.
»Und wann haben Sie Monsieur Belloq davon erzählt?«
»Sobald ich es entdeckt hatte.«
»War um die Zeit noch jemand hier?«
»Nein.«
»Ich danke Ihnen, Mariella.«
Sie nickte und hastete davon; offenkundig war sie dankbar, von der Befragung befreit zu sein.
Amand ging auf den Eingang des Cafés zu und warf unterwegs einen Blick auf den Mann mit dem Eimer, der die Gedenktafel abschrubbte. Das Hakenkreuz war jetzt von dicker grauer Seifenlauge verdeckt, die auf das Mauerwerk hinuntertropfte.
»Er ist jetzt hier«, sagte Belloq genau in dem Moment, als Amand in die Bar trat, und streckte ihm das Telefon entgegen.
»Geht diese Uhr richtig?«, fragte Amand und wies mit einer Kopfbewegung in Richtung der Standuhr, die seit Vorkriegstagen die Zeit im Café Belloq maß.
Belloq nickte. »Ich stelle Sie jeden Morgen nach, wenn ich sie aufziehe. Wieso?«
»Weil mich interessiert, warum Sie drei Stunden gebraucht haben, um uns anzurufen, nachdem Sie eine Nazi-Schmiererei auf einer jüdischen Gedenkstätte vor ihrem Café entdeckt hatten.«
Belloq zuckte die Achseln. »Dachte, das wäre nicht wichtig.«
Amand ergriff das Telefon und nahm den Tabakgeruch wahr, den das schwarze Plastik im Lauf von Jahrzehnten aufgesogen hatte. »Amand.«
»Warum gehen Sie nicht an Ihr Handy?«
Amand erstarrte, als er die Anspannung in der Stimme des Sergeanten wahrnahm. »Was ist los, Henri?«
»Es geht um Josef Engel. Seine Putzfrau hat gerade angerufen. Sie ist hysterisch und behauptet, überall seien Ratten. Parra ist schon unterwegs zu Engels Atelier. Sie sagt, er ist ermordet worden.«
4. Kapitel
Solomon tat die Hand dort weh, wo er von dem herabsausenden Stock getroffen worden war, als er ihn abgefangen hatte: ein brennendes Gefühl, das nicht gänzlich unangenehm war. Er bewegte die Finger, um den Schmerz zu befördern und ihn seine Sinne schärfen zu lassen, während er die Straße entlangging. Inzwischen roch er Hinweise auf die Stadt vor ihm; sie waren wie etwas Kleines, Hartes, das unter den weicheren, alles überdeckenden Düften des Landes lag. Er vernahm den Geruch von Stein und Beton, heißen Ziegeln und Speiseöl, saurem Schweiß und Haarfett sowie den tiefer liegenden Abwassergestank von fast tausend Jahren menschlicher Besiedlung.
Seine Füße in den abgewetzten Arbeitsstiefeln, die er sich von einem toten Mann in Arizona geliehen hatte, waren reisemüde. Sie hatten ihn über die Fernstraßen und Feldwege von New Mexico und Texas getragen, waren über die Metallplatten des Decks eines Containerschiffs gepoltert, das in Galveston auslief, und schritten jetzt über eine gerade Straße, die Legionssoldaten in Sandalen vor zweitausend Jahren gebaut hatten. Graue Vierecke überlappten sich auf der Straßenoberfläche, und zwar an den Stellen, wo die glühende Sommerhitze und die trockenen, eiskalten Winter den Belag wieder und wieder mit Rissen übersät hatten. Im Laufe der Zeit war diese Straße zu einem Flickwerk aus Bruchstücken geworden – so wie Solomon selbst.
Nach und nach kam die Stadt Cordes in Sicht: Sie stieg aus dem Dunst auf wie ein Bergschloss am Ende der Patchworkstraße. Der Gipfel war von Festungsmauern eingefasst, deren große Steine verwittert waren und mit den schroffen, ursprünglichen Kalkfelsen des Puech de Mordagne verschmolzen. Steinhäuser klammerten sich an seine Hänge wie Rankenfüßer an eine Haifischflosse, und Solomon konnte die Geschichte der Stadtentwicklung an ihrer Architektur ablesen: Die ältesten Gebäude befanden sich ganz oben und die jüngsten am Fuß des Bergs; und es gab schmale, kurvenreiche Straßen sowie lange Steintreppen, welche die unterschiedlichen Ebenen miteinander verbanden. Hoch oben auf dem Gipfel erhob sich ein schmaler Turm. Ausgelöst durch dessen Anblick, erklang der Name der Kirche, zu der dieser Turm gehörte, flüsternd in Solomons Kopf: L’Église Saint-Michel – die Kirche des Heiligen Michael.
Solomon hatte die Stadt schon einmal gesehen, und zwar in einem Traum. Er schlief wenig und träumte fast nie, doch wenn dies geschah, dann hatte er fast immer den gleichen Traum – der mit dem Spiegel, der ihm kein Spiegelbild zeigte. Aber einmal, in seiner engen Koje in der Kombüse des Frachtschiffs, war er eingeschlummert und hatte im Traum diesen Ort erblickt, nebelumflossen und undeutlich – genau wie er sich in diesem Moment vor ihm präsentierte.
Cordes-sur-ciel – »Cordes am Himmel« – war nach dem Phänomen benannt, dessen Zeuge Solomon jetzt wurde. Die Stadt schien auf dem Nebel im Tal zu schweben.
Immer weiter kristallisierte sich die Stadt aus dem Dunst heraus, während er näher kam, und noch mehr Fakten stiegen an die Oberfläche seines Bewusstseins:
1222 durch den Grafen von Toulouse gegründet … 1348 fast durch die Pest ausgelöscht … Schwer beschädigt durch den Hundertjährigen Krieg im vierzehnten Jahrhundert und die Religionskriege des sechzehnten.
Ort mit Marktrecht. Handelszentrum. Textilien und Wolle, später Indigo und Broderie-Anglaise-Spitze. Die berühmten kleinen Krokodile eines weltbekannten französischen Designerlabels waren hier hergestellt worden.
Heute eine Touristenstadt, in der es in den langen Sommermonaten vor Menschen nur so wimmelt, die von der Geschichte des Ortes, dem Wetter hier, den schönen Steinhäusern sowie der herrlichen Aussicht über Weinberge angelockt werden.
Die Informationen stürzten durch Solomons Kopf wie ein Wasserfall. Alle Fakten waren korrekt, doch nichts davon erklärte ihm, was seine Verbindung zu diesem Ort sein mochte. Dieser Teil seines Gedächtnisses war nicht vorhanden, genau wie jedes andere Detail darüber, wer er war oder vielleicht einmal gewesen sein könnte. Immer wenn er sein allwissendes Gehirn dazu bringen wollte, Gedanken über seine Person hervorzubringen, verstummte es: keine Fakten, keine Erinnerungen. Es war, als sähe er in den Spiegel aus seinem Traum – in den, der kein Spiegelbild zurückwarf. Alles, was er hatte, waren Fragmente und Fragen.
Er knöpfte sein maßgeschneidertes Jackett auf und betrachtete das eingestickte Etikett darin:
Ce costume a été fait au trésor pour M. Solomon Creed – Dieser Anzug ist ein Geschenk für Mr Solomon Creed.
Die Goldfäden, aus denen die Inschrift bestand, glitzerten in der Morgensonne. Am Rande des Etiketts stand zudem die Adresse, wo der Anzug hergestellt worden war:
Fabriqué 13, Rue Obscure, Cordes-sur-Ciel, Tarn.
Solomon ließ das Vorderteil des Jacketts wieder herabfallen, das sich perfekt an seinen schlanken Körper schmiegte. Dies war der Ort, wo jemand an ihm Maß genommen und den Schnitt immer wieder angeglichen hatte, bis das Kleidungsstück ihm passte wie eine zweite Haut. Hier musste jemand seine Bezahlung entgegengenommen haben. Und vielleicht waren für die Lieferung gewisse Modalitäten vereinbart und eine Adresse sowie ein Name notiert worden: winzige Fragmente seiner verlorenen Lebensgeschichte, die ihn womöglich zu seiner wahren Identität zurückführen konnten – wie eine Spur aus Steinen, die in einem dunklen Wald ausgelegt waren. Er war nicht vollständig, und die Geschichte der Kleidung, die er trug, ebenfalls nicht.
Ce costume stand auf dem Etikett – dieser Anzug –, doch er besaß nur das Jackett.
Er knöpfte es wieder zu. Sein Stoff hatte die Gerüche seiner langen Reise eingefangen: Meersalz, Dieselabgase und Reisessig, Meerrettich und Tabakrauch. Er öffnete und schloss die Hand und ging weiter auf die Stadt und den Schneider zu – er war fünftausend Meilen gereist, nur um diesen Menschen zu finden. Schritt auf die Adresse zu, die in Gold auf ein Etikett gestickt war. Auf Antworten.
Nun, da er die Stadt sehen konnte, war ihr Geruch stärker: Die Ausdünstungen der Menschen, die hier lebten, tränkten im Verlauf ungezählter Jahrhunderte den Stein und wurden von der Brise und den Hitzeschleiern herangetragen wie Blütenstaub. Solomon atmete tief ein und identifizierte jeden Geruch so leicht, wie ein Florist den Duft unterschiedlicher Blumen einzeln benennen konnte. Auch die Ursache eines jeden kannte er, das Gefühl hinter jedem Enzym: Angst, Trauer, Glück, Sehnsucht … Aber da war ein neuer, ungewöhnlicher Geruch, scharf und metallisch, der ihm vertrauter vorkam als all die anderen Düfte und Ausdünstungen, die ihm auf der unsteten Brise entgegenwehten. Ein Geruch, der sein Herz schneller pochen und das Brandmal auf seiner Schulter auf eine Art schmerzen ließ, die ihm verriet, dass er bedeutsam war – der Geruch von frisch vergossenem menschlichem Blut.
5. Kapitel
Als Amand eintraf, befand sich Lieutenant Émile Parra bereits an dem Atelier in der Rue Obscure. Er parkte seinen fünfzehn Jahre alten Citroën, trat auf die Straße und sah zu dem stillen Haus hoch, an dem die Fensterläden geschlossen waren, und zu dem eingeschossigen Atelier, das daneben errichtet war. »Atelier Engel – Maßschneider« stand auf dem Schild über der Tür.
Amand schaute zu Parra hinüber. »Wer ist bisher in dem Haus gewesen?«
»Nur die Putzfrau – und ich.«
»Wo ist sie jetzt?«
Mit einer Kopfbewegung wies Parra die Straße entlang. Dort saß eine dünne, grauhaarige Frau in einer hellblauen Haushälterinnenschürze auf der Treppe eines Ferienhauses, an dem die Rollläden heruntergelassen waren. Ihre Hände lagen gefaltet in ihrem Schoß, und sie starrte nach unten auf das Kopfsteinpflaster, sodass es aussah, als würde sie beten. Amand kannte die Frau: Madame Ségolin, eine Matriarchin aus einer der alteingesessenen Familien dieses Ortes. »Hast du sie vernommen?«
»Kurz.« Parra klappte ein Notizbuch auf. »Sie sagt, sie sei kurz nach acht gekommen, weil im Moulin, wo sie das Baguette für Monsieur Engel kauft, eine Schlange stand. Sie schloss auf, roch etwas, das sie für einen verstopften Abfluss hielt, ging ins Atelier und sah Monsieur Engel auf dem Boden liegen. Dann bemerkte sie die Ratten und rannte nach draußen. Sie hat uns vom Handy aus angerufen und saß schon da drüben, als ich hier angekommen bin. Seitdem hat sie sich nicht gerührt.«
Amand beobachtete, wie sie sich mit offenen Augen, aber leerem Blick leicht vor und zurück wiegte. Er vermutete, dass sie vor ihrem inneren Auge sah, was sie auf dem Boden des Ateliers entdeckt hatte, und bei der Erkenntnis, dass er es gleich auch zu Gesicht bekommen würde, zog sich seine Brust ein wenig zusammen.
»Vergewissern Sie sich, dass es ihr gut geht«, sagte er. »Finden Sie heraus, ob jemand hier in der Nähe ihr einen Kaffee oder etwas Stärkeres geben kann.« Er schritt an Parra vorbei und betrat das Atelier.
Noch im selben Moment, als er hineinging, schlug ihm der üble Gestank entgegen: Abwasser, Ammoniak und Rost sprachen einen urtümlichen Teil seines Hirns an und erweckten in ihm den Wunsch, sich augenblicklich umzudrehen und wegzulaufen. Sein Vater hatte ihm einmal gesagt, Tapferkeit bestünde nicht darin, furchtlos zu sein, sondern Angst zu haben und das, was einen ängstigte, trotzdem zu tun. Papa hatte fünf Jahre als Mitglied der Fremdenlegion in Nordafrika gekämpft und war wegen Dienstunfähigkeit entlassen worden, nachdem man ihm ins Bein geschossen hatte; also wusste er, wovon er redete. Amand griff erneut in seine Tasche, steckte sich noch eine Nitroglyzerin-Kapsel unter die Zunge und ging weiter.
Mehrere Schritte von ihm entfernt war ein umgekippter rechteckiger Putzeimer aus Plastik, daneben lagen Flaschen mit Bleichmitteln sowie Lappen auf den Bodendielen. Amand vermutete, dass der Eimer Madame Ségolin aus der Hand geglitten war, als sie gesehen hatte, was sich dort hinten im Raum befand. Er trat darauf zu, aber die zahlreichen Schneiderpuppen, die in unterschiedlicher Weise bekleidet waren, versperrten ihm zunächst die Sicht. Aufgrund der stark ansteigenden Tagestemperaturen setzte bereits ein penetranter Verwesungsgestank ein, der sich mit dem Geruch von Blut, Urin und Kot vermischte. Als Amand den Eimer erreichte, konnte er den zusammengesackten Körper sehen. Der Leichnam lag in einer dunklen Lache, in der sich das Licht spiegelte, das durch die Deckenfenster einfiel. Amand trat einen weiteren Schritt darauf zu, doch dann ließ ihn eine leichte Bewegung auf der Leiche erstarren. Er sah, wie hinter dem Kopf des alten Mannes eine kleine, spitze Schnauze mit feuchten Schnurrhaaren und langen, rot gefärbten Zähnen auftauchte. Einen Moment lang sog die Ratte die Luft ein, duckte sich dann wieder und fraß weiter.
Amand brannte die Galle im Hals. Er stampfte auf die Bodenbretter, um das Ungeziefer zu vertreiben, und noch mehr Ratten kamen unter dem Leichnam hervor. Sie huschten in die Dunkelheit davon, die ihnen Sicherheit versprach, und hinterließen mit ihrem feuchten Fell und ihren nassen Krallen Spuren auf dem Boden. Doch eine von ihnen hielt neben einem kleinen Holzkasten inne, der in der Nähe des Toten stand, und sah sich um. Amand stampfte noch einmal auf den Boden, aber die Ratte quietschte herausfordernd und wandte ihm die ausgefransten Ohren zu. Dann drehte sie sich um und begann, sich wieder auf die Leiche zuzubewegen. Amand spürte, wie ihm die Galle in den Mund stieg. Er griff nach seiner Dienstpistole, entsicherte sie und zog sie aus dem Halfter. Der Schuss hallte in dem stillen Atelier wie ein Donnerschlag wider, und die Ratte wurde zur Seite geschleudert. An der Stelle, an der sie gewesen war, blieben eine Blutschliere und gesplittertes Holz zurück. Hinter sich hörte Amand, wie jemand herbeigerannt kam. Er drehte sich um und hob die Hände. »Alles in Ordnung«, sagte er. »Rufen Sie La Domial in Les Cabannes an. Sie sollen sich ein paar Rattenfallen schnappen und sie herbringen. Fallen, kein Gift. Die verdammten Biester hier sind jetzt Beweisstücke.«
Parra nickte, griff nach seinem Handy und blickte an Amand vorbei: Mit weit aufgerissenen Augen starrte er die Leiche auf dem Boden an.
»Und rufen Sie in Albi an und sagen Sie den Leuten, sie sollen mit dem Spurensicherungsteam in die Hufe kommen«, fuhr Amand fort. »Wir müssen diesen Raum untersuchen und die Leiche einpacken, bevor noch irgendetwas von ihr abgebissen wird.«
Er drehte sich wieder um, ging weiter durch das Atelier und schlängelte sich um die Schneiderpuppen herum, damit er die Leiche genauer in Augenschein nehmen konnte. Als er das Gesicht des alten Mannes sah, schluckte er heftig. Er hatte Josef Engel ziemlich gut gekannt, doch in der Gestalt, die vor ihm auf dem Boden lag, erkannte er ihn nicht wieder. Von dem Gesicht des Schneiders und seinem Oberkörper war nur noch rotes, nacktes Fleisch übrig. Tausende winziger Bisse zeigten, wo die Ratten sich an ihm gütlich getan hatten. Amand begann im Stillen, das Gespräch zu proben, das er mit Josefs nächsten Angehörigen führen würde, und fragte sich, wie er all das, was er hier erblickte, in einer gemessenen Beileidsbekundung wiedergeben sollte.
»Rufen Sie Marie-Claude an!«, befahl er. »Überprüfen Sie, ob sie zu Hause ist – und wenn, dann sorgen Sie dafür, dass sie auch dort bleibt. Wer immer das getan hat, könnte einen Groll gegen die ganze Familie hegen. Ach, und schicken Sie jemanden dorthin. Vergewissern Sie sich, dass es ihr gut geht, und sagen Sie, ich komme gleich …«
Dann hörten sie etwas, das ihre Köpfe herumfahren ließ.
Musik. Im Haupthaus spielte jemand Klavier.
Amand hob die Pistole in die Richtung, aus der die Musik kam, und warf Parra einen Blick zu. »Sie sagten doch, im Haus wäre niemand.«
»Madame Ségolin hat das gesagt …«
»Sie haben nicht nachgesehen?«
Parra schüttelte den Kopf. »Ich habe die Leiche gesehen und Sie sogleich angerufen.«
»Wo haben Sie Ihre Waffe?«
»Im Auto. Ich könnte sie holen gehen –«
»Nein. Bleiben Sie hier. Halten Sie die Stellung, und rufen Sie auf der Wache an. Lassen Sie schnell noch mehr Leute herkommen, und schicken Sie jemanden zu Marie-Claude nach Hause.«
Parra nickte und sah auf sein Handy hinab. Amand bewegte sich mit vorgestreckter Pistole auf die Tür zu, die zum Haupthaus führte. Die Musik spielte weiter – komplexe Klangfolgen, die schnell ineinander übergingen –, und Amand wurde die Brust immer enger.
Tapferkeit bedeutet, Angst vor etwas zu haben und es trotzdem zu tun.
Er erreichte die Tür, drehte den Knauf und trat ins Haupthaus.
6. Kapitel
An Marie-Claudes Tür klopfte es laut, sodass sie die Milch verschüttete, die sie gerade über die Getreideflocken ihres Sohns goss. Sie warf einen Blick auf die Uhr: 8.22 – zu früh für einen Höflichkeitsbesuch.
»Wer ist das?«, fragte Léo, dessen dicke, runde Brillengläser seine ohnehin großen braunen Augen noch riesiger wirken ließen. »Ist das etwa Papa?«
Sie nannte den für Léo typischen Blick, den er in vielen Situationen zeigte, »seine Disney-Augen«: große, weit aufgerissene Augen, in denen die ganze Hoffnung und Sehnsucht standen, die ein Siebenjähriger aufbringen konnte. Aber manchmal hatte er einen »Bambi-Blick« – einen ängstlichen Ausdruck –, und genau das war jetzt der Fall.
»Nein«, antwortete sie, und Léos Brille verstärkte seinen Ausdruck der Erleichterung. »Wahrscheinlich eine Lieferung oder so etwas. Iss dein Frühstück. Ich gehe nachsehen, wer das ist.«
Marie-Claude trat in die Diele und zog die Tür hinter sich fast zu, sodass nur noch ein winziger Spalt blieb. Sie konnte den dunklen Umriss des unerwarteten Besuchers erkennen, der vor der großen Mattglasscheibe, die Licht durchließ, von einem Fuß auf den anderen trat. Er sah zu klein aus, um ihr Mann zu sein – ihr Exmann, genauer gesagt. Das konnte er nicht sein. Obwohl – möglich wäre das gewesen. Jean Baptiste war vor drei Wochen aus dem Gefängnis entlassen worden, vorzeitig und ohne Auflagen, und seitdem hatte ihn niemand mehr gesehen.
Sie ging die kurze Diele entlang, warf einen Blick auf den Baseballschläger, der von den Mänteln verborgen wurde, und rieb sich die Narbe an ihrem Unterarm. Amand hatte angeboten, ihr eine Pistole zu besorgen, aber sie hatte es abgelehnt. Was hätte sie auch damit anfangen sollen? Sie konnte ihren Exmann schließlich nicht erschießen, und sie wollte wegen Léo keine geladene Waffe im Haus haben. Ihr Herz hämmerte, als sie durch den Türspion spähte. Vor dem Eingang stand ein Gendarm und trat von einem Fuß auf den anderen. Marie-Claude stieß die Luft aus; erst jetzt wurde ihr bewusst, dass sie den Atem angehalten hatte. Als Nächstes sah sie nach, ob die Kette fest vorgelegt war, und öffnete dann die Tür.
Beim Rasseln der Kette nahm der Gendarm Haltung an. »Bedaure, Sie zu behelligen, Madame. Mir wurde befohlen, nachzusehen, ob Sie zu Hause sind, und mich zu vergewissern, dass es Ihnen gut geht.«
»Warum?« Sie senkte ihre Stimme. »Was ist passiert? Geht es um meinen Exmann?«
»Ich weiß es nicht. Man hat mir nur mitgeteilt, ich soll nachsehen …«
»Wer hat Ihnen das gesagt?«
»Commandant Amand.«
»Hat er erwähnt, warum?«
»Ich habe nicht direkt mit ihm gesprochen, sondern nur eine Nachricht erhalten: Mein Befehl ist es, sicherzustellen, dass Sie hier sind, und Ihnen zu sagen, Sie sollen sich nicht von der Stelle rühren, bis der Commandant kommt.«
»Dann stehe ich unter einer Art Hausarrest?«
»Nein, Amand – ich meine, der Commandant – hat gesagt …«
»Mein Sohn muss in zwanzig Minuten in der Schule sein. Wie soll das gehen, wenn ich das Haus nicht verlassen darf?«
»Man hat mir nur mitgeteilt … Ich bin mir sicher, dass der Commandant bis dahin hier ist.«
»Na, das sollte er auch, sonst bringe ich meinen Sohn trotzdem zur Schule.«
Sie schob die Tür zu, bevor der Polizist etwas entgegnen konnte, schloss sie wieder ab und lehnte sich gegen das Holz. Durch den Adrenalinstoß zitterten ihre Knie leicht. Sie hasste es, so zu leben, hasste es, dass ihr Ex diesen Einfluss auf sie hatte. Jean Baptiste. Er war irgendwo da draußen, seit vier Jahren fort; und immer noch warf er einen Schatten auf ihr Leben. Jedes Mal, wenn es an der Tür klopfte; jedes Mal, wenn das Telefon klingelte; jedes Mal, wenn sie auf der Straße Schritte hinter sich hörte – bei alldem schärften sich ihre Sinne, und ihr Herz hämmerte wie verrückt. Es war ermüdend. Machte sie zornig.
Nachdem es passiert war, hatte sie eine Zeit lang eine Therapeutin aufgesucht: eine Psychiaterin, die ihr erklärt hatte, dass Menschen, die unter posttraumatischem Stresssyndrom litten, in einem ständigen Alarmzustand lebten – sich gefühlsmäßig immer in einer Kampf- oder Flucht-Situation befanden – und ihre Sinne dauernd auf Hochtouren arbeiteten. Die Frau hatte ihr auch erzählt, Kinder kämen schneller über so etwas hinweg als Erwachsene, und ihr geraten, sich auf sich selbst zu konzentrieren und aufzuhören, sich so viele Sorgen um Léo zu machen. Danach war Marie-Claude nicht wieder zu ihr gegangen.
Mit immer noch zittrigen Beinen trat sie vom Eingang weg und blieb an ihrer offenen Schlafzimmertür stehen. Bevor Léo aufgewacht war, hatte sie Interviewmaterial eingegeben, und ihr unordentliches Zimmer wurde von dem kalten Leuchten ihres Laptop-Monitors erhellt, auf dem das Bild eines neunzigjährigen Mannes mit tränenüberströmten Wangen zu sehen war. Sie trennte Arbeit und Zuhause so stark wie möglich, denn ihr war klar, dass ihr Sohn dem, was auf sie therapeutische Wirkung hatte, nicht unbedingt ausgesetzt werden musste. Sobald er alt genug war, um mit alldem umzugehen, wollte sie ihm alles erzählen: ihre Familiengeschichte und ihr dunkles Erbe. Doch einstweilen beschützte sie ihn davor und versteckte ihre Arbeit in einem kleinen Büro am anderen Ende der Stadt, weit weg von wachsamen Blicken.
Sie schloss die Tür, ging wieder die enge Diele entlang und blieb kurz an der Küchentür stehen, um Léo durch den Spalt zu beobachten. Er aß sein Frühstück und las den Text auf der Rückseite der Cerealien-Schachtel. Immer las er. Sie fragte sich, ob das für ihn eine Art Flucht war: eine Möglichkeit, die reale Welt auszuschließen und in einer imaginären, besseren zu verschwinden. Oder vielleicht las er einfach nur gern und hätte sich womöglich genauso verhalten, wenn er in eine normale Familie hineingeboren worden wäre – wie auch immer die aussehen mochte.
Als sie durch die Tür trat, blickte Léo auf. Seine Brille verstärkte seinen neugierigen Blick. »Wer war das?«
»Niemand. Ein Freund von Onkel Benny.«
»War es wegen Papa?«
»Nein.« Sie nahm den Cornflakes-Karton und stellte ihn auf die Arbeitsplatte. »Iss dein Frühstück auf, sonst kommst du zu spät zur Schule.«
»Aber der Mann an der Tür hat gesagt, wir sollten nirgendwo hingehen.«
Marie-Claude schüttelte den Kopf. Sie gab sich solche Mühe, Léo zu beschützen und dafür zu sorgen, dass sein Leben so normal wie möglich verlief, aber er schnappte alles auf. In den ersten beiden Jahren, nachdem es passiert war, hatte er kein einziges Wort gesprochen. Es war, als hätte das Trauma – hervorgerufen durch den Anblick dessen, was sein Vater seiner Mutter angetan hatte – dafür gesorgt, dass er sich tief in sich selbst zurückzog. Es hatte ihn übersensibel und besonders wachsam gemacht. Er sah alles, mehr als die meisten Menschen … zu viel. Und sie hätte am liebsten geweint, weil sie sich nur wünschte, er könnte ein normales Kind sein, jedoch nichts dagegen tun konnte.
»Iss deine Cornflakes«, sagte sie und trat an die Spüle, damit sie ihm weiter den Rücken zudrehen konnte. »Ich entscheide, ob du zur Schule gehst oder nicht – und nicht du und schon gar nicht Onkel Benny.«
Er beobachtete, wie der Gendarm sich vom Haus entfernte, wieder in sein Auto stieg und sich eine Zigarette anzündete.
Sein eigenes Fahrzeug hatte er vom Haus abgewandt geparkt: so weit weg, dass er nicht auffiel, aber so nahe, dass er das Gebäude durch den Rückspiegel im Auge behalten konnte. Er wartete darauf, dass die Frau herauskam, damit er das Haus durchsuchen konnte. Bald würde sie es verlassen, vielleicht ihren Sohn zur Schule bringen und dann das Kommissariat aufsuchen. Oder sie würde möglicherweise direkt zur Leichenhalle gehen, um ihren toten Großvater zu identifizieren. Das hing alles davon ab, wie der Chefermittler die Sache angehen wollte. Commandant Amand – so hieß dieser Beamte. Das hatte er aus dem Polizeifunk aufgeschnappt; das Abhörgerät hierfür war an den Zigarettenanzünder angeschlossen. Der Gendarm, der in dem geparkten Auto rauchte, war viel zu jung, um Amand zu sein, und hatte zu kurz mit der Frau geredet, um ihr viel zu erzählen. Sie hatte auch nicht bestürzt gewirkt. Vielleicht war dieser Polizist nur hier, um sie abzuholen.
Denn aufgelöst würde sie sein, wenn sie herausfand, was passiert war. Jemand würde bei ihr bleiben, ein Trauerberater beispielsweise oder jemand, der dazu ausgebildet war, sich um Menschen zu kümmern, die kürzlich einen Angehörigen verloren haben. Die Polizei würde ihr Fragen stellen müssen:
Wann haben Sie Ihren Großvater zuletzt gesehen oder mit ihm gesprochen?
Hatte er Feinde?
Kennen Sie jemanden, der ihm hätte übelwollen können?
Er empfand keine Freude darüber, die Ursache für all das zu sein, und er rief sich ins Gedächtnis, dass ihr Großvater schon im Krieg hätte sterben sollen. Von Rechts wegen dürfte es weder sie noch den kleinen Jungen geben. Sie waren Irrtümer der Geschichte. Und Irrtümer mussten bereinigt werden.
Er öffnete sein Fenster ein Stück weit, um etwas frische Luft hereinzulassen.
Er wartete.
7. Kapitel
Im Haupthaus klang das Klavier viel lauter. Das Stück war etwas Kompliziertes, Klassisches, und in Amands Kopf stieg eine vage Erinnerung an einen Film auf, in dem genau dieselbe Melodie einen Pianisten in den Wahnsinn getrieben hatte. Wer immer da jetzt spielte, hatte keinerlei solcher Probleme. Die Musik klang so gut, dass Amand sich fragte, ob er in Wirklichkeit bloß die Wiedergabe einer Aufnahme hörte; möglicherweise hatte sich ein CD-Spieler oder so über einen Timer automatisch eingeschaltet. Nur dass immer wieder ein bestimmter Ton gedämpft und matt klang, was in einer kommerziellen Aufnahme niemals vorkommen würde. Jemand musste auf dem Instrument spielen.
Amand folgte der Musik den Hausflur entlang. Er achtete darauf, dass seine Schritte leise waren, und spitzte die Ohren nach anderen Geräuschen als der Musik. Im Haupthaus war er noch nie zuvor gewesen. Er spähte im Vorbeigehen durch jede Tür und überzeugte sich davon, dass in den Zimmern niemand war, während er sich dem Raum näherte, aus dem die Klänge durch eine halb offen stehende Tür herausströmten. Die Unordnung, die er überall erblickte, und die aufgerissenen Schubladen verrieten ihm, dass das Haus durchsucht worden war. Er hatte keine Ahnung, wonach die Eindringlinge gesucht hatten. Vielleicht wusste es ja der Unbekannte, der auf dem Klavier spielte. Als Amand ans Ende des Hausflurs kam, stieg die Musik zu einem Crescendo an. Er hob die Pistole, dann trat er durch die Tür und in den Raum hinein.
Mit seinen adrenalingeschärften Sinnen nahm er in Sekundenbruchteilen den Gesamteindruck des Salons in sich auf – Gardinen vor den Fenstern, elegantes antikes Mobiliar, Bücherregale voller Modezeitschriften und noch mehr Schneiderpuppen, die im Raum aufgestellt waren. Letztere wirkten wie kopflose Partygäste, die dem Vortrag des hochgewachsenen, blassen Mannes lauschten, der an dem Klavier an der gegenüberliegenden Wand saß. Auch dieser Raum war von den Eindringlingen durchsucht worden.
»Die Hände dahin, wo ich sie sehen kann!«, befahl Amand. Doch der Mann am Klavier ignorierte ihn und spielte weiter, wobei er sich leicht hin und her wiegte, während seine langen weißen Finger den Tasten Musik entlockten. »Hören Sie auf zu spielen! Und Hände hoch.« Amand hob seine Waffe noch ein wenig mehr an und trat einen Schritt auf den Unbekannten zu.
Als Antwort darauf wurde die Musik lauter und gewann an Intensität, bevor schließlich der letzte Akkord erklang und verhallte. »Ich hatte mich gefragt, ob ich spielen kann«, erklärte der Mann mit weicher, tiefer Stimme. »Ich habe das Klavier gesehen und musste es einfach herausfinden.« Mit den Fingern der rechten Hand strich er an den Tasten entlang und schlug die hohl klingende Note am Ende an. »Jemand müsste sich um das g über dem eingestrichenen c kümmern«, sagte er und schlug die Taste noch ein paarmal mit dem kleinen Finger an. »Aber daraus wird jetzt nichts mehr, nicht wahr?« Langsam drehte er sich auf dem Klavierschemel um und sah zu Amand auf. »Er ist tot, oder? Der Schneider, meine ich.«