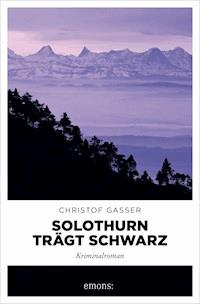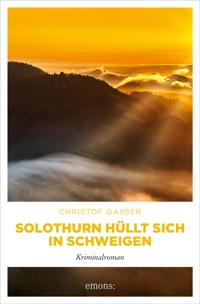Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Emons Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2022
Bestsellerautor Christof Gasser legt nach: rasant, vielschichtig und hochaktuell. Das Büro einer Frauenrechtsorganisation in Olten wird überfallen und in Brand gesetzt, dabei wird eine der Aktivistinnen schwer verletzt. Staatsanwältin Angela Casagrande und Polizeihauptmann Dominik Dornach nehmen rechtsextreme Kreise ins Visier, die bereits Anschläge gegen linke und grüne Politikerinnen verübt haben sollen. Kurz darauf verschwindet die Syrerin Rana Amidi, eine Freundin von Dornachs Tochter Pia spurlos – und Dornach gerät in ein Netz gefährlicher Verstrickungen zwischen Diplomatie, Wirtschaftsinteressen und globaler Machtpolitik.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 454
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Dieses Buch ist ein Roman. Handlungen und Personen sind frei erfunden. Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen sind nicht gewollt und rein zufällig. Im Anhang findet sich ein Glossar.
© 2022 Emons Verlag GmbH
Alle Rechte vorbehalten
Umschlagmotiv: Montage aus picture alliance/Werner Thoma, shutterstock.com/kuzmaphoto
Umschlaggestaltung: Nina Schäfer, nach einem Konzept von Leonardo Magrelli und Nina Schäfer
Umsetzung: Tobias Doetsch
E-Book-Erstellung: CPI books GmbH, Leck
ISBN 978-3-96041-897-9
Originalausgabe
Unser Newsletter informiert Sie
regelmäßig über Neues von emons:
Kostenlos bestellen unter
www.emons-verlag.de
Dieser Roman wurde vermittelt durch die Agentur Editio Dialog, Dr. Michael Wenzel (www.editio-dialog.com).
Im Gedenken anToni BallyChef, Mentor, FreundundMensch
Tho’ much is taken, much abides;and though we are not now that strengthwhich in old days moved earth and heaven;that which we are, we are;one equal temper of heroic hearts,made weak by time and fate,but strong in will to strive, to seek, to find.And not to yield.
Sind wir auch länger nicht die Kraft,die Erd’ und Himmel einst bewegte,so sind wir dennoch was wir sind;Helden mit Herzen von gleichem Schlag,geschwächt von Zeitund von dem Schicksal;doch stark im Willenzu ringen, zu suchen, zu finden.Und nie zu weichen.
Alfred Lord Tennyson, »Ulysses«
Es ist Unsinnsagt die VernunftEs ist was es istsagt die Liebe
Erich Fried, »Was es ist«
Prolog
In der klimatisierten, mit Tropenhölzern ausgekleideten Passagierkabine wischte er sich erleichtert den Schweiß von der Stirn. Die Hitze lag wie ein feuchtheißes Laken über dem Flughafen. Trockener Wüstenhauch hatte sich mit kühleren Luftströmungen des Golfes von Oman vereinigt. Allein die paar Schritte von der Limousine zum Privatjet hatten sein Hemd am Körper kleben lassen.
Die Flugbegleiterin hatte ihn am Fuß der Gangway willkommen geheißen und zu seinem Platz begleitet. Sie trug eine dunkelblaue, eng geschnittene Uniform. Obwohl ihre strohblonden Haare und die blauen Augen auf das Gegenteil schließen lassen müssten, machte ihr die Hitze offensichtlich nichts aus. Ihr dezentes Make-up war tadellos. Angesichts des kleinen Vermögens, das seine Firma für den Privatjet hingeblättert hatte, war ein vorzüglicher Zustand des Fluggerätes und erstklassiges Personal das Mindeste, was man erwarten durfte. Er zögerte, bevor er ihr den Rollkoffer überließ, damit sie ihn in der Gepäckablage verstauen konnte. Die Aktenmappe behielt er bei sich. Entspannt ließ er sich im komfortablen Ledersessel nieder und schnallte sich an. Ein Blick auf seine Uhr verhieß einen pünktlichen Start in einer Viertelstunde. Azravi, sein Begleiter, war noch nicht eingetroffen. Sie hatten am Abend zuvor miteinander telefoniert. Azravi hatte den kürzeren Weg von seinem Zuhause zum Flughafen und den schnelleren. Er wurde stets von einer Motorradeskorte begleitet, die dafür sorgte, dass die Straßen für ihn vom Verkehr befreit waren.
Er selbst hatte sich während seines Aufenthaltes mit einem vorausfahrenden Polizeiwagen mit Blaulicht und Sirene begnügen müssen. Es hatte ausgereicht. Die Einheimischen waren diszipliniert, eher aus Angst vor dem drakonischen Regime als dem eigenen Antrieb geschuldet.
Die Flugbegleiterin, die sich ihm als Gabrielle vorgestellt hatte, reichte ihm ein gekühltes Frotteetüchlein und ein Glas Champagner.
»Wann heben wir ab?«, fragte er.
»Der Tower hat soeben die Rollerlaubnis zur Startpiste erteilt. Wir starten in weniger als zehn Minuten.« Ihr Englisch hatte eine französische Klangfärbung. Er war versucht, ihr auf Französisch zu antworten, aber ihr Akzent war zu charmant.
»Dr. Azravi muss sich beeilen, sonst fliegen wir ohne ihn.«
Ein Stirnrunzeln löste Gabrielles Lächeln ab. »Hat man Ihnen das nicht mitgeteilt? Dr. Azravi fliegt nicht mit uns. Er wurde heute Morgen in einer dringenden Angelegenheit in den Palast gerufen. Er kommt am Abend mit dem Linienflug nach.«
Weshalb hatte man ihn nicht darüber informiert? Während des Fluges wollten sie die nächsten Schritte besprechen. Er schluckte den Ärger hinunter. »In diesem Fall werden wir uns gegenseitig Gesellschaft leisten müssen.«
»Selbstverständlich, Sir.« Ihr Mund verzog sich zum Anflug eines Lächelns.
»Wie lange sind wir unterwegs?«
»Die Gesamtflugzeit beträgt rund acht Stunden und dreißig Minuten, einschließlich eines Zwischenstopps. Wegen der Wetterverhältnisse über Südosteuropa werden wir in Istanbul Treibstoff aufnehmen. Ungefähr um achtzehn Uhr dreißig Ortszeit sollten wir am Grenchen Airport aufsetzen.«
Während Gabrielle die Flugroute rekapitulierte, rollte die Maschine zur Startbahn. Er warf einen Blick auf seine Rolex. Kurz vor zwölf Uhr. Wenn alles gut ging, würde er mit seiner Familie zu Abend essen.
Sie nahm ihm das leere Champagnerglas ab. »Ich muss auf meine Position. Sobald wir die Reiseflughöhe erreicht haben, serviere ich die Vorspeise.«
Er lehnte sich zurück. Das Klima hatte ihm dieses Mal mehr zu schaffen gemacht als bei seinen früheren Besuchen. Oder waren es die Bilder, die sich in sein Gedächtnis gebrannt hatten? Die Unterlagen allein durchzugehen würde ihn Überwindung kosten.
Das Anschnallzeichen leuchtete auf. Der Schub presste seinen Körper in den Sitz. In einigen Minuten würde der Bombardier Learjet die Reiseflughöhe erreichen.
Entspannt schloss er die Augen.
Dutzende Menschen bildeten ein Spalier entlang der Straße: Frauen, Männer, Kinder. Er sah sie nicht, sein Blick war auf den Boden geheftet. Als er es endlich wagte, den Kopf zu heben, war das Spalier verschwunden. Menschen lagen am Straßenrand, leblos, mit verzerrten Gesichtern, mitten unter ihnen ein kleiner Körper, ein Mädchen. Im Gegensatz zu den anderen machte es den Anschein, friedlich zu schlafen. Es umklammerte seine verschleierte Puppe, deren Gesicht seine kleine Hand bedeckte. Er beugte sich über das Kind. Nur wenige Zentimeter trennten ihre Gesichter voneinander.
Es schlug die Augen auf.
Er fuhr mit einem Aufschrei hoch.
»Entschuldigen Sie, Sir. Ich wollte Sie nicht erschrecken.« Die Flugbegleiterin sah ihn besorgt an. »Fühlen Sie sich nicht gut?«
»Nein, es ist nichts. Ich muss eingenickt sein.«
»Darf ich Ihnen die Vorspeise servieren, ein Lachstatar?« Sie reichte ihm ein erwärmtes, parfümiertes Erfrischungstuch.
Das mit Rosenduft durchsetzte Baumwollfrottee kühlte wohltuend. »Auf jeden Fall, ich habe einen Bärenhunger. Wenn etwas von dem vorzüglichen Champagner übrig ist, nehme ich gern noch ein Glas.«
Gabrielle war ehrlich froh, dass es ihm besser ging. Sie erinnerte ihn an die Tochter, die er sich sehnlichst gewünscht und die Vorsehung ihm nie vergönnt hatte.
»Kommt sofort«, sagte sie und entfernte sich in die kleine Kombüse hinter der Pilotenkanzel.
Wenig später stellte sie einen sorgfältig arrangierten Teller vor ihm hin, dessen Duft ihm das Wasser im Mund zusammenlaufen ließ.
Der stechende Schmerzkam von der Injektionsspritze, die in seinen Nacken gerammt wurde, und ging sofort vorüber. Bevor er realisierte, was es für ihn bedeutete, lösten sich seine Gedanken in nichts auf.
***
Gabrielle zog die Spritze aus dem Nacken der Zielperson und entsorgte sie im Abfallkübel der Kombüse. Das Notebook befand sich in seiner Aktenmappe. Aus dem Schrankfach für die Crew nahm sie eine externe Festplatte. Während sämtliche Daten des Notebooks auf die Festplatte kopiert wurden, tauschte sie ihre Uniform mit einem schwarzen Druckanzug. Sie steckte die Festplatte in eine gefütterte Innentasche und klopfte dreimal kurz, zweimal lang, zweimal kurz an die Tür des Cockpits. Die beiden Piloten traten heraus. Sie trugen bereits ihre Druckanzüge.
»Everything alright?«, fragte der Captain mit einem rollenden Akzent.
»Oui.« Gabrielle deutete auf den zusammengesunkenen Körper im Flugsessel. »Er wird nichts merken.«
»Let’s go then!«
Gabrielle öffnete die Gepäckablage. Neben dem Rollkoffer lagen drei Fallschirme und drei Helme. Nachdem sie die Ausrüstung angelegt und den Sitz gegenseitig geprüft hatten, nahm sie zwei Sprengsätze mit Zeitschaltung aus ihrer Tasche.
Sie befestigte die Haftladungen in der Kabinenmitte auf der Höhe der Flügel und hinten.
»Trente secondes!«, rief sie.
Der Kapitän löste die Kabinentür aus.
Sie sprangen hintereinander, Gabrielle als Letzte. Sie legte die Arme an ihren Körper und ging auf Tauchflug, wie sie es vor dem Einsatz zigmal geübt hatte.
Der wolkenlose Himmel leuchtete in einer helleren Nuance als das Meer unter ihr. Ein einzelnes, aus ihrer Perspektive fast mikroskopisch kleines Schiff durchpflügte die Wassermasse. Es hatte das gleiche Ziel wie sie: »LZ UNO«, ihr Landegebiet mitten im Golf, wo es sie aufnehmen sollte, bevor ein streunendes Boot der iranischen Küstenwache oder Marine ihrer gewahr wurde.
Die Explosion und den Blitz schräg über ihr nahm sie aus den Augenwinkeln wahr.
Phase eins der Mission war erfüllt.
1
Sechs Wochen später
Der Donner riss Anastasia Tomaso aus ihren Gedanken. Sie war dermaßen in den Bericht vertieft gewesen, dass sie den Wetterumschlag nicht mitbekommen hatte. Bereits den ganzen Tag lag die für Mitte August ungewöhnlich schwüle Hitze wie ein Deckel über dem Talkessel von Olten. Allein die zwei Minuten Fußweg vom Zug bis zum Büro am Morgen waren schweißtreibend gewesen.
Sie stellte den Tischventilator ab, mit dem sie mehr schlecht als recht versucht hatte, die Raumluft in Bewegung zu halten. Das Geräusch, welches das Gerät von sich gab, klang wie ein Seufzer der Erleichterung.
»EmmaWatch« hatte seine Büros im Erdgeschoss neben dem Eingang in einem mehrstöckigen Gebäude. Kein Lufthauch erreichte den Grund der Häuserschlucht in der Martin-Disteli-Straße hinter dem Bahnhof. Die Mittagspause hatte Tomaso zusammen mit ihren Kolleginnen an der Aare verbracht, die den östlichen Stadtteil von der Altstadt trennt. Am Fluss hatte ihnen ein schwacher, lauwarmer Wind ein Mindestmaß an Abkühlung verschafft.
Ein Blitz erhellte das dämmrige Zwielicht draußen, kurz darauf folgte ein weiterer, schärferer Donnerschlag. Das Gewitter war nah. Möge es diesmal das Bifangquartier mit einer wirklichen Abkühlung beglücken, nicht wie vorgestern Montag, als es sich nach ein paar verirrten Regentropfen südlich des Borns Richtung Wiggertal und Zentralschweiz verzogen hatte.
Die Wanduhr zeigte kurz vor Viertel vor acht. Feierabend, schon lange eigentlich. Nicht für sie, solange sie mit den Akten nicht durch war. Sie hatte noch Zeit. Der letzte Intercity nach Solothurn würde Olten zwanzig Minuten vor Mitternacht verlassen. Danach fuhren nur noch Regionalzüge – mit Halt an jedem Misthaufen.
Zudem hatte sie im Bummelzug schon zweimal der gleiche Typ im Hoodie komisch angestarrt. Sie war sich einiges gewohnt und nicht leicht zu verunsichern. Für Extremsituationen hatte sie einen Pfefferspray in ihrem Rucksack. Sie hatte es Gerda erzählt. Die hatte gefragt, ob es ein Ausländer gewesen sei, und sich gleich für die stereotype Frage entschuldigt. Manchmal waren Frauenrechtlerinnen so wenig davor gefeit wie Normalsterbliche. Was das betraf, hatte Tomaso Entwarnung gegeben. Der Mann war eindeutig einheimisch gewesen. Als er eingestiegen war, hatte er telefoniert, mit echtem Niederämter Zungenschlag.
Ein scharfer Knall hinter ihr ließ sie herumfahren. Das war kein Donner gewesen.
»Ups!« Gerda kam mit belämmerter Miene aus der Toilette. »Sorry, Nasti, die Tür ist mir aus der Hand gerutscht.«
»Mann«, stieß Tomaso hervor. »Ich dachte, du seist gegangen. Was treibst du noch hier?«
»Was raus muss, muss raus. Das Gleiche könnte ich dich fragen. Ich mach mich auf den Weg. Kommst du auch? Sundowner im Aarebistro?«
Tomaso deutete auf den Stapel vor ihr. »Netter Versuch, aber nein danke, ich muss den unbedingt abbauen. Bis zu den Ferien will ich sauberen Tisch machen. Außerdem, hast du mal rausgeschaut?« Die Hauswände reflektierten die Blitze. »Da geht’s gleich ab.«
Gerda zuckte mit den Achseln. »Dann halt ein andermal.« Sie umarmte ihre Kollegin. »Vergiss diesmal nicht, die Alarmanlage einzuschalten, wenn du einen Abgang machst. Ciao, Bella.«
»Versprochen.« Tomaso hob die Hand zu einem knappen Abschiedsgruß, bevor sie sich erneut den Akten zuwandte. Heftiges Prasseln drang von außen an ihre Ohren. Sie warf einen Blick aus dem Fenster. Die ersten schweren Tropfen verdampften auf der Straßenoberfläche. Durch die schräg geöffneten Fenster drang der Geruch von feuchtheißem Asphalt herein und kitzelte ihre Nase. Eine teerig-metallene Mischung, die sie seit ihrer Kindheit mit dem Sommer verband. Die Erinnerung rief Bilder sonniger Ferientage im Juli auf, die sie während der ersten Schuljahre in ihrem kleinen Elternhaus in Solothurn verbracht hatte. Die Eltern hatten sich lange Zeit keine Ferien in den Bergen oder am Meer leisten können. Das größte Vergnügen war es, mit ihrem kleinen Bruder im aufblasbaren Badebecken zu planschen. Brunos verzücktes Kreischen, als sie ihn nass spritzte, klang in ihr nach.
Tomaso fuhr hoch und sah sich verwirrt um. Sie musste eingenickt sein. Na toll, so kam sie nirgendshin. Sie stand auf und streckte sich. Sie brauchte unbedingt Koffein, auf das Risiko hin, nachher nicht einschlafen zu können. In der Küchennische stand ein funkelnagelneuer Jura-Vollautomat, das Geschenk der dankbaren Mutter einer Klientin. Erleichtert stellte sie fest, dass er betriebsbereit war, allerdings mit leerem Bohnenfach. Die Nachfüllung wäre heute Gerdas Job gewesen. »Danke, Schatz.«
Schon der Geruch des frischen Kaffees, der in ihre Tasse einlief, weckte ihre Lebensgeister.
Es klingelte. Die Eingangstür wurde geöffnet. Sie sollte doch abgeschlossen sein. War Gerda zurückgekommen?
»Wieder was vergessen?«, rief Tomaso. Gerda war ein Musterfall von Zerstreutheit. Mindestens ein- oder zweimal pro Woche musste sie auf halber Strecke nach Hause oder zur Arbeit kehrtmachen, weil sie entweder ihre Hausschlüssel oder ihren Geldbeutel nicht eingesteckt hatte. Was war es diesmal, ein Schirm? Mittlerweile ging ein richtiger Wolkenbruch über der Stadt nieder.
Tomaso stutzte. Warum antwortete ihre sonst so redselige Kollegin nicht?
»Gerda?«
Keine Antwort, bis sie rasche, schwere Schritte und das Quietschen der Schublade eines ganz bestimmten Aktenschrankes vernahm. Dort war ganz sicher kein Schirm drin.
»Gerda, was ist los?«
Mit der dampfenden Tasse in der Hand ging sie hinaus in den Büroraum.
Sie blieb wie gelähmt stehen.
Sie erkannte den Hoodie sofort. Den Kerl darunter auch, das heißt, sie glaubte, ihn zu erkennen. Die untere Hälfte seines Gesichtes war mit einem schwarzen Schal bedeckt.
Hinter ihm tauchte eine zweite vermummte Gestalt auf. Kein Hoodie, sondern eine schwarze Roger-Staub-Mütze. Ein schmaler Schlitz gab ein dunkles Augenpaar frei.
»Sie … Was wollt ihr hier?«
Hoodies Augen blinzelten unsicher.
»Verschwindet oder ich rufe die Polizei.« Tomaso schielte zu ihrem Handy. Es lag auf ihrem Pult, außer Reichweite.
»Worauf wartest du?«, zischte die Roger-Staub-Mütze den Hoodie an. »Kümmere dich um die Schlampe, bevor sie die Nachbarschaft zusammentrommelt.«
Hoodie kam auf Tomaso zu. Sie schüttete ihm den Kaffee an den Kopf. Aufschreiend schlug er die Hände vors Gesicht.
Die Roger-Staub-Mütze reagierte schneller. Er ging auf Tomaso los und versetzte ihr einen Faustschlag ins Gesicht. Tomaso ging zu Boden. Sie schlug hart mit dem Hinterkopf auf. Sie blieb bei Bewusstsein, wollte sich aufrichten. Das Letzte, was sie sah, waren Hoodie und ein Schlagstock, der auf sie zuraste.
***
Die Dunkelheit. Das Zimmer. Das Mondlicht bahnte sich einen Weg durch einen Spalt des zugezogenen Vorhangs. Wie ein silbernes Schwert teilte es die Dunkelheit. Es leuchtete auf die schlafende, nackte Frau neben ihm. Sie war von außerirdischer Schönheit. Ihr Gesicht strahlte im Dunkeln, umkränzt von schwarzen Locken.
Jana.
Sein Leben, seine Liebe. Sie war so nah. Nichts konnte sie auseinanderbringen, nicht einmal der Tod. Er streckte seine Hand aus. Er wollte sie fühlen, die Weichheit ihrer Lippen, ihre Wärme, die seidige Sanftheit ihrer glatten Haut, die narbige Verhärtung ihrer Wunde, wo sie Vukovics Kugel in die Brust getroffen hatte.
Jana.
Sie verlangte nach der Berührung. Seine Hand erreichte ihre Aura, den Strahlenkranz ihres Körpers. Sein Leib erzitterte. Ihre Vibration übertrug sich auf ihn.
Jana.
Ihr Körper wich von ihm zurück. Die Distanz betrug nur wenige Zentimeter, und doch blieb sie unerreichbar. Er setzte sich auf, beugte sich über sie. Eine transparente Wand hinderte ihn daran. Sie ließ alles durch, nur ihn nicht. Je mehr er vordrang, desto mehr wich sie zurück.
»Jana!« Seine Stimme, er hörte sie, weit entfernt.
»Jana!« Noch einmal.
Sie öffnete die Augen.
Die Wand war nicht mehr da. Nichts stand mehr zwischen ihnen. Ihr Mund öffnete sich. Ihre Lippen berührten sich – fast. Er konnte sie spüren, ihren Atem riechen und schmecken – Pfefferminze.
Er wollte sich erneut über sie beugen. Eine Hand an seiner Schulter hielt ihn zurück.
Janas Gesicht verzerrte sich, wurde zu einer Fratze. Ihr Angstschrei zerriss die Stille, drang in ihn hinein. Die Hand riss an seiner Schulter.
»Paps?« Pia rüttelte sanft an seiner Schulter.
»Was?« Janas Schrei klang in seinen Ohren nach.
»Hast du geträumt?« Ihr Blick belustigt, gleichzeitig leicht irritiert.
»Nein, ja, was Verrücktes.«
»Was denn?« Definitiv belustigt.
»Es war …« Warum sollte er ihr das erzählen? Alte Wunden aufreißen, die gerade erst vernarbt waren. »Keine Ahnung, hab’s vergessen.«
»Aha. Und warum ist er nicht im Bett?«
Dornach folgte ihrem Blick zum hölzernen Laufgitter vor dem Cheminée, in dem er als Baby schon Stunden verbracht hatte. Hinter den Stäben schichtete Mirio stillvergnügt bunte Bauklötze aufeinander.
Erwischt. Großvaterleistung des heutigen Abends für Dominik Dornach: mangelhaft.
Wo waren die Ausreden, wenn man mal eine brauchte?
»Er spielte friedlich mit seinen Klötzen, da brachte ich es nicht übers Herz. Du weißt, wie er tobt, wenn man ihn von etwas losreißt, in das er sich vertieft hat. Genau wie –«
»Wie ich in seinem Alter, schon klar. Hast du mal auf die Uhr gesehen? Fast halb elf. Morgen wird seine Laune unterirdisch sein. Von wem er das wohl hat?«
»Schon gut, mein Fehler.«
»Bist mir ein schöner Babysitter.« Sie hob die Flasche Rotwein vom Beistelltisch. Leer. »Sag nicht, du hast die ganz allein getrunken.« Es klang besorgt. Seit Janas Tod hatte sie ihn in Verdacht, mehr zu trinken.
»Was du übriggelassen hast, reichte für wenig mehr als ein Glas.« Mehr lag nicht drin. Er war an diesem Abend Pikettoffizier. »Habe den Rest Mirio gegeben. Wollte ihm aber nicht so recht schmecken.«
»Du hast was?«
»Kleiner Scherz, du solltest dein Gesicht sehen.«
»Witzig, Paps.« Pia hob ihren Sohn aus dem Laufgitter. »Zeit zum Dodomachen. Auf Großpapi ist kein Verlass.«
»Dodo nei, nei Dodo«, quengelte Mirio, bis er seinen Kopf in ihre Halsbeuge legte. Ein sicheres Zeichen, dass er demnächst einschlafen würde.
»Ich bringe ihn zu Bett«, bot Dornach an. Pias Bemerkung hatte seinen großväterlichen Stolz angekratzt.
»Lass nur.« Sie roch an Mirios Windel und rümpfte die Nase. »Ich mache das schon. Hol du mal eine neue Flasche Wein, ich habe auch Lust auf ein Glas.«
»Wo hast du den Rest eures ›Trio infernal‹ gelassen?«
»Nadal und Rana sind im ›Solheure‹ hängen geblieben.« Sie ging mit Mirio nach oben. Die Mutterschaft hatte die verbliebenen Ecken und Kanten des Teenagers wegradiert. Sie war voller geworden. Die großen dunklen Augen, ein Vermächtnis ihrer Mutter, hatten ihren inquisitiven Ausdruck und das Feuer behalten. Es loderte verhaltener, es sei denn, etwas lief ihr zuwider. Die eine oder andere Stichflamme ließ dann nicht lange auf sich warten.
Trotz allem, was Pia während der frühen Wochen ihrer Schwangerschaft durchgemacht hatte, war diese ohne Komplikationen verlaufen. Erst Monate nach Mirios Geburt hatte sie eine tiefe Depression durchlaufen. Das tragische Schicksal von Mirios Vater Rafik im Irak und Janas Tod hatten ein tiefes Gefühl von Verlassenheit ausgelöst. Es ging so weit, dass sie ihren Sohn nicht mehr sehen wollte. Nachdem Dornach dem Ganzen eine Zeit lang zugesehen hatte, hatte er zum Telefon gegriffen und die einzige Person angerufen, die Pia früher immer wieder aus ihren selbst gezimmerten kleinen Höllen zu befreien vermochte.
Manu Bürki, Pias beste Freundin aus Teenagerzeiten, hatte sich nicht lange bitten lassen. Sie organisierte ihren Mann und ihre beiden Mädchen. Dann stieg sie in den nächsten Flieger in ihrer neuen Heimat Kalifornien. Wenige Tage später hatte Pia zum ersten Mal nach langer Zeit gelacht. Zwei Wochen später war sie wieder auf dem Damm.
Das Klingeln seines Handys unterbrach ihn. Dornach sah auf das Display und seufzte. Pia würde das Glas Wein ohne seine Gesellschaft trinken müssen.
Er antwortete.
2
Angela Casagrande zündete sich eine Zigarillo an.
Die Luft war durchsetzt vom Gestank verbrannter Kunststoffe. Auf dem glitzernden Asphalt vermischte sich Regenwasser mit Löschschaum.
Jenseits der Absperrungen war eine beträchtliche Anzahl Schaulustiger zusammengekommen. Auf ihr Geheiß war die Martin-Disteli-Straße ab der Personenunterführung beim Bahnhof bis zur Verzweigung Neuhardstraße für den Publikumsverkehr gesperrt worden. Zwei Polizisten beobachteten die Gaffer und schossen Fotos von ihnen. Sollte es sich um Brandstiftung handeln, wie sie vermutete, befand sich möglicherweise der Täter darunter, um sich an seinem Werk zu ergötzen.
Wo blieb Dornach?
Wie auf Stichwort bog ein dunkler Volvo XC40 mit blinkendem Blaulicht um die Ecke. Einer der Polizisten hob das Absperrband an und ließ ihn passieren. Der Volvo stoppte neben Casagrande. Sie zog noch einmal an der Zigarillo und drückte sie auf einem Mauervorsprung aus. Den Stummel steckte sie in die kleine Blechschachtel, die sie in ihrem Jackett verschwinden ließ. Öffentliche Aschenbecher waren Mangelware geworden.
Sie hatten sich seit über einer Woche nicht mehr gesehen.
»Angie? Ich habe dich erst am Montag erwartet. Wie war’s in der Toskana?« Sie umarmten sich. Auf die traditionellen drei Freundschaftsküsse verzichteten sie in der Öffentlichkeit.
»Eine Woche Nichtstun im Haus meiner Eltern hat mir mehr als gereicht. Was geht an der Großvaterfront?«
»Pia meint, ich lasse dem Kleinen zu viel durchgehen.«
Casagrande lachte. »Nonno-Privileg. Da muss sie durch.«
Dornach deutete auf das Gebäude mit den Brandspuren. »Was war da los?«
»Brand im Büro im Erdgeschoss. Ein Anwohner hat zum Glück frühzeitig die Feuerwehr alarmiert. Sonst wär’s zu spät gewesen.«
»Zu spät wofür?«
»Für die Frau, die sie drinnen bewusstlos vorgefunden haben. Schweres Schädeltrauma. Du hast gerade die Ambulanz verpasst.«
»Kantonsspital?«
Sie nickte. »Der Zustand der Frau ist kritisch. Der Notarzt meinte, man müsse abwarten, wie sie die Nacht übersteht.«
Ein Feuerwehrmann trat zum Gebäude heraus und gab ihnen das Zeichen, dass es sicher war, einzutreten.
»Was ist da drin?«, fragte Dornach.
»Das Regionalbüro Solothurn der ›EmmaWatch‹.«
»Die Frauenrechtsorganisation? Ein neuer Anschlag?«
Casagrande zuckte mit den Schultern. »Müssen wir zum jetzigen Zeitpunkt mit in Erwägung ziehen. Hast du die Spusi mitgebracht?«
»Sebi ist unterwegs, Maja und Karin auch.«
»Macht Karin wieder Außendienst?«
»Sie meint, sie sei fit. Die Psychologin hat keine Bedenken, es zu versuchen. Schauen wir mal.«
Ein Feuerwehroffizier wartete im ausgebrannten Büro auf sie. »Hauptmann Brändli, freut mich.«
Casagrande bemühte sich, kein belustigtes Gesicht zu machen, als sie den Namen hörte. Sie wusste nicht, ob er ihre zuckenden Lippen bemerkte, als sie seine Hand schüttelte. Jedenfalls ließ sich Brändli nichts anmerken. »Ich muss Ihnen etwas zeigen.«
Der Geruch war schier unerträglich. Casagrande hielt sich die Hand vor den Mund, bis Dornach ihr ein Papiertaschentuch reichte. Parfümierte Hygieneartikel waren nicht so ihres. Diesmal ließ sie zu, dass sich das Menthol in ihrer Nasenhöhle ausbreitete.
Hauptmann Brändli führte sie durch das Büro. Der Grad der Verwüstung war beträchtlich. Alles Brennbare war mehr oder weniger Opfer der Flammen geworden, einschließlich der vertikalen Stoffjalousien und der Papiere, die auf den Arbeitsflächen herumgelegen hatten.
Brändli deutete auf verschiedene Stellen am Boden und an den Arbeitstischen. »Da, da und da haben wir Spuren von Brandbeschleuniger gefunden.«
»Also eindeutig Brandstiftung«, sagte Dornach.
»Das müssen eure Brandermittler abschließend feststellen, aber ich würde sagen, ja.«
Dornachs Blick wanderte zum hinteren Teil. »Was befindet sich dort?«
»Ein Aufenthaltsraum mit Küchenabteil, ein Besprechungszimmer und ein Materiallager. Dieser Teil wurde weitgehend vom Feuer verschont.«
»Ist es möglich, dass die verletzte Frau das Feuer gelegt hat?«, fragte Casagrande.
»Denkbar, sie kann gestolpert oder gestürzt sein und sich dabei den Kopf aufgeschlagen haben«, sagte Dornach. »Wer ist die Frau?«
Casagrande zog ein Notizbuch aus ihrer Jacketttasche. »Tomaso, Anastasia. Sie ist eine der Co-Leiterinnen.«
»War sie zum Zeitpunkt des Brandausbruchs allein hier?«
»Scheint so«, sagte Brändli. »Ein Anwohner von gegenüber hat uns kurz nach halb zehn alarmiert, weil er ein Flackern hinter den Fenstern des Büros gesehen hat. Das war Glück im Unglück. Ein paar Minuten später, und die Flammen hätten auf das übrige Gebäude übergegriffen.«
»Glück vor allem auch für Frau Tomaso«, sagte Dornach. Er zeigte auf die eine Stelle im hinteren Teil des Büroraumes, nahe dem Küchenabteil. Blutflecken auf dem Boden boten einen empörenden Kontrast zum verrußten Umfeld. »Frau Tomaso lag dort, nicht wahr?«
Brändli bejahte.
»Können wir sie befragen?«
»Das müssen die Ärzte entscheiden«, sagte Casagrande. »Ich schätze, das wird nicht so schnell möglich sein. Ich habe veranlasst, dass sie rechtsmedizinisch untersucht wird.«
»Gibt es weitere Augenzeugen?«
»Bis jetzt hat sich niemand gemeldet. Die Schaulustigen werden gerade befragt. Vielleicht bringt das was.«
»Überwachungskameras?«
Casagrande zeigte auf ein verrußtes Teil über dem Eingang. »Die Frage ist, wie wir an die Daten kommen. Die Rechner hier drin dürften unbrauchbar sein.«
»Überlassen wir das Google und Karin.« Dornach schritt die Arbeitsplätze ab. Er beleuchtete jede Kante und jedes Tischbein mit seiner Taschenlampe. »Fehlanzeige bei den Blutspuren, soweit ich das sehen kann. Sebi wird sich das genauer ansehen müssen.«
»Entschuldigung? Wer sind Sie? Was ist hier passiert?«
Casagrande und Dornach wandten sich um.
Eine mittelgroße blonde Frau in den Dreißigern in leichter Regenjacke stand verstört im Eingang, hinter ihr der Polizist, der sie offensichtlich durchgelassen hatte.
Dornach stellte sich und Casagrande vor und frage dann: »Sie sind?«
»Gerda«, sagte sie. »Gerda Büttiker. Ich bin die Co-Leiterin von ›EmmaWatch‹. Eine Bekannte, die in der Nähe wohnt, hat mich angerufen und gesagt, dass es hier gebrannt hat. Wo ist Nasti? Geht’s ihr gut?«
»Wer?«
»Anastasia Tomaso, meine Kollegin in der Leitung.«
»Wann war das?«
»So gegen acht oder kurz danach. Nasti, also Frau Tomaso, wollte ein paar Dokumente durchgehen, bevor sie auf den Zug nach Solothurn ging.«
»Sie wohnt in Solothurn selbst?«
Büttiker nickte. »In ihrem Elternhaus in der Ziegelmatt.«
»Verheiratet, Familie? Hat sie einen Freund?«
Büttiker schüttelte den Kopf. »Ledig und single, jedenfalls kein Freund, von dem ich wüsste.« Sie sah Dornach und Casagrande ängstlich an. »Sagen Sie mir endlich, wo Nasti ist. Ist sie … wurde sie …« Ihre Stimme bebte.
»Es tut mir leid, Ihre Kollegin wurde schwer verletzt«, sagte Dornach. »Sie wurde ins Kantonsspital gebracht.«
»Was … was heißt schwer verletzt?«
»Mehr können wir Ihnen zu diesem Zeitpunkt noch nicht sagen.«
Büttiker schlug die Hände vors Gesicht. »Wäre ich nur bei ihr geblieben.«
»Wie ist die Täterschaft hier hereingekommen? Schließen Sie abends nicht ab?«
»Normalerweise schon, immer diejenige, die bleibt, schließt ab. Nasti war da etwas nachlässig.«
»Haben Sie offizielle Öffnungszeiten?«
»Sicher, von halb neun bis fünf. Aber wenn wir gebraucht werden, sind wir da, Tag und Nacht, sieben Tage die Woche.« Büttiker wischte sich die Tränen aus den Augen. »Das war sicher dieser Kerl.«
»Welcher Kerl?« Dornach und Casagrande im Chor.
Neue Tränen füllten Büttikers Augen. »Es ist meine Schuld. Ich hätte sie zwingen müssen, mit ins Aarebistro zu kommen. Dann wäre das nicht passiert.«
Casagrande nahm sie beim Arm. »Kommen Sie, Frau Büttiker, wir gehen raus, und Sie erzählen mir genau, was Sie wissen. Wo kann man um diese Zeit was trinken?«
»Wir können es in der ›Galicia Bar‹ versuchen.«
Casagrande bedeutete Dornach, in ein paar Minuten nachzukommen. Auf dem Weg nach draußen kreuzten sie den Chef der Kriminaltechnik Sebi Tschanz und seine Leute. Maja Hartmann und Karin Jäggi stiegen aus einem zivilen Dienstwagen. Casagrande sagte ihnen, wo sie ihren Chef finden würden, bevor Büttiker und sie den Weg zur Bar unter die Füße nahmen.
***
Dornach nippte an einem alkoholfreien Bier. Er musste den Brandgestank hinunterspülen. Seine Wagenschlüssel hatte er Maja übergeben, er wollte mit Casagrande zurück nach Solothurn fahren. »Frau Büttiker ist sich sicher, dass Frau Tomaso gestalkt wurde?«
Casagrande hatte die Frauenrechtlerin von einer Patrouille nach Hause fahren lassen, bevor er dazugekommen war.
»Sie vertritt die Annahme rigoros«, sagte sie.
»Und stützt sich dabei auf das, was sie von ihrer Kollegin über ihn weiß? Selbst hat sie ihn nie gesehen?«
»Scheint so. Wir müssen abwarten, bis wir mit Frau Tomaso sprechen können.«
»Oder einen Blick in ihr Handy werfen können. Vielleicht hat sie ein Foto von dem Kerl gemacht.«
»Warum sollte sie ihn fotografiert haben?«
»Spekulation. Pia macht das auch, wenn sie komisch angemacht wird. Frau Tomaso ist Frauenrechtsaktivistin. Auffällige Männer fotografieren ist für sie ein natürlicher Reflex.«
»Nicht schlecht kombiniert, Sherlock«, sagte Casagrande beeindruckt.
»Danke, Watson.«
»Habt ihr das Handy?«
Dornach schüttelte den Kopf. »Sebi hat es nicht gefunden. Es befindet sich auch nicht unter ihren persönlichen Effekten im Spital. Kann sein, dass der oder die Täter es mitgenommen haben.«
»Weshalb sollten sie das tun?«
»Weiß nicht, vielleicht eben gerade weil Frau Tomaso einen von ihnen fotografiert haben könnte.«
Casagrande leerte ihr Glas Mineralwasser. »Du glaubst, der Anschlag galt Frau Tomaso, weil sie ein Foto von einem Mann gemacht hat?«
»Anastasia Tomaso ist führende Aktivistin in einer Frauenrechtsorganisation, die ihren Gegnern ein paar empfindliche politische und juristische Niederlagen beigebracht hat.«
»Eine politische Aktion von Frauenhassern?«
»Nach dem, was in den vergangenen Wochen passiert ist, sollten wir das nicht ausschließen.«
»Du sprichst die Sprengstoffanschläge auf die Linken-Politikerinnen an? Bei denen hatte es die Täterschaft bisher nur auf ihre Briefkästen abgesehen.«
»Kann sein, dass sie gerade einen Gang hochgeschaltet haben.«
»Lässt sich nicht ganz von der Hand weisen. Weiß man schon, ob die Täter etwas haben mitlaufen lassen?«
Dornach schürzte die Lippen. »Es bleibt uns nichts anderes übrig, als abzuwarten, bis Frau Büttiker ein Inventar gemacht hat.«
Casagrande sah auf ihre Armbanduhr. »Heute passiert eh nicht mehr viel. Wollen wir?«
»Gerne, es sei denn, du willst vor mir Ruhe haben.«
»Hatte ich gerade, eine ganze Woche lang.«
3
Dornachs neue Chefin belegte den Rapportraum für ein Meeting mit den Kripochefs der Konkordatskantone. Deshalb würde der Teamrapport in seinem Büro stattfinden.
Heute war er früher dran. Beim Betreten seines Büros schlug ihm der aromatische Geruch seines italienischen Bohnenkaffees entgegen. Vor Jahren hatte er eine eigene Maschine angeschafft. Das Automatengebräu verursachte bei ihm Magenbrennen. Mittlerweile hatten viele seiner Kaderkolleginnen und -kollegen Kapselmaschinen in ihren Büros stehen. Dornach war seiner italienischen Bezzera-Kolbenmaschine treu geblieben, wovon er ein weiteres Exemplar zu Hause stehen hatte.
Karin Jäggi machte sich mit dem Rücken zu ihm an der Bezzera zu schaffen.
»Kaffee kommt gleich, Maja.« Mit einer vollen Espressotasse in der Hand drehte sie sich um. »Dominik! Du bist’s. Ich dachte, Maja …«
»Morgen, Karin.« Er zeigte auf die Tasse. »Kann ich den haben, oder willst du ihn für Maja aufheben?«
Sie sah ihn an, als wäre er von einem anderen Stern. »Was? Ach so.« Sie hielt ihm die Tasse hin. »Entschuldige, ich …«
»Kein Problem. Danke. Wurde es gestern spät in Olten?«
»Wir sind eine Stunde nach euch gegangen.«
»Ihr habt nicht zufällig ein Handy gefunden?«
»Dasjenige von Frau Tomaso? Fehlanzeige. Dafür haben wir interessante Hinweise bei den Passantenbefragungen bekommen.«
»Aha?«
»Zum Zeitpunkt des Anschlags ging ein Gewitter mit heftigem Regen über dem Gebiet nieder. Ein Passant hatte bei einem Hauseingang auf der gegenüberliegenden Straßenseite Schutz gesucht. Von dort aus hat er gesehen, wie zwei Gestalten in dunkler Kleidung und mit Rucksäcken das Gebäude von ›EmmaWatch‹ betraten. Einer trug einen Hoodie, der andere eine Roger-Staub-Mütze.«
»Haben wir eine Beschreibung?«
»Sorry.« Karin deutete leere Hosentaschen an. »Die Gaffer-Fotos haben auch nichts gebracht. Kein Hoodie oder Roger Staub. Nach unserer Rückkehr hat sich Google hinter die Festplatte mit den Daten der Überwachungskamera geklemmt. Sieht übel aus, aber er ist zuversichtlich. Ich gehe mal rüber zu ihm.«
Karin sah Dornach unsicher an. Wollte sie seine Erlaubnis? Ihre alte Unsicherheit schien zurück zu sein.
»Mach das. Bis gleich.«
»Ja … ähm … klar.« Sie verließ den Raum fast fluchtartig.
***
»Angela, hast du einen Moment?«
Sie stand im Innenhof des ehemaligen Franziskanerklosters, welches heute die Solothurner Staatsanwaltschaft beherbergte. Im Grunde war sie schon zu spät dran. »Wenn’s nicht lange dauert, Kurt. Ich werde in der Schanzmühle erwartet.«
»Nur ganz kurz. Hattest du im Urlaub Zeit, darüber nachzudenken, was wir zuvor besprochen hatten?«
Natürlich hatte sie, ohne Ergebnis. Jetzt einfach Zeit gewinnen. »Worüber?«
»Du weißt schon, man erwartet eine Antwort von mir.«
»Erst nächste Woche, habe ich gedacht.«
»Stimmt, aber du wolltest vorher mit –«
»Bin nicht dazu gekommen. War zu viel los gestern Abend.«
Mit der Schuhspitze verschob Oberstaatsanwalt Kurt Mosimann ein imaginäres Steinchen auf dem Pflaster. »Ich will dich nicht drängen, aber kannst du das dieses Wochenende erledigen? Es wäre schade, wenn du die Gelegenheit verpassen würdest, wegen dir, nicht wegen der Staatsanwaltschaft Solothurn.«
»Mach ich.«
»Gut, und sonst? Gibt’s erste Erkenntnisse zum Brandanschlag in Olten?«
»Nur vage Indizien. Wir hoffen, die eine oder andere konkrete Spur herauszufiltern, bevor ich den Fall an den Kollegen in Olten abgebe.«
»Daraus wird nichts. Du wirst den Fall definitiv übernehmen müssen.«
»Weshalb? Olten liegt nicht in meiner Zuständigkeit. Ich war gestern nur dort, weil ich das Pikett mit einem Kollegen getauscht hatte.«
»Die Oltner sind momentan komplett überlastet.«
Und die Solothurner leisteten sich derweil einen lauen Lenz, oder was? Casagrande schluckte die Bemerkung hinunter.
»Nach den Vorkommnissen der letzten Wochen hier ist es besser, du befasst dich mit dem Dossier. Du weißt, warum«, sagte Mosimann.
»Die Anschläge auf die Briefkästen unserer Politikerinnen, ja.« Eben gerade deshalb litt sie nicht unter Arbeitsmangel. »Alles klar, jetzt muss ich aber los. Halte dich auf dem Laufenden. Schönen Tag noch.«
Zumindest einen kannte sie, der nicht unglücklich darüber sein würde, dass der Fall bei ihr blieb. Vielleicht bot sich ein Moment, mit ihm über ihre Zukunftspläne zu reden.
***
Kaum hatte Dornach sich hinter seinen Arbeitstisch gesetzt und den Computer hochgefahren, öffnete sich seine Tür erneut, ohne dass vorher geklopft wurde.
»Karin, hast du –« Maja blieb wie angegossen stehen. »Dominik, du bist schon da?«
»Was ist denn heute los? Ihr tut so, als sei ich ständig der Letzte.«
»Sorry, Chef. Ich dachte nur, weil es sicher spät wurde bei dir und Angela.«
»Nicht später als bei euch. Wo sind die anderen?«
»Karin ist bei Google. Sebi überprüft was und kommt später. Was ist mit Angela?«
»Schon da.« Casagrande tauchte hinter Majas Rücken auf. »Habe ich was verpasst?«
»Nicht der Rede wert«, sagte Dornach. »Kaffee?«
»Ich kümmere mich drum.« Maja trat an die Maschine.
Casagrande legte eine Tüte Croissants auf den Besprechungstisch. »Wissen wir, ob bei ›EmmaWatch‹ etwas weggekommen ist?«
»Ich habe einen Kollegen der Regionalpolizei Olten gebeten, das mit Frau Büttiker zu klären«, sagte Maja. »Sie geben uns Bescheid, sobald sie durch sind.«
»Gibt’s was Neues von Frau Tomaso?«
»Ich habe mit dem Arzt gesprochen«, sagte Dornach. »Ihr Zustand ist nach wie vor kritisch, aber stabil. Heute werden wir sie nicht befragen können.«
»Schade, sie ist die einzige Zeugin, die präzisere Hinweise zur Täterschaft geben könnte.«
»Weißt du schon, wer sich bei der Staatsanwaltschaft Olten um den Fall kümmert?«, fragte Dornach.
»Niemand. Die sind angeblich überlastet. Mosimann hat mir den Fall übertragen. Wegen möglicher Parallelen zu den Vorfällen bei uns in Solothurn.«
Dornach machte eine mentale Notiz, den Oberstaatsanwalt demnächst auf ein Bier einzuladen.
»Die Briefkastenbomben bei den Kantonsrätinnen der Grünen und Sozialdemokraten?«, fragte Maja. »Glaubt er, die Fälle hängen mit dem Brand von gestern zusammen?«
»Völlig von der Hand weisen können wir es nicht«, sagte Casagrande. »Wer engagierten Politikerinnen Bomben in den Briefkasten legen kann, ist auch in der Lage, das Büro einer Frauenrechtsorganisation in Brand zu setzen. Die mentale Disposition für das eine wie das andere dürfte die gleiche sein.«
»Ich weiß nicht«, sagte Maja. »Die Tatmuster stimmen nicht überein. Weshalb sollten sie in Olten in ein Büro eindringen und es in Brand setzen? Das Risiko ist größer. Außerdem wurde bei den Briefkastenbomben bisher niemand verletzt.«
»Hat wohl eher mit mehr Glück als Verstand zu tun«, wandte Dornach ein. »Die betroffenen Frauen erlitten immerhin einen schweren Schock.«
»Mittlerweile sollten die im Umgang mit Kerlen in der Politik einiges gewohnt sein. Eine von ihnen ist die Präsidentin der SP-Kantonalpartei.«
»Komm schon, Maja«, sagte Casagrande. »Das hat nichts damit zu tun. Dir ist schon klar, in welchem Maß Bedrohungen gegen Politiker und Politikerinnen bei uns in jüngster Zeit zugenommen haben, gerade auch Morddrohungen.«
»Ja, sorry, kommt davon, wenn man Idioten wie die von der Fortschrittspartei in die Parlamente wählt. Die haben mittlerweile fast zwanzig Prozent Wähleranteil.«
»Mag ja sein. Trotzdem, nicht alle von ihnen sind Idioten.«
Maja schnaubte. »Ein paar wenige genügen schon. Man hätte erwarten dürfen, dass nach dem Kapitel mit dem Ex-Präsidenten Schubiger selig was Besseres nachkommt. Aber nein, stattdessen heben sie den Emporkömmling Urner auf den Thron, der extra deswegen von der SVP desertierte. Deren Politik war ihm angeblich zu brav.«
»Andere würden sagen ›vergleichsweise vernünftig‹«, schaltete sich Dornach ein. »Das ist nicht der Punkt. Gibt es bei den Briefkastenbomben konkrete Anknüpfungspunkte zum Anschlag bei ›EmmaWatch‹?«
»Misogynie«, sagte Casagrande wie aus der Pistole geschossen.
»Hä?«, fragte Maja.
»Frauenfeindlichkeit.«
»Das engt die Täterschaft nicht zwingend ein«, bemerkte Dornach.
»Es ist ein Anhaltspunkt.«
Nach kurzem Klopfen an der Tür kam Sebi Tschanz herein. »Entschuldigt meine Verspätung, Kollegen. Ich habe mich mit der Rechtsmedizin in Bern unterhalten.«
»Unterhalten?«, fragte Dornach. »Habt ihr auch über den Fall gesprochen?«
»Ausschließlich Letzteres.« Tschanz entlockte der Kaffeemaschine einen doppelten Espresso. »Wir sind uns über die Tatwaffe einig geworden.«
»Für welche Tat? Den Brand oder Frau Tomasos Verletzungen?«
»Ebenfalls Letzteres.« Tschanz nahm sich ein Gipfeli aus der Tüte. »Der Kollege vom IRM und ich sind uns einig: harter, länglicher Gegenstand aus Metall oder so ähnlich.«
»Ein Baseballschläger?«, fragte Casagrande.
»Eher weniger massiv. Diese Waffe war schmaler und ist nach oben verjüngt. Ich tippe auf einen Teleskopschlagstock.«
»Das macht Sinn«, sagte Maja. »Ausziehbare Schlagstöcke kann man praktisch und unauffällig in einem Rucksack verstauen.«
»Der Täter oder die Täterin hat dreimal zugeschlagen«, fuhr Tschanz fort. »Ein Schlag traf Frau Tomaso an der Schulter. Die anderen beiden waren Volltreffer am Hinterkopf. Sie kann von Glück sagen, wenn sie den Überfall überlebt.«
»Da scheint eine gehörige Portion Wut dahinterzustecken. Hinweise auf sexuellen Missbrauch?«
»Nichts dergleichen.«
»Könnte eine Beziehungstat sein«, sagte Maja.
»Oder eine extreme Ausprägung von Angelas Vermutung.«
»Wie kommt man an Waffen wie Teleskopschlagstöcke?«, fragte Casagrande.
»Internet«, sagte Dornach. »Ohne Angaben über Marke und Typ bringt uns das nicht weiter. Die Intensität des Angriffs legt nahe, dass Frau Tomaso kein Zufallsopfer war. Wir brauchen mehr Informationen über sie und die Fälle, die sie betreute.«
Es klopfte an der Tür. Karin steckte den Kopf herein. »Stören wir?«
Dornach winkte sie heran. Karin und Google traten ein. Die Kollegen öffneten den Kreis, sodass die beiden die Besucherstühle von Dornachs Schreibtisch nehmen und sich dazusetzen konnten.
»Wir haben etwas«, sagte Karin.
»Womit man hoffentlich was anfangen kann«, bemerkte Maja spitz.
»Wie wäre es mit den Tätern?« Google drehte sein Notebook so, dass alle auf den Bildschirm sehen konnten.
Das Gesicht stellte nicht viel mehr dar als einen Fleck vor grauem Hintergrund. Die Kapuze des Hoodies umgab es wie ein schwarzer Heiligenschein.
Zuweilen machte Google es zu spannend.
Dornach schielte zu Maja hinüber, die demonstrativ ein Gähnen unterdrückte. Es konnte auch am Schlafmanko der vergangenen Nacht liegen.
»Woher stammt die Aufnahme?«, fragte Dornach.
»Gebäudeeingang«, erwiderte Google. »Die Hausverwaltung hatte eine Kamera installieren lassen. Sie hatte die Nase voll von betrunkenen Nachtschwärmern, die den Eingang als Pissoir benutzten.«
»Und, hat’s sich gebessert?« Maja wurde langsam wach.
Google zuckte mit den Achseln. »Ich kann gern nachfragen, wenn du’s wirklich wissen willst.«
»Danke, was genau soll man darauf erkennen? Einen Kerl, der nicht in den Hauseingang pinkelt? Mehr sehe ich nämlich nicht.«
»Gemach, Kollegin. Ich gebe zu, das Budget der Hausverwaltung dürfte zu nicht mehr als einer Spielzeugkamera gereicht haben. Aber nicht verzagen, Google fragen.«
»Oh Mann.« Maja verdrehte die Augen.
Die folgende Aufnahme war schärfer.
Dornach kniff die Augen zusammen. Der Mann sah direkt in die Kamera. Das Bild war immer noch zu unscharf. »Schon besser, aber erkennen kann man trotzdem nichts. Kannst du nicht –«
Bevor er den Satz beendet hatte, klickte Google erneut. »Musste einen Spezialkniff anwenden. Besser so?«
»Gut, haben wir darüber geredet«, murrte Maja.
Das trug ihr einen Seitenhieb von Karin ein.
Googles Bildbearbeitung verlieh dem Mann Konturen. Er war jung, zwischen Mitte zwanzig und Anfang dreißig, nicht unattraktiv. Was musste im Leben eines Mannes schieflaufen, welche falsche Abzweigung hatte er genommen, um eine wehrlose Frau einfach so halb totzuschlagen?
Der Mann sah direkt in die Kamera, Augen aufgerissen, Mund halb geöffnet.
»Er scheint überrascht zu sein, eine Kamera zu sehen«, sagte Dornach.
»Sieht so aus«, sagte Google. »Auf dem Filmausschnitt dreht er den Kopf gleich weg. War schwer, das Stillfoto so hinzukriegen.«
»Depp«, sagte Maja. »Wenn ich so einen Überfall vom Stapel lassen will, finde ich als Erstes heraus, ob es Kameras hat und wo sie sind.«
»Vielleicht war es doch eine Tat im Affekt«, sagte Karin, »und er wollte Frau Tomaso gar nicht niederschlagen.«
»Ja sicher, sie waren zu Tee und Kuchen verabredet. Ist halt ein wenig aus dem Ruder gelaufen.«
»Davon sollten wir nicht ausgehen«, meldete sich Casagrande zum ersten Mal zu Wort. »Frau Büttiker wusste von nichts. Frau Tomaso würde sich nie mit jemandem allein an ihrem Arbeitsplatz verabreden. Erst recht nicht um diese Uhrzeit.«
»Na also«, sagte Maja. »Die beiden stürmen herein, schlagen Frau Tomaso zusammen und hauen ab. Zum Glück für uns ist einer von den beiden so dumm, sich dabei filmen zu lassen.«
»Wissen wir, wer der Kerl ist?« Dornachs Frage richtete sich an Karin.
»Das tun wir. Er ist kein Unbekannter.« Auf ein Zeichen von ihr tauschte Google den Still mit einer erkennungsdienstlichen Aufnahme. »Grüniger, Leo, Jahrgang 95, vorbestraft wegen Sachbeschädigung, schwerer Körperverletzung und Autodiebstahl.«
»Meldeadresse?«
»Quaistraße 37 in Trimbach. Er wohnt dort zur Untermiete bei einer Frau Surbeck. Ein Team der Oltner Kollegen ist unterwegs, ihn festzusetzen und zur Befragung auf den Regionenposten zu bringen.«
»Laut Zeugen waren es zwei Männer. Haben wir was über den anderen?«
»Nichts außer Rücken und Hinterkopf«, sagte Google. »Letzterer steckt in einer Wollkappe, vermutlich eine Roger-Staub-Mütze.«
»Was wissen wir sonst über Grüniger?«
»Die Kollegen, die ein Auge auf die rechtsextreme Szene werfen, und die Bundeskriminalpolizei haben ihn im Visier«, sagte Karin.
»Weswegen?«
»Grüniger ist Mitglied der ›Helvetischen Wacht‹.«
»Schau, schau«, sagte Maja.
Casagrande spitzte die Lippen. Dornach zog die Augenbrauen hoch.
»Kennt ihr die?«, fragte Karin. »Mir sagt das auf Anhieb nichts.«
»Kann es auch nicht.« Maja legte die Hand auf die Schulter ihrer Kollegin. »Du warst in Rekonvaleszenz, als die Truppe aufgetaucht ist. An die ›Schutzfront CH‹ erinnerst du dich aber noch, oder?«
»Die ehemalige Sicherheitstruppe der Fortschrittspartei?«
»Korrekt«, sagte Dornach. »Schubigers Nachfolger hat sie nach dessen Tod aufgelöst.«
»Und sie nach ein paar Monaten mit anderem Namen mit den genau gleichen Verbrechervisagen neu aufgestellt«, ergänzte Maja.
»›Helvetische Wacht‹. Klingt ungeheuer patriotisch«, sagte Karin.
»Die sind so patriotisch wie Wilhelm Tell auf Ecstasy. Die Truppe ist nichts anderes als eine neonazistische Schlägerbande und Urners Privatarmee.«
»Offiziell sorgt die ›Helvetische Wacht‹ für Sicherheit und Personenschutz an politischen Anlässen. Ihr Hauptauftraggeber ist, wenig überraschend, die Fortschrittspartei«, erklärte Dornach.
»Müssen wir davon ausgehen, dass die hinter dem Anschlag auf ›EmmaWatch‹ steht?«, fragte Karin.
»So sicher wie das Amen in der Kirche«, sagte Maja. »Urner hat oft genug öffentlich gegen Aktivistinnen gewettert, die vor allem Ausländerinnen aus islamischen Ländern den Weg in die Schweiz ebnen. Tomaso und er sind sich bei einer Kundgebung mal in die Haare geraten.«
»Wobei erwiesen ist, dass Tomaso Urner zuerst tätlich angegriffen hatte«, bemerkte Casagrande. »Sie wurde gebüßt.«
»Scheint nicht gereicht zu haben. Urner wollte sich richtig revanchieren.«
»Das ist Spekulation, Maja«, entgegnete Casagrande. »Die Aufnahmen von Grüniger beweisen erst mal nur, dass er am Tatort war. Eine Verbindung zwischen dem Anschlag, der ›Helvetischen Wacht‹ und Nationalrat Urner müssen wir nachweisen können.«
»Werden wir, sobald wir Grüniger haben.«
»Stell dir das nicht zu einfach vor. Urner wird Grüniger seine Anwälte zur Seite stellen. Die werden unsere Indizien so lange löchern, bis sie nicht mal mehr zum Emmentaler Käse taugen.«
Karins Handy klingelte. Sie antwortete und hörte eine Weile zu. »Okay, danke euch«, sagte sie schließlich und beendete den Anruf. »Grüniger ist an seiner Wohnadresse nicht auffindbar. Laut der Vermieterin war er seit Tagen nicht zu Hause.«
***
Beat Urner zog genüsslich an seiner Zigarre. Zu gern hätte er sich ein Glas des hervorragenden Rums dazu genehmigt, den ihm ein Parteifreund von einer Karibikreise mitgebracht hatte. Es war zu früh. Er wollte für die Sitzung der Außenwirtschaftskommission des Nationalrates fit sein. Den Rum konnte er trinken, wenn seine Fraktion das anstehende Geschäft nach ihrem Gusto durchgebracht hatte und bereit für die kommende Parlamentsdebatte war. Dann würde sogar mehr als ein Glas drinliegen.
Der Blick von der Terrasse seines Hauses in Hessigkofen über das Aaretal und die gegenüberliegenden Jurahöhen war bis auf ein paar Schleierwolken ungetrübt. Möglich, dass sich die harmlos aussehenden Striemen am Himmel bis zum Abend zu dräuenden Gewitterwolken verdichteten. Er hatte Fraktionskollegen sowie ein paar ihm wohlgesinnte Liberale zu einem Grillabend eingeladen. Man wollte die Kontroverse mit der Ratslinken um die vorgesehene Verschärfung des Exportgesetzes für Kriegsmaterial diskutieren und eine Gegenstrategie entwickeln.
Es musste einen Weg geben, gegen die Phalanx rot-grüner Gutmenschen anzukommen. Seine Freunde in der Rüstungsindustrie und ihre Lobbyisten saßen ihm im Nacken. Es galt, um jeden Preis zu verhindern, dass die Freigabekompetenz für große Rüstungsverkäufe ins Ausland sich vom Bundesrat zum Stimmvolk verschob.
Pest und Cholera allen Grünen und Roten. Die hatten keine Ahnung, wie Realpolitik heutzutage ablief, nicht einmal, wenn sie ihnen so anschaulich demonstriert wurde wie gegenwärtig in Osteuropa, einen Steinwurf von der Schweiz entfernt.
Er tat einen tiefen Zug an der Zigarre, als könne er damit das Ziehen in seiner Brustgegend zum Verschwinden bringen. Sein Arzt hatte aufgegeben, ihn vor den Sargnägeln zu warnen. Für Urner und das Land war der politische Gegner tödlicher als Tabak und Alkohol.
Noch war seine Fortschrittspartei eine der stärksten politischen Kräfte auf dem nationalen Parkett. Doch ihr Fundament war sumpfig. Während ein paar Jahren hatten sie zulegen können, doch jetzt begann sie die Vergangenheit mit dem Debakel um seinen Vorgänger und dem Skandal um dieses vermaledeite katholische Mädcheninstitut im Unterengadin einzuholen. Er brauchte einen Erfolg, vor allem aber ein Thema, mit dem sie verlorene und zusätzliche Wählerstimmen auf ihre Seite ziehen konnten. Er und seine Partei standen für eine starke Schweiz inmitten einer fragilen geopolitischen Lage, besonders in Europa. Was es brauchte, waren militärische Stärke und Autarkie, nicht das Gedöns von wegen EU-Rahmenabkommen und Mitgliedschaft im UN-Sicherheitsrat. Das setzte eine starke nationale Rüstungsindustrie voraus, die weltweit vorne mitspielte. Vor allem neue Verbündete waren vonnöten, was man allerdings nicht laut sagen durfte. Schließlich war die Schweiz neutral. Glücklicherweise ließ sich der Begriff dehnbar interpretieren.
Das Ziehen in der Brust beruhigte sich tatsächlich. Ob er sich nicht doch ein kleines Glas Rum mit dem Rest seiner Zigarre gönnen sollte?
Ein Geräusch ließ ihn herumfahren. Die Gestalt im schwarzen Hoodie hatte ihn im wahrsten Sinn des Wortes beinahe zu Tode erschreckt. »Leo, warum zum Henker schleichst du dich an. Was willst du hier?«
»Die Tschuggerei ist hinter mir her.«
»Weshalb?«
Grüniger machte Anstalten, sich zu setzen.
»Du bleibst gefälligst stehen, bis ich dir was anderes sage. Mach den Mund auf! Was will die Polizei von dir?«
Grüniger, ein Baum von einem Mann, schrumpfte buchstäblich vor Urner. »Gestern in Olten ist was schiefgelaufen.«
Urner schwante etwas. Er griff zu seinem Handy. An diesem Morgen hatte er die Schlagzeilen der Pushnachrichten nur überflogen. Der Brand bei »EmmaWatch« kam an dritter Stelle. Er zeigte Grüniger die Nachricht auf dem Display. »Eine Frau wurde verletzt. Du hast mir gesagt, es sei niemand dort.«
Grüniger wand sich. »Das dachten wir auch. Dann ist die Tusse plötzlich aufgetaucht. Sie hat sich gewehrt und da … Das Ganze ist aus dem Ruder gelaufen.«
»Ihr Deppen habt sie halb totgeschlagen? Was habe ich dir gesagt?«
»Keine Alleingänge.«
»Und?«
»Wir sollen den Ball flach halten.«
Urner warf das Handy auf den Tisch. »Das nennst du den Ball flach halten? Wie ist die Polizei so schnell auf dich gekommen?«
»Keine Ahnung.«
»Was heißt keine Ahnung?«
»Wir haben gar nicht …« Grünigers Stimme ging in ein unverständliches Murmeln über.
»Ihr seid in eine Kamera geraten. Ihr Idioten habt nicht mal gecheckt, ob die Videoüberwachung haben.« Das Ziehen in Urners Brust machte sich erneut bemerkbar. »Du bist wirklich der Hinterletzte. Wer war dabei?«
»Stefano, aber der hat sich schon nach Italien zu seiner Schwester abgesetzt.«
Wenigstens einer aus der Schusslinie. »Was erwartest du von mir?«
»Weiß auch nicht, könnten Sie mich nicht hier –«
»Hat’s dir ins Hirn geschissen? Wo, glaubst du, sucht die Polizei als Nächstes, wenn sie mal herausgefunden hat, dass du in der ›Wacht‹ bist?«
»Sie meinen …?«
»Ja, ich meine, vielleicht sind sie schon auf dem Weg hierher.«
Grüniger blickte wie ein gehetztes Tier um sich. »Sie müssen mir helfen, sonst …«
»Sonst was?«
Es war ihm anzusehen, dass er seinen ganzen Mut zusammennahm. »Sie hängen mit drin. Ich weiß Dinge, die –«
Obschon Urner fast einen Kopf kleiner war, baute er sich vor Grüniger auf. »Willst du Würstchen mich etwa erpressen?«
»Nein, nein. Ich meine nur, Sie haben mich immer unterstützt. Wenn Sie mir Geld geben, damit ich weg von hier kann, vielleicht auch nach Italien.«
Urner sah ihn kalt an. »Ich überlege mir was und rufe dich an. Hast du dein Prepaidhandy?«
»Ja, aber –«
»Ich habe gesagt, ich melde mich. Mach, dass du wegkommst.«
Grüniger ging zur Tür.
»Nicht da durch, Idiot! Hintenraus, über die Wiese und durch den Wald.«
***
Rebekka Muntwyler stoppte den Streifenwagen vor dem unscheinbaren Wohnblock mit der Hausnummer 37 in der Quaistraße in Trimbach. Sie warf ihrem Partner Rolf Brotschi einen unsicheren Blick zu. Sie arbeitete erst seit Anfang des Monats bei der Regionalpolizei Olten. Das war ihr erster richtiger Einsatz.
Eine korpulente Frau, etwa Mitte sechzig, graue Kurzhaarfrisur, stand vor dem Hauseingang. Sie schaute nervös zu ihnen herüber.
»Dann wollen wir mal«, sagte Muntwylers älterer Kollege Brotschi.
»Was soll ich machen?«
»Hinter mir bleiben, zuschauen und zuhören.« Brotschi öffnete die Wagentür.
Die sichtlich verstörte ältere Frau kam auf sie zu.
»Frau Surbeck?«, fragte Brotschi. »Sie haben den Notruf gewählt?«
»Ja, hier bitte.« Sie zeigte den beiden Polizisten unaufgefordert ihre ID-Karte.
Brotschi stellte sich und Muntwyler vor. »Unsere Kollegen waren heute Morgen schon bei Ihnen, nicht wahr?«
»Stimmt, sie wollten zu meinem Untermieter, Leo, Herr Grüniger. Den habe ich seit Tagen nicht mehr gesehen.«
»Was ist genau passiert?«
»Wie ich schon am Telefon gesagt habe, bin ich vom Einkaufen nach Hause gekommen und wollte in meine Wohnung.« Frau Surbeck zeigte auf zwei Einkaufstaschen, die bei der Eingangstür standen. »Da habe ich gesehen, dass die Tür einen Spalt offen war.«
»Haben Sie –«
»Natürlich hatte ich abgeschlossen. Ich drehe den Schlüssel immer zweimal um.«
»Gut, und weiter?«
»Ich hörte Geräusche aus der Wohnung und habe es mit der Angst zu tun gekriegt. Die Sache mit Leo und die Polizisten, die vorher hier waren. Das war mir unheimlich. Da bin ich runtergerannt und habe den Notruf gewählt.«
»Wohnt außer Herrn Grüniger sonst jemand bei Ihnen?«
»Niemand, nur Leo.«
»Sie glauben, der oder die Eindringlinge sind noch in der Wohnung?«
Frau Surbeck zuckte mit den Achseln. »Seit ich hier stehe, ist jedenfalls niemand die Treppe heruntergekommen.«
»Ist das der einzige Zugang zum Haus?«
Frau Surbeck nickte.
Brotschi ließ den Blick über die Fassade schweifen. »Wo wohnen Sie genau?«
»Im zweiten Stock. Linker Eingang, wenn Sie hochkommen.«
Brotschi nickte seiner jungen Kollegin zu. »Wir gehen rein. Frau Surbeck, Sie bleiben hier und warten, bis die Verstärkung da ist. Auf keinen Fall kommen Sie nach oben, bevor wir es Ihnen sagen, klar?«
Die Frau versprach es.
Die Polizisten betraten das Haus. Bevor sie die Treppe zum zweiten Stock in Angriff nahmen, drehte Brotschi sich zu Muntwyler um. »Schon mal eine Wohnung oder einen Raum gesichert?«
»Nur geübt«, sagte sie.
»In dem Fall ist das deine Feuertaufe. Zieh deine Waffe.« Muntwylers Hand zitterte leicht, als sie die Dienstwaffe aus dem Holster zog. Brotschi gab per Funk ihre Absicht an die Zentrale durch und forderte zur Sicherheit Verstärkung an.
Ihre Waffen im Anschlag, stiegen sie die Treppe hoch. Frau Surbecks Wohnungstür war einen Spalt offen. Brotschi legte die Finger auf die Lippen und lauschte. Nichts zu hören.
Er öffnete die Tür ganz. »Polizei! Ist jemand in der Wohnung?«
Vor ihnen lag ein Korridor. Links und rechts führten Türen in die anderen Zimmer.
Brotschi bedeutete seiner Kollegin, dass sie sich die rechte Seite vornehmen sollte.
Die erste Tür führte in das Wohnzimmer. Keiner drin. Alles schien an seinem Platz zu sein.
»Wohnzimmer sicher.«
Prompt folgte ein »Küche sicher« von Muntwyler.
Die nächste Tür führte in ein Schlafzimmer. Der Einrichtung zufolge war es dasjenige von Frau Surbeck. »Schlafzimmer sicher.«
Der nächste Raum auf seiner Seite war eine Art Arbeitszimmer. Verlassen und ordentlich wie die vorherigen Zimmer. »Arbeitsraum si–«
Der Schrei seiner Kollegin stoppte ihn. Ein Schuss ertönte aus dem hinteren Teil der Wohnung.
»Rebekka!« Den Türrahmen als Deckung benutzend, spähte Brotschi in den Korridor. Ein schwarzer Schatten flog auf ihn zu und rempelte ihn so heftig an, dass er zu Boden ging. Bis sich Brotschi aufgerappelt hatte, war der Angreifer draußen.
»Rebekka, bist du in Ordnung?«
Keine Antwort.
Brotschi ging langsam den Korridor entlang bis zu einer geöffneten Tür. Dahinter war ein Zimmer mit Bett.
»Rebekka!«
Seine Kollegin lag reglos am Boden.
***
Erst hatte Karin gar nicht richtig verstanden, worum es ging. Keine zwei Stunden waren vergangen, seit gesagt worden war, Grüniger sei nicht in seiner Wohnung. Und nun das? Sie hatte geglaubt, über den Berg zu sein.
Eine junge Polizistin war mit einer tödlichen Waffe angegriffen worden. Die Nachricht warf Karin zurück zu jenem Nachmittag, der beinahe ihr letzter gewesen wäre. Sie sah die Frau, die ihr mit dem Messer in der Hand im Spitalzimmer gegenübergestanden hatte. Aufs Neue glaubte sie, die Klinge zu spüren, die in ihren Körper eindrang.
Reiß dich zusammen, du hast es bisher auch geschafft.
Als die Nachricht reingekommen war, hatte sie mit Gerda Büttiker mitten in der Verwüstung von »EmmaWatch« gestanden. Büttiker hatte ihr versichert, dass nichts fehlte. Die wichtigen Akten über die Klientinnen wurden in brandsicheren Schränken im hinteren Teil des Büros aufbewahrt. Karin war mit dem Zug von Solothurn gekommen. Eine Patrouille brachte sie nach Trimbach.
Es war unschwer zu erkennen, wo etwas passiert war. Vor dem betreffenden Hauseingang sah sie den vorderen Teil einer Ambulanz. Bevor sie ausstieg, holte Karin einmal tief Luft und atmete aus. Sie ging auf die Ambulanz zu.
In eine Wolldecke gehüllt saß Muntwyler blass und sichtlich geschockt vor der Rettungskabine. Erleichterung durchflutete Karin.
Ein Rettungssanitäter löste eine Blutdruckmanschette von Muntwylers Oberarm. An der Stirn über ihrem rechten Auge klebte ein Pflaster. Karin kannte Rebekka aus der Zeit, als sie ein Praktikum in der Schanzmühle gemacht hatte. Muntwyler schüttelte die Decke ab und umarmte Karin schluchzend.
»Rebi, was ist passiert?«
»Ich … ich habe den Typen gar nicht bemerkt. Kaum hatte ich die Tür aufgestoßen, ging er auf mich los. Er packte mich am Arm, dabei hat sich ein Schuss gelöst. Dann habe ich nur seine Faust gesehen und nichts mehr.« Muntwyler wischte sich die Augen trocken. »Scheiße, Karin. Ausgerechnet mir muss das passieren. Bei den Sicherungsübungen war ich immer eine der Besten.«
»Der Typ hat dich nicht schwer verletzt? Das wurde nämlich so durchgegeben.« Fake News, für einmal willkommen.
»Nein, zum Glück, dort drin hätte er mich garantiert nicht verfehlt. Die Kugel blieb in der Decke stecken.«
»Schlimm?« Karin deutete auf das Pflaster an Muntwylers Stirn.
»Ein Kratzer, nichts weiter.«
Sie hatten alle Schwein gehabt, Muntwyler, ihr Partner, das Korps, alle. Karin wollte sich nicht vorstellen, was hätte sein können.
»Beruhig dich, Rebi. Du hast Glück gehabt, das gehört auch dazu.« Karin dachte an das, was ihr in jenem Spitalzimmer zugestoßen war. Die Frau hatte sie überrumpelt und zugestochen. Das Glück war ihr weit weniger hold gewesen. Oder doch? Sie hatte überlebt.
Muntwyler stöhnte. »Ich muss einen Rapport schreiben. An das, was ich mir von den Kollegen anhören muss, will ich gar nicht denken.«
»Wahrscheinlich werden sie dich damit aufziehen. Aber glaub mir, alle sind heilfroh, dass dir nichts Schlimmeres passiert ist.«
Muntwyler schniefte. »Meinst du?«
»Sicher.«