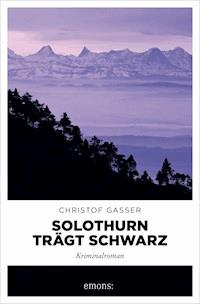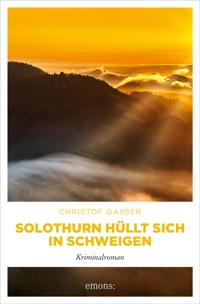Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Emons Verlag
- Kategorie: Krimi
- Serie: Cora Johannis
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2019
Da waren es nur noch neun Obwohl sie nicht nur angenehme Erinnerungen an die gemeinsame Zeit hat, verbringt Journalistin Cora Johannis mit ihrer Jugendclique ein Wochenende in einem abgelegenen Jagdhaus in den Alpen. Beim ersten Abendessen bricht ein Gast tot zusammen, kurz darauf geschehen weitere mysteriöse Todesfälle. Die Anwesenden werden zur Zielscheibe eines kaltblütigen Mörders, und weit und breit ist niemand, der ihnen helfen kann. Cora fasst einen lebensgefährlichen Plan ...
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 441
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Christof Gasser, geboren 1960 in Zuchwil bei Solothurn, war lange in führender Funktion in der Uhrenindustrie tätig und leitete zwölf Jahre einen Produktionsbetrieb in Südostasien. Seit 2016 arbeitet er als freischaffender Autor. Seine bereits veröffentlichten Romane mit dem Solothurner Ermittler Dominik Dornach und der Staatsanwältin Angela Casagrande figurierten monatelang ganz vorne auf den schweizerischen Bestsellerlisten. Eine deutsche Filmproduktion hat 2018 eine Option auf die Filmrechte für sein Buch »Schwarzbubenland« mit der Journalistin Cora Johannis erworben.
Dieses Buch ist ein Roman. Handlungen und Personen sind frei erfunden. Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen sind nicht gewollt und rein zufällig. Im Anhang findet sich ein Glossar.
©2019 Emons Verlag GmbH Alle Rechte vorbehalten Umschlagmotiv: jba/photocase.de Umschlaggestaltung: Nina Schäfer, nach einem Konzept von Leonardo Magrelli und Nina Schäfer Umsetzung: Tobias Doetsch Lektorat: Irène Kost, Biel/Bienne (CH) eBook-Erstellung: CPI books GmbH, LeckISBN 978-3-96041-493-3 Originalausgabe
Unser Newsletter informiert Sie regelmäßig über Neues von emons: Kostenlos bestellen unter www.emons-verlag.de
Dieser Roman wurde vermittelt durch die Agentur Editio Dialog, Dr.Michael Wenzel (www.editio-dialog.com).
Old sins cast long shadows.
Alle Verfehlungen werfen lange Schatten.
Dame Agatha Christie (1890
Prolog
Die Vibramsohlen der Bergschuhe schlitterten über den glatten Felsen. Sie fanden keinen Griff, der ihr zeitlupengleiches Abgleiten in die Schlucht aufhielt.
Die Schlinge um ihren Hals zog sich stetig zu. Wie durch Watte drang das unaufhörliche Grollen des Wasserfalles zu ihr. Es vermischte sich mit dem Rauschen des Blutes in ihren Ohren.
Sie lag mit dem Rücken zur Wand. Mehrmals versuchte sie, sich umzudrehen und einen Felsvorsprung oder ein Stück Wurzelwerk im Steilhang zu finden, an dem sie sich festhalten konnte.
Obwohl die Sonne hoch am Himmel stand, wurde es schwärzer und enger um sie. Am Rand ihres Gesichtsfeldes zuckten sternförmige Blitze. Die Gesichter ihrer Kinder schwebten an ihrem geistigen Auge vorbei. Sie hätte der Tochter noch so viel sagen wollen: wie sehr sie sie liebte und wie stolz sie auf sie war.
Der Mann, von dem sie nicht wusste, wie sie ihn lieben sollte, lächelte ihr vor ihrem geistigen Auge zu. Sie hatte ihm ihre Gefühle nie offenbart. Das Bedauern darüber kam zu spät.
War es das gewesen? Hatte es einen Zweck, gegen das Schicksal anzukämpfen? Loslassen war der Preis, den sie bezahlen musste, damit die Last ihrer Mitschuld an dieser Katastrophe von ihren Schultern fiel.
EINS
»Mila, bist du so weit? Wir müssen uns beeilen, wenn…« Cora blieb im Türrahmen stehen. Milas vorwurfsvolle Miene sagte alles: Ihre Mutter hatte sich wieder mal nicht an die strikte Regel gehalten, anzuklopfen. Cora lenkte ab, indem sie auf das Kopfkissen zeigte, unter das Mila ein Foto geschoben hatte, als Cora eintrat. »Was ist das?«
»Was ist was? Du hast nicht angeklopft.«
»Tut mir leid, kommt nicht mehr vor. Was ist auf dem Bild unter deinem Kissen?«
»Welches Bild?«
»Trage ich einen Blindenstock? Das war ein Foto. Zeigst du’s mir?«
Mit strengem Blick verschränkte Mila die Arme. »Sobald du noch mal rausgegangen bist und angeklopft hast.«
»Im Ernst? Wir haben keine Zeit für so was. Der Zug zum Flughafen wartet nicht.«
»Abmachung ist Abmachung. Du sagst selber, Anstand kennt keine Zeit.«
Hauskater Van Helsing hatte einen Satz von Milas Bett auf den Boden gemacht, als Cora eingetreten war, und setzte sich demonstrativ vor sie. Beide starrten Cora auffordernd an. Sobald Mila eingezogen war, hatten sich die beiden auf Anhieb gegenseitig ins Herz geschlossen und waren eine Art Freundschaftspakt eingegangen. Van Helsing betrachtete Milas Zimmer als ureigenes Territorium, dessen Herrschaft er sich mit Mila teilte. Lediglich in der Frage, welches Mitglied der Familie Johannis ihm sein Futter kredenzen durfte, war er weniger wählerisch.
Cora seufzte ergeben. Mittlerweile wusste sie, wann ihre Tochter sie mit den eigenen Argumenten schlug, wenn sie obendrein von der Katze sekundiert wurde. »Also gut.« Sie ging zur Tür hinaus und wartete einige Sekunden, bevor sie zweimal klopfte.
»Ja bitte!«, flötete es aus dem Inneren des Zimmers.
Cora verdrehte genervt die Augen und öffnete die Tür. Van Helsing saß wie ein Torwächter auf Milas Bett. Seine grünen Augen fixierten Cora missbilligend. Das reichte: Sie erwiderte den stechenden Blick und klatschte zweimal in die Hände. Van Helsing erkannte, dass die Zeit zum Rückzug gekommen war. Er sprang vom Bett, strich einmal um Coras Beine und machte sich davon.
»Also, was ist jetzt?«, fragte Cora, nachdem sie die Tür hinter sich geschlossen hatte. »Zeigst du es mir?«
Mila zog das Foto unter dem Kissen hervor.
Cora betrachtete es lange. Es war ein Gruppenbild. »Das ist ja uralt, woher hast du das?«
»Gefunden, zwischen den Seiten eines der Bücher, die ich für dich ausmisten sollte.« Mila tippte auf eine Person mit lockigen schwarzen Haaren und engen Shorts. »Das bist du, nicht wahr? Siehst megageil aus. Wenn ich daran denke, was du mir vorpredigst, wenn ich mal kurze Hosen und ein bauchfreies Shirt anziehen will.«
»Moment mal, Fräulein, du bist gerade mal vierzehn.«
»Fünfzehn, in zwei Monaten.«
»Na schön.« Cora tippte mit dem Zeigefinger auf das Foto. »Hierdrauf bin ich achtzehn.«
»So what? Drei Jahre Differenz.«
»Mit dem kleinen, feinen Unterschied, dass ich mit achtzehn volljährig war.« Cora spekulierte, Mila würde das nicht nachprüfen. In der Schweiz galt Volljährigkeit ab achtzehn erst seit 1996. Das Foto war acht Jahre zuvor im August gemacht worden, wie der handschriftliche Vermerk auf der Rückseite klarstellte.
Mila musterte ihre Mutter misstrauisch. Cora atmete innerlich auf, als die Aufmerksamkeit ihrer Tochter von ihrem damaligen Outfit abdriftete. »Wer sind die anderen?«
»Das war die ›Clique‹.«
»Die ›Clique‹?«
»So nannten wir uns. Wir waren sieben Freunde. Wir gingen zusammen in die Bezirksschule und später an die Kanti. In der Freizeit sind wir ständig zusammen abgehängt, wie man heute sagt.«
»Und?«
»Und was?«
»Welcher von den Typen war dein Freund?«
»Wir waren alle Freunde«, sagte Cora mit dem überzeugendsten Unschuldsblick, den sie aufbringen konnte.
Mila grinste. »Ja, sicher. Du weißt genau, was ich meine. Mit welchem von den Jungs hast du…?« Sie tippte mit dem Finger auf den Zweiten von links in der stehenden Reihe. »Der hätte gut zu dir gepasst.«
»René Gamper?« Cora lachte und hoffte, dabei nicht zu erröten. »Du irrst dich, meine Liebe. Das war Ludivines Freund.« Sie zeigte auf die Blondine neben René. »Sie war zwanzig und dachte schon ans Heiraten.«
»Haben sie?«
»Was?«
»Geheiratet?«
Cora schüttelte den Kopf. »Daraus wurde nichts. Ludivine ging kurzerhand in die Staaten. Sie wollte dort studieren. Nicht lange danach hat sich die Clique in alle Winde zerstreut. Seither ist der Kontakt abgebrochen, mindestens soweit es mich betrifft.« Sie gab Mila das Foto zurück.
»Darf ich es behalten?«
Cora zuckte mit den Achseln. »Wenn du willst.« Ihr Blick fiel auf die Auslegeordnung auf dem Fußboden. Mila hatte mehrere Badeanzüge, Jeans, T-Shirts, Unterwäsche, Schuhe, Sonnenbrillen, Toilettenartikel, Girlie-Magazine und Comicbücher in Stapel aufgeteilt. Die Menge an Utensilien übertraf die Kapazität des Rollkoffers bei Weitem, den ihr Cora für die Reise ausgeliehen hatte. »Es geht nur mit, was in den Koffer passt. In einer Stunde müssen wir zum Bahnhof, wenn wir den Zug rechtzeitig erreichen wollen.«
»Ich habe massenhaft Zeit. Wir kommen zwei Stunden vor dem Abflug in Kloten an, dort hänge ich bloß rum.«
»Nur, wenn wir den Zug in Solothurn rechtzeitig erwischen. Außerdem muss ich dich zum vereinbarten Zeitpunkt beim Check-in im Flughafen an deine Begleitperson übergeben.«
»Das ist echt uncool, Cora, ich fliege nicht zum ersten Mal.«
»Allein schon, beeil dich!«
Mila hielt ein knappes Bikinihöschen mit passendem Oberteil in die Höhe. »Was hältst du davon?«
Cora nahm die spärlichen Teile, die sie nie zuvor gesehen hatte, in die Hand. »Fast so viel, wie Stoff dafür verwendet wurde. Du willst nicht allen Ernstes mit diesem Ding in Argentinien herumlaufen? Woher hast du das überhaupt?«
»Hat mir Patty geschenkt.«
Cora musste mit ihrer besten Freundin und Milas Patentante Patrizia Egger ein ernsthaftes Wort reden. Sie wollte sich deshalb nicht mit Mila streiten. Sollte sich Matthias die nächsten zwei Wochen mit der gemeinsamen Tochter herumschlagen, wenn er sie schon eingeladen hatte, ihre Frühlingsferien bei ihm in Argentinien zu verbringen. Cora war nicht ganz wohl dabei. Mila wohnte erst knapp ein Jahr bei ihr, nachdem Matthias mit seiner zweiten Frau Grazyna nach Südamerika gezogen war, wo er für fünf Jahre die Bauleitung einer Windkraftanlage in Patagonien übernommen hatte.
Vorher wohnte Mila bei ihrem Vater und verbrachte alternierende Wochenenden oder Ferienwochen bei ihrer Mutter und ihrem sieben Jahre älteren Halbbruder Julian. Nach Matthias’ Übersiedlung nach Südamerika zog Mila zu ihnen nach Nennigkofen. Die ersten Monate des dauerhaften Zusammenlebens waren für Mutter und Tochter schwierig gewesen, bis ein dramatisches Erlebnis die beiden zusammengeschweißt hatte. Cora befürchtete insgeheim, die zwei Wochen bei Milas nach wie vor heiß geliebtem »Daddy« könnten die erreichten Fortschritte zunichtemachen. Sie war ehrlich genug zuzugeben, dass diese Gedanken mehr ihrer Eifersucht entsprangen als echter Sorge um Milas Zuneigung. Matthias war ein verantwortungsvoller Mann und Vater. Er hatte nie versucht, die beiden gegeneinander auszuspielen. Cora hatte Mühe, das anzuerkennen. Matthias’ zweite Ehe mit der ehemaligen polnischen Assistentin eines baltischen Kunden hielt seit acht Jahren, und Cora empfand sie heute noch als ihr persönliches Waterloo.
Sie legte den Bikini zurück auf das Bett. »Ich empfehle dir, deinen einteiligen Badeanzug mitzunehmen. In dem spärlichen Ding läufst du dort am Strand nicht lange rum.«
»Und wieso nicht, wenn ich fragen darf?«
»Darfst du. Die Antwort kannst du selber googeln. April und Mai sind die ungünstigsten Monate, um in Playas Doradas Urlaub zu machen. Pack dir auf jeden Fall einen Pullover mit ein, wie den da…« Cora betrachtete das altrosafarbene Sweatshirt. »Sag mal, das Teil suche ich seit Tagen. Wie kommt das zu dir?«
Wenn sie von Mila Schuldbewusstsein erwartete, lag sie falsch. »Mach jetzt deswegen keinen Aufstand. Du hast gerade gesagt, ich soll mich drüben warm anziehen.«
»Na hör mal«, Cora zeigte auf einen der Wäschestapel, »du hast ja wohl genug Pullover.«
»Alles Kleinmädchenkram. Meinst du, ich gehe in solchen Klamotten aus? Die guten Stücke sind in der Wäsche. Du bist ja so beschäftigt. Du hast nicht mal Zeit, auf den Knopf zu drücken.«
»Wenn ich mein allergnädigstes Fräulein Tochter daran erinnern dürfte, dass ich nebenbei arbeite. Außerdem weißt du so gut wie ich, wie die Maschine funktioniert.«
Mila schnitt eine abschätzige Grimasse. »Arbeiten? Wenn du dich endlich entscheiden könntest, mit deinem Daniel was anzufangen, hättest du’s nicht mehr nötig. Der ist schon lange heiß auf dich.«
Cora hielt für einen Moment die Luft an. Zielsicher, wie sie war, hatte Mila ihren wunden Punkt getroffen. »Du hörst mal wieder das Gras wachsen, was? Zwischen Daniel und mir ist nichts, und es wird nie was sein.«
Mila rollte mit den Augen. »Und ich glaube an den Osterhasen.«
Cora sah auf die Uhr. »Ende der Diskussion. In zwanzig Minuten fahren wir zum Bahnhof– mit oder ohne Gepäck.«
»Kann ich deinen Pulli haben oder nicht?«
Cora zuckte mit den Achseln. »Meinetwegen, aber falls du mir den nicht exakt in dem Zustand zurückbringst, wie du ihn mitnimmst, solltest du schon mal einplanen, dein Sackgeld der nächsten Monate beiseitezulegen.«
»Danke, Cora.« Freudig umarmte Mila sie. Körperliche Zärtlichkeitsbezeugungen ihrer Tochter waren für Cora immer noch ungewohnt. Erst seit jener furchtbaren Nacht, als sie beide den Tod vor Augen hatten, ließ Mila diese Nähe zu. Verstohlen wischte sie sich mit einer Hand über die Augen, während sie mit dem Daumen zärtlich Milas Schläfe streichelte. Ein schmaler weißer Striemen in den blonden Strähnen zeigte den Verlauf des Projektils, das Mila fast das Leben gekostet hatte. Die Verletzung hatte die Pigmentierung an dieser Stelle zerstört.
Mila merkte, was in ihrer Mutter vorging. Sie küsste sie auf die Wange. »Keine Angst, Cora, ich komme wieder heim.«
Cora schluckte leer. »Sicher?«
DIE CLIQUE– AUGUST1988
Richard kämpft verbissen mit dem Stativ, dessen ausziehbare Aluminiumbeine sich nicht fixieren lassen wollen.
»Versuch’s mal mit gut zureden, Richi«, ruft Sibylle, die sich neben Magdalena auf den Boden setzt.
Alle lachen. Richard schwitzt. Die Wirkung des Alkohols, welcher, der herrschenden Hitze geschuldet, reichlich fließt, ist spürbar. Die Freunde witzeln und foppen einander, während er sich mit dem störrischen Gestänge abmüht, das er sich mit seinem in den Sommerferien erarbeiteten Geld zusammen mit der neuen Spiegelreflexkamera angeschafft hat.
Sibylle hat von allen am meisten getankt. Magdalena kneift sie in die Seite. »Schalt einen Gang runter und reit nicht ständig auf Richards Ausrüstung herum. Er muss sich halt erst an sie gewöhnen.«
Sibylle wirft ihr einen neckenden Seitenblick zu. »Entschuldige, Mägi, ich wollte deinem Schätzli nicht zu nahe treten.«
»Richard ist nicht mein…« Beleidigt wendet sich Magdalena von Sibylle ab. Sie dreht sich nach den anderen um, die hinter ihr stehen. Matteo schenkt ihr ein aufmunterndes Lächeln. »Lass dir von dem Lästermaul nicht die Sommerlaune verderben.«
René stellt sich neben Matteo hin. Wo der wohl herkommt, fragt sich Richard. Er war plötzlich weg, verschwunden im Wald. Ludivine musste ihn suchen gehen. Anschließend haben sich die beiden gestritten. Anscheinend haben sie sich wieder versöhnt. Ludivine legt ihren Arm um Renés Hals und küsst ihn auf den Nacken.
Mittlerweile ist es Richard gelungen, das widerspenstige Stativ zu zähmen und die Kamera einzustellen. »Sind alle da?– Ludivine, könntest du René für ein paar Minuten loslassen? Der läuft dir nicht davon. Setz dich neben Sibylle auf den Boden.«
»Dann stimmt die Aufstellung nicht mehr. Cora fehlt. Die sollte unten sitzen. Und du musst ebenfalls in die untere Reihe, in die Mitte.«
Wo steckt Cora überhaupt? Ihr Verschwinden ist Richard als Einzigem aufgefallen. Sie hat die Gruppe kurz nach René verlassen und sich in die Büsche geschlagen. Ludivine hat es nicht bemerkt, sonst würde sie weniger glücklich dreinschauen.
»Weiß einer, wo Cora steckt?«, fragt Sibylle.
»Ich gehe sie suchen«, ruft Magdalena.
»Bleib sitzen«, sagt Richard. »Ich gehe.«
»Nicht nötig, bin schon da«, ertönt es hinter ihm. Cora steht neben ihm. Sie zupft an ihren ultrakurzen Shorts und dem über dem Bauchnabel zusammengeknoteten Hemd, dessen oberste Knöpfe offen sind und den Ansatz eines Paares sonnengebräunter Rundungen anpreisen.
»Wo bist du gewesen?«, fragt Richard vorwurfsvoll, ohne sich von den ihm gewährten Einblicken beeindrucken zu lassen. »Du weißt genau, dass wir unser Jahresfoto machen wollen.«
»Spazieren, habe ich ja gesagt«, antwortet Cora schnippisch. »Weiß nicht, was du hast, anscheinend hab ich nichts verpasst.« Sie drückt ihm einen Kuss auf die Wange, bevor sie ihre lockige schwarze Mähne zurechtschüttelt und mit betontem Hüftschwung zu dem ihr zugewiesenen Platz geht.
René stößt einen Pfiff aus, was ihm und Cora einen vorwurfsvollen Blick von Ludivine einträgt. »Setz dich hin, Cora, bevor jemand auf falsche Gedanken kommt.«
»Keine Sorge, Lüdi, René hat nur Augen für dich.«
Bevor sich Cora neben Sibylle auf den Boden setzt, versetzt diese ihr einen Klaps auf den Hintern. »Hast du keine Angst, in dem Aufzug im Wald herumzurennen? Wenn dir ein Perverser über den Weg läuft, bist du für den ein gefundenes Fressen.«
»Oder er für mich.«
Sibylle kichert. »Du bist ein schamloses Miststück, weißt du das?«
»Ich muss sehen, wo ich bleibe.« Cora wirft Richard eine Kusshand zu. »Mach vorwärts, Richard, Schatz. Ich habe einen Bärenhunger, und das Feuer ist noch nicht einmal an.«
René kickt sie mit dem Fuß von hinten an. Auch das entgeht Ludivine. Die Gruppe ist endlich so aufgestellt, wie Richard sie haben will. »Habt ihr eure Getränke?«
Alle heben ihre Bierflaschen in die Höhe, bis auf Ludivine, die Weißwein aus einem Plastikbecher trinkt, und Cora, die mit leeren Händen dasitzt. »Scheiße, ich habe noch keins.«
»Was wärst du ohne deine Freunde?«, sagt Magdalena lachend. Sie reicht Cora eine volle Bierflasche.
ZWEI
Der Blick, mit dem Daniel vom Staal sie beobachtete, wie sie von der Toilette kommend den Raum durchquerte, brachte Cora in Verlegenheit.
Sie strich mit beiden Händen ihr Kleid an den Hüften glatt und warf einen prüfenden Blick über ihre Schulter auf ihr einziges Paar hochhackiger Schuhe, die sie speziell für den Abend angezogen hatte. »Was ist? Schleife ich einen Meter Toilettenpapier hinter mir her?«
»Wie kommst du darauf? Du bist wunderschön in diesem Kleid. Du solltest so was öfter tragen.«
Cora hatte mit sich gerungen, das knielange, schulterfreie Cocktailkleid anzuziehen. In ihren üblichen Jeans und einem Baumwollhemd wäre ihr wohler gewesen. Nur wäre sie damit für den Abend im Restaurant »Vue« des Berner Hotels »Bellevue Palace« eindeutig underdressed gewesen. Nach der Rückkehr vom Flughafen, wo sie Mila der Flugbetreuerin übergeben hatte, war sie knapp dran gewesen. Trotzdem hatte sie sich Zeit genommen, sich herauszuputzen. Das Kleid hatte sie vor zwei Jahren auf Pattys hartnäckiges Zureden hin für einen denkwürdigen und sinnlich aufregenden Madeira-Urlaub gekauft. Wenn sie ihrem Spiegelbild Glauben schenken durfte, saß es, ungeachtet der unaufhaltsam näher rückenden Vollendung ihrer fünften Lebensdekade, nach wie vor tadellos. Die Hüftkurven zeigten, obwohl gefühlt breiter geworden, weder Ausbeulungen noch Verflachungen an Stellen, wo solche nicht erwünscht waren. Das Dekolleté, bei dem sie gefürchtet hatte, es würde konsequente textile Unterstützung benötigen, konnte sich zu ihrer Erleichterung notfalls ohne sehen lassen. Trotzdem trug sie den schwarzen Push-up-BH mit Spitzen, zu dessen Kauf sie ihre Tochter gedrängt hatte. Die junge Cora vor dreißig Jahren und die Mila von heute hatten vieles gemeinsam, wenn es darum ging, ihre Reize zur Geltung zu bringen.
Sie ließ sich von vom Staal in den Stuhl helfen. Die anachronistische Geste im Zeitalter der Gleichberechtigung schmeichelte ihr fast gegen ihren Willen. »Komplimente von dir machen mich nervös«, sagte sie. »Was gibt’s zum Dessert?«
Das Bedienungspersonal musste über telepathische Fähigkeiten verfügen. Ein paar Sekunden nach dem halblaut ausgesprochenen Satz reichte ihr ein Kellner diskret die Dessertkarte.
Cora sah sich im Raum um. Es war ihr erster Besuch im Restaurant des exklusivsten Stadtberner Hotels. Das »Bellevue« lag auf einer Terrasse hoch über der Aare, die eine große grüne Schlaufe um die Altstadt zog. Unmittelbar daneben überragte das Bundeshaus die alten Häuser und engen Gassen des Marziliquartiers. Von diesem Standort hatten Hotelgäste wie regierende eidgenössische Magistraten die Botschaften und Residenzen der ausländischen Diplomaten im Kirchenfeldquartier jenseits des Flusses im Blick. An klaren Tagen war die Bundesterrasse ein imposanter Aussichtspunkt für Einheimische und Touristen auf die prominentesten Berner Alpengipfel: Eiger, Mönch und Jungfrau.
Bei einer früheren Gelegenheit war Cora aus beruflichen Gründen während eines Empfangs lediglich im Foyer des Hotels gewesen, mit dessen Geschichte sie sich im Vorfeld vertraut gemacht hatte. Das Haus existierte seit 1865 und wurde 1913 nach einer Komplettrenovation neu eröffnet. Seit jeher prägte es die politische Geschichte der Schweiz mit. Im Ersten Weltkrieg wurde das Hotel als Hauptquartier der schweizerischen Armee zweckentfremdet. Noch heute spielt es eine informelle Rolle als Erweiterung des Bundeshauses. Bei Staatsbesuchen nutzen es ausländische Staats- und Regierungschefs als Residenz. Während der Sessionen der eidgenössischen Räte dient es als vorübergehender Wohnsitz für Parlamentarier aus entfernten Landesgegenden. Alle vier Jahre, anfangs Dezember, wenn die Vereinigte Bundesversammlung nach den eidgenössischen Parlamentswahlen den Bundesrat neu bestellt, werden Foyer, Bar und einige Hinterzimmer am Vorabend der Wahl Schauplatz der »Nacht der langen Messer«. Dann wird abgerechnet, und es werden letzte Absprachen getroffen, wer in die Landesregierung portiert und wer daraus verschwinden sollte. Die Abwahl eines Bundesrates durch das Parlament ist das politische Ereignis in der Schweiz, welches einem Staatsstreich am nächsten kommt. Seit der Gründung des Bundesstaates im Jahr 1848 hatte sich eine derartige Ungeheuerlichkeit viermal zugetragen.
Im Zug von Coras Recherchen zu ihrem Lieblingsthema Flüchtlinge und Migration hatte die jüngere Schweizer Geschichte ihr Interesse geweckt. In den wechselvollen Perioden der beiden Weltkriege und während des Kalten Krieges diente das Land als internationale Drehscheibe und Verhandlungsort rivalisierender Mächte. Das Schicksal Hunderttausender, wenn nicht von Millionen Menschen war in diesen ehrwürdigen holzgetäfelten Räumen bei Kaffee, Cognac und Zigarren mit gedämpfter Stimme besiegelt worden. Nicht immer hatten alle einen Vorteil daraus gezogen, am wenigsten die Betroffenen selbst. Die Schweiz wusste ihre Politik der Guten Dienste im Umgang mit Monarchen, Diktatoren, Revolutionären, Nazis oder Kommunisten für sich zu nutzen. Sie hatte das Land nie ärmer gemacht, im Gegenteil.
Cora wurde in diesem Land geboren und besaß seit ihrer Jugend den roten Pass. Trotzdem wurde sie teilweise noch heute als »Papierlischwizerin« angesehen, nur auf dem Papier eine Schweizerin. Sie gehörte nicht zu den Ursprünglichen, die sich Eidgenossinnen nennen durften, weil ihre Stammbäume seit Generationen in schweizerischem Boden und schweizerischer Kultur verwurzelt waren. Möglicherweise hatte sie sich deshalb nie berufen gefühlt, in ihren Reportagen explizit zur Rolle ihrer Wahlheimat in internationalen Konflikten Stellung zu beziehen und zu be- oder zu verurteilen. In den sechziger Jahren mussten ihre Eltern aus Rumänien flüchten, das damals von Nicolae Ceaușescu mit harter Hand regiert wurde. Die Schweiz hatte sie ohne Wenn und Aber aufgenommen. Cora verdankte dem Land ihren Beruf, den sie liebte, und dass ihre Kinder in Sicherheit mit intakten Zukunftsaussichten aufwachsen konnten.
Aus diesem Grund hatte sie ihrem Freund, Chefredaktor Wagner vom »Solothurner Tagblatt«, bisher nicht zugesagt. Er wollte sie für eine Reportage über die Goldgeschäfte der Schweiz im Zweiten Weltkrieg gewinnen. Die zweifelhaften Deals, welche die damalige Regierung mit den Nazis gemacht hatte, um das Land vor einer Invasion zu bewahren, interessierten sie nicht. Ein großer Teil des Goldes, das vielleicht noch heute in den Kellern der Nationalbank oder anderswo im Land lagerte, hatte ursprünglich vor allem jüdischen Familien gehört. Zu Millionen wurden sie von den Nazis zuerst aus ihrer Heimat vertrieben und schließlich exekutiert oder in den Vernichtungslagern von Auschwitz, Treblinka oder Majdanek ermordet.
Die Schweiz hatte mit dem Vermögen der Opfer des Naziterrors ihren Schnitt gemacht, bis ein eifriger amerikanischer Staatsanwalt in den neunziger Jahren den Finanzgnomen in der Zürcher Bahnhofstraße und der Genfer Rue du Rhône sowie ihrem Bankgeheimnis zum ersten Mal den Garaus machte.
Der Wink mit dem Flüchtlingszaunpfahl vermochte Cora dennoch nicht zu motivieren. Allerdings konnte sie es sich nicht versagen, vom Staal darauf anzusprechen, sobald das Dessert serviert worden war.
»Was weißt du über Raubgold?«, fragte sie, bevor sie einen Löffel mit kandierter Citron de Menton in Sabayon in den Mund schob.
»Wie bitte?« Vom Staal sah von seinem Nachtisch, einer Selektion erlesener Käse mit Feigensenf und Früchtebrot, auf.
»Was weißt du über das Gold, das die Nazis im Zweiten Weltkrieg in der Schweiz bunkerten?«
»Warum interessiert dich das?«
Cora erzählte es ihm.
»Wozu will Wagner diese alten Gamellen aufwärmen?«, fragte vom Staal. »Die Geschichte ist seit Ende der neunziger Jahre aufgearbeitet und trägt mittlerweile einen langen weißen Bart. Damit lockst du nicht mal mehr einen greisen Nazijäger hinter dem Ofen hervor.«
»Etwas muss dran sein, wenn er eine Reportage für sein ›WP&G‹-Magazin machen will– mehrere Seiten mit Fotostrecke.« Cora schrieb freischaffend für »Wirtschaft, Politik und Gesellschaft«. Sie galt gewissermaßen als Hausjournalistin der Publikation. Nachdem vom Staal ihre Nachforschungen zum Verschwinden seiner Frau äußerst großzügig honoriert hatte, konnte sie sich ihre Jobs mehr oder weniger aussuchen.
Vom Staal legte Messer und Gabel zur Seite und trank einen Schluck des Rotweins, bei dem er seit dem Hauptgang geblieben war. Cora hatte sich vom Kellner zu einem Glas Champagner verleiten lassen und verzichtete dafür auf den Kaffee nach dem Dessert.
»Die Schweiz war in beiden Weltkriegen neutral.«
»Das waren die Belgier und Holländer auch, geholfen hat es ihnen nicht.« Coras Ton wurde eindringlicher. Sie hasste Ausflüchte.
Vom Staal ließ die Bemerkung stehen. »Stimmt, wir hatten das Glück, für Hitler als Produktions- und Finanzierungsbasis für seine Feldzüge zu wertvoll zu sein, als dass er das Land als Durchmarschroute für seine Armeen missbrauchen wollte. Vermutlich war es für ihn eine Frage der Zeit, bis er uns ›heim ins Reich‹ holen konnte. Zumindest herrschte diese Idee in den ersten Kriegsjahren vor.«
»Im Gegenzug wurde hier das Gold gehortet, das er sich in den eroberten Gebieten zusammengestohlen hatte.«
»Als neutrales Land hat die Schweiz mit allen Staaten regen Handel betrieben. Deutschland war im Krieg unser wichtigster Handelspartner und ist es noch heute. Die Goldtransfers der Reichsbank an die Nationalbank sollten einerseits die Guthaben der Schweiz in Deutschland decken, andererseits dienten sie zur Währungssicherung, damit die Inflation niedrig gehalten werden konnte.«
»Das allein kann es nicht gewesen sein«, sagte Cora. »Mir ist nicht bewusst, dass Hitler sich je um Verpflichtungen scherte.«
»Da liegst du richtig. Die Nazis deckten sich unter Umgehung der Wirtschaftssanktionen der Alliierten und über Schweizer Mittelsmänner weltweit mit kriegswichtigen Gütern ein. Zudem lieferten wir ihnen wichtige Rüstungsgüter, die sie mit Rohstoffen, vor allem mit Kohle und mit Erdöl aus dem Heimatland deiner Eltern, bezahlten. Das wurde von den Alliierten moniert, die gegen Ende des Krieges deswegen den Bundesrat massiv unter Druck setzten.«
»Die Schweizer Exportwirtschaft und der Finanzplatz waren demnach die großen Profiteure des Krieges?«
»Wenn du so willst. Die Nationalbank war jedoch nicht nur das Golddepot der Deutschen. Die Goldtransaktionen der Alliierten mit der Schweiz waren insgesamt umfangreicher als diejenigen mit der Reichsbank. Praktisch jede europäische Zentralbank hinterlegte ihren Goldvorrat im Keller der Nationalbank drüben unter dem Bundesplatz.«
»Wie? Hatten die ihre Kellerabteile wie in Mietshäusern– jedem Mieter sein eigener Verschlag?«
»So in etwa darfst du dir das vorstellen, einfach besser gesichert.«
»Und das Gold der, sagen wir, der Franzosen oder Engländer, lag einträchtig neben demjenigen der Nazis?«
»Korrekt, bewacht von den Schweizern, koordiniert und kontrolliert von der BIZ.«
»BIZ?«
»Die Bank für Internationalen Zahlungsausgleich. Sie wurde 1930 als Bank der Zentralbanken mit dem Ziel gegründet, die deutschen Reparationszahlungen aus dem Ersten Weltkrieg abzuwickeln. Sie existiert in ihrer Koordinations- und Regulierungsfunktion bis heute an ihrem ursprünglichen Sitz in Basel. Zwischen 1939 und 1945 überwachte sie die Goldtransaktionen. Sie verfügt über einen exterritorialen Status, das heißt, die Schweizer Behörden haben nur beschränkt Zugriff.«
»Wie die UNO«, sagte Cora.
»Genau. Während des Krieges arbeiteten Menschen aus aller Herren Länder in Basel.«
»Wie? Auch Deutsche?«
»Viele Deutsche arbeiteten dort, aber auch Amerikaner, Franzosen, Engländer, Skandinavier und natürlich Schweizer.«
»Die saßen und arbeiteten dort friedlich zusammen, während sich ihre Landsleute auf den Schlachtfeldern gegenseitig die Köpfe einschlugen?«
»Geld hat seine eigenen Regeln, im Frieden wie im Krieg. Das gilt ebenso für Gold.« Vom Staal nickte einem Kellner zu, um einen Espresso zu bestellen. »Selbstverständlich kannst du davon ausgehen, dass in Basel auch andere Dinge vor sich gingen. Wie die übrige Schweiz war die Stadt ein Tummelplatz der Spione aller Mächte. Der BIZ-Anwalt AllenW. Dulles beispielsweise war gleichzeitig Gesandter für die Schweiz im amerikanischen Geheimdienst OSS, dem ›Office of Strategic Services‹, der Vorgängerorganisation der heutigen CIA. Sicher wurde unter anderem auch mit Gold gemauschelt. Ich bin nicht der Spezialist dafür, aber ich kann mich schlaumachen, wenn du willst.«
Cora schüttelte den Kopf. »Sollte ich was brauchen, bin ich froh, wenn ich auf dein Wissen zurückgreifen darf.« Sie leerte ihr Glas.
»Lust auf einen Schlummertrunk?«, fragte er. In seinen Augen erkannte Cora ein hoffnungsvolles Leuchten.
»Musst du nicht fahren?«
Sie hatten sich in Bern getroffen, weil er von einer Besprechung in Lausanne gekommen war. Am nächsten Morgen musste er wieder dort sein. Trotz seiner Proteste und des Angebotes, sie abholen zu lassen, hatte Cora es vorgezogen, mit der Bahn von Solothurn anzureisen.
»Ich habe eine Limousine mit Fahrer gechartert«, antwortete vom Staal.
»Hast du was gegen die Bahn?«
»Ich nichts, aber sie gegen mich. Wenn ich mich in letzter Zeit entscheide, den Zug zu nehmen, hat er einen Ausfall. Angesichts unserer heutigen Verabredung wollte ich dieses Risiko nicht eingehen. Mittlerweile sind die Staus auf den Autobahnen in ihrer Permanenz berechenbarer als unsere Bundesbahn. Wie steht’s? Schlummertrunk, ja oder nein?« Er zögerte einen Moment, bevor er weitersprach: »Wenn du möchtest… ich habe vorsorglich für heute Nacht ein Zimmer reserviert.«
Sie sah ihn verdattert an. »Hier?«
»Es ist eine Suite– mit zwei Schlafzimmern–, Frühstück inbegriffen.«
Cora gab sich Mühe, sich ihre Erregung nicht anmerken zu lassen. Der Blick seiner klaren blauen Augen war so eindringlich wie einladend. Vom Staal, der Alkohol oder beides gleichzeitig verdrehte ihr den Kopf. Andererseits verspürte sie keine Lust, einsam zu Hause zu hocken. Außer einem mürrischen Kater, der seiner verreisten jungen Herrin nachtrauerte, wartete dort niemand auf sie. Für Van Helsing war Cora lediglich eine zweibeinige Bedienstete, zuständig für regelmäßige Futterabgabe und gelegentliche Verabreichungen von Streicheleinheiten. Julian war auf einer Studienreise in Italien. Niemand würde sie vermissen, wenn sie es sich für eine Nacht im Fünf-Sterne-Hotel gut gehen ließ.
***
Die ersten Strahlen der Frühlingssonne vermochten die Terrasse des »Bellevue« noch nicht zu erwärmen, obwohl die Wettervorhersage einen warmen Tag prophezeite. Cora schlang den Pashminaschal enger um die Schultern, während sie an ihrem Cappuccino nippte und an die letzte Nacht und den Morgen dachte.
Vom Staal hatte sie überrascht. Da sie nicht damit gerechnet hatte, in Bern zu übernachten, hatte sie außer dem Cocktailkleid und einem leichten Frühlingsmantel keine Wechselkleidung dabei. Ausgelegt auf dem Bett in ihrem Schlafzimmer der Suite hatte sie gefunden, was sie für den nächsten Tag brauchte: ein Paar Designer-Jeans, eine Seidenbluse, einen Kaschmirpullover und den Pashminaschal. Vom Staal hatte den Hotelconcierge mit Instruktionen versorgt, die Sachen zu besorgen, während sie beim Essen waren. Woher er ihre Größe wusste, war Cora ein Rätsel. Jedenfalls passte alles perfekt.
Sie hatte die Kleider erst nicht annehmen wollen und bestand zumindest darauf, sie zu bezahlen. Vom Staal hatte seinen ganzen Charme und sein Durchsetzungsvermögen aufbringen müssen, sie davon abzubringen. »Du lässt mir keine andere Möglichkeit, dir meine Zuneigung zu zeigen. Tu mir den Gefallen und akzeptiere wenigstens das.«
»Ich komme mir vor wie die blutjunge Geliebte eines Sugardaddys, wenn du so was tust. Das ist meinem Selbstbewusstsein wenig zuträglich.«
Vom Staal hatte gelacht. »Über dieses Stadium dürften wir beide hinaus sein. Außerdem habe ich bis jetzt nichts erlebt, was dein Selbstbewusstsein erschüttern konnte. Daran werden die Jeans und ein Kaschmirpullover nichts ändern. Ist ja mein Fehler, ich hätte dich wegen der Übernachtung vorwarnen sollen.«
»Wenn ich nicht hier schlafen würde, hättest du es umsonst gekauft.«
»Für mich ist bei dir nie etwas umsonst, Cora.« Er hatte sie freundschaftlich geküsst, bevor er in seinem Zimmer verschwunden war. Damit hatte er ihr erspart, sich zu überschwänglichen Dankesbezeugungen verpflichtet zu fühlen.
Das Frühstück war kurz ausgefallen, da vom Staal fahren musste, bevor sie aufwachte. Er hatte die Suite mit spätem Check-out gebucht und bereits bezahlt. Sie stand Cora bis achtzehn Uhr zur Verfügung.
Nach einem Besuch in der hoteleigenen Sauna im Wellnessbereich hatte sie sich mit zwei Tageszeitungen und einem Cappuccino auf die Terrasse gesetzt. Sie konnte sich nicht entschließen, ob sie später durch die Lauben der Berner Altstadt schlendern oder bereits am frühen Nachmittag den erstbesten Zug zurück nach Solothurn nehmen wollte. Ihr graute vor dem leeren Haus in Nennigkofen.
Sie werweißte, einen zweiten Cappuccino zu bestellen, als sie eine Stimme von hinten ansprach: »Cora? Cora Johannis?«
Irritiert drehte sie sich in ihrem Stuhl um und musterte die groß gewachsene blonde Frau, die wenig älter als sie sein mochte. Ein dezentes Make-up betonte einen blassen Teint und zart gemeißelte hohe Wangenknochen unter einem Paar graublauer Augen. Vereinzelte silbrige Strähnen durchzogen ihr aschblondes Haar. Die Frau rückte ein teures Versace-Seidenfoulard zurecht, das sie um ihren Hals geschlungen hatte.
Eine diffuse Erinnerung kroch aus Coras Unterbewusstsein hervor und verfestigte sich zu einem klaren Bild, bis ihr Gedächtnis den passenden Namen zum Gesicht hervorgegraben hatte. »Ludivine? Sie sind… du bist Ludivine Spiegelberg. Das gibt’s nicht!« Sie stand auf, um die Frau zu umarmen.
»Ich heiße jetzt Giroud«, sagte diese, nachdem sie sich voneinander gelöst hatten. »Außerdem nanntest du mich immer nur ›Lüdi‹, erinnerst du dich nicht mehr?«
»Ludivine hatte damals einen unmöglichen Klang für uns.«
»Das habt ihr immer dann betont, wenn ihr mich ärgern wolltet.«
Beide lachten herzlich. Cora bot ihr an, sich an ihren Tisch zu setzen. Ludivine schlug vor, das Wiedersehen mit einem Glas Prosecco zu feiern.
»Was machst du so?«, fragte Cora.
»Ich pendle zwischen der Schweiz und Südafrika hin und her. Meine Mutter wohnt in der Nähe von Kapstadt. Erinnerst du dich an sie?«
»Ich bin ihr nicht oft begegnet, aber wie könnte man Césarine Spiegelberg vergessen?«, erwiderte Cora. »Die wenigen Gelegenheiten, bei denen ich auf sie traf, beeindruckte sie mich mit ihrer selten starken Persönlichkeit. Wenn ich mich nicht täusche, bist du ihr wie aus dem Gesicht geschnitten.«
»Das sagen viele, ja. Ihre Haare waren dunkler als meine. Inzwischen sind sie weiß geworden. Sie feiert dieses Jahr ihren Achtzigsten.«
»Sie lebte damals allein mit dir in Solothurn, nicht wahr?«
»Ja, es hielt sie nichts mehr auf der Alp, nachdem Vater…« Ludivine räusperte sich. »Als der Berg ihn behielt.«
Cora erinnerte sich. Die sterblichen Überreste von Leopold Spiegelberg wurden Jahre nach seinem Verschwinden im Wildhorngebiet geborgen. Es passierte in den späten sechziger Jahren, bevor Cora geboren war. Césarine Spiegelberg, eine geborene Rettenmund, war daraufhin mit ihrer knapp einjährigen Tochter Ludivine in ihre Heimatstadt Solothurn zurückgekehrt.
»Du hast deinen Vater nie gekannt?«
Ludivine verneinte. »Er war dreiundzwanzig Jahre älter als meine Mutter. Im Nachhinein habe ich nie verstanden, warum sie einen so viel älteren Mann geheiratet hatte.«
»Möglicherweise hatte er andere Qualitäten.«
»Mag sein, sie hat nie groß über ihn gesprochen.«
»Sie hatte ihn nicht geliebt, meinst du?«
»Ich glaube schon, es war halt eine schwierige Zeit. Kurz bevor Vater verschwand, sind ihre beste Freundin und ihr Baby von deren Ehemann brutal erschlagen worden. Das und Vaters Verschwinden waren die Auslöser, weg von der Tungelalp und zurück nach Solothurn zu gehen.«
»Tungelalp? Steht euer Jagdhaus mit diesem unheimlichen Namen noch dort?«
»›Blutlauenen‹, ja. Es ist im Besitz unserer Familie geblieben.«
Heute wie damals fragte sich Cora, wie man einem Haus einen solchen Namen geben konnte, selbst wenn es ein Jagdhaus war. Ludivine hatte ihr erklärt, dass der Name nicht mit Blut im eigentlichen Sinn zu tun hatte. Das althochdeutsche »bluete« oder »blüete« bezog sich auf etwas, das unter großen Mühen oder Kosten entstand. Man musste »dafür bluten«. Der Ausdruck gehörte noch heute zur Umgangssprache.
»Mutter will, dass ich ›Blutlauenen‹ verkaufe, sofern sich für den Kasten ein Käufer finden lässt. Sie ist nicht gut zu Fuß und wird Südafrika wohl nicht mehr verlassen.«
»Vielleicht findet sich jemand, der es als Hotel oder Gasthaus führen will«, sagte Cora.
»Das dürfte schwierig werden. Es gibt weder eine vernünftige Straße, noch besteht die Möglichkeit, dort etwas hinzubauen, eine Seilbahn für Touristen oder so was. Abgesehen von einer Materialbahn für die Sennereien dort gibt es nichts. Seit Ende der vierziger Jahre gilt das gesamte Lauenental als Naturschutzgebiet.«
»Was ist mit Touristentransport auf Esel- oder Maultierrücken wie früher? Pionierromantik in den Alpen soll en vogue sein.«
Ludivine nickte anerkennend. »Deine kreativen Ideen sind dir offenbar nicht ausgegangen– wie in alten Zeiten. Über die möglichen Verwendungszwecke des Gemäuers sollen sich potenzielle Käufer den Kopf zerbrechen. Ich bin froh, wenn ich es los bin und…« Nach einer kurzen Pause fuhr sie fort. »Ist schon ein Zufall, dass wir uns ausgerechnet heute begegnen. Ich habe ein paarmal versucht, dich über deine Redaktion ausfindig zu machen. Es ist schwierig, dich zu erreichen.«
»Das war mir nicht bewusst.« Cora war in keinem Telefonbuch gelistet, auch ihre private Mailadresse fand sich in keinem öffentlichen Verzeichnis.
»Ich bekomme demnächst die gefürchtete Fünf auf die zweite Dezimalstelle meiner Altersangabe. Das will gefeiert werden. Diese Begegnung mit dir heute ist wirklich ein verrückter Zufall.«
»Inwiefern?«
»Ich will unsere alte Clique ein letztes Mal zusammenkommen lassen– Erinnerungen an unsere wilden Zeiten, verstehst du?«
Cora war nicht sicher, ob sie nach all den Jahren an alles erinnert werden wollte, was sie damals erlebt hatten. Ihr Gedächtnis hatte nicht nur rosige Momente gespeichert.
»Ist das nicht Schicksal?«, plauderte Ludivine weiter. »Ich konnte die ganze Clique lokalisieren, bis auf dich. Und siehe da: Wir laufen uns über den Weg. Du musst mitkommen. Morgen Freitag geht es los. Bis Dienstag feiern, spielen und diskutieren wir. Wer will, kann spazieren gehen oder herumhocken. Es wird genug zu essen und zu trinken geben. Ich habe die Vorräte bereits auf die Alp bringen lassen.«
»Dieses Wochenende?«, fragte Cora ungläubig. »Auf welcher Höhe ist das? Liegt da nicht alles noch im Schnee?«
»Das passt schon. Die Meereshöhe von ›Blutlauenen‹ beträgt circa tausendachthundert Meter. Außerdem ist im Winter wenig Schnee gefallen. Und sonst gehen wir Schneeschuhlaufen. Wir könnten einen Ausflug hinüber zur Geltenhütte machen. Der Pfad soll fast schneefrei sein.« Ludivine strahlte sie aufmunternd an. »Was ist? Jetzt, wo ich dich gefunden habe, musst du dabei sein. Schließlich gehörst du inzwischen zur Prominenz. Jeder kennt deine Artikel und Bücher.«
Cora ging das etwas zu schnell. Sie zog Sonne und Strand den Bergen vor, vor allem, wenn letztere mit Schnee und Eis bedeckt waren. »Ich weiß nicht, ich recherchiere gerade für einen Auftrag«, log sie.
»Komm schon, Cora. Du hast es doch nicht nötig, zu arbeiten. Dein letztes Abenteuer im Schwarzbubenland stand in allen nationalen Zeitungen. Sogar der Johannesburger ›Sunday Independent‹ berichtete darüber. Die Verkäufe deiner Bücher haben dir garantiert ein Vermögen an Tantiemen eingebracht.«
Cora äußerte sich nicht dazu. Ihre Lust auf die Einsamkeit ihres Hauses war unter den Nullpunkt gesunken. Warum nicht die Zeit für ein paar Tage gemeinsam mit alten Freunden und Jugenderinnerungen überbrücken? »Wer ist sonst dabei? Kommt die ganze Clique?«
»Alle«, bekräftigte Ludivine. »Magdalena, Sibylle, Richard und Matteo, weißt du noch?«
»Wie könnte ich Matteo vergessen. Der ist mit seinen Bildern inzwischen eine Berühmtheit geworden.« Cora schmunzelte. »Hätte ihm früher keiner zugetraut, wenn er seine Kritzeleien herumzeigte.«
»Ich habe ihm ein wenig unter die Arme gegriffen und seine ersten Bilder in meinen Galerien ausgestellt. Inzwischen hat er sich einen Namen gemacht.«
Cora gönnte es Matteo, dessen künstlerische Ambitionen von allen, einschließlich ihr selbst, belächelt worden waren.
»René kommt ebenfalls«, sagte Ludivine beiläufig. Sie sah Cora erwartungsvoll an.
Coras Herz machte einen Sprung. »René Gamper lädst du ein? Nach all dem, was ihr… was passiert ist?«
Ludivine winkte ab. »Das ist lange her– Jugendsünden. Ich will mit euch meinen Übergang in die bessere Lebenshälfte feiern.«
Sie prosteten sich zu.
»Und dein Mann?«, fragte Cora.
»Welcher Mann?«
»Der dir deinen klingenden Nachnamen verpasst hat.«
»Giroud? Kannst du getrost vergessen. Alte Familie von Privatbankiers in Martigny mit Geld wie Heu. Wir waren fünf Jahre verheiratet. Dann kam ihm in den Sinn, öffentlich zu bekennen, dass er schwul ist. Immerhin hatte er den Anstand, meine Einwilligung in die Scheidung mit einem zweistelligen Millionenbetrag abzugelten. Guter Kerl.« Sie hob ihr Glas und trank einen Schluck. »Wir werden in ›Blutlauenen‹ unter uns sein, Cora. Nur wir sieben, wie früher.– Nein, stimmt nicht ganz. René bringt seinen Sohn Alexander mit. Er will ihn unbedingt dabeihaben. Es würde ihm guttun, die verrückten Freunde seines Vaters kennenzulernen, wie er sagt. Mir soll’s recht sein. Alexander ist ein flotter Kerl.«
Sieh an, dachte Cora. Gamper, der auf sämtliche Bibeln geschworen hatte, nie in den Hafen der Ehe einfahren zu wollen, hatte einen Sohn.
»Zwei Bedienstete kommen auch mit«, setzte Ludivine ihre Erläuterungen fort. »Unsere langjährige Haushälterin Chantal sorgt für unser leibliches Wohl. Der alte Fredi Schwizgebel ist zuständig dafür, dass wir nicht frieren müssen. Die beiden arbeiteten schon für meine Eltern. Insgesamt sind wir zehn– mit dir.«
»Und wie kommen wir auf die Alp? Zu Fuß, mit Gepäck und allem?«
»Wo denkst du hin? Ich habe einen Heli bei Air-Glaciers gechartert. Treffpunkt morgen Mittag, ein Uhr, auf dem Flugplatz Saanen zum Apéro. Um zwei heben wir ab. Am Dienstagnachmittag holt er uns wieder ab. Also was ist? Sei bitte keine Spielverderberin.«
Cora musste nicht mehr überzeugt werden. Ludivine fiel ihr um den Hals. Ein Blick auf ihre Armbanduhr ließ sie aufschnellen. »Was, schon so spät? Ich bin im Kornhauskeller mit einem Galeristen verabredet. Wir wollen eine gemeinsame Ausstellung machen. Wir sehen uns morgen in Saanen, ja?«
Sie tauschten Telefonnummern aus. Der Einkaufsbummel unter den Lauben war gestrichen. Cora musste nach Hause, für das Bergwochenende packen. Zuvor hatte sie ein Telefonat zu führen.
***
Cora musste Wagner zugestehen, dass er sich alle Mühe gab, sie umzustimmen. Sie verkniff sich ein Lachen, während sie ihm am Telefon zuhörte.
»Du bist mein bestes Pferd im Stall für diese Reportage, Cora. Das Ding ist heikel. Ich brauche jemanden, der fundiert recherchiert.«
»Und da bin ich die Einzige, die dir in den Sinn kommt? Gibt’s da nicht einen anderen ausgezeichneten Investigatoren?«
»Ich weiß nicht, wen du meinst.«
»Heizmann. Letztes Jahr war er gut genug, an meiner Stelle die Flüchtlingsreportage zu machen.«
Wagner schnaubte. »Macht dir die Retourkutsche Freude? Du weißt, es war nicht meine Entscheidung gewesen, Heizmann an deiner Stelle nach Sizilien zu schicken. Es war die Teppichetage in Langenthal, die–«
»Geschenkt, Wagner.« Es ging ihr nicht darum, ihrem alten Freund eins auszuwischen, ebenso wenig den Erbsenzählern am Hauptsitz des Mittelland-Verlages. »Ich brauche mal etwas Abstand. Ludivine Giroud-Spiegelberg, die Galeristin, ist eine alte Freundin von mir. Sie hat mich eingeladen, ein Wochenende mit Freunden zu–«
»Hast du Spiegelberg gesagt?«
»Ja, warum?«
Am anderen Ende herrschte für ein paar Sekunden Stille.
»Wagner, bist du noch dran?«
»Cora«, sagte Wagner gedehnt, »sag mir nicht, du hast vor, auf eigene Faust zu recherchieren?«
»Natürlich nicht. Wie kommst du auf so was?«
»Weil der Name Spiegelberg in den Dokumenten auftaucht, die uns für diese Reportage zugespielt wurden.«
»Echt?«
»Echt. Und gib nicht vor, keine Ahnung davon zu haben. Solche Zufälle gibt’s bei dir nicht.«
»Ehrlich, Wagner, woher soll ich wissen, was du über die Spiegelbergs hast, wenn ich diese Unterlagen nie gesehen habe?«
»Leopold Spiegelberg, sagt dir das was?«
»Das ist Ludivines Vater und gerade mal alles, was ich über ihn weiß.«
»Oberst im Generalstab Spiegelberg war in den Fünfzigern Kommandant des Solothurner Infanterieregiments11. Im Zweiten Weltkrieg diente er als zugeteilter Offizier im Regimentsstab. In dieser Zeit wurde das Regiment innerhalb der dritten Heeresdivision als ›Gruppe Kander‹ für die Verteidigung des Raumes Spiez–Wimmis im Berner Oberland eingesetzt.«
»Wagner«, unterbrach ihn Cora seufzend, »wozu erzählst du mir das? Militärkram interessiert mich, wenn überhaupt, nur am Rande.«
»Eins noch: Spiegelberg war kein gewöhnlicher Stäbler. Er fungierte als Verbindungsoffizier zum Militärischen Nachrichtendienst und arbeitete direkt mit dessen Chef, Roger Masson, zusammen.«
»Sagt mir nichts, aber ich höre dir trotzdem zu.«
»Oberstbrigadier Masson war ein Vertrauter des Oberbefehlshabers der Armee im Zweiten Weltkrieg, General Henri Guisan. Masson hat, vermutlich mit dessen Wissen, geheime Nachrichtenverbindungen mit Deutschland geknüpft.«
Das war Cora neu, und es tönte unerhört. »Der Schweizer Geheimdienst und die Nazis haben zusammengearbeitet?«
»In gewissen Bereichen. Masson hatte ab 1944 regelmäßige Kontakte mit dem Chef des Sicherheitsdienstes derSS, Standartenführer Walter Schellenberg.«
»Wie ließ sich das mit der schweizerischen Neutralität vereinbaren?«
»Insofern, als der Militärische Nachrichtendienst höchstwahrscheinlich ähnliche Verbindungen mit den Briten und dem amerikanischen Geheimdienst OSS unterhielt. Muss recht spannend zu- und hergegangen sein bei uns in jener Epoche.«
»Warum taten sie das?«
»Reiner Lebenserhaltungstrieb. 1943 landeten die Alliierten in Italien. Damit sah sich das Deutsche Reich einer dritten Front gegenüber. Im selben Jahr musste die bisher unbesiegbare Wehrmacht in Stalingrad ihre erste große Niederlage einstecken. Das Kriegsglück der Nazis begann sich gegen sie zu wenden.«
»Was hatte die Schweiz damit zu tun?«
»Nach den Invasionsängsten von 1940 durchlebte das Land bis 1943 eine relativ friedliche Zeit. Doch dann befürchtete man erneut, Hitler könnte einmarschieren, um General Guisan daran zu hindern, den Alliierten die Grenzen zu öffnen, damit sie Deutschland an seiner ungeschützten Südflanke angreifen konnten. In Geheimdienstkreisen will man damals gewusst haben, dass die Deutschen eine ganze Armee von Skandinavien an einen unbekannten Bestimmungsort verlegten. Es wurde kolportiert, sie sollte in Süddeutschland aufmarschieren, um die Schweiz zu besetzen und den Durchmarsch der Alliierten zu verhindern. Dank der Verbindung Masson-Schellenberg kam es zu Geheimgesprächen zwischen SS-Reichsführer Himmler und General Guisan, bei denen Letzterer garantierte, die Schweizer Armee würde das Land gegen jeden Invasor, ob deutsch oder alliiert, verteidigen. Im Gegenzug sicherte Himmler im Namen seines Führers die Respektierung der schweizerischen Neutralität zu– unter gewissen Bedingungen.«
Cora dachte an das Gespräch mit vom Staal vom Vorabend. »Was waren das für Bedingungen?«
»Lieferung von Spitzentechnologie für deutsche Waffensysteme. Die Schweiz war ein wichtiger Rüstungslieferant der Nazis. Das Geschäft sollte sich in den letzten Kriegsjahren intensivieren.«
»Hatten die Deutschen zu diesem Zeitpunkt den Krieg nicht schon verloren?«
»Das wussten alle– außer die Nazis selbst. Nach Stalingrad rief Propagandaminister Goebbels in seiner Sportpalastrede zum totalen Krieg auf. Wusstest du, dass die deutsche Industrieproduktion der Kriegsjahre erst 1944 ihren höchsten Stand erreichte?«
»Nicht wirklich. Womit haben sie das bezahlt?«
»Womit glaubst du wohl?«
»Mit Gold, nehme ich an.«
»Die Reichsbank verschob enorme Goldmengen in die Schweiz und kaufte dafür im großen Stil Kriegsmaterial, welches unter anderem die Schweizer Rüstungsindustrie mehr oder weniger bereitwillig lieferte. Bis zu einem gewissen Grad war es das zweifelhafte Verdienst unseres Landes, den Schrecken des Krieges bis 1945 verlängert zu haben.«
»Und die Alliierten? Haben die einfach zugeschaut?«
»Wo denkst du hin? Die offizielle Schweiz wurde mehrmals davor gewarnt, mit den Nazis zusammenzuarbeiten. Der britische Premier Churchill erwog sogar, den deutschen Nachschub zu unterbinden, indem er unsere Eisenbahnlinien durch die Alpen bombardieren wollte, zog es jedoch nicht durch.«
»Dafür haben die Alliierten immer mal wieder Schweizer Städte bombardiert wie Zürich, Schaffhausen und Basel. Das war nicht wirklich ein Versehen, oder?«
»Offiziell schon. Die Engländer und Amerikaner setzten unsere Regierung gegen Ende des Krieges massiv unter Druck, die Lieferungen gegen Gold nach Deutschland einzustellen.«
»Was passierte dann?«
»Der Bundesrat beharrte auf dem Neutralitätsstatus der Schweiz, der es ihr erlaubte, mit jedem Land Handel zu treiben. Die Goldlieferungen wurden fortgesetzt. Ein letzter von der BIZ sanktionierter Transport fand im März 1945 statt. Etwas mehr als drei Tonnen Gold wurden hierherverschoben. Vordergründig dienten sie zur Sicherstellung von Guthaben unserer Nationalbank bei der Reichsbank und zur Abgeltung humanitärer Dienste.«
»Nicht zu fassen, welche Deckmäntelchen Politiker und Funktionäre damals wie heute für ihre schmutzigen Geschäfte finden«, sagte Cora.
»Du sagst es. Aber jetzt kommt der Scoop: Nach dem offiziellen letzten Transport soll es einen weiteren gegeben haben, in den letzten Kriegstagen, Ende April 1945.«
»Was heißt das?«
»Denk nach, Cora. Wer in Deutschland konnte im damaligen Chaos solche Geheimcoups arrangieren? Nach den uns vorliegenden Informationen ging es um über eine Tonne Feingold, umgerechnet zu heutigen Kursen sprechen wir von vierzig bis fünfzig Millionen Franken.«
»Der Krieg war verloren. Die Nazis verließen das sinkende Schiff. Ein paar von denen wollten vorher ihr Schäfchen ins Trockene bringen.«
»Du triffst den Nagel auf den Kopf. Darunter befanden sich die Gottvaterstellvertreter persönlich, in diesem Fall Himmler und Reichsmarschall Göring zusammen mit einigen ihrer obersten Kumpane.«
Cora musste das kurz sacken lassen. »Darüber wollt ihr einen Artikel bringen? Ist das nicht Schnee von gestern?«
»Da gebe ich dir recht– teilweise. Die Geschichte ist ausgelutscht, bis auf diejenige mit dem Gold, das spurlos verschwunden ist.«
»Wie, verschwunden?«
»Himmlers goldenes Sparschwein hätte zu einem Bunker im Berner Oberland gebracht werden sollen. Es ist nie dort eingetroffen.«
»Eine Tonne Gold verschwindet nicht einfach so.«
»Das macht die Sache ja gerade so spannend. Laut unserer Quelle überquerte der fragliche Transport am 25.April 1945 die österreichisch-schweizerische Grenze bei Au-Lustenau. Es war einer der wenigen Orte, wo die Grenze noch offen war. Die Alliierten waren dabei, den süddeutschen Raum bis zum Bodensee vollständig zu besetzen. Die Spur des Goldes verliert sich im Einsatzraum der ›Gruppe Kander‹. Es gab nichts mehr, kein Gold, kein Transportfahrzeug. Ebenso wenig ist das SS-Begleitpersonal je wiederaufgetaucht.«
»Die haben sich mit der Beute abgesetzt und sich ein schönes Leben gemacht, ist doch sonnenklar.«
»Vermutlich, aber wohin? Sie sind nicht nach Deutschland oder Österreich zurückgekehrt, so viel steht fest. Wenige Tage nachdem der Transport die Grenze im St.Galler Rheintal passiert hatte, besetzten französische Truppen Vorarlberg. Ganz Kontinentaleuropa, mit Ausnahme der Schweiz, befand sich unter alliierter Kontrolle. Damals konnte man nicht mal so hurtig in einen Flieger nach Südamerika oder in die Karibik steigen.«
»Vor allem nicht mit einer Tonne Gold im Handgepäck«, sinnierte Cora.
»Verstehst du, was ich sagen will? Das Zeug ist im Land geblieben und liegt womöglich bis heute irgendwo. Dem wollen wir nachgehen.«
»Weshalb erst jetzt? Die Geschichte ist vor siebzig Jahren passiert.«
»Weil mir erst kürzlich Dokumente mit diesen Informationen zugespielt wurden. Frag mich nicht nach den Quellen. Sie machen jedenfalls den Anschein, echt zu sein.« Wagner machte eine Pause. »Also was ist, bist du interessiert?«
Coras Neugier war geweckt. »Schick mir alles, was du hast. Ich schaue es mir über das Wochenende an und gebe dir Bescheid, sobald ich zurück bin.«
»Ich zähle auf dich, Cora.«
LEOPOLD SPIEGELBERG– MÄRZ1945
Die Szene kommt ihm surreal vor. Die Welt, wie man sie kennt, versinkt im Chaos. Währenddessen gehen die Bewohner Berns außerhalb des für das Treffen von Spezialtruppen gesicherten Hotels ihren abendlichen Geschäftigkeiten nach. Es ist wie ein Affront gegen das zigtausendfache Sterben, das sich jenseits der Landesgrenzen abspielt.
Die Gruppe von vier Männern hat es sich, unbeachtet von den anderen Hotelgästen, in einer Sitzgruppe in einem diskreten Winkel des Hotelfoyers bequem gemacht. Die beiden Deutschen tragen Zivilkleidung. Sie sind über Konstanz angereist. Vermutlich werden sie die Rückreise nicht auf derselben Route absolvieren können. Es ist eine Frage von Wochen eher als Monaten, bis französische und englische Truppen die Bodenseeregion unter ihre Kontrolle bringen werden.
Leopold mustert dieSS-Offiziere. In ihren dunklen Anzügen, ohne die schneidige, die arische Herrenrasse definierende Uniform, sehen sie gewöhnlich aus. Er überlegt, ob sich hinter der arroganten Fassade in Wirklichkeit nicht blanke Angst verbirgt. In einem, bestenfalls in zwei Monaten wird das Deutsche Reich aufhören zu existieren, und die Jäger werden zu Gejagten. Während des Essens sprach man eingehend über den Plan. Leopold hat im Grunde nur Verachtung für diese als harmlose Zivilisten getarnten Verbrecher übrig. Aber es liegt nicht an ihm, zu urteilen. Er ist Soldat und hat zu gehorchen. Andere werden die Untaten dieser Scheusale vergelten.
»Mein lieber Oberst«, wendet sich der ältere Deutsche an Leopolds Vorgesetzten. »Wir sind uns einig, wo der Transport ihre Grenze überqueren soll. Ist es unerlässlich, dass Ihr Mann das Fahrzeug begleitet?« Er deutet auf Leopold. »Wir verfügen über bestens ausgebildete Fahrer, welche die Gegend kennen wie ihre Westentasche.«
Leopold verabscheut den Deutschen, der bis vor drei Jahren dem Stab von Reinhard Heydrich angehörte, dem damaligen Chef des Reichssicherheitshauptamts und gefürchteten stellvertretenden Reichsprotektor von Böhmen und Mähren. Bevor Heydrich 1942 in Prag von eingeschleusten tschechischen Partisanen ermordet wurde, war er Architekt eines Konzeptes gewesen, das festlegte, wie mit den Juden in Europa verfahren werden sollte. Leopolds Quellen zufolge war es an einer Konferenz am Wannsee bei Berlin entstanden. Welche Grausamkeiten der Nazis würden eines Tages an die Oberfläche kommen? Er verflucht diese Menschen innerlich. Gibt es etwas, das sie nicht über die Schweiz wissen? Aber es wird ihnen am Ende nichts nützen, Hitler und seinem Tausendjährigen Reich. Die Hölle soll diesen Teufel in Menschengestalt mitsamt seinem Führerhauptquartier verschlingen.
Leopolds Vorgesetzter zieht an seiner Zigarre und betrachtet die Glut, bevor er das Wort ergreift. »Wir befinden uns noch im Krieg, mein lieber Standartenführer. Auch wenn es auf Schweizer Territorium keine Kampfhandlungen gibt, werden immer wieder kurzfristig Gebiete und Straßen gesperrt. Sie wollen nicht riskieren, dass der Transport in eine außerplanmäßige Sperre gerät und kontrolliert wird, außer…«, der Oberst pufft an der Zigarre, »…die Situation würde sich komplett ändern und Ihr… ähm… seit Langem angekündigter Endsieg fände früher als vorgesehen statt.«
Die Miene des Standartenführers entgleist für einen Moment, bevor er laut herauslacht. »Was ich an euch Schweizern liebe, ist euer trockener Humor.« Er wird ernst. »Sie haben natürlich recht, lieber Oberst. Ihr Mann steigt beim Grenzübergang Au ein.«
»Danke, Standartenführer. Major Spiegelberg hat mein vollstes Vertrauen.«
»Darauf stoßen wir an.« Der Standartenführer winkt einem Kellner zu. Sobald die Cognacschwenker nachgefüllt sind, heben sie die Gläser. »Auf den Endsieg!«, sagt der Deutsche. Die Schweizer prosten ihm schweigend zu.
»Übrigens, Herr Major.« Der Standartenführer sieht Leopold an und zeigt auf den Mann, der neben ihm sitzt. Dieser hat bisher kein Wort gesagt. »Sturmbannführer Kessler wird den Transport befehligen. Ich denke, Sie werden Freunde.«
»Danke, Herr Standartenführer.« Leopold hebt sein Glas erneut in Richtung des jüngeren Deutschen, der mit seinen hellen Augen und kurz geschnittenen blonden Haaren aussieht wie ein Bilderbucharier. »Sturmbannführer Kessler.«
»Major Spiegelberg.«
DREI
Cora war spät dran. Zum Zeitpunkt, als der Helikopter der Air-Glaciers in Richtung Lauenental abhob, hatte sie gerade erst Zweisimmen hinter sich gelassen.
In der Nacht zuvor hatte sie lange mit ihrer Tochter telefoniert und war erst um drei Uhr morgens eingeschlafen. Matthias hatte Mila am Flughafen in Buenos Aires abgeholt. Zusammen waren sie weiter nach Comodoro Rivadavia in der Provinz Chubut geflogen, wo er mit Grazyna wohnte.
Es gab Momente, da war Mila Cora unheimlich. Cosima, Milas Großmutter, stand in dem Ruf, das zweite Gesicht zu haben. Cora hielt wenig davon. Es gab eben Menschen, die feinfühliger waren als andere. Dabei ließ sie es bewenden. Mila war jedoch besonders sensibel. Sie hatte die Gabe, in die Seelen ihrer Mitmenschen hineinzusehen. Nachdem Cora ihr von Ludivine erzählt hatte, war Milas Reaktion zurückhaltend.
»Bist du sicher, es wird dir guttun, wenn du gehst?«