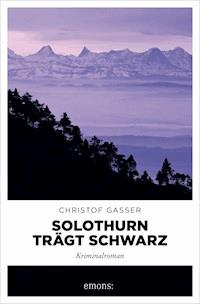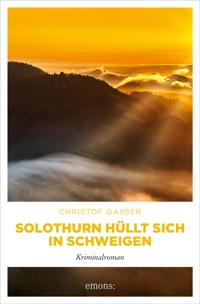Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Emons Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Solothurner Kantonspolizei
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2018
Terrorwarnung in der Ambassador - ein brisanter Kriminalroman mit Sprengkraft. Ein Oberrichter, der gerade ein umstrittenes Urteil gesprochen hat, entgeht knapp einen Bombenanschlag, wenig später verschwindet sein kleiner Sohn. Gibt es einen Zusammenhang zu dem Kinderskelett, das kurz zuvor auf der Burgruine Balm gefunden wurde? Dominik Dornach uns sein Team setzen alles daran, den Jungen zu finden, als sich plötzlich Hinweise auf eine akute terroristische Bedrohung für Solothurn verdichten. Ein tödlicher Wettlauf gegen die Zeit beginnt.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 463
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Christof Gasser, geboren 1960 in Solothurn, war lange in leitender Funktion in einem Industriekonzern tätig, unter anderem während zwölf Jahren als Betriebsleiter in Südostasien. Heute arbeitet er als freier Autor und nebenamtlich als Dozent an der Fachhochschule Nordwestschweiz. Seine bereits veröffentlichten Romane mit dem Solothurner Ermittler Dominik Dornach und Staatsanwältin Angela Casagrande landeten auf Anhieb ganz vorne auf den schweizerischen Bestsellerlisten. Im Herbst 2017 erschien sein dritter Roman «Schwarzbubenland» mit der Journalistin Cora Johannis.www.christofgasser.chwww.facebook.com/solothurnkrimi
Dieses Buch ist ein Roman. Handlungen und Personen sind frei erfunden. Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen sind nicht gewollt und rein zufällig. Im Anhang findet sich ein Glossar.
©2018 Emons Verlag GmbH Alle Rechte vorbehalten Umschlagmotiv: mauritius images/MARKA/Alamy Umschlaggestaltung: Nina Schäfer, nach einem Konzept von Leonardo Magrelli und Nina Schäfer Umsetzung: Tobias Doetsch Lektorat: Irène Kost, Biel/Bienne (CH) eBook-Erstellung: CPI books GmbH, LeckISBN 978-3-96041-350-9 Originalausgabe
Unser Newsletter informiert Sie regelmässig über Neues von emons: Kostenlos bestellen unter www.emons-verlag.de
Dieser Roman wurde vermittelt durch die Agentur Editio Dialog, Dr.Michael Wenzel (www.editio-dialog.com).
Herr, die Not ist gross!
Die ich rief, die Geister
Werd ich nun nicht los.
Aus «Der Zauberlehrling» von Johann Wolfgang von Goethe (1749–1832)
Die Schuld eines Menschen ist schwer zu wiegen. Wir streben unser Leben lang nach Glück. Aber manchmal verlieren wir uns, und die Dinge gehen schief. Dann trennt uns nur noch das Recht vom Chaos: eine dünne Schicht aus Eis, darunter ist es kalt, und man stirbt schnell.
Prolog
Der Wind legte zu. Der lose Schweif des gelben Signalbandes flatterte in einem Winkel von nahezu fünfundvierzig Grad zur Vertikale der Stange, an der der Schütze es in der Nacht zuvor festgemacht hatte. Die Brise von der nahen Nordsee würde den Drall des Projektils verstärken. Um ihn auszugleichen, schraubte er am Diopter des Präzisionsgewehres. Die Distanz betrug wenig mehr als hundertfünfzig Meter. Er hatte schon schwierigere Ziele aus grösseren Entfernungen und unter schlechteren Bedingungen getroffen.
Ein prüfender Blick auf den Swiss Army Chronographen bestätigte, dass er im Zeitplan lag. Die Zielperson musste jeden Moment zur Tür hinaustreten. Die Lichtverhältnisse waren günstig. Der Wind schob eine niedrige Wolkendecke von der Küste landeinwärts. Kein Sonnenlicht, das in den nächsten Minuten blenden würde. Auf dem Flachdach, wo er Position eingenommen hatte, herrschte eine erträglich kühle Temperatur. Die schwarze Wollmaske exponierte die Augen und den Mund. Sie hielt das Gesicht warm, ohne dass er darunter schwitzte. Das Schweissband lag unbenutzt in einer Segeltuchtasche mit den Wechselkleidern.
Hinter ihm, an der Kante des Aufbaus mit den Klimaaggregaten, war eine Sicherheitskamera angebracht. Die Linse des Objektivs starrte ihn blind an. Ein Schmunzeln huschte über seine Lippen. In diesem Moment versuchten die Informatik-Spezialisten im Gebäude verzweifelt, den Virus von den Systemen zu entfernen, den er mittels eines Trojaners in den Hostserver geschleust hatte. Der Schaden, den die Malware anrichtete, war nicht der Rede wert, bis auf den Umstand, dass die Bildaufzeichnungen der letzten vierundzwanzig Stunden permanent gelöscht sein würden, sobald das System erneut normal funktionierte.
Die Brise frischte weiter auf. Nach einem Blick durch das Zielfernrohr auf das Signalband drehte der Schütze am Diopter. Er kontrollierte den Sitz des Magazins, das fünf Patronen fasste. Wenn alles nach Plan lief, benötigte er nicht mehr als zwei davon. Er hatte nur den einen Versuch. Die Personenschützer der Zielperson waren erfahren und kompetent. Er rechnete damit, dass sein Standort innert Sekunden entdeckt werden würde.
Er schwenkte das Gewehr nach links. Zwischen ihm und dem Zielbereich hatten die Städtebauer einen kreisförmigen Teich angelegt, durch den die Einfahrt zur Tiefgarage des Hotels führte. Der Schütze nahm die Eingangstür des Gerichtsgebäudes ins Visier, atmete ein und liess für einen Moment Erinnerungen vor dem geistigen Auge vorbeiziehen, Bilder von Leid, Schmerz und Verrat. Sie verbanden ihn mit dem Mann, der in wenigen Augenblicken ins Fadenkreuz treten würde. Heute würde dieser Teufel in Menschengestalt sterben.
Der Schütze sah Bewegung hinter dem Glas der Eingangstür jenseits der Gewehrmündung. Die Türflügel glitten zur Seite und gaben den Weg frei für einen breitschultrigen Mann mittleren Alters mit kurz geschorenem Haar. Der Schütze erkannte die Ausbeulung der Schulterhalfter unter dem Jackett seines grauen Anzugs. Hinter dem Breitschultrigen trat sein jüngerer Klon heraus. Er trug denselben Anzug wie sein Kollege, nur enger geschnitten. Das Holster zeichnete sich deutlicher ab. Die Personenschützer tasteten das Gelände mit zusammengekniffenen Augen ab. Ihre Blicke schweiften über das Hotelgebäude. Sie konnten den Schützen nicht sehen– noch nicht. Der Ältere drehte seinen Kopf zur Eingangstür und nickte. Der Jüngere winkte eine abseits wartende Limousine heran.
Drei Personen– ein Mann, flankiert von einem distinguiert aussehenden Herrn mit weissen Haaren und einer jungen Frau– traten ins Freie. Der Schütze interessierte sich nur für den Mann in der Mitte. Die Frau gehörte zu dessen Anwaltsteam. Sie war Mutter einer einjährigen Tochter. Wenn alles nach Plan verlief, würde sie an diesem Abend zu Kind und Mann zurückkehren, unter Schock und später als üblich, aber am Leben.
Die letzten Monate hatten bei der Zielperson Spuren hinterlassen. Das schwarze Haar war ergraut. Der Mann, der vorgab, ein moderner Kreuzritter des Christentums zu sein, war gealtert. Hatten ihn die Seelen der unschuldigen Frauen, Kinder und alten Menschen eingeholt, die er im Namen Gottes, in Wahrheit jedoch aus reiner Macht- und Geldgier abgeschlachtet hatte? Der Schütze beobachtete, wie er die Anwältin umarmte. Mit einer übergriffigen Geste liess er seine Hände über den eng anliegenden Stoff an ihrer Hüfte gleiten. Slavko Vukovic hatte seine Raubtierinstinkte nicht verloren. Er blieb eine Ausgeburt des Bösen. Vor seinem geistigen Auge sah der Schütze Vasil. Er war nur neun Monate alt geworden. Vukovic hatte ihn an eine Wand geschleudert, weil er zu laut geweint hatte. Der Schütze schluckte die Wut und Trauer hinunter, die erneut in ihm aufzusteigen drohten.
Es schien, dass die Verhandlung gut für Vukovic verlaufen war. Er, den man den «Wolf» nannte, verliess das Gericht als freier Mann. Dem Schützen blieben nur Sekunden freies Schussfeld, bevor Vukovic die Limousine bestieg. Er hielt den Atem an und schloss die Augen. Einen Herzschlag später öffnete er sie. Er glaubte, die schwarze Glut in Vukovics Blick zu erkennen. Für einen kurzen Augenblick war ihm, dass er ihn anstarrte. Der Schütze zog den Abzug bis zum Druckpunkt, atmete aus, schoss. Er atmete wieder ein, fasste den Druckpunkt noch einmal, zielte, atmete aus und zog erneut durch.
Die sanften Erschütterungen des Rückstosses an der Wange bestätigten, dass beide Projektile mit einer Geschwindigkeit von mehr als sechshundert Metern pro Sekunde aus dem Lauf schossen. Er verharrte nur kurz, um das Ergebnis seines Tuns zu betrachten. Vukovic sackte zusammen. Anstelle des verhassten Gesichts sah der Schütze einen blutigen Wulst aus Knochensplittern und Gehirnmasse. Der Wolf war gestorben, bevor sein Körper zu Boden ging– ein gnädiger Tod für ein Monster. Mit schreckgeweiteten Augen kauerte die Anwältin im blutbespritzten Deux-Pièces einen Meter neben ihm. Sie hatte den Mund aufgerissen. Ihre schrillen Schreie drangen erst in diesem Moment an die Ohren des Schützen. Der weisshaarige Kollege der Frau stand vor Schock gelähmt und totenbleich daneben.
Mit raschen, präzisen Handgriffen zerlegte der Schütze das Gewehr, sammelte die automatisch ausgestossenen Patronenhülsen auf und verstaute sie zusammen mit der Waffe in der schwarzen Sporttasche. Geduckt, ohne zu rennen, eilte er zum Eingang des Treppenhauses, wo er rasch die Kleider wechseln wollte. Er vermutete, dass die Personenschützer ihn bereits entdeckt hatten.
EINS
Am höchsten Punkt der Rütimatt, bevor er in das Dorf Balm bei Günsberg hineinfuhr, durchdrang der XC60 die Nebelwand und rollte in den gleissenden Sonnenschein. Lang gezogene Wolkenreste der vergangenen Gewitternacht klammerten sich an die Felswand der Balmflue. Bald würde die aufgehende Sonne sie in feuchte, warme Luft auflösen. Dornach ging vom Gas, als ihn das Sonnenlicht blendete, und blickte über das Aaretal unter ihm und die Hügelzüge des Oberaargaus und des Emmentals dahinter. Am östlichen Horizont krochen die gleissenden Vorboten eines weiteren sehr warmen Frühsommertages über den Alpenkamm. Die digitale Uhr am Armaturenbrett zeigte kurz nach halb sechs an.
Die Sturmnacht hatte ihm einen unruhigen Schlaf beschert. Rasch aufeinanderfolgende Blitze, begleitet von ohrenbetäubenden Donnerschlägen, hatten ihn aus diffusen Träumen gerissen, an die er sich nicht mehr erinnern konnte. Er hatte mitbekommen, wie Pia und Manu kurz nach vier Uhr kichernd und tuschelnd von einer Geburtstagsparty zurückkehrten. Sie hatten durchfeiern wollen. Das Gewitter musste ihnen einen Strich durch die Rechnung gemacht haben.
Kurz vor fünf Uhr kam der Anruf von der Alarmzentrale. Er war offenbar nicht der Einzige, dem die entfesselten Elemente den Schlaf geraubt hatten. Eine Bewohnerin von Balm hatte Lust auf einen nächtlichen Spaziergang mit ihrem Hund verspürt und dabei eine makabre Entdeckung gemacht. Die Schilderung des wachhabenden Beamten verursachte bei Dornach noch jetzt eine Gänsehaut.
In Balm waren die ersten Anzeichen von Geschäftigkeit erkennbar. Neugierige Blicke aus geöffneten Fenstern folgten seinem Wagen. Er bog in die schmale Strasse ein, die zur Burgruine führte. Für Besucher war die Zufahrt bis zum Parkplatz gestattet. Die Ruine Balm zog nicht gerade Heerscharen von Touristen an. Dornach hoffte, dass Mike Lüthi die Umgebung weiträumig hatte absperren lassen, bevor es den ersten Schaulustigen einfiel, die Burgruine zum Ziel ihres Morgenspaziergangs zu erküren. Er war nicht in Stimmung, sich mit Gaffern herumzuschlagen, es sei denn, einer von ihnen bot ihm einen frisch gebrauten Kaffee an. Und er hegte noch die leise Hoffnung, dass es nur ein Bubenstreich war, der ihn um sein Frühstück brachte.
Die Balmflue war eine mit Buschwerk und Gebirgswald durchzogene Felswand. Sie bildete den unteren Teil der gewaltigen Bergflanke des Balmfluechöpfli. Die Burgruine war vom Auto aus noch nicht zu erkennen. Bäume und Unterholz versperrten die Sicht auf den unteren Teil der Felswand. Der Lichtstrahl eines mobilen Scheinwerfers der Kriminaltechnik schimmerte durch das dichte Grün des Laubes, zwanzig Meter über der Strasse.
Unmittelbar beim Zugang zur Ruine standen Dienstfahrzeuge der Kantonspolizei und der Leichenwagen eines lokalen Bestatters. Dornach parkierte auf dem Besucherparkplatz am Waldrand und ging zu Fuss zurück zu der Stelle, wo ein Pfad weg von der Strasse durch das Gehölz zur Felswand führte. Ein Absperrband und eine uniformierte Polizistin verwehrten Unbefugten den Zugang. Dornach kannte die junge Beamtin nicht, sie ihn hingegen schon. Sie wollte vor ihm salutieren, was er vermied, indem er ihr die Hand zur Begrüssung entgegenstreckte und sich vorstellte. «Ist Mike Lüthi oben?» Er zeigte in die Richtung, wo er die Ruine hinter dem Laubwald vermutete.
«Feldweibel Lüthi wartet oben auf Sie, Hauptmann Dornach», erwiderte die Polizistin. «Folgen Sie dem Felsenpfad.» Sie bekundete Mühe, den Blick von seinen grauen Augen und dem dunklen, an den Schläfen silbern durchzogenen Haar abzuwenden. Auf dem Weg zum Felsaufgang machte Dornach eine mentale Notiz zuhanden ihres Vorgesetzten, er möge die Kollegin darauf hinweisen, dass die Dienstgrade der Kantonspolizei meistens administrativen Zwecken dienten. Im täglichen Umgang unter Kollegen fanden sie sehr selten Anwendung.
Er stieg über prekäre, in den Kalkfels gehauene Treppenstufen zum Ort, wo die Freiherren zu Balm im 12.Jahrhundert ihre Stammburg errichtet hatten. Von der ehemaligen Grottenburg waren die Reste der zwei Meter dicken äusseren Wehrmauer erhalten. Der dahinterliegende Innenhof mass zwanzig Meter in der Länge, und er reichte rund sechs Meter tief in den Fels hinein.
Dornachs Stellvertreter Mike Lüthi sass auf dem Absatz einer nachträglich angebrachten Türöffnung. «Morgen, Dominik, sorry, dass ich dich aus den Federn holen liess.»
«Schon gut. Wäre trotzdem schön, wenn du einen Kaffee aus der Westentasche zaubern könntest.»
Lüthi zog mit beiden Händen an imaginären Hosentaschen seines Schneemanns, dem weissen Schutzanzug der Kriminaltechnik. «Tut mir leid, meine Kaffeeköchin schläft noch.»
«Lass ja Maja nicht hören, wie du sie betitelst. Die ist in der Lage und verpasst dir eine Woche Schweigebehandlung mit Annäherungsverbot.»
«Ich kann nichts dafür, wenn sie immer die Erste ist, die aufsteht, und obendrein die Einzige, die weiss, wie unsere neue Maschine funktioniert. Um das Ding zu bedienen, brauchst du ein Ingenieurstudium. Von mir aus hätte es die alte Filtergurgel noch lange getan.»
Dornach hatte es aufgegeben, seinem langjährigen Kollegen die Vorzüge von frisch gemahlenem Bohnenkaffee zu vermitteln. Wenn das nicht mal Kollegin Maja Hartmann schaffte, war jede missionarische Liebesmüh umsonst.
«Was soll ich mir ansehen?»
Lüthi zeigte mit dem Daumen nach hinten durch die Maueröffnung. «Hierdurch und dann rechts hoch. Sebi ist bereits da. Ich warte auf einen Anruf von der Rechtsmedizin aus Bern.»
Im Innern ihres felsgespickten Gevierts war die Burg ursprünglich zweigeschossig gebaut worden. Dornach erinnerte sich vage daran, was ihm sein Vater früher darüber erzählt hatte. Ausserhalb der Mauer hatte ein befestigter Wehrbau existiert. Der Raum dahinter diente vermutlich der Nutzung als landwirtschaftlicher Komplex. Den Herren von Balm musste es in ihrer neuen Burg bald zu zugig und feucht geworden sein. Schon früh nach der Erbauung verlegten sie ihren Herrschaftssitz in die milderen Gefilde des heute luzernischen Altbüron. Die Dynastie besiegelte ihr Schicksal im Jahr 1308 in Windisch mit dem Tod von Kaiser AlbrechtI. von Habsburg, an dessen Ermordung Rudolf von Balm direkt beteiligt gewesen sein soll. Über die von Balm wurde die Reichsacht verhängt. Der unglücksselige Rudolf verbrachte den Rest seiner Tage auf der Flucht und starb in einem Kloster in Basel.
Auf einem erhöhten Felsabsatz stand ein mobiler Scheinwerfer der Kriminaltechnik, dessen Strahl auf eine Nische gerichtet war. Etwas abseits warteten zwei Bestatter mit einem Leichensack. Sie hatten darauf verzichtet, einen sperrigen Zinksarg über den Felsenpfad zu schleppen. Sebastian Tschanz, der Leiter der Kriminaltechnik, kniete auf dem Boden. Er beugte sich über etwas, das Dornach von seinem Standort nicht erkennen konnte.
«Kann ich hochkommen, Sebi?»
«Kein Zutritt für Nicht-Kostümierte.»
Nachdem Dornach einen Schneemann übergestreift hatte, schaute er Tschanz über die Schulter. «Was ist denn das?», fragte er erstaunt.
«Was soll es denn deiner Meinung nach sein? Ich muss dir hoffentlich nicht erklären, wie ein Skelett aussieht.»
Dornach betrachtete das kleine, schmale Gerüst, dessen Grösse auf ein Kind oder einen kleinwüchsigen Erwachsenen schliessen liess. Die Knochen schimmerten bräunlich weiss unter anhaftenden Erdpartikeln. Dornach stach die Position ins Auge. Es lag flach auf dem Rücken auf dem felsigen Boden. Die skelettierten Hände waren über dem Bauch gefaltet. «Wurde es so aufgefunden?»
Tschanz nickte. «Die Frau, die es entdeckte, hatte ihren Hund dabei. Er ist vor der Öffnung stehen geblieben und hat angeschlagen, bis sie gekommen ist. Ich habe ihr gesagt, sie soll dem Viech auf meine Kosten einen grossen Knochen vom Metzger besorgen. Spart mir eine Menge Arbeit, wenn ich mich nicht mit Tierfrass herumschlagen muss.»
Dornach blickte um sich. «Wo ist die Zeugin?»
«Ich habe sie nach Hause bringen lassen», sagte Lüthi, der sich zu ihnen gesellt hatte. «Sie war etwas mitgenommen. Aber sie hält sich zur Verfügung, wenn du mit ihr reden willst.»
«Später vielleicht. Was suchte sie so früh an einem Donnerstagmorgen hier? Ist nicht gerade der ideale Spazierweg, wenn man mit dem Hund unterwegs ist.»
Lüthi zeigte zu den Wohnhäusern am Dorfrand hinüber. «Sie wohnt da drüben und meinte, kurz vor dem Gewitter einen schwachen Lichtschimmer an der Felswand gesehen zu haben. Es war ihr unheimlich. Sie ist erst hergekommen, nachdem das Gewitter vorüber war.»
Dornach ging in die Hocke. Der Anblick des Skelettes hatte ihn zunächst derart in den Bann gezogen, dass ihm erst jetzt zwei Details ins Auge stachen. Es lag im Zentrum eines Steinkreises. Zu beiden Seiten des Kopfes, auf der Höhe der Hüften und bei den Füssen waren zur Hälfte hinuntergebrannte Kerzenstummel aufgestellt.
«Das…», begann Dornach.
«… sieht aus wie ein Bestattungsritual, ja», kam Tschanz ihm zuvor. «Das Skelett lag unter einem flachen Steinhügel. Die Steine liegen da drüben.» Er zeigte auf eine Anzahl aneinandergereihter Felsbrocken. «Ich habe alles fotografiert, aber das Ausmass des Hügelgrabes erkennst du schon am Steinkreis, den ich für dich habe stehen lassen. Die Kerzenstummel stehen ebenfalls dort, wo wir sie gefunden haben.»
«Wie lange, denkst du, liegt es hier?»
«Nicht allzu lange. Ich wage zu behaupten, es wurde erst in dieser Nacht hier abgelegt, frühestens gestern Abend. Der Boden unter den Steinen ist trocken. Das heisst, das Skelett lag schon vor dem Gewitter hier. Die Ruine ist nicht stark frequentiert. Trotzdem, wenn der Grabhügel schon länger hier wäre, müsste er unweigerlich früher aufgefallen sein.»
«Weshalb bestattet jemand zu später Stunde ein Skelett an diesem Ort? Hat er eine spirituelle oder religiöse Bedeutung?»
«Wenn du einen Hexenschuss als spirituelle Eingebung ansehen willst, warum nicht?», sagte Lüthi. «So was fängt man sich garantiert ein, wenn man zu lange in dieser Villa Durchzug rumsitzt.»
«Sobald das Skelett abtransportiert ist, schaue ich mir den Untergrund genauer an», sagte Tschanz.
«Männlich oder weiblich?», fragte Dornach.
«Schwer zu sagen. Die Entwicklung des Knochenbaus weist auf einen Todeszeitpunkt im Kindesalter hin. Aufgrund der Hüftanatomie tippe ich auf einen Jungen.» Er zeigte auf den Schädel. «Dafür sprechen auch die relativ stark ausgebildeten Knochenwülste über den Augenhöhlen.»
«Alter?»
Tschanz deutete mit einem Stift auf das freigelegte Gebiss. «Der Durchbruch der verbleibenden Zähne hat eingesetzt. Einige Milchzähne sind bereits ausgestossen. Die Länge des Skeletts lässt eine Alterseinschätzung von über sieben bis unter zehn Jahren zu. Die genaue Eingrenzung überlasse ich den Anthropologen im Institut für Rechtsmedizin.»
Dornach schritt um Tschanz herum und kauerte vor dem Schädel nieder. «Keine Anzeichen auf spitzes oder stumpfes Trauma. Auf den ersten Blick kein Indiz auf einen gewaltsamen Tod.»
«Die übrigen Knochen weisen ebenfalls keine offensichtlichen Verletzungen auf, soweit ich das hier erkennen kann. Es scheint auch nicht von irgendwo heruntergestürzt zu sein.»
«Autounfall oder Erschlagen als Todesursache sind also weniger wahrscheinlich», sagte Lüthi.
«Das soll die Rechtsmedizin klären.» Tschanz hob die Schultern. «Es gibtx andere Todesursachen wie Krankheit oder eine Vergiftung. Es ist schwierig, so etwas an einem Skelett nachzuweisen.»
«Aufgrund dieser Auffindesituation sollten wir vorerst von einem aussergewöhnlichen Todesfall ausgehen», sagte Dornach. «Wie lange schätzt du den Todeszeitpunkt zurück, Sebi?»
«Falls du auf eine mögliche Verjährung spekulierst, muss ich dich enttäuschen. Der Tod liegt sicher nicht dreissig Jahre oder darüber hinaus zurück. Ich würde auf weniger als zehn tippen.»
Dornachs Magen krampfte sich zusammen. Das konnte heissen, dass da Eltern waren, die seit Jahren ihr Kind vermissten. Ohne Leichnam klammerten sich die Angehörigen an den dünnen Strohhalm der Hoffnung, ihr verschwundenes Kind eines Tages wiederzusehen. Dornach würde diesen letzten Funken Lebensglauben zuerst auslöschen müssen, bevor er erlösender Gewissheit Platz machen konnte.
«Ich habe noch was für euch», sagte Tschanz. Er hielt einen Plastikbeutel in der Hand. Der Inhalt bestand aus einem herzförmigen silberfarbenen Ring. Wo das Herz spitz zusammenlief, war er mit kleinen Brillanten besetzt. Das Schmuckstück hing an einer dünnen Schnur.
Dornach nahm Tschanz den Beutel aus der Hand und betrachtete ihn eingehend. «Das lag mit dem Skelett im Grab?», fragte er. «Die Grösse des Ringes passt auf eine erwachsene Person.» Er reichte den Beutel Lüthi.
«Der Ring war nicht am Fingerknochen, sondern mit der Schnur um seinen Hals gebunden», erwiderte Tschanz.
«Ich glaube, auf der Innenseite ist eine Inschrift», sagte Lüthi. «Vielleicht ein Name. Konntest du sie entziffern, Sebi?»
«Kann ich nicht genau sagen. Das Metall, vermutlich ist es Silber, ist angelaufen. Ich muss den Ring zuerst reinigen. Das mache ich später in der Schanzmühle, wo ich besseres Licht habe und ihn genau unter die Lupe nehmen kann.»
Lüthi gab ihm den Beutel zurück.
«Kommen die von der Rechtsmedizin oder nicht?», fragte Tschanz ihn.
«Professor Bodmer hat mich vorhin angerufen. Ihr Anthropologe ist derzeit an einem anderen Fall im Berner Oberland und kann so schnell nicht hier sein. Sie sagt, es liege an dir, Sebi. Wenn du denkst, dass der Fundort nicht der ursprüngliche Ablage- oder Tatort sein kann, reicht es, wenn du das Skelett zusammen mit einigen Bodenproben und Fotos frei Tisch nach Bern lieferst.»
«Okay.» Tschanz winkte die Bestatter zu sich. «Ich schaue mir die Umgebung noch mal an, dann sind wir weg.»
«Ich kehre mit Mike in die Schanzmühle zurück», sagte Dornach. «Melde dich, wenn du fertig bist.»
«Denkst du, was ich denke?», fragte Lüthi auf dem Weg zu ihren Autos.
Dornach nickte. «Maja und Karin sollen sich das Vermisstenregister vornehmen.» Er klopfte Lüthi auf die Schulter. «Du hast mich geweckt, also besorgst du Gipfeli und Weggli für alle beim Rapport.»
ZWEI
Mit der Waffe im Anschlag schlüpfte Jana Cranach durch das mannshohe Loch in der Wand zur Nachbarwohnung. Der Fluchtweg hatte den Bewohnern nicht viel geholfen. Der Zugriff durch die Einsatzgruppe Tigris der Schweizer Bundeskriminalpolizei in der konspirativen Wohnung war blitzschnell erfolgt. Die Extremisten hatten keine Chance. Nachdem die Verdächtigen abgeführt worden waren, blieb Jana absichtlich zurück. Sie hatte etwas gesucht, ohne sich darüber im Klaren zu sein, was es war. Dabei war sie auf den Durchgang gestossen. Die Naivität der Extremisten, zu glauben, es genüge, zur Tarnung einen Schrank vor das Loch zu schieben, hatte sie den Kopf schütteln lassen.
Der Funkstöpsel in ihrem Ohr übermittelte die Kommunikation in Französisch zwischen den Beamten der Einsatzgruppe Tigris und ihren Kollegen von der Sondereinheit der Genfer Polizei.
Minuten zuvor hatten die Elitepolizisten die Wohnung in einem Miethaus, unmittelbar neben der Genfer Zentralmoschee in der Rue de Montchoisy im Stadtviertel Eaux-Vives, gestürmt. Der Einsatz war aufgrund eines Hinweises des französischen Auslandsnachrichtendienstes erfolgt: Scheich Abdul Adil, der Führer der gleichnamigen islamistischen Terrorgruppe, halte sich mit seiner Nummer zwei Jemina Osmankovic, genannt «Saïf Allah» oder «Schwert Gottes», dort auf.
Marius Châtelain von der BKP, der schweizerischen Bundeskriminalpolizei, leitete den Einsatz. Jana kannte ihn aus ihrer Zeit beim österreichischen Bundeskriminalamt, in der sie ihm einige Male grosszügige Amtshilfe gewährt hatte. Sie hatte eine Grenze gezogen, nachdem sie gemerkt hatte, dass sich hinter der Einladung zum Nachtessen eine andere Absicht verbarg als reine Dankbarkeit. Das war lange bevor sie Dornach kennengelernt hatte. Châtelain hatte seinen verletzten Stolz hinuntergeschluckt. Er musste einsehen, dass sie es war, die bestimmte, wann sie mit wem ins Bett ging. Das tat seinem Respekt für sie keinen Abbruch.
Jana war am Vorabend auf der Durchreise von ihrer Dienststelle, der Europol-Zentrale in Den Haag, nach Montreux in Genf eingetroffen. Châtelain hatte davon erfahren und sie eingeladen, bei dem Zugriff dabei zu sein. In ein paar Stunden hatte sie vor führenden Sicherheitsverantwortlichen europäischer Staaten ein Referat zur Terrorbekämpfung zu halten. Sie hegte den Verdacht, dass der Westschweizer die Gelegenheit für eine weitere Charmeattacke nutzen würde. Damit konnte sie umgehen. Was in diesem Moment zählte, war der Zugriff. Seit Monaten war Jana hinter Adil und Osmankovic her. Sie wollte vor allem die Frau.
«Alpha an Lilo», hörte Jana Châtelains Stimme über Funk. Er sprach Französisch mit ihr. «Wo sind Sie?»
«Ich sehe mich um», antwortete sie in derselben Sprache.
«Seien Sie vorsichtig. Wir haben bisher keine Spur von Adil und Osmankovic. Die beiden halten sich wahrscheinlich irgendwo im Gebäude auf. Ich schicke Ihnen ein paar Leute rauf.»
«Nicht nötig. Die sollen besser die Keller absuchen. Wenn die Extremisten hier oben ein Loch in die Wand schlagen können, gelingt es ihnen auch unten. Lilo aus.»
Der Raum hinter dem Durchbruch war leer. Jana blieb stehen, um ihre Augen an das diffuse, staubgefilterte Tageslicht zu gewöhnen, das zwischen den Lamellen der heruntergelassenen Jalousien hereindrang. Im Grunde hatte sie nicht die Absicht gehabt, sich an diesem Zugriff aktiv zu beteiligen, sie wollte nur beobachten. Deshalb trug sie anstelle ihres Kampfoveralls ein eng geschnittenes dunkelgraues Hosenkostüm unter der kugelsicheren Weste. Sie hatte keine Wechselkleidung dabei. Das Kostüm hatte für das Referat in Montreux sauber zu bleiben. Ihre Wildlederstiefeletten mit flachen Absätzen gingen für diesen Zweck knapp durch.
Eine daumendicke Staubschicht bedeckte einen abgenutzten Linoleumboden mit Ausnahme der Schuhabdrücke zweier Paar Schuhe, die in direkter Linie zur Zimmertüre führten. Die Grösse entsprach derjenigen von Frauenschuhen. Zwei weibliche Personen waren kurz zuvor hier durchgegangen.
Jana öffnete die Tür zum Korridor. Dahinter war es stockdunkel. Sie knipste die schmale LED-Stablampe an, die sie in die Tasche ihres Jacketts gesteckt hatte. Der kräftige Lichtstrahl tauchte den Korridor in taghelles Licht. Sie richtete ihn auf den Boden. Im Dunkeln riskierte sie, allfällige Stolperdrähte einer Sprengfalle zu übersehen. Da war nichts. Sie knipste die Lampe aus und wartete erneut ein paar Sekunden, bevor sie sich weiter vortastete.
Die Luft im gefangenen Korridor roch muffig, die Wohnung musste seit Ewigkeiten nicht mehr gelüftet worden sein. Jana glaubte, verstanden zu haben, dass einige Wohnungen im Gebäude einer seit Langem angekündigten Renovierung harrten. Sie lauschte. Ein beinahe körperliches Gefühl, nicht alleine zu sein, beschlich sie. Sie sah den Gang hinunter. Unter den Ritzen der Türen beidseits des Korridors drang Helligkeit hindurch. Sie hatte sich so weit an das Schummerlicht gewöhnt, dass sie vor sich die Umrisse der Eingangstüre ausmachen konnte.
Hinter der Tür unmittelbar rechts von ihr hörte sie ein Geräusch, wie ein heftig auftretender Schuh, gefolgt von einem unterdrückten Aufschrei. Jana trat einen Schritt zurück. Sie presste ihren Rücken gegen die Wand neben der Tür. Vorsichtig streckte sie die linke Hand nach der Klinke aus und drückte sie hinunter. In diesem Augenblick brach die Hölle los. Mehrere Kugeln durchschlugen die Türfüllung. Rasch zog Jana ihre Hand zurück. Die Projektile hätten sich in Janas Schutzweste gebohrt, wenn sie direkt vor der Tür gestanden wäre.
Sobald die Schüsse verstummten, zögerte Jana nicht mehr. Sie trat gegen die Tür und liess sich gleichzeitig zur Seite fallen. Der Fusstritt war dermassen kräftig, dass er die leichte Zimmertür beinahe aus den Angeln hob. Im Schwung der Bewegung ging sie mit ihrer Glock17 im Anschlag vor der Türöffnung in die Knie. Sie blickte in das kindliche Gesicht einer Frau im Teenageralter. Sie hielt eine Pistole in der Hand und starrte sie angsterfüllt an.
«Bitte nicht schiessen, ich bin unschuldig», sagte sie. Sie sprach ebenfalls Französisch.
«Waffe fallen lassen. Wer sind Sie?», antwortete Jana. Mit einer katzenartigen Bewegung, immer die Glock im Anschlag, kam sie auf die Füsse.
Das Mädchen ignorierte Janas Anweisung. «Bitte tun Sie mir nichts. Ich heisse Medina.» Ihre Angst war echt.
«Beruhigen Sie sich, Medina. Ich bin Polizistin. Legen Sie die Waffe auf den Boden.»
«Ist… ist sie weg?»
«Wer?»
«Die Frau, die mich hierher verschleppt hat.» Medina schielte zur Seite zu einer Tür, die zu einem Nebenraum führte. «Ich hatte solche Angst, dass sie zurückkommt, deshalb habe ich geschossen.»
Jana folgte dem Blick des Mädchens. «Was für eine Frau? Wie sah sie aus?» Sie legte den Zeigefinger auf die Lippen und bewegte sich auf die Tür zu.
«Sie war schön», flüsterte Medina. Möglicherweise wurde ihr bewusst, wie unpassend das unter den gegebenen Umständen klang. «Aber sie hatte ein böses Gesicht mit giftigen Augen. Die Haare weiss ich nicht. Sie trug einen Hidschab.»
Jana wusste, dass Osmankovic braunrote Haare hatte, die sie schwarz färbte und mit einem Hidschab bedeckte, um sich besser in die islamische Gemeinschaft einzufügen. Ihr Gesicht mit den kalten Augen verbarg sie unter keinem Schleier. Schliesslich hatten sie ihr zu ihrem Kriegsnamen verholfen.
Medina legte ihre Waffe auf den Boden und trat zwei Schritte zurück.
«Woher haben Sie die Waffe?», fragte Jana. Das Mädchen nicht aus den Augen lassend ging sie auf die Nebentür zu.
«Gestohlen, in der anderen Wohnung, bevor mich diese Frau hierher zerrte, weil die Polizei dort die Türe aufgebrochen hatte.» Medina zeigte in die Richtung der Nachbarwohnung. «Die Frau ist geflüchtet und hat mich zurückgelassen.»
Jana knipste ihre Stablampe an. Mit einem weiteren gezielten Fusstritt sprengte sie die Tür auf und ging sogleich in die Hocke, um einem allfälligen Gegner kein grosses Ziel zu bieten. Der Nachbarraum war ebenso leer geräumt wie derjenige, in dem sie standen.
Bevor sie die Bewegung hinter sich wahrnahm, wusste Jana, dass es ein Fehler gewesen war, Medina den Rücken zuzukehren.
«Allahu Akbar!»
Aus den Augenwinkeln sah Jana, wie das Mädchen die Pistole hob und auf sie anlegte. Sie duckte sich zur Seite weg. Die Kugel schlug hinter ihr in die Wand ein. Jana zielte kurz, bevor sie zweimal abdrückte. In Bauch und Brust getroffen brach Medina zusammen.
Jana ging neben Châtelain die Rue des Eaux-Vives entlang zum Parc de la Grange. Dort wartete ein Militärhelikopter, der sie nach Montreux fliegen sollte. In anderthalb Stunden musste sie vor ihren Zuhörern im Montreux Palace stehen.
«Das hätte schiefgehen können, Jana. Warum sind Sie allein in diese Wohnung gegangen? Wenn etwas passiert wäre, hätten meine Leute nicht rechtzeitig eingreifen können», begann Châtelain.
Sie schenkte ihm ihr entwaffnendes Lächeln. «Glauben Sie mir, Marius. Ich habe schon weitaus kniffligere Situationen gemeistert.»
«Das glaube ich Ihnen gerne. Trotzdem, der Einsatz lag in meiner Verantwortung. Sie durften nur als Beobachterin hier sein.» Er blieb stehen und ergriff ihre Hände. «Abgesehen davon, dass Ihr Anblick mit einer Kugel im Kopf für mich unerträglich wäre, will ich mir die diplomatischen Verwicklungen gar nicht ausmalen, wenn eine stellvertretende Direktorin von Europol bei einem schweizerischen Polizeieinsatz von einem Terroristen verletzt oder gar getötet würde.»
«Ach, Marius.» Jana entzog sich ihm sanft. «Lassen Sie mir den Nervenkitzel. Zurück in Den Haag darf ich nur wieder Akten wälzen. Freuen Sie sich lieber über den Erfolg.»
Das tat Châtelain. Die drei festgenommenen Personen standen seit Langem auf der Fahndungsliste der BKP. Der Wermutstropfen war, dass Jemina Osmankovic, eine der meistgesuchten Terroristinnen Europas, zusammen mit ihrem Dienstherren Abdul Adil verschwunden war. Beide waren rachsüchtig und gefährlich. Die nur wenige Kilometer entfernte Grenze zu Frankreich war hermetisch abgeriegelt. Die Tatsache, dass sich zwei internationale Top-Terroristen in der Schweiz aufhielten, war alles andere als beruhigend.
«Wie steht es um das Mädchen?», fragte Jana.
«Sie wird bereits operiert und kommt vermutlich durch. Sie zielen gut, Jana.»
«Ich wünschte, ich hätte mich nicht ablenken lassen. Sie ist noch ein Kind. Konnten Sie sie identifizieren?»
«Sie wissen selbst, dass es für Terroristen kein Mindestalter gibt. Das Mädchen heisst in Wirklichkeit Ecrin Altinsoy und ist Schweizerin türkischer Abstammung. Sie war aufgrund ihrer Nähe zu radikalen islamistischen Gruppierungen im Visier von unserem Geheimdienst, dem Nachrichtendienst des Bundes NDB.» Er bemerkte Janas nachdenklichen Ausdruck. «Manchmal heisst es eben sie oder wir.»
Ein schwacher Trost für Jana. Dennoch hatte Châtelain nicht unrecht: Geradeso gut könnte sie es sein, die auf dem Operationstisch oder im Zinksarg lag.
«Wollen Sie mich nicht zur Pressekonferenz begleiten?», fragte Châtelain. «Ihr Referat in Montreux können Sie am Nachmittag halten. Danach könnte ich Ihnen die Gegend zeigen. Im Lavaux haben wir ausgezeichnete Weine, ausserdem gehört es zum UNESCO Weltkulturerbe.»
Jana sah ihn von der Seite an. Mit seinem scharf geschnittenen Gesicht, dem vollen Haar in Salz- und Pfeffer-Farben und dem gepflegten Dreitagebart entsprach der aus La Chaux-de-Fonds stammende Châtelain dem Typus «Mann für gewisse Stunden». Jana hatte kein Interesse. Sie sehnte sich nach einem anderen Schweizer, der ihr unter die Haut gegangen war.
Sie schenkte Châtelain ein diplomatisches Lächeln. «Machen Sie die Konferenz ohne mich, Marius. Polizeichefs und Staatssekretäre aus zwanzig Staaten lassen sich nicht einfach so versetzen.» Sie sah auf ihre Uhr. «Ich muss mich sputen, wenn ich rechtzeitig in Montreux sein will.»
«Wir sind gleich da.» Sie erreichten eine Querstrasse, die mit Avenue William-Favre angeschrieben war. Gegenüber lag eine Grünanlage, der Parc de la Grange. Der Weg durch den Park führte sie geradewegs zu einer offenen Fläche. Mittendrin stand ein Super Puma der Schweizer Luftwaffe. Jana erkannte die knabenhafte Gestalt, die eiligen Schrittes auf sie zukam. Wenige Meter vor ihr salutierte sie.
«Magali!» Jana umarmte die Pilotin. Im Vorjahr war ein gemeinsamer spektakulärer Rettungseinsatz in den Walliser Alpen nicht zuletzt dank den Flugkünsten von Hauptmann Magali Fournier glücklich ausgegangen.
«Ich habe gehört, dass du ein Lufttaxi brauchst, und so wollte ich es mir nicht nehmen lassen, Chauffeurin zu spielen», sagte sie fröhlich. «Dieser Flug dürfte ein bisschen langweiliger sein als der letzte.»
«Wenn du Gas gibst, bleibt uns Zeit für ein Glas Wein– für dich Traubensaft», ergänzte Jana angesichts Magalis bedauernder Grimasse.
DREI
Dornach schnappte sich ein Gipfeli. Maja Hartmann stellte ihm eine volle Kaffeetasse hin. Er wollte sie nach dem Stand der Nachforschungen nach den vermissten Kindern fragen. Er kam nicht dazu. Angela Casagrande trat durch die Tür. «Bekomm ich auch einen Kaffee?», rief sie Maja zu.
«Klar, Mike übt gerade», sagte Maja. Grinsend zeigte sie zu ihrem Freund hinüber, der konzentriert auf den Knöpfen der Kapselmaschine herumdrückte. Dornach hatte es fertiggebracht, dass vom Budget der Kantonspolizei ein Betrag für eine leistungsfähigere Maschine abgezweigt wurde, die dagegen etwas komplexer zu bedienen war.
«Immer langsam, ich bin hier nicht der Barista vom Dienst.»
«Dafür ein vollendeter Gentleman», erwiderte Casagrande. «Du weisst, welche Sorte ich mag?»
«Wie Dominik, dunkel und bitter.»
Die Staatsanwältin nahm neben Dornach Platz, dessen Arm sie kurz drückte. Im vergangenen Herbst war sie im politisch heiklen Fall um die Aschenkreuz-Morde und die Patriotische Fortschrittspartei der Schweiz derart unter Druck geraten, dass sie ein Burn-out erlitten hatte. Nun hatte sie sich vollständig erholt. Ihr Gesicht mit dem energischen Kinn wirkte ebenmässiger, und das kastanienbraune Haar hatte seinen gewohnten Glanz wiedergewonnen. Sie hatte auch zugenommen, was ihr hervorragend stand, wie Dornach fand, auch wenn er ihr das nie sagen durfte. Das kämpferische Leuchten in ihren Augen war zurück.
«Was liegt an?», fragte sie.
Tschanz war dazugestossen. Er hatte Urs Jäggi, den Chef der Kriminalpolizei, und Rolf «Google» Gubler, den IT-Freak der Ermittlung, im Schlepptau. Tschanz begann gleich mit der Erläuterung der Fundsituation. «Sobald das Skelett in der Rechtsmedizin eingetroffen war, habe ich mich mit Professor Bodmer und Dr.Andriessen kurzgeschlossen.»
«Wer ist Dr.Andriessen?», fragte Casagrande.
«Der neue forensische Anthropologe. Er ist Däne.»
«Praktisch», bemerkte Gubler. «Bringt sicher einen Haufen Erfahrung aus Scandi-Krimis mit.»
«Wie auch immer», fuhr Tschanz fort. «Bodmer, Andriessen und ich sind uns prinzipiell über Geschlecht und Alter des Skelettes in etwa einig. Andriessen will sich erst definitiv festlegen, wenn er seine Untersuchung abgeschlossen hat. Die DNA-Analyse wurde in Auftrag gegeben. Es wird Tage dauern, bis sie vorliegt.»
«Kann man nichts machen», meinte Dornach. «Hast du noch was, Sebi?»
«Ja, ich habe den Ring vom Fundort gereinigt und angeschaut.» Er nickte Karin zu, die am Computer sass. Auf der Projektionswand erschien eine Vergrösserung des Ringes mit der Schnur. «Das Material ist tatsächlich Silber. Die Brillanten sind nicht echt, vermutlich Massenware von Swarovski. Den Kaufpreis würde ich zwischen sechzig und siebzig Franken ansetzen.»
«Und? Gibt’s eine Gravur auf der Innenseite?», fragte Lüthi.
«Gibt es.» Auf der Projektionswand wechselte das Bild. «Für das beste Mami 2008», las Lüthi die Inschrift vor. «Das heisst, wenn wir davon ausgehen, dass wir es mit einem toten Kind zu tun haben, gehörte der Ring vielleicht seiner Mutter.»
«Fragt sich, von wem an wen die Widmung gerichtet ist?», sagte Maja. «Wenn der Ring dem Kind gehören würde, stünde ja wohl sein Name drin.»
«Oder der Ring war für die Mutter bestimmt», mutmasste Karin.
«Diese Spekulationen helfen uns jetzt nicht weiter», schaltete sich Dornach ein. Er bat Tschanz, allen die Fotos des Ringes auf die Handys zu senden. «Wie steht es mit der Aufstellung über die vermissten Kinder?» Dornach warf Maja, die an einem Gipfeli kaute, einen fragenden Blick zu. Da sie einen vollen Mund hatte, stiess Maja ihre Kollegin Karin Jäggi an.
Karin war offenbar überrascht und errötete, bevor sie loslegte. «In der Schweiz werden gegenwärtig über zwanzig Personen vermisst, die zum Zeitpunkt ihres Verschwindens minderjährig waren. Einige Fälle reichen in die achtziger Jahre zurück. Die Kinder waren damals zwischen fünf und acht Jahre alt. Wenn sie noch leben, sind sie heute Mitte dreissig bis Anfang vierzig.» Sie liess einen Stapel Papiere zirkulieren, von denen sich jeder der Anwesenden zwei Blätter nahm.
Für einen Moment war es still im Raum. Alle gingen die Liste durch. Dornach dachte bei sich, wie es den unglücklichen Geschöpfen ergangen sein mochte, weg von der Geborgenheit des Elternhauses.
Karins Räuspern holte sie in die Realität zurück. «Ich habe die Recherche vorerst auf Buben fokussiert, die in etwa dem Lebensalter entsprachen, das wir dem Skelett zurechnen. Es gibt drei Namen von Buben, die zwischen 2005 und 2008 vermisst gemeldet wurden. Zwei davon waren zum Zeitpunkt ihres Verschwindens acht Jahre alt, einer war neun. Schaut euch die gelb markierten Stellen an.»
«Mario Gunzinger, acht Jahre, aus Grossaffoltern, Kanton Bern; Jean-Marc Huber, neun Jahre, aus Frick im Aargau und Raphael Howald, ebenfalls acht Jahre, aus Solothurn», las Dornach laut vor.
Karin projizierte drei vergrösserte Fotoporträts von Knaben an die Wand: lächelnde Bubengesichter, die unbekümmerte Zuversicht ausstrahlten, sich den Herausforderungen des Lebens zu stellen. Das Schicksal hatte es anders gewollt, zumindest für einen von ihnen. Ein beklemmendes Gefühl breitete sich in Dornachs Brust aus. Es stellte sich immer dann ein, wenn er mit Opfern im Kindes- oder Jugendalter konfrontiert war. Gleichzeitig fühlte er Erleichterung, dass mit seiner Tochter Pia alles gut gegangen war, was seine erzieherische Verantwortung betraf. Als Vater würde er sich ohnehin zeitlebens Sorgen um sie machen, alleine schon wegen ihres Temperaments, das punkto Gelassenheit Gemeinsamkeiten mit einer Wagenladung Nitroglyzerin aufwies.
«Ich erinnere mich an den Fall Raphael Howald», meldete sich Jäggi zu Wort. «Es passierte im Sommer 2008. Du warst damals in den Staaten, Dominik. Mike, du weisst darüber Bescheid.»
Lüthi dachte kurz nach. «Stimmt. Das war im Juni, kurz vor den Sommerferien. Der Junge verschwand auf dem Schulweg zwischen dem Schulhaus Hermesbühl an der Bielstrasse und seinem Zuhause im Ziegelmattquartier. Wir setzten sofort alle Hebel in Bewegung, nachdem uns schliesslich die Eltern alarmiert hatten.»
«Warum schliesslich?», fragte Dornach.
«Sie hatten fast einen Tag mit der Vermisstenanzeige gewartet.»
«Aus welchem Grund?»
«Sie befürchteten eine Entführung. Sie meinten, Kidnapper verlangten üblicherweise, keine Polizei einzuschalten. Sie wollten das Leben ihres Sohnes nicht gefährden.»
So ein Unsinn, dachte Dornach, ohne es auszusprechen. Je eher man sie einschaltete, desto besser lagen die Chancen, die Übeltäter zu fassen und das Kind wohlauf den Eltern zurückzubringen. «Sind die Howalds wohlhabend?»
«René Howald ist ein hohes Tier bei einer französischen Bank an der Zürcher Bahnhofstrasse. Trotz der Finanzkrise kassiert er offenbar immer noch schöne Boni. Seine Frau Melanie besass bis vor Kurzem eine Premium-Modeboutique in Solothurn mit Filialen in Bern und Aarau. Aufgrund der aufkommenden Konkurrenz durch die Online-Versandhäuser hat sie das Geschäft aufgegeben und sich an einer Modellagentur beteiligt.»
«Nicht zwingend die Sorte Leute, bei denen am Ende des Geldes Monat übrig bleibt», bemerkte Maja mit Seitenblick zu Dornach.
Dieser überhörte die Anspielung auf seinen wohlhabenden Familienstammbaum, den Maja «altes Geld» nannte. «Trotzdem dürfte man erwarten, dass Howalds zur Sorte gehören, die es besser wissen sollten.»
«Wir mobilisierten alles», sagte Jäggi. «Suchmannschaften, Hundestaffel, landesweite Aufrufe, sogar im benachbarten Ausland. Leider zu spät, die Spuren waren bereits kalt.»
Casagrande schüttelte verständnislos den Kopf. «Mittlerweile sollte es durchgedrungen sein, dass die ersten achtundvierzig bis zweiundsiebzig Stunden in solchen Fällen entscheidend sind.»
Jäggi war noch nicht fertig. «Kurz nachdem der kleine Raphael verschwunden war, konnten wir den Täter verhaften. Bernhard Hauser hat die Tat gestanden und zugegeben, dass der Junge nicht mehr lebte. Er gab an, ihn mit einem Kissen erstickt zu haben. Hauser wurde zu fünfzehn Jahren verurteilt.»
«Hat er die Entführung von Mario Gunzinger und Jean-Marc Huber ebenfalls gestanden?», fragte Dornach.
«Nie. Er hat uns auch nicht verraten, wo er Raphael Howald hingebracht hatte.»
«Was war sein Motiv?»
«Er hat sich unklar darüber geäussert und gab lediglich an, eine Schwäche für den Knaben gehabt zu haben. Das psychologische Gutachten hat ihm eine diesbezügliche Neigung attestiert.»
«Wir müssen ihn noch mal dazu befragen», sagte Dornach.
Jäggi machte eine bedauernde Geste. «Tut mir leid, das geht nicht mehr.»
«Warum nicht?»
«Er ist vor zwei Jahren im Schachen gestorben– Bauchspeicheldrüsenkrebs. Mit Hausers Tod verliefen sich die Spuren der anderen vermissten Buben im Sand.»
«Wir sollten die Eltern dieser Kinder über den Skelettfund informieren», sagte Karin.
«Was willst du ihnen sagen?», fragte Dornach. «Dass wir ein Skelett gefunden haben und es ihr Sohn sein könnte? Was, wenn es sich anders herausstellt? Zuerst fügst du ihnen Schmerz zu, weil du den letzten Funken Hoffnung zerstörst, den sie haben. Dann kommt die Erlösung, weil sie endlich loslassen können. Wenn es falsch ist, haben wir die Trauer verschlimmert.»
«Entschuldigung, daran habe ich nicht gedacht.»
«Schon gut. Ich möchte die Eltern erst einbeziehen, wenn die Resultate der DNA-Analyse vorliegen. Bis dahin sollten wir in Betracht ziehen, dass es sich bei dem Skelett um jeden der drei Buben handeln könnte oder um jemanden, den wir gar nicht auf dem Radar haben. Bleibst du dran, Karin?»
«Dauert halt. Ich stehe mit den Recherchen erst am Anfang.»
«Man nannte ihn den ‹Bubenfresser›», warf Jäggi ein.
«Wen?»
«Hauser. Raphael, Mario und Jean-Marc waren wohl nicht seine einzigen Opfer. Zuvor gab es weitere Fälle von vermissten Buben im Bernbiet. Denen war jeweils ein Stück Muskelfleisch von den Beinen oder vom Bauch herausgeschnitten worden. Wir wissen nicht, warum. Der forensische Psychologe vermutete, dass er es verspeist hatte.»
«Gab es Hinweise darauf, dass er sich an den Buben sexuell vergangen hat?», fragte Dornach.
«Nein, das ist ihnen erspart geblieben. Die einzigen offensichtlichen Verletzungen waren die Wunden der Einschnitte.»
«Hat Hauser das zugegeben?», fragte Dornach.
«Ebenso wenig wie alles andere. Er gestand nur die Entführung und die Tötung des kleinen Raphael.»
«Steht zweifelsfrei fest, dass der Tod nicht länger als dreissig Jahre zurückliegt?», fragte Casagrande. «Ich will nicht den Apparat in Bewegung setzen, wenn die Verjährungsfrist abgelaufen ist. Ihr wisst ja–»
«Das liebe Budget», sagte Dornach seufzend. Er nickte Tschanz zu. «Die Frage geht an dich, Sebi.»
«Unter Vorbehalt einer abweichenden Schlussfolgerung des Kollegen von der Rechtsmedizin meine ich aufgrund meiner Erfahrung, dass dieser Fund lange nicht unter das Verjährungsstatut fällt. Tut mir leid, Angela.»
«Schon gut, ich bin die Letzte, die sich der Aufklärung eines Kindsmordes widersetzt. Ich will mir lediglich Hofmann vom Hals halten, wenn’s geht.» Sie warf einen Blick zur Wanduhr und stand auf. «Ich muss zu einer Verhandlung am Obergericht. Treffen wir uns später, Dominik?»
Dornach hob zustimmend die Hand. Er bat Lüthi und Maja, sich die Akten des Falles Raphael ein weiteres Mal gründlich vorzunehmen. «Ich weiss, es ist vergebene Liebesmüh, wenn es sich nicht um Raphaels Überreste handelt. Falls doch, gewinnen wir Zeit. Karin, du–»
«Ich weiss, was ich für den Rest des Tages zu tun habe.»
«Ich helfe unserer Kleinen», bot Gubler an. Er ignorierte Karins eisigen Blick.
«Das dürftest du dir langsam abgewöhnen», sagte Dornach zu Gubler, nachdem sie den Raum verlassen hatte. «Karin hat schon mehrfach bewiesen, dass sie kein Nesthäkchen ist.»
«Ist mir schon lange klar. Es reizt mich, sie zwischendurch ein wenig aus der Reserve zu locken.»
«Schon mal was von selbsterfüllender Prophezeiung gehört?»
Gubler blinzelte ihn fragend an. «Weiss nicht, was du meinst.»
«Ich meine, dass du aufpassen solltest, was du dir wünschst», sagte Dornach. «Sonst fängst du dir bei Karin bald mal ein blaues Auge ein.»
***
Pias Atem ging gleichmässig. Sie machte eine Wende und setzte mit kräftigen Crawlzügen zur letzten Länge an, um ihr Tagespensum von zweitausend Metern zu erfüllen. Körper und Geist arbeiteten im Einklang mit dem Rhythmus ihrer Schwimmzüge.
Seit die Saison in der Solothurner Badi eröffnet war, absolvierte sie jeden Tag und bei jedem Wetter ihre zwei Kilometer. Trotz der späten Heimkehr vergangene Nacht, in der sie knapp fünf Stunden geschlafen hatte, war sie kurz vor zehn ins grosse Schwimmbecken gehüpft. Laut ihrer besten Freundin Manu gehörte sie damit zu den unentwegten Hardcore-Schwimmfuzzis.
Die Sonne hatte die Wolken des nächtlichen Gewitters weitgehend vertrieben und die Temperaturen merklich ansteigen lassen. Seit Pia regelmässig schwamm, hatte sie sich selten körperlich und geistig so fit gefühlt wie an diesem Morgen. Sie überlegte, das öfter nach einer Party zu tun. Dass sie im Gegensatz zu Manu so gut wie keinen Alkohol getrunken hatte, trug zweifellos zu ihrer guten Form bei.
Durch die verzerrte Optik der Schwimmbrille sah sie Manu am Beckenrand sitzen. Sie hatte eine schwarze Sonnenbrille aufgesetzt, welche die dunklen Ringe unter ihren Augen verdecken sollte. In der Hand hielt sie ihr Handy, mit dem sie Pias Zeit stoppte. Am Vortag hatte Manu hoch und heilig geschworen, dass sie einige Längen schwimmen wollte. Angesichts des Exzesses der vergangenen Nacht blieb der Wunsch fromm. Pia und Manu waren seit ihrem ersten Schultag beste Freundinnen. Nach dem tragischen Tod von Manus Mutter vor etwas mehr als einem Jahr hatte Pias Vater sie in seinem Haus aufgenommen, das mehr als genug Platz bot. Manu hatte keinen Kontakt mehr zu ihrem Vater, nachdem sich die Eltern scheiden gelassen hatten. Er lebte und arbeitete in Ostasien.
Pia entstammte Dornachs ebenso stürmischer wie kurzlebiger Beziehung zu einer damaligen Walliser Medizinstudentin. Dr.Laure Zenklusen war Oberärztin im Kantonsspital von Sion. Pias Verhältnis zu ihr war bald zum Machtkampf zwischen einem ausgewachsenen und einem werdenden Alphaweibchen ausgeartet. Pia hatte sich stets mehr zu ihrem Vater hingezogen gefühlt als zur Mutter und von klein auf nie einen Hehl daraus gemacht, dass sie lieber bei ihm leben wollte. Schliesslich kamen Dornach und Laure überein, dass sie bei ihrem Vater in Solothurn wohnen sollte.
«Achtundfünfzig dreiundvierzig», rief Manu, sobald Pia den Beckenrand berührte. «Fast eine Minute schneller als vorgestern– neuer Rekord. Du kannst dich bald für die Olympiade anmelden.»
«Warten wir’s ab, bis ich unter fünfzig Minuten komme», sagte Pia heftig atmend. Sie schob die Schwimmbrille über die Stirn und zog die Nasenklammer ab, die sie am Ausschnitt ihres Schwimmanzuges befestigte. Schwungvoll stemmte sie sich aus dem Wasser.
«Ist was?» Sie sah Manus kritischen Blick, während sie sich mit dem bereitgelegten Handtuch abtrocknete.
«Du bist ganz schön dünn geworden.» Manu betrachtete Pias flachen Bauch und ihre muskulösen Hüften. «Hat Rafik keine blauen Flecken?»
«Bisher sind keine Klagen eingegangen.» Pia erwiderte den Blick ihrer Freundin. Manu trug einen knappen Bikini, über den sie ein tief ausgeschnittenes T-Shirt gestreift hatte. Der Saum endete eine Handbreit unter dem Oberteil. Die Bänder des Höschens betonten zwei neckische Hüftröllchen. «Ein bisschen mehr Bewegung würde auch dir nicht schaden, sonst bist du bald breiter als lang», gab Pia zurück.
Manu quittierte die Bemerkung mit einem Achselzucken. «Ich weiss nicht, was du meinst. Ich werde genug bewegt.» Sie sah an Pia vorbei. «Da drüben ist Nadal.»
Pia drehte sich um. Nadal kam auf sie zu. Sie trug einen hochgeschlossenen beinfreien Badeanzug. Ihr ebenholzfarbenes Haar fiel offen bis zu den Schultern. Äusserlich glich sie ihrem Bruder, Pias Freund, sie hatte die gleichen mandelförmigen Augen und geschwungenen Lippen.
Die Frauen begrüssten sich herzlich, bevor sie sich im Schatten der hohen Bäume hinsetzten.
«Hast du heute keinen Unterricht?», fragte Pia. Nadal war Primarlehrerin einer ersten Klasse im Schulhaus Hermesbühl.
«Ich habe Pause. Die Kiddies sind mit Konrad im Kinderbecken. Ich wollte nachsehen, was sie treiben. Kommt ihr mit?»
Die drei gingen zusammen hin. Pia war schon lange nicht mehr im ehemaligen Frauenbecken gewesen, das sich im östlichen Teil der alten Badeanlage befand. Ein turmähnlicher Aufbau trennte Männer- und Frauenbecken räumlich voneinander. Ein Mauerring mit Umkleidekabinen umrahmte beide Becken. Gleichzeitig bot er Schutz vor unbefugten Augen. Seines ursprünglichen Zweckes der Geschlechtertrennung enthoben, war der Aufbau heute Ausgangspunkt für eine Wasserrutschbahn, die in weiten Schlaufen im Becken des ehemaligen Frauenbades endete. Gleich dahinter lag das seichte Kinderbecken.
Die Kinderschar war zu hören, bevor sie ins Blickfeld kam. Eine Gruppe stand am Beckenrand. Sie sah einem Mann zu, der einen auf dem Rücken im Wasser liegenden Jungen stützte. Der Bub war sichtlich verängstigt. Er strampelte hektisch, derweil seine Kameraden sich vom Rand aus über ihn lustig machten.
«Was passiert denn dort?», fragte Pia.
«Das ist Jonas Scheurer», sagte Nadal. «Er ist wasserscheu. Bisher hat es nur Konrad geschafft, ihn ins Wasser zu kriegen. Jonas vertraut ihm. Mit mir wäre er nie ins Becken gegangen.» Sie tadelte die laut lachenden Kinder am Beckenrand, die sogleich verstummten. Dann winkte sie ihrem Kollegen zu. «Kommst du klar, Konrad?»
Konrad Tanner war sportlich, etwa Anfang vierzig, mit schütterem blonden Haar und einer Stahlbrille, die ihm ein nerdiges Aussehen verlieh, wie Pia still befand.
«Keine Sorge, alles im Griff, nicht wahr, Jonas?», sagte Tanner zu dem Kleinen, der sich mittlerweile im Wasser stabilisiert hatte. Es gelang ihm sogar, Nadal mit einer Hand zuzuwinken, ohne das Gleichgewicht zu verlieren.
«Wir sehen uns später in der Schule», rief Nadal Tanner zu.
Die drei Frauen gingen zurück Richtung Liegewiese an der Aare. Pia stupste Nadal mit dem Ellenbogen in die Seite. «Ist Konrad ein heimlicher Verehrer von dir?»
«Er ist nicht mein Verehrer, weder heimlich noch sonst wie», wiegelte Nadal ab. «Er ist hilfsbereit, das ist alles.»
«Definiere hilfsbereit», sagte Manu.
«Da ist nichts, wirklich», insistierte Nadal. «Konrad unterrichtet Chemie und Sport im Schulhaus Kollegium in der Altstadt. Er hat angeboten, in den Freistunden meinen Kiddies Schwimmunterricht zu geben. Da ist nicht mehr– jedenfalls jetzt nicht», fügte sie leicht verlegen hinzu.
«Wegen Gezim?», fragte Pia. «Stalkt er dich immer noch?»
«Gezim stalkt mich nicht. Es fällt ihm schwer, sich damit abzufinden, dass ich mit ihm Schluss gemacht habe.»
«Wenn mir jemand an jeder Ecke auflauert und mich zu jeder Tages- und Nachtzeit anruft, nenne ich das Stalken.»
«Typisch Balkan-Machos», sagte Manu und zu Pia: «Du solltest diesen Albaner mal abpassen und den Tarif durchgeben.»
«Solches Gehabe hängt nicht mit der Herkunft zusammen», antwortete Pia etwas ungehalten, «eher damit, dass die Herren der Schöpfung es nicht ausstehen können, wenn wir ihnen mit einem Laufpass buchstäblich auf den Schwanz treten. So was weckt bei denen unterschwellige Kastrationsängste.»
Manu kicherte. «Du kannst das immer so schön ausdrücken.»
Nadal war das Thema unangenehm. «Wo steckt Rafik eigentlich? Ich dachte, ich würde ihn hier treffen, wenn er sich sonst schon rarmacht.»
«In Olten, er lernt für seine letzten Prüfungen», sagte Pia. «In zwei Wochen muss er seine Masterarbeit präsentieren. Dann hat er es hinter sich. Wir sehen uns heute Abend.» Sie zeigte zu den Umkleidekabinen hinüber. «Ich gehe mich umziehen. Essen wir was?»
Manu liess einen lauten Seufzer der Erleichterung vernehmen. «Gott sei Dank, es muss essen, also lebt es. Ich habe schon befürchtet, ich hätte einen Roboter zur besten Freundin– Pizza oder Hamburger?»
«Ich dachte eher an einen Salatteller», sagte Pia. Nadal schloss sich ihr an.
«War ja klar, dass da ein Haken ist», brummte Manu. «Dann besorge ich mal mein Essen und euer Grünfutter. Nur damit es klar ist: Wenn ihr beiden denkt, ihr könnt euch bei mir bedienen– vergesst es einfach.»
Pia tauschte ihren Schwimmanzug gegen einen weissen, mit altrosa Blütenmuster bedruckten Bikini. Dazu schlang sie ein grosses Seidentuch um die Hüften. Sobald sie aus dem Kabinentrakt trat, hörte sie aus der Richtung des Restaurants lautes Frauengeschrei. Unter dem Gekeife glaubte sie, die Stimmen ihrer Freundinnen zu erkennen. Sie ging dem Lärm entgegen.
Insgesamt sechs Frauen hatten Manu und Nadal vor dem Aufgang zum Restaurant eingekreist. Anstelle von Badeanzügen trugen sie Abayas, lange schwarze Überkleider, die muslimische Frauen über ihrer Strassenbekleidung trugen. Ihre Köpfe waren mit Hidschabs, traditionellen islamischen Kopftüchern, bedeckt. Daneben standen ein paar Kleinkinder, die das Geschehen mit grossen Augen verfolgten. Eine der Frauen sprach akzentfrei Schweizerdeutsch.
Eine recht hilflose Bademeisterin versuchte zu schlichten. Die Schweizerin gestikulierte von allen am heftigsten. Sie war offenbar die Sprecherin der Gruppe.
«Kann ich helfen?», fragte Pia, sobald sich der Lärmpegel für einen Moment legte.
Die Frauen verstummten und starrten sie an. Es dauerte einige Sekunden, bis die Schweizerin das Wort ergriff. «Hure!»
Es war klar, dass sie damit Pia meinte.
«Wie bitte?»
«Du hast mich verstanden. Sieh dich an, wie du rumläufst. Wie eine Schlampe.»
Die Gefährtinnen begannen derweil erneut heftig, teils in Arabisch, auf Manu einzureden. Sie zeigten auf Manus knapp geschnittenen Bikini. Die paar Brocken, die Rafik Pia beigebracht hatte, reichten nicht aus, damit sie das Gesagte übersetzen konnte. Nadal hingegen verstand es genau. Sie gab den Frauen entsprechend Konter.
Pia sah an sich herunter. Die Natur hatte bei ihr nicht gegeizt, was die Ausstattung mit Attributen der weiblichen Anatomie anging. Das Seidentuch um ihre Hüfte sollte zum Ausdruck bringen, dass sie ihren Körper nicht über Gebühr präsentieren wollte. Sie war im Gegensatz zur voluptuösen Manu schmal. Dennoch war ihr Bikini nicht annähernd so knapp geschnitten wie derjenige ihrer Freundin. Sie wandte sich an die Schweizerin. «Erstens frage ich mich, mit welchem Recht Sie mich duzen. Zweitens verstehe ich nicht, worüber Sie sich aufregen. Wenn Sie sich umschauen, laufen alle hier mit einem Badeanzug oder einem Bikini herum, mit Ausnahme von Ihnen.»
«Die da», die Schweizerin zeigte herablassend auf Manu. «Die ist absichtlich nah an uns vorbeigegangen und hat uns verspottet.»
«Das stimmt nicht», rief Manu empört. «Die haben mich angemacht. Dabei habe ich nur den Kleinen zugelächelt.» Sie zeigte auf die Kinder, von denen eines zu weinen begann.
«Seht ihr», setzte die Schweizerin ihre Keiferei fort. «Ihr gottlosen Schlangen macht unseren Kindern Angst. Allah wird euch strafen.»
Der Chefbademeister kam dazu. Pia kannte ihn, seit sie mit fünf Jahren im Kinderbecken geplanscht hatte. Schon damals und später immer wieder hatte er sie zurechtweisen müssen, wenn sie mit ihren Spielkameraden über die Stränge geschlagen hatte. Er liess sich von seiner Kollegin das Problem erklären. Die Frauen setzten ihren Streit auf Arabisch mit Nadal fort.
Der Chefbademeister klatschte einige Male kräftig in die Hände, was alle zum Schweigen brachte. Er wandte sich an die Musliminnen. «Sie können sich aufregen, wie Sie wollen, meine Damen. Es liegt keine Regelwidrigkeit vor. Die Bekleidung der jungen Damen hier», er zeigte auf Pia und Manu, «ist absolut konform.»
Die Schweizerin wollte eine scharfe Entgegnung machen. Der Bademeister liess sie nicht zu Wort kommen. «Sie hingegen», sagte er an die Adresse der Musliminnen, «musste ich vor zwei Tagen schon einmal ermahnen, weil Sie mit Ihren Strassenkleidern ins Becken steigen wollten.»
«Das ist ein Skandal. Sie lassen zu, dass sich Frauen nackt präsentieren. Und wir, die Anständigen, werden verteufelt. Wir haben auch ein Recht darauf, zu baden.»
«Zweifellos, aber nicht in diesen Kleidern, zumindest nicht in diesem Schwimmbad.» Der Bademeister versuchte vergeblich, den Frauen die Problematik der Hygiene zu erklären.
Manu und Pia wollten sich in die Diskussion einmischen. Nadal bedeutete ihnen, mit ihr wegzugehen.
«Ich kenne diese Frauen», sagte sie, «auch die Schweizerin. Sie gehören zur Gemeinde der Oltner Moschee. Sie haben schon mal vergebens eine Petition eingereicht, die verlangte, dass die Stadt Olten in ihrer Badi einen abgetrennten Bereich für Musliminnen einrichten sollte. Jetzt lässt man sie dort nicht mehr rein, weil sie sich nicht an die Vorschriften gehalten haben.»
«Dafür terrorisieren diese Hyänen uns nun hier», rief Manu wütend. «Die sollen zurück in die Wüste und sich dort im Sand wälzen.» Sie wollte den Musliminnen den Stinkfinger zeigen.
«Hör auf, Manu!», sagte Pia. «Das gibt dir kein Recht, sie zu beleidigen.»
«Ist doch wahr.»
«Ganz unrecht hat sie nicht», sagte Nadal. «Ich begreife nicht, dass sie hier solche Ansprüche stellen, wenn zum Beispiel in Saudi-Arabien Kirchen und jegliche christlichen Symbole verboten sind.»
Kaum hatten sie die ersten Stufen zur Terrasse des Restaurants genommen, hörten sie eine Männerstimme rufen.
«Nadal!»
Nadal drehte den Kopf in die Richtung, aus der der Ruf kam.
«Gezim?»
Ein dunkelhaariger Mittzwanziger mit dem Hauch eines beginnenden Vollbartes kam gestikulierend auf sie zu.
Pia verdrehte die Augen. «Auch der noch.»
«Was willst du, Gezim?», fragte Nadal barsch. «Ich habe dir x-mal gesagt, du sollst mich in Ruhe lassen.»
«Wie läufst du herum?»
«Wie ich herumlaufe? Das siehst du ja.»
«Man kann deine Beine sehen.»
«Na und? Ich habe sie erst gestern Abend rasiert.»
«Du schamloses Weibsstück!» Gezim hätte Nadal in aller Öffentlichkeit geschlagen, wäre Pia nicht dazwischengegangen.
«Ein Schritt weiter, und es wird dir leidtun.»
Er ballte die Faust. «Halt dich da raus oder du wirst es bereuen.»
Pia fixierte ihn. «Glaub mir, Gezim, du bist der Erste, der hier etwas bereuen wird. Lass Nadal in Ruhe und verschwinde, bevor ich den Bademeister rufe. Er schaut schon in unsere Richtung.»
Der Bademeister kam tatsächlich auf sie zu. Gezim zeigte mit dem Finger auf Nadal. «Wir sind nicht fertig miteinander.» Er eilte davon.
«Schwachkopf», kommentierte Manu. «Der ist so blöd, dass es verboten gehört.»
«Ich verstehe nicht, was in ihn gefahren ist», sagte Nadal. «Früher war er lustig und liebenswert. Seit er ständig in dieser Moschee mit den Leuten von der Al-Hamdulillah herumhängt, hat er sich verändert.»
«Al-was?», fragte Manu.