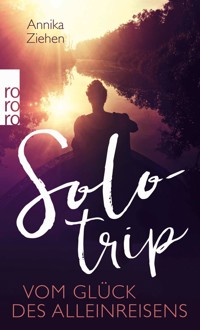
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Lebensstil
- Sprache: Deutsch
Der Solotrip – für die einen die beste Art des Reisens überhaupt, für andere ein Abenteuer, von dem sie schon lange träumen. Was ist das Besondere am Alleinreisen? Und gehört wirklich so viel Mut dazu, wie viele meinen? Annika Ziehen reist seit Jahren allein, und was sie zwischen Kapstadt und New York erlebt hat, inspiriert, es ihr sofort nachzutun. Dieses Buch ist eine Liebeserklärung an das Reisen. Eingebettet in zahlreiche Anekdoten von unterwegs, nennt Annika Ziehen tausend gute Gründe, die dafür sprechen, lieber allein die Koffer zu packen, als gar nicht zu reisen. Sie erzählt, warum der Solotrip gut fürs Selbstbewusstsein ist, weshalb man ohne Begleitung intensiver reist, was am Eat-Pray-Love-Mythos dran ist und woher das ganz große Freiheitsgefühl kommt. Und sie verrät, was man bei der Reiseplanung alles beachten sollte, warum du genauso gut mit Rollkoffer wie mit Rucksack reist, wie man auch allein unterwegs Momente mit anderen teilen kann und wie das Dinner for One – die Krönung des Alleinreisens – zum Vergnügen wird. Egal, ob Städtereise oder Strandurlaub, Bergbesteigung oder Inselhopping – Reisen kann man üben. Und wenn du weißt, wie, wird es dich richtig glücklich machen. Versprochen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 288
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Annika Ziehen
Solotrip
Vom Glück des Alleinreisens
Über dieses Buch
Der Solotrip – für die einen die beste Art des Reisens überhaupt, für andere ein Abenteuer, von dem sie schon lange träumen. Was ist das Besondere am Alleinreisen? Und gehört wirklich so viel Mut dazu, wie viele meinen? Annika Ziehen reist seit Jahren allein, und was sie zwischen Kapstadt und New York erlebt hat, inspiriert, es ihr sofort nachzutun.
Dieses Buch ist eine Liebeserklärung an das Reisen. Eingebettet in zahlreiche Anekdoten von unterwegs, nennt Annika Ziehen tausend gute Gründe, die dafür sprechen, lieber allein die Koffer zu packen, als gar nicht zu reisen. Sie erzählt, warum der Solotrip gut fürs Selbstbewusstsein ist, weshalb man ohne Begleitung intensiver reist, was am Eat-Pray-Love-Mythos dran ist und woher das ganz große Freiheitsgefühl kommt. Und sie verrät, was man bei der Reiseplanung alles beachten sollte, warum du genauso gut mit Rollkoffer wie mit Rucksack reist, wie man auch allein unterwegs Momente mit anderen teilen kann und wie das Dinner for One – die Krönung des Alleinreisens – zum Vergnügen wird.
Egal, ob Städtereise oder Strandurlaub, Bergbesteigung oder Inselhopping – Reisen kann man üben. Und wenn du weißt, wie, wird es dich richtig glücklich machen. Versprochen.
Vita
Annika Ziehen, geboren 1979 im hessischen Bad Hersfeld, wurde die Kleinstadt schnell zu eng, und so zog sie nach dem Abitur erst nach Hamburg und dann nach New York. Es folgten aufregende Jahre am Fashion Institute of Technology und in der New Yorker Modewelt. Um für Abwechslung und Sonne zu sorgen, ging sie mit 28 nach Kapstadt, wo sie als Fotoproducerin arbeitete. Von dort zog sie aus, um das Alleinreisen zu lernen, die Welt zu entdecken und Geschichten darüber zu schreiben. Auch wieder zurück in Hamburg kann sie damit nicht mehr aufhören. Ihre Texte erscheinen neben ihrem eigenen Blog u.a. auf dem internationalen Reiseblog «Travelletes» sowie bei der «Huffington Post».
Impressum
Veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Hamburg, Juni 2017
Covergestaltung ZERO Media GmbH, München
Coverabbildung Umschlagabbildung: privat
ISBN 978-3-644-40113-6
Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation
Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
www.rowohlt.de
Für meine Eltern, die mich sanft, aber bestimmt aus dem Nest gestoßen haben; meine Zuckerwatte-Freundin, die mich inspiriert hat, meine «lustigen» Geschichten aufzuschreiben; und für Alex, der mich liebevoll the girl who travels nennt.
Vorwort
Ich stehe an der Kreuzung von Lafayette und Broadway. Die Ampel ist rot, und es regnet. Noch nicht in Strömen, aber genug, um meine Sommergarderobe in ihre Schranken zu weisen, es ist halt erst Mai. Geld für die Subway habe ich keins mehr, meine letzten Dollarscheine sind für das Taxi zum Flughafen reserviert. Mein üppiges Frühstück habe ich mit der «Notfall»-Kreditkarte meines Vaters bezahlt und mir die Reste meines Obstsalats als Doggy Bag einpacken lassen. Besser ein kleines Mittagessen als gar keins.
Alles tropft, und während ich auf das Grün der Ampel warte, fällt mein Blick auf die braune Papiertüte, das Doggy Bag, das inzwischen ebenso trieft wie ich. «Mein Tütchen ist ja auch schon ganz nass», schießt es mir durch den Kopf, und ich starre auf das durchweichte, matschige Braun. Woher diese genaue Formulierung und das plötzliche Mitleid für das Tütchen kommen, weiß ich nicht. Aber wieso ich mich an diesen Satz auch heute noch erinnere, das weiß ich. Die Szene ist auch im Nachhinein noch grau und nass, aber sie ist mir trotzdem eine meiner liebsten Erinnerungen. Denn auch nass im Regen stehend wusste ich damals schon, dass sich so die ganz große Freiheit anfühlt.
«When setting out on a journey, do not seek advice from those who have never left home.»
Rumi
Mit zwanzig habe ich meine erste Soloreise unternommen. So spät erst? In dem Alter sind einige schon allein über ganze Kontinente gejettet. Ich nicht, denn von dem oft als heiliger Gral des Reisens gepriesenen Alleinreisen hatte ich bis dahin noch nie gehört. Mein Leben wie die Reisen, die ich unternahm, waren ganz normal. Mit dreizehn schickten mich meine Eltern nach Malta, wo ich mit meiner besten Freundin an der Verbesserung meiner Englischnote arbeiten sollte. Diese Arbeit haben wir auch sehr ernst genommen. So ernst man das halt nehmen kann, wenn die Unterrichtsstunden neben dem Pool stattfinden und man ein hormondurchströmtes Teenagermädchen in einem Haus voller hormondurchströmter Teenagerjungen ist. Wir schafften es beide, uns in die einzigen zwei nur Italienisch sprechenden Jungs auf der Insel zu verlieben.
Der hormondurchströmte Teenagerjunge musste da bleiben, und ich kehrte mit einem ziemlich gebrochenen Herzen zurück. Wie ich das mit dem Englischsprechen und Notenverbessern hinbekommen habe, weiß ich eigentlich nicht. Aber im Nachhinein hat sich das Ganze als sehr nützlich erwiesen.
Diese Reise war etwas Besonderes, denn ansonsten fuhr ich dreimal im Jahr mit meinen Eltern in unser Haus an der holländischen Nordsee. Dort war es mein Liebstes, stundenlang allein am Strand spazieren zu gehen. Hätte ich schon als Kind eine Kontaktanzeige aufgeben wollen, wäre das Klischee «liebt lange Spaziergänge am Strand» zutreffend gewesen. Nur die Tatsache, dass das Alleinsein ein essenzieller Bestandteil dieser Spaziergänge war, die hätte ich verschwiegen. Ich wusste schon damals, dass allein sein zu wollen irgendwie als komisch vom Rest der Welt angesehen wird. Dass es für mich der ausschlaggebende Grund werden würde, zur Alleinreisenden zu mutieren, ahnte ich damals noch nicht.
Ich wusste nur, dass allein am Strand in die unendliche Weite zu laufen, der beste Teil jeder Reise nach Holland war. Einen Schritt vor den nächsten, Wind im Gesicht, Wasser und klebriger Sand an den Füßen, der irgendwann auch seinen Weg auf und in meine Hosenbeine fand – mehr brauchte ich damals nicht, um glücklich zu sein. Kind sein war herrlich einfach, und vielleicht ist es die Erinnerung an diese Unkompliziertheit, die mich auch heute noch so am Alleinreisen reizt.
Dann war ich auf einmal mehr oder weniger erwachsen, und das wahre Leben sollte losgehen.
Nach dem Abitur landete ich erst mal in Hamburg, und hier war ich glücklich. Es war eine Zeit, als ich Erwachsensein noch toll fand. Hamburg war meine Stadt der unbegrenzten Möglichkeiten, der durchtanzten Nächte, der Gespräche von Sonnenuntergang bis Sonnenaufgang, der besten Dates mit den falschesten Männern und des trügerisch-schönen Gefühls, dass ich zwanzig und damit unbesiegbar war. Wer braucht einsame Strandspaziergänge, wenn einem vermeintlich die ganze Welt zu Füßen liegt?
Das Hoch hielt ein Jahr, dann spürte ich, wie leise eine Sehnsucht anklopfte. Eine Sehnsucht, die ich damals noch nicht als solche erkannte, die mich aber bis heute nicht wieder losgelassen hat. Eine Sehnsucht nach anders, nach mehr, nach weg. Ich konnte nur nachgeben und begab mich auf die Suche nach dem Anders, dem Mehr, dem Weg. Hamburg war keine Welt, die mir zu Füßen lag, Hamburg war eben doch nur eine Perle. Ich wollte Ozeane entdecken.
Das Ziel war schnell gefunden – ein Studium in New York sollte der nächste Schritt sein. Bevor es losging, waren aber noch ein paar Hürden zu überwinden, auch mir wurde das Alleinreisen nicht in den Schoß gelegt. Mein Vater stand meinem Sologlück in weiter Ferne fest und breit im Weg. Seine Kleene in New York? Das passte ihm so gar nicht, auch wenn es zunächst einmal nur eine Woche sein sollte, um mir das College und die Stadt anzusehen. Nur eine Woche in New York, um mal echte, große Weite-Welt-Luft zu schnuppern. If you can make it there … Mein Vater, der mir eigentlich mein Reiselustig-Gen vererbt hat, fand diesen Schritt einfach zu groß. Sein Kind allein in so einer riesigen, gefährlichen Stadt?! Meine Mutter sollte mich doch wenigstens begleiten. Aber dazu hatte die, ohne Reiselustig-Gen geboren, so gar keine Lust. Mein Vater selbst wollte auch nicht mit, und so stand mein Plan kurz vorm Scheitern. Ohne sein Einverständnis wollte ich nicht wirklich fahren, und ohne seine Kreditkarte konnte ich es auch nicht. In New York kann man ohne Kreditkarte noch nicht mal ein Hostelbett buchen. Genug Mumm, um einfach zu fliegen und mich mit Bargeld durchzuschlagen, hatte ich nicht. Allein zu reisen war mir schon genug Herausforderung, ich wollte es mir nicht unnötig schwer machen. Tage des Zweifelns, des Planungsstillstandes und vieler Tränen folgten. Dann lenkte mein Vater ein und besorgte mir eine Kreditkarte zu seinem Konto. Das Hotel musste ich bis auf den letzten Cent zurückbezahlen, seinen Segen bekam ich gratis dazu.
In New York angekommen, wohnte ich im, wie mir schien, schlimmsten Hotel der Stadt. Und ich hätte es gegen keinen Palast tauschen wollen! Meine kleine Welt war in diesem Kämmerchen auf einmal schlagartig größer geworden. Ich war eine Reisende, und das Alleinsein fühlte sich so weit und großartig an wie damals beim Strandspaziergang.
«I’m restless. Things are calling me away. My hair is being pulled by the stars again.»
Anaïs Nin
Einer Woche in New York folgten insgesamt sechs fast schlaflose Jahre. Während meiner New Yorker Zeit bin ich nicht viel gereist. New York war meine Welt, in der ich alle anderen Welten entdecken konnte. Was hatte der Rest der Welt schon, was New York nicht hatte? Nichts Erwähnenswertes, zumindest nicht für mich. Ich wurde schneller zu einem New York liebenden Snob, als die Mäuse durch meine erste Wohnung im East Village flitzen konnten.
Eigentlich hätte ich es kommen sehen sollen, dass mir auch New York eines Tages nicht mehr genug sein würde. Das Reiselustig-Gen hatte zwar lange geschlummert, konnte aber auf Dauer nicht stillstehen.
Ich sah es nicht kommen, weshalb es mich besonders heftig traf, als es dann an einem warmen Abend in Brooklyn passierte. Ich saß rauchend auf meinem kleinen Balkon, und ein noch wärmerer Wind wehte mir ins Gesicht. Ein Wind, wie er im Film Chocolat beschrieben wird. Ein Wind, der lockend in die Ferne ruft und eigentlich unwiderstehlich ist. Ein Wind, den man am besten ignoriert, denn wie bescheuert kann man sein, eine gute Karriere, tolle Freunde und eine bezahlbare Wohnung mit hohen Decken in Williamsburg aufgeben zu wollen? Und das nur, um einem Wind zu folgen? Ich war nicht bescheuert und steckte mir stattdessen eine weitere Zigarette an und ignorierte den Wind.
Die Tatsache, dass ich ein paar Monate später vier Wochen lang mehr oder weniger auf der Couch verbrachte und nichts tat, außer Oprah zu gucken, war schon schwerer zu ignorieren. Ich merkte, dass ich kurz vor einer Depression stand. Es war November, und jegliche warmen Winde waren weg, aber die Gedanken, die mir dieser eine eingeflößt hatte, konnte ich nicht mehr ignorieren. Zum Glück kam mir dann, wie so vielen anderen Menschen auch, Oprah zur Hilfe.
Südafrika. Da war es. Erst auf dem Bildschirm, dann in meinem Kopf. Ob es um Geparden oder eine Schule für unterprivilegierte Kinder ging, weiß ich nicht mehr. Mir war das auch egal, denn alles, was ich sah, war ein Himmel, der blauer als blau war. Wie damals, als ich mit sechzehn zum ersten Mal in Kapstadt bei meinen Verwandten gewesen war. Da musste ich wieder hin – unter diesem Himmel, der blauer als blau war, wollte ich leben.
Am nächsten Tag verließ ich die Couch und machte mich auf den Weg ins Internetcafé. Wie das wohl ging mit einem Visum für Südafrika zum Arbeiten und so? Während ich eifrig googelte, rief meine Mutter an. Sie hätte da ein bisschen über mich nachgedacht, wie Mütter das so tun, und hatte eine Idee. Warum ich denn nicht einfach mal für ein paar Monate nach Kapstadt gehen würde? Nur so, um mich umzugucken, denn ich war doch schon einmal da gewesen und hatte es sehr gemocht, oder? Der Wind hatte sich in einen großen Zufall verwandelt, und Oprah und meine Mutter hatten sich verbrüdert. Alle im Publikum bei Oprah bekamen einen Mixer, ich kriegte einen Schubs vom Sofa und ein Touristenvisum für drei Monate Südafrika obendrauf.
Ein halbes Jahr später erwartete mich meine Cousine Thekla am Flughafen von Kapstadt. Zwölf Jahre waren seit unserem letzten Treffen vergangen, aber trotzdem erkannten wir uns ohne Namensschild. Es fühlte sich an, wie nach Hause zu kommen.
Auch wenn das erst mal wie ein Paradox klingt, wurde mit diesem Nach-Hause-Kommen meine Reiselust erst so richtig geweckt. Zuerst lernte ich in Lesotho, auf der linken Straßenseite Auto zu fahren, nur um mich dann so richtig gut in und um Kapstadt verfahren zu können. Dabei entdeckte ich mehr oder weniger freiwillig die ganze Stadt. Dazu kamen Wochenenden in Stellenbosch, Montague, Knysna und Johannesburg und viel Faul-in-der-Sonne-Liegen auf den Seychellen. Hier schnorchelte ich auch zum ersten Mal. Es war eine graubewölkte Erfahrung, die mich trotzdem schon ahnen ließ, dass ich das mit dem Ozeane-Entdecken irgendwann wörtlich nehmen würde.
Auf La Réunion lief ich über nur fast erkaltete Lavaströme, trank zu viel Punch à la Maison und lernte, auch über unlustige Vulkanwitze zu lachen. In Sambia pflanzte ich Bäume und kuschelte mit einer Katze im Dunkeln an den Viktoriafällen. Das schrecklichste Silvester meines Lebens erlebte ich in Namibia und auch den besten Morgen danach, mit Krapfen im Mund und einem Gecko am Ohr.
Und dann, dann habe ich meine große Liebe getroffen. Marokko. In Marokko habe ich aufgehört, Länder zu zählen, und angefangen zu reisen. Länder sind unwichtig und genauso irrelevant wie Stempel im Pass. Viele sammeln sie und haben trotzdem nichts erlebt. Ich zähle nicht, ich mag mich lieber verlaufen und lerne gerne neue Wörter, die mir einen Knoten in die Zunge binden. Ich finde, Sonnenuntergänge sind eigentlich nie überbewertet, und das nervige Gebimmel von einer 7-Eleven-Tür ist ganz toll. Besonders die Tatsache, dass es den 7-Elevens auf der ganzen Welt eigen ist. Ich streichele überall kleine, struppige Katzen und füttere sie auch in richtig feinen Restaurants unter dem Tisch. Ich glaube an keinen Gott, aber Kirchenglocken, der Ruf zum Gebet und der Geruch von Räucherstäbchen erfüllen mich mit Dankbarkeit. Das Anders, das Mehr, das Weg ist für mich Alltag, Therapie und Teil von mir geworden.
Ich habe keine Bucket List mit Orten, die ich noch bereisen will. Nach meinem ersten Marokkoaufenthalt habe ich gemerkt, dass mir die Vorstellung, Marokko jetzt von einer imaginären Liste streichen zu sollen, das Herz brechen würde. Davon abgesehen, dass man eigentlich ein Land nie komplett kennen kann, wollte ich einfach immer und immer wieder hin, um mich mit jedem Mal ein bisschen mehr zu Hause zu fühlen.
Ich will nicht mit den Ländern prahlen, in denen ich schon war, oder von meinen Reiseplänen für das nächste Jahr schwärmen. Reisen ist unabhängig davon, wo man hinfährt. Reisen ist kein Ziel an sich, sondern eine Aktivität.
Als ich mit dem Schreiben anfing, hatte ich einen Blog, auf dem ich mehr oder weniger amüsant über Männer, Pasta und den Wunsch, eine Babygiraffe zu besitzen, erzählte. Dass die Leserschaft überwiegend aus wohlmeinenden Freunden bestand, die sich so auf meine Kosten über die jeweilige Affäre amüsierten, wundert mich im Nachhinein nicht. Aber während dieser Blog schnell in den Tiefen des Internets versank, fing ich irgendwann an, über meine Reisen zu schreiben. Anaïs Nin sagte: «We write to taste life twice.» Das trifft es. Ich musste ja die Zeit zwischen dem Reisen füllen, und durch das Schreiben erlebte ich irgendwie alles noch mal. Und ich reiste intensiver, wenn ich unterwegs war. Schließlich würde ich ja über das Erlebte schreiben wollen, also musste ich auch was erleben. Keiner mag es, wenn Blogger nur Fotos von ihren Füßen am Strand posten.
Auf dem Papier passt meine Art des Reisens wohl gut in die Kategorien Frauen- und Alleinreisen. Ich bin eine Frau und reise, oft auch allein, deswegen schreibe ich dieses Buch. Aber ich hasse es. Nicht das Schreiben, sondern solche Schubladen. Abenteuerreisen, Gruppenreisen, Familienreisen, Alienreisen. Kann ich denn nicht einfach nur mein kleines, reisendes Ich sein? Denn genau deswegen möchte ich übers Reisen schreiben. Weil ich gerne und viel reise und weil ich glaube, dass ich das gut kann. Wenn es Noten fürs Reisen gäbe, dann hätte ich bestimmt eine 2 plus. Im Tolle-Restaurants-Finden und Mir-nicht-den-Magen-Verderben auch eine 1. Im Kartenlesen wäre es wahrscheinlich eine 3, aber trotzdem, im Großen und Ganzen krieg ich das mit dem Reisen ganz gut hin. Gut genug, um darüber ein bisschen zu schreiben. Aber ja, wenn man so will, hatte ich irgendwann als Fachgebiet das Alleinreisen. Leistungskurs sozusagen. Gewählt habe ich das nicht, irgendwie hat es mich gefunden. Ich langweile mich selten mit mir selbst, fürchten tue ich mich auch nicht. Meistens nerve ich mich nicht und kann auch längere Zeit mit mir allein aushalten. Und wer es toll findet, allein in New York im Regen an einer Kreuzung zu stehen, der ist wohl zum Alleinreisen prädestiniert.
Und du? Du scheinst dich ja auch für das Alleinreisen zu interessieren, sonst wären wir jetzt nicht hier. Vielleicht warst du sogar schon allein unterwegs und hast Blut geleckt, vielleicht zögerst du aber auch noch. Manchmal nützen schlaue Slogans wie «Just do it!» eben einfach nichts. Darum schreibe ich dieses Buch. Um dich zu inspirieren, dir ganz praktische Tipps zu geben und dir zu den vielen vermeintlich guten Gründen, die dich noch davon abhalten, allein die Koffer zu packen, noch viel bessere Gegenargumente zu geben. Denn eins verspreche ich dir: Im Regen allein in New York zu stehen, kann so richtig glücklich machen. Und Alleinreisen sowieso.
Warum Alleinreisen so glücklich macht
«Don’t be scared to walk alone. Don’t be scared to like it.»
John Mayer
Das Glück des Alleinreisens – das hört sich für viele erst mal wie ein unüberwindbarer Gegensatz an. Dass das manchmal nötig ist oder letztendlich gut tut, okay, aber glücklich machen? Alleinsein hat in unserer Gesellschaft immer irgendwie einen negativen Beiklang. So, als ob etwas fehlt, als ob man ohne Partner, Freunde, Familie nicht vollständig ist. «Zusammen ist man weniger allein», «Geteiltes Leid ist halbes Leid», «Jeder Topf findet seinen Deckel». Diese Weisheiten kennen wir alle, und nicht selten machen wir sie uns mehr oder weniger freiwillig zum Lebensmotto. Egal, ob der Druck von außen kommt oder von uns selbst, für viele ist er ständig da – bist du allein, machst du was falsch; dein Leben ist nicht komplett, wenn du es solo beschreitest. Diese Gedanken nerven gewaltig, mehr als das Alleinsein selbst – vor allem, wenn es selbst gewählt ist.
Mit dem Alleinreisen verhält es sich ähnlich: Oft sind es eher die äußeren Umstände als die inneren, die einen zurückhalten. Das geht vielen so – von Solo-Veteranen bis zu denen, die zum ersten Mal allein ins Flugzeug steigen. Doch trotz aller Steine, die andere oder wir selbst uns in den Weg legen, wage ich zu behaupten: Nichts macht glücklicher als das Alleinreisen.
So, jetzt ist es raus. Wie jetzt, fragst du, nichts soll glücklicher machen als allein zu reisen? Jawohl! Oder zumindest sehr wenig. Ich behaupte, dass der Glücksfaktor vom Alleinreisen locker mit Hundebabys, ersten Küssen, Champagner und Pikachus-Fangen mithalten kann. Oder was auch immer dein Äquivalent zu Hundebabys und Pikachus ist.
So ganz überzeugt bist du noch nicht? Kein Problem, dafür bin ich ja da. Ich werde dir die besten Gründe nennen, warum du dich auf einen Solotrip begeben solltest, und dir zeigen, wie du selbst herausfindest, warum das Alleinreisen so verdammt glücklich macht.
Was will ich eigentlich?
You can’t always get what you want – das ist kein neues Dilemma. Geld, Zeit, Ideen, Mut, gute Geister, irgendwas scheint immer zu fehlen, um uns das zu bescheren, was wir doch so gerne hätten. Das große Glück, das käme dann schon gratis mit dazu, wenn ich reicher, schöner, schlauer wäre. So reden wir es uns zumindest ein – und träumen weiter. Oft kommen wir gar nicht dazu, uns näher mit dem Was zu beschäftigen, da das Wie doch immer irgendwie im Weg steht.
Ich glaube, dass die meisten Menschen gar nicht richtig wissen, was sie wollen. Wir träumen zwar alle von einer guten Fee und drei Wünschen, die wir frei haben, aber wenn dann eine käme, müssten die meisten erst mal ganz schön überlegen. Angeblich bekommen die, die immer Wünsche parat haben, sie auch ohne gute Fee erfüllt.
Alleinreisen bringt einen dazu, Wünsche zu formulieren. Sich mit der Frage zu beschäftigen: Was will ich eigentlich? Frei von den Vorstellungen anderer und von dem, was wir gelernt haben, wollen zu sollen. Wobei – eigentlich lernen wir von klein auf, dass wir sowieso nichts zu wollen haben, nichts zu fordern. Wir können etwas mögen, leise und artig um etwas bitten, aber wollen, das hat eine Frechheit an sich, die sich nicht gehört. Wenn meine Mutter heute noch davon spricht, dass sie mein starker Wille als Kind regelmäßig zur Verzweiflung getrieben hat, dann meint sie das nicht als Kompliment. Inzwischen denke ich allerdings, dass eben dieser starke Wille mich dahin gebracht hat, wo ich heute bin. Denn wo ein Wille ist, ist auch ein Weg.
Kein Buch hat sich mehr mit der Frage, wie man eigentlich herausfindet, was man will, und dem Thema Reisen beschäftigt als der moderne Klassiker Eat Pray Love von Elizabeth Gilbert. Darin erzählt die Autorin, wie sie nach einer gescheiterten Ehe die Reise ihres Lebens antritt und dabei sich selbst und ihr neues Glück findet. Es geht darum, Konventionen über Bord zu werfen, wenn sie einem nicht mehr dienlich sind, auch wenn es schwerfällt. In sich zu gehen und ganz genau auf das eigene Bauchgefühl zu hören: Was will ich? Diesem Was folgen, auch wenn es keiner versteht. Und der Erkenntnis, dass das eben nur allein geht. Sobald man mit anderen reist, ist immer irgendwann ein Kompromiss gefragt. Beim Alleinreisen muss man lernen, mit sich selbst kompromisslos Kompromisse einzugehen.
Das ist gar nicht so einfach, wie man denkt. Auch mir fällt das nach vielen Jahren des Alleinreisens noch oft schwer. Zu unterscheiden, ob ich etwas will oder ob ich glaube, etwas zu wollen. Das ist nicht nur eine Frage, die einem im täglichen Leben begegnet, sondern auch beim Reisen, eigentlich schon bei der Reiseplanung. Es gibt ja so Reiseziele, von denen es heißt, dass man sie unbedingt gesehen haben muss. Machu Picchu zum Sonnenaufgang, Kilimandscharo besser zum Sonnenuntergang. Sterben kann man erst, wenn man Paris gesehen hat; und wenn die erste Soloreise nicht nach Thailand geht, hat man sowieso im Leben etwas falsch gemacht.
Nein, ganz so einfach ist es nicht, herauszufinden, wie das so geht mit dem Wollen. Da kann man ganz schön viel falsch machen, das ist nichts für Leichtgewichte.
Gerade sitze ich in einem kleinen Airbnb-Bungalow in Ubud auf Bali und bin eigentlich ganz im Reinen mit mir. Ich will nirgendwo hin, nicht nach draußen und auch nicht an den Strand. Zum Glück, denn der nächste Strand ist circa eine Stunde mit dem Auto entfernt – und das auch nur, wenn gerade kein Verkehr herrscht, was auf Bali eigentlich nie der Fall ist. Und dennoch schleicht sich immer wieder die Frage in meinen Hinterkopf, ob ich nicht etwas anderes wollen sollte. Ich bin zum ersten Mal auf Bali und zum ersten Mal in Ubud. Müsste ich nicht über Reisfelder wandern, Tempel besichtigen und im Monkey Forest mit kleinen Äffchen spielen wollen? Was ist nur los mit mir? Äffchen sind doch toll! Und wie soll ich denn nur meinen persönlichen Filipe (das ist die heiße Urlaubsliebe in Eat Pray Love) kennenlernen, wenn ich hier allein im Bungalow hocke?
Mir egal! Ich will hier sitzen und den viel zu lauten Fröschen lauschen, den Nachbarn und leider auch den vielen Mopeds, die vorbeifahren. Und wahrscheinlich werde ich heute Abend nur kurz über die Straße huschen, um im selben Warung, in dem ich schon Mittag gegessen habe, wieder das Gleiche zu bestellen. Weil es mir schmeckt und weil ich das heute so will.
Auch wenn dieses Abendprogramm unspektakulär erscheinen mag, ist es für mich berauschend. Ich mache etwas nur für mich, und das gibt mir zwar keinen Adrenalinkick, aber ein sehr wohliges Gefühl im Bauch. Ich fühle mich angekommen. Ankommen ist nicht nur eine Aktivität, sondern auch ein Zustand. Der ist unabhängig vom Ort, kann in den seltsamsten Momenten eintreten – meistens dann, wenn man es am wenigsten erwartet. Das ist ein Moment, in dem ich weiß, dass ich meinem Herzen gefolgt bin, nachdem ich mich gefragt habe, was will ich, und mir selbst diesen Wunsch erfüllt habe. Vielleicht ist das für einige der Sonnenaufgang über Machu Picchu. Für andere bedeutet es, sich ein blaues Tütchen bei Tiffany’s zu kaufen und sich wie Audrey Hepburn zu fühlen. Und für mich? Nun, heute bedeutet es, in meinem Zuhause für die nächsten vier Tage zu sitzen und mich von den Fröschen nerven zu lassen.
Die Erkenntnis, wie du reisen willst und was du unterwegs machen möchtest, ist auch eine gute Übung fürs Nachhausekommen. Lebst du dein Leben so, wie du es dir schon immer gewünscht hast? Gibt es Dinge, die du aufräumen, anders machen willst? Wenn man einmal anfängt, den eigenen Wünschen, dem Was will ich eigentlich? nachzugehen, dann fällt es schwer, wieder damit aufzuhören. Und das ist verdammt gut so.
Date mit mir
«Travel far enough and you will meet yourself.»
David Mitchell
Meine Mutter hat früh das Motto in mir geprägt, dass man sich überall hin selbst mitnimmt. Das war für mich immer eine gute Ermahnung, dass man zwar vor vielem, aber nicht vor sich selbst weglaufen kann. Weglaufen ist kein guter Grund zum Reisen. Wenn du dich zu Hause nicht magst, dich zu dünn oder dick, zu dies oder jenes findest, dann wird sich das unterwegs nicht ändern. Auch die einfachsten Hotels haben heute einen Spiegel und eine Waage, und oft werden uns unsere vermeintlichen Unarten in einem neuen Umfeld noch stärker bewusst.
Du kannst einiges an Problemen, nörgelnden Ehemännern, gescheiterten Karrieren und verregneten Sommern zurücklassen, dich selbst hast du leider immer im Gepäck. Aber wer bist du eigentlich? Oft haben wir das vergessen, es geht halt schnell mal im Alltag und einem verregneten Sommer unter.
Meiner Meinung nach gibt es nichts Besseres, als sich aus seiner gewohnten Umgebung zu bewegen, aus der eigenen Komfortzone zu treten, um das rauszufinden. Wer bin ich? Auf meinen letzten Reisen habe ich gelernt, dass ich um einiges mutiger bin, als ich dachte, und fast alles zumindest einmal probiere. Das kann ein Spinnenbein oder Gleitschirmfliegen sein. Oft einmal und nie wieder (das galt für das Spinnenbein!), aber ich probiere es. Auch wenn ich Tierdokumentarfilme doof finde, gibt es nichts Faszinierenderes für mich, als Tiere in der Wildnis zu sehen. Sobald ich von Affen, Löwen oder Fischen umgeben bin, bin ich froh. Ich brauche den Geruch von feuchter Seeluft, der Meeresnähe verspricht, um richtig glücklich zu sein. Außerdem glaube ich, dass ich woanders ein besserer Mensch bin. Warum das so ist, weiß ich nicht. Vielleicht sinkt mein Anspruch an mich selbst und ich höre auf, selbst mein schlimmster Feind zu sein. Oder ich vergesse die Zeit und lache mehr als in Deutschland, bin neugieriger und offener für anderes. Was auch immer es ist, ich mag es. Ich mag mich auf Reisen oder zumindest diese reisende Version von mir.
Das sind alles keine weltbewegenden Erkenntnisse, aber sie haben mir trotzdem geholfen, mich ein bisschen besser kennenzulernen. Erst allein auf Reisen habe ich erkannt, dass ich stärker bin und mehr kann, als ich dachte. Das hilft mir, nicht nur die nächste Reise zu gestalten, sondern auch meinen Alltag. Dadurch habe ich erkannt, dass ich Reisen gerne zum Alltag machen möchte, ein Ziel, auf das ich jetzt mehr denn je aktiv hinarbeite. Ich fühle mich in der Fremde, in der Ferne zu Hause – etwas, das ich nie realisiert hätte, hätte ich mein Zuhause nicht verlassen.
Herauszufinden, wer man eigentlich ist und was man will, das ist in vertrauter Umgebung oft schwierig. Wir lernen, zu funktionieren und nicht zu hinterfragen, so geht das mit dem Alltag meistens besser. Wenn man aber aufgibt, was einen stetig umgibt, schärft das nicht nur den Blick auf die neue Umgebung, sondern auch auf einen selbst. Auch wenn das erstmal kontra-intuitiv klingt. Geborgenheit und Vertrautheit ist auch immer etwas einschränkend, und nicht selten findet man sich erst, wenn man all das abgelegt hat. Wenn man verloren in der Wildnis, in der Ferne, in der Stille oder in nie gekanntem Lärm, umgeben von fremder Sprache, Gerüchen und Menschen steht, dann sieht man sich auf einmal ganz klar.
Wer bin ich und was mag ich gerne? Möchtest du umgeben von vielen Menschen in einem Hostel schlafen oder vielleicht doch lieber die Stille auf einem Bauernhof auf dem Land genießen? Willst du möglichst viel sehen oder den neuen Ort einfach langsam in dir aufsaugen und die Seele baumeln lassen? Das und so viel mehr gilt es jetzt und nur im Einklang mit dir selber zu entscheiden. Das sind die magischen Momente, die auf Reisen passieren, wenn du merkst, wer du bist und dass du, egal, wo du hingehst, nie allein sein wirst. Im Guten wie im Schlechten hast du dich immer dabei. Schön ist, wenn du weißt, auf wen du dich da einlässt.
Wachsen und erwachsen werden
«I am not the same having seen the moon shine on the other side of the world.»
Mary Anne Radmacher
Reisen bildet, das ist nichts Neues. Das ist einer der Gründe, warum sich jährlich Horden von Abiturienten und Hochschulabsolventen auf große Reise begeben und unterwegs auf vermeintlich Erwachsene treffen, die entweder ein Sabbatjahr eingelegt haben oder ihrer Midlife-Crisis erlegen sind. Es ist egal, in welchem Alter man sich aufmacht, Reisen macht erwachsen und lässt uns wachsen. Auch die, für die Reisen und Urlaub eins sind und die lieber faul auf der Liege am Strand des Club Med Sonne tanken. Es gibt immer etwas zu sehen, zu lernen und zu entdecken. Ich möchte zumindest glauben, dass ein bisschen anders und neu besser ist als gar nichts.
Für alle kann Reisen also Herausforderung und Chance zum Wachsen sein. Manchmal macht das überhaupt keinen Spaß. Doch wir wachsen an der Einsamkeit, den Hürden, der Fremdheit und dem Fremdsein, dem Überwinden von Schwierigkeiten. Alle Dinge, die als Argument gegen das Alleinreisen aufgeführt werden, sind die besten, wenn auch oft mühevollen Lehrer.
Das passiert im Praktischen wie im Philosophischen. Du lernst nicht nur, wie du allein von A nach B kommst, ohne zu wissen, wie man A oder B in der Landessprache sagt, sondern auch, ob dir das Alleinsein überhaupt etwas ausmacht. Auch wenn der Gedanke, allein zu sein, vielen erst einmal unheimlich ist, kann es viel Gutes mit sich bringen: Stille, Entspannung und die Möglichkeit, immer wieder der Frage nachzugehen: Was will ich? Das muss nicht immer toll sein, aber manchmal ist es einfach gut zu wissen, dass man es auch mal allein mit sich aushält. Dass man eben nicht vor Einsamkeit vergeht und dass es überall auf der Welt andere Menschen gibt, die zwischenmenschliche Kontakte und Nähe suchen und brauchen.
Die Ironie ist, dass viele glauben, ihnen fehle das Selbstbewusstsein zum Alleinreisen, und dass es gleichzeitig nichts Besseres gibt, um eben das zu stärken. Zu Hause bewegt man sich in einem sozialen Netz aus Eltern, Partnern, Freunden und Kollegen. Mehr oder weniger glücklich, aber sich davon zu lösen, ist erst mal ein bisschen unheimlich. Man könnte ja verloren gehen, im wahrsten und übertragenen Sinne des Wortes (beides kann richtig toll sein, aber dazu später mehr). Auch wenn wir als Kinder lernen, uns zu lösen und Dinge eigenständig zu tun, scheinen wir einen Teil dieser Freiheit und Selbständigkeit irgendwann wieder abzugeben. Stattdessen lernen wir, uns sowohl in praktischen als auch emotionalen Dingen auf andere Menschen zu verlassen.
Meinen Führerschein habe ich ganz normal mit 18 Jahren gemacht und durfte mir dann mit meiner Mutter ein Auto teilen. Zu sagen, dass meine Mutter mit dem Autofahren nie warm geworden ist, wäre eine Untertreibung. So saß sie neben mir auf dem Beifahrersitz und hätte mir am liebsten die Hand gehalten. Weil das nun nicht ging, klammerte sie sich an das Armaturenbrett und murmelte stattdessen Stoßgebete. Dass ich so das Autofahren nie besonders lieb gewonnen habe, ist wohl keine Überraschung. Ich war froh, dass man in New York kein Auto brauchte, und lernte lieber schnell, richtig gut U-Bahn und Taxi zu fahren.
So verbrachte ich zehn schöne Jahre, ohne hinters Steuer zu müssen. Erst mit meinem Umzug nach Südafrika wurde ich wieder mit dem leidigen Thema konfrontiert; Autofahren war dort eine Notwendigkeit. Dass das Ganze auf der linken Straßenseite stattfinden sollte, machte mir dabei noch am wenigsten Angst.
Damit ich irgendwie klarkäme, gab mir mein Onkel während einer gemeinsamen Fahrt durch Lesotho erst mal Fahrstunden. Das Gute an den dortigen Straßen: Man sitzt meistens im einzigen Fahrzeug weit und breit und kann so anderen wenig Schaden zufügen. Der Nachteil ist, dass man oft nicht ohne Vierradantrieb weiterkommt und die Straßen – nett formuliert – unbefestigt und schmal sind.
Da saß ich nun in einem Terrano, der mir größer als ein Haus schien, mit meinem Onkel neben mir, der mir Anweisungen gab. Ich weiß nicht, ob es das fremde Land, das riesengroße Auto oder die Ruhe meines Onkels war, aber hier lernte ich Auto fahren und dazu, mir und meinen Fahrkünsten zu vertrauen.
Ich bin nicht zur besten Autofahrerin der Welt mutiert, aber ich fühle mich heute wohl damit. Mir bereitet der Gedanke, am Steuer zu sitzen, keine Bauchschmerzen mehr, und das ist ein tolles Gefühl. Es gibt mir Freiheit und hat meinem Selbstbewusstsein einen unglaublichen Schubs gegeben – ich liebe es, wenn ich Dinge allein tun kann und nicht auf andere angewiesen bin.
Was gibst du gerne an andere ab, weil du es vermeintlich nicht kannst? Deine beste Freundin ist einfach besser darin, Typen an der Bar anzuquatschen, und dein Mann war in Mathe schon immer besser, was so hilfreich beim Trinkgeld-Ausrechnen ist? Kenn ich und kann ich beides auch nicht sonderlich gut. Ich spreche auch nicht fünf verschiedene Sprachen, um überall nach dem Weg fragen zu können, und das Kartenlesen musste ich mir erst mühsam aneignen. Es ist normal, Gesellschaft haben zu wollen, wenn wir uns langweilen, eine starke Schulter, wenn wir einen schlechten Tag haben, und moralische Unterstützung, wenn jemand fies zu uns ist. Und trotzdem ist es ein unglaublich tolles Gefühl, zu wissen, dass man auch allein klarkommt. Allein unterwegs lernt man, Situationen auszuhalten, Dinge neu zu beurteilen und sehr oft auch, dass man eigentlich etwas richtig gut selbst kann und zu Hause nur nie dazu gekommen ist.





























