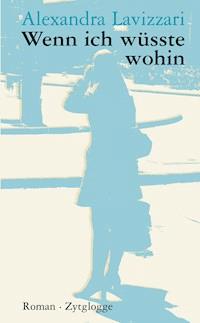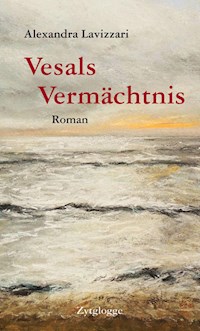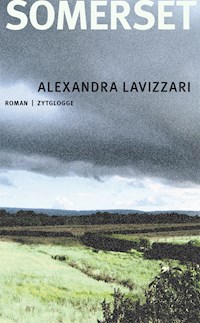
19,00 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Zytglogge
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Fruchtbarkeitsriten So ganz überraschend kommt es nicht, dass Alexandra Lavizzari mitihrem neuen Buch ‹Somerset› einen Thriller vorlegt.Schon in ihrem ersten Buch ‹Ein Sommer› (1999) liess sie kriminalistischeElemente in die Geschichte einer unglücklichen Jugend auf dem Landeinfliessen, und auch unter den elf Erzählungen im Band ‹Flucht aus demIrisgarten› (2010) finden sich einige, in denen Dunkles, mitunter Brutalesdie Oberfläche einer scheinbar heilen Welt durchbricht.Aus dieser Perspektive gesehen mag sich ‹Somerset› als Steigerunglückenlosan Lavizzaris frühere Werke reihen; die Autorin geht diesmaljedoch einen Schritt weiter, indem sie ihre spannungsreiche Geschichtemit den dazugehörenden Ingredienzien wie Mord, Erpressung, Verfolgungusw. gestaltet.Inspiriert von Landschaft und Leuten ihrer Wahlheimat – der englischenGrafschaft Somerset, wo sie heute lebt –, ist Alexandra Lavizzari aufeine Fundgrube urtümlicher Traditionen gestossen. Die aus heidnischenZeiten überlieferten Fruchtbarkeitsrituale bilden die thematische Grundlagezu ihrem Buch, das geschickt zwei Parallelgeschichten miteinanderverknüpft und zu einem dramatischen Finale konvergieren lässt.Ausgangspunkt IDie Berner Lehrerin Vera Wyler reist im November 2010 nach Southcombein der idyllischen Grafschaft Somerset und mietet sich für einSabbatical-Jahr im Station House ein, dem Haus des ehemaligen Bahnwärtersdirekt an einer obsoleten Bahnstation. Nadja, ihre Tochter, hates vermittelt, und sie ist es auch, die Vera mit dem Dorfleben und denGepflogenheiten in Somerset vertraut macht.Ausgangspunkt IIJenseits des Kanals, in Westfrankreich, lebt der neunundzwanzigjährigeJason, der eine Zeit lang in einem Pub in London gejobbt hat und nun inSt-Valéry als Handlanger und Gärtner in einem schlossähnlichen Anwesenarbeitet. Er hat nach einem traumatischen Erlebnis in Southcombejeglichen Kontakt zu seiner Heimat abgebrochen, lebt seither verstecktund in Angst, entdeckt und nach Southcombe zurückgeholt zu werden.– Kommen Sie doch einmal zum Tee vorbei. Sie wissen ja, wo wir wohnen,Quantock Views Nummer 14. Von unserem Wintergarten aus geniesstman eine wunderbare Aussicht auf die Quantock Hills. Und vielleichtkann ich Ihnen bei dieser Gelegenheit eine kleine Einführung indie Mentalität unseres Dorfes geben und Sie damit versöhnen.– Ja, vielleicht, wer weiss.Aber Vera wollte nicht versöhnt werden, sondern verstehen. Verstehen,warum Nadja daran war, ihr zu entgleiten. Alles andere kümmerte sienicht. Mochten die Bewohner von Southcombe ihre Apfelbäume anbetenund sonstigem New-Age-Kram anhängen; solange sie Nadja nichtmithereinzogen, konnte sie damit leben und sich sogar darüber amüsieren.Aber Nadja, das war eine andere Geschichte.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 498
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
SOMERSET
ALEXANDRA LAVIZZARI
ROMAN | ZYTGLOGGE
Für David
Alle Rechte vorbehalten
Copyright: Zytglogge Verlag, 2013
Lektorat: Bettina Kaelin
Korrektorat: Monika Künzi, Jakob Salzmann
Umschlagfoto: Ausblick auf die Blackdown Hills
Umschlag: Franziska Muster Schenk, Zytglogge Verlag
ISBN 978-3-7296-0861-0
eISBN 978-3-7296-2014-8
Zytglogge Verlag, Schoren 7, CH-3653 Oberhofen am Thunersee
[email protected], www.zytglogge.ch
1
Es begann schon zu dunkeln, als Vera das Städtchen Taunton erreichte und sich bei der Ausfahrt in die Kolonne der Pendler reihte, die von der Arbeit in ihre dörfliche Idylle zurückkehrten. Nadja hatte sie gewarnt. «Taunton ist zwar klein, Mama, aber gerade vor Weihnachten ist der Stossverkehr besonders schlimm; abends dauert es eine Ewigkeit bis nach Southcombe. Schau, dass du vor halb fünf ankommst. Oder eben später, gegen acht.»
Die Uhr auf dem Armaturenbrett zeigte elf nach sechs. Vera hatte sich wieder einmal verplant. Statt zielstrebig von Folkstone nach Taunton zu fahren, wie es ursprünglich ihre Absicht gewesen war, hatte sie unterwegs spontan in Wells Halt gemacht und zu lange in der Kathedrale und im Bischofspalast verweilt. Nun hatte sie die Bescherung: Nach Stunden flotten Fahrens kam sie plötzlich nur noch im Schneckentempo vorwärts. Sie schlich an desolaten Häuserzeilen und Gewerbezentren vorbei über eine Brücke, wo der Verkehr dann eine gute Viertelstunde stillstand. Da man sie im B & B von Southcombe jedoch zu keiner genauen Uhrzeit erwartete, nahm sie es gelassen. Sie summte sogar am Steuer, während sie den grünen Ford vor sich anstarrte, und dachte an knusprigen Fish ’n’ Chips in einem Pub.
Was ihr auf dieser letzten Fahrtstrecke sonst noch alles durch den Kopf ging, konnte sie später nicht mehr sagen, aber eines war sicher: Die sogenannten berühmten Vorahnungen hatte sie nicht. Weder verspürte sie plötzlich ein beengendes Gefühl in der Brust noch hörte sie eine innere Stimme, die sie zur Umkehr mahnte, bevor es zu spät sei. Im Gegenteil: Trotz des Staus war sie zufrieden und, ja, zum ersten Mal seit Roberts Tod sogar wieder zuversichtlicher und neugierig aufs Leben. Jedenfalls konnte weder der Regen noch der Wind ihre Laune an diesem Abend trüben. Wenn der Verkehr stockte, legte sie das Kinn aufs Steuer und betrachtete die Herbstblätter und Plastiktüten, die in der Luft herumwirbelten, und am Himmel die sich aufbauschenden und dehnenden Starwolken, und als die letzten Terrassenhäuser endlich hinter ihr lagen und die Strasse sie durch schwach beleuchtetes Land führte, mit Feldern und Weiden, über denen Nebelbänke schwebten, dachte sie ans wärmende Kaminfeuer, mit dem Pubs um diese Jahreszeit ihre Gäste willkommen heissen. Mit etwas Glück würde sie sogar Mrs. Moore in ihrem B & B mit einem solchen verwöhnen. Ihrer Stimme am Telefon nach zu urteilen, war sie eine Dame älteren Jahrgangs, wahrscheinlich etwas taub, denn sie redete ziemlich laut und in jener absurd hohen Tonlage, die blutjungen oder eben betagten Engländerinnen eigen ist. Ihre Anweisungen hatten auf Vera etwas routiniert gewirkt, doch erwiesen sie sich jetzt als hilfreich; ohne Probleme fand sie die Abzweigung, die beim Postamt von Southcombe in die High Street mündete, und von dort die Mulberry Lane, an deren Nummer 57 sie kurz nach sieben mit einem Seufzer der Erleichterung den Wagen anhielt.
Unter dem ‹Birch Cottage› hatte sie sich ein schmuckes, weiss verkleidetes Häuschen vorgestellt, womöglich mit Rieddach und von Rosenstauden umrankten Fenstern, mit einem Garten voller Birken, woher sonst der Name? Nun war sie verblüfft, ein Backsteinhaus vorzufinden, und zwar in jenem unverkennbaren englischen Stil, in dem im ausgehenden 19. Jahrhundert skurrile Viktorianer ihre Fantasien zu verwirklichen pflegten. Düster stand das Haus am Ende eines Kieswegs, eingerahmt von Buchen. Es hatte eindeutig schon bessere Zeiten erlebt. Im Licht der Gartenleuchte, die bei Veras Betreten des Grundstücks automatisch anging, erkannte sie ein paar Risse im Gemäuer, und die Eingangstür mitsamt Rahmen hätte dringend einer neuer Malschicht bedurft. Aber mit seinen Erkern, Türmchen, Giebelfenstern und Bündelpfeilern wirkte das Haus wiederum verspielt und lebendig. Licht brannte im Erdgeschoss, und als Vera klingelte, ertönte aus dem Innern ein fröhliches «Come in», gefolgt von einem Japsen und Hecheln.
Zwei Terriers sprangen an ihr hoch, die Mrs. Moore alsgleich mit einem barschen «Stop it» wegjagte, während sie ihrem Gast den Koffer abnahm und durch den Korridor vorausging. «Sam und Maisy sind noch jung und etwas unerzogen. Ich hoffe, Sie haben nichts gegen Hunde, sonst sperre ich sie bis morgen in der Garage ein.»
«Aber nein, das ist nicht nötig. Ich selbst habe zwar keine Hunde, doch sie stören mich nicht im Geringsten.»
Mrs. Moore nickte wohlwollend und führte Vera ins Wohnzimmer. Sie war jünger, als Vera geschätzt hatte, knappe fünfzig vielleicht, und auffallend hochgewachsen und mager. Vera fand jedoch, dass ihre Eleganz nicht so recht in diesen hintersten Winkel von Somerset passte. Oder täuschte sie sich? Von den Samtpantoffeln bis zum Seidenfoulard war Mrs. Moore ganz in Weinrot gekleidet, und über den sonst ungeschminkten Augen hatte sie einen entsprechenden Lidschatten aufgetragen. Ein grosser, in Gold gefasster Feueropal zog Veras Aufmerksamkeit auf sich, und dabei fiel ihr Blick auf den Ehering, der aus zwei aneindergeschweissten Ringen bestand. Mrs. Moore ist also verwitwet, dachte sie, genau wie ich.
Im Vergleich kam sich Vera in ihren Jeans ziemlich schäbig vor, auch der Pullover und die Sportschuhe waren nicht mehr die neusten, doch Mrs. Moore schien dies alles nicht zu beachten. Sie kramte in einer Schublade nach Prospekten über die Sehenswürdigkeiten der Gegend und empfahl ihr eine Reihe von Restaurants und Pubs, die entweder zu Fuss oder mit einer kurzen Fahrt zu erreichen waren. Obwohl kein Feuer im Kamin knisterte, strahlte das Zimmer mit seinen Beige- und Rosatönen Wärme aus. Porzellanfigürchen und sonstige Nippes überstellten die Fenstersimse, und auf einer Kommode, zwischen Familienfotos und Vasen, reihten sich die ersten Weihnachtskarten. Aus einem Nebenzimmer drangen Gelächter und Dialoge einer Sitcom herüber; Vera hatte Mrs. Moore offenbar beim Fernsehen unterbrochen. Sie wollte sich schon dafür entschuldigen, als Mrs. Moore ihr mit der Frage zuvorkam, ob sie gut gereist sei.
«Ja, danke. Drei Tage am Steuer sind zwar recht lang, und der Linksverkehr ist für uns ‹Continentals› gewöhnungsbedürftig, aber alles in allem habe ich die Reise gut überstanden.»
«Das freut mich. Soviel ich verstanden habe, sind Sie aber nicht zum ersten Mal hier, nicht wahr?»
«Nein, ich bin schon einmal in Southcombe gewesen. Vor anderthalb Jahren etwa. Damals wohnte ich jedoch bei meiner Tochter; ihr Haus ist das letzte von Church Street, gleich neben dem Friedhof.»
«Ja, ich kenne das Haus. Ihre Tochter ist übrigens persönlich vorbeigekommen, um Ihr Zimmer zu reservieren. Eine sehr nette junge Frau.»
«Sie ist es auch, die mir von Station House erzählt hat. Und zwar in den höchsten Tönen.»
«Station House, ach ja. Sie werden sehen, es wird Ihnen gefallen. Bis jetzt ist es allen meinen Mietern so ergangen.»
«Kann ich es morgen schon beziehen?»
«Aber natürlich, so haben wir es doch vereinbart. Letzte Woche habe ich Heizung, Kochherd und Waschmaschine kontrollieren lassen, und gestern hat meine Putzfrau geputzt. Lucy ist eine Perle. Sie ist sehr gefragt im Dorf, aber falls Sie ihre Dienste in Anspruch nehmen möchten, könnte ich bestimmt ein Wort für Sie einlegen.»
«Das ist sehr lieb von Ihnen, aber ich werde erst mal sehen, ob ich nicht auch allein zurechtkomme.»
«Wie Sie wollen, Sie können ja immer noch zu einem späteren Zeitpunkt auf mein Angebot zurückkommen. Ich dachte, wir könnten morgen so gegen zehn hingehen, passt Ihnen das? Den Mietvertrag können wir dann vor Ort durchsehen.»
«Wunderbar. Danach bleibt genügend Zeit, damit ich im Dorf das Nötigste für die kommenden Tage einkaufen kann.»
Nachdem Mrs. Moore Vera den Zimmerschlüssel ausgehändigt und ihre Wünsche fürs Frühstück entgegengenommen hatte, bezog Vera ihr Zimmer und legte sich nach einer oberflächlichen Inspektion des edlen, von den Fliesen bis zum Badetuch mintgrünen Badzimmers bäuchlings aufs Bett und schickte Nadja eine SMS: «Eben angekommen, B & B bestens. Sehen uns morgen.» Am liebsten wäre sie gleich liegen geblieben, doch sie war hungrig und hatte das Bedürfnis, sich nach der Fahrt die Beine zu vertreten.
Vor anderthalb Jahren hatte Vera ein verlängertes Wochenende mit Robert hier verbracht, aber da war er schon sehr krank gewesen und hatte kaum mehr Kraft für Spaziergänge gehabt. Sie hatten sich hauptsächlich in Nadjas und Toms Haus aufgehalten, und wenn die Temperatur es erlaubte, gelegentlich auch im Garten; weiter als bis zum Ende des Friedhofs waren sie nie gekommen. So hatte Vera von Southcombe nur gerade ein paar Strassen und den Coop-Laden gesehen, in den sie mit Nadja manchmal einkaufen ging.
Eine kalte Brise blies ihr entgegen, als sie das B & B verliess. Die Strassen waren menschenleer, nur vor dem ‹Kings Arms› standen ein paar Jugendliche, schlotternd und still in ihren Kapuzenjacken um ein Mädchen herum, das gerade eine Kerze in die Öffnung einer leeren Bierdose schraubte.
Vera hatte sich vorgenommen, vor dem Essen bis ans Dorfende zu spazieren, vielleicht mit einem kleinen Umweg durch die Church Street, obwohl sie wusste, dass Nadja und Tom an diesem Abend nicht zu Hause waren, sondern irgendwo in Exmoor die Hochzeit von Toms bestem Freund feierten. Kurz vor der Kirche stiess Vera jedoch auf eine Absperrung. Ein Polizeiwagen war am Strassenrand geparkt und Polizisten mit Funkgeräten standen vor einem schmalen Reihenhaus schräg gegenüber vom Pfarrhaus. Hinter ihr erschallte das Geheul eines nahenden Krankenwagens. Sämtliche Fenster waren erleuchtet. Unter der Dachschräge stand eines offen mit einer durchsichtigen Tüllgardine, die unruhig im Wind wehte. Posters von Palmenstränden schmückten die Wände, und eine Lampe mit rotem Schirm warf einen flackernden Lichtkreis auf die Decke. Vera sah wieder zu den Polizisten und zu der in ihrer Mitte ausgebreiteten Decke am Strassenrand. Sie wollte wegschauen, aber es war schon zu spät. Sie hatte nicht nur die Decke gesehen, sondern auch die angewinkelte Form darunter und was seitlich hervorlugte: ein Ballerinaschuh mit einer Schnalle, die glänzte. Pink.
«Please, Madam, bleiben Sie nicht hier», mahnte ein Polizist und zeigte mit der Hand auf die Umleitung hinter der abgeriegelten Häuserzeile. Aber Vera mochte nicht mehr spazieren gehen. Auch die Lust auf Fish ’n’ Chips war ihr vergangen. Plötzlich wurde ihr übel, ihre Kehle schnürte sich zusammen und ihr Herz begann zu rasen. Sie sah noch, wie zwei Türen des Krankenwagens sich öffneten und Sanitätsleute auf das Reihenhaus zugingen, dann machte sie kehrt und ergriff das Weite.
Auf dem Rückweg zwang sie sich, tief durchzuatmen und sich abzulenken, indem sie an angenehmere Dinge dachte. Es gelang nicht; auch die Hausnummern von High Street abzuzählen, nützte nichts. Das Bild von der Decke und den darum herumstehenden Polizisten ging ihr nicht aus dem Kopf. Sie war nicht abergläubisch, aber dieser Todesfall wenige Stunden nach ihrer Ankunft liess sie Ungutes für ihren Aufenthalt in Southcombe ahnen. Vor dem ‹Kings Arms› angelangt, verlor sie keinen Gedanken mehr daran einzukehren, sondern wollte nur noch auf schnellstem Weg nach Hause zurück und sich in ihrem Zimmer verkriechen.
Die Jugendlichen standen noch immer schweigend vor dem Eingang, ihre Gesichter unter der Kapuze jetzt fahl beschienen von der Kerze, die das Mädchen mit den Händen vor dem Wind zu schützen versuchte.
Die Stille rundum flösste Vera ein seltsames Unbehagen ein. Kein Auto, keine Stimme, kein Radio, nichts. Auch aus dem Pub kam kein Laut. Unwillkürlich beschleunigte Vera ihre Schritte. Sie war erschüttert, klar; wäre sie ein paar Minuten früher zur Stelle gewesen, hätte sie womöglich miterlebt, wie eine Frau – oder war es ein Mädchen? – aus dem Fenster stürzte. Aber das war es nicht allein, was sie schaudern liess: Erst jetzt, in dieser vollkommenen Stille, fiel ihr auf, dass sich ausser den Polizisten und ihr kein einziger Mensch an der Unfallstelle eingefunden hatte. Weder hatten Familienangehörige des Opfers noch Schaulustige herumgestanden, wie dies in solchen Fällen sonst üblich ist. Niemand hatte aus dem Fenster gelehnt, um zu sehen, was sich auf der Strasse abspielt; und Zeugen, die den Polizisten Red und Antwort gestanden hätten, hatte Vera auch keine bemerkt. Dabei musste doch jemand etwas gehört oder gesehen haben, ein Nachbar oder zumindest ein Passant. In den meisten Häusern hatte warmes Licht gebrannt oder jenes bläuliche von Fernsehapparaten.
Warum aber war nach dem Aufprall kein Fenster aufgegangen, hatte niemand versucht herauszufinden, was den dumpfen Aufschlag verursacht hatte?
Fast begann Vera zu zweifeln, ob sie nicht alles nur geträumt oder sich etwa an die Szene eines Films erinnert hatte. Nein, entschied sie schliesslich, sie hatte nicht geträumt: Eine Frau war soeben in der High Street eines tragischen Todes gestorben, Vera hatte die Decke mit eigenen Augen gesehen: dunkel mit kariertem Schottenmuster war sie gewesen. Und was den pinken Schuh anbelangte, so hatte er sich ihr ebenso deutlich ins Gedächtnis eingeprägt. Vor allem die Schnalle, übergross und spitz wie die Flügel eines Schmetterlings. So was erfand man nicht.
Nach diesem Erlebnis kam Vera ‹Birch Cottage› noch düsterer vor als bei ihrer Ankunft. Sie war froh, auf dem Weg ins Zimmer die beiden Terrier bellen zu hören und einen Lichtstreifen unter der Wohnzimmertür zu sehen. Und als sie die Kekspackung aufriss, die sie neben dem elektrischen Wasserkocher fand, und sich damit einen Augenblick ans Fenster setzte, vernahm sie unter sich beruhigende Frauenstimmen: Mrs. Moore schaute noch immer fern. Auch Nadjas Antwort auf dem Handy tat Vera gut: «Super», hatte sie geschrieben, «bin um halb 10 bei dir.»
Zu wissen, dass sie ihre Tochter in wenigen Stunden in die Arme schliessen würde, verdrängte die dunklen Bilder allmählich aus ihrem Kopf. Sie legte sich ins Doppelbett, und statt die ‹Somerset Gazette› zu lesen, die sie in Wells gekauft hatte, liess sie sich von Erinnerungen treiben und von der Vorfreude auf die kommenden Monate, die sie in Nadjas Nähe verbringen würde. Von ihr getrennt zu leben, war ihr nach Roberts Tod besonders schwergefallen. Auch wenn sie sich einredete, dass sie sich als Mutter freuen sollte, ihr Kind glücklich verheiratet zu wissen, haderte sie manchmal mit dem Schicksal und bedauerte, dass Nadja wegen Tom so weit weggezogen war. Sie hatte nichts gegen Tom, nein, wirklich nicht, aber als Eltern hatten sie sich beide gewünscht, dass Nadja in der Schweiz geblieben wäre, nicht gerade in Bern, aber wenigstens nahe genug, dass sie sie jederzeit besuchen konnten.
Nadja kam auf die Welt, als Vera bereits aufgegeben hatte, an eine Schwangerschaft zu glauben. Robert und sie hatten alles versucht, mal verbissen, mal mit Humor, doch alles in allem selten entspannt, und darin hatte vielleicht der Grund ihrer Schwierigkeiten gelegen. Sie hatten vom Spezialisten bis zum Quacksalber alle möglichen Ärzte konsultiert, und jeder hatte die Schuld auf etwas anderes geschoben, frühere Therapien belächelt und Wunder bei der eigenen versprochen. Mit den Wundern war aber nichts gewesen und die Jahre vergingen. Robert und sie wurden ungeduldig und stritten sich oft. Das Wort Trennung hing eine Weile in der Luft, ohne dass sie gewagt hätten, es auszusprechen. Zum Glück merkten sie jedoch rechtzeitig, was an ihrer Beziehung zehrte, und so kamen sie schliesslich an ihrem dreissigsten Geburtstag überein, bei Prosecco und Kaviartoast die Enttäuschungen der vergangenen Jahre wegzustecken und einen feierlichen Schlussstrich unter ihre Fruchtbarkeitsexperimente zu ziehen. Statt einem Wesen nachzutrauern, das nur in ihrer Fantasie existierte, versuchten sie, sich mit einer angetrunkenen Dosis Optimismus über die Freuden einer kinderlosen Zukunft klar zu werden, von der individuellen Freiheit bis hin zum Geldbeutel. Beim letzten Glas Prosecco waren sie so weit, eine Reise in die Sahara zu planen und den Balkon mit einer Verglasung in einen Wintergarten umzufunktionieren. Sie wurden sich sogar einig, welchen Innenarchitekten sie damit beauftragen und welche Möbel sie dafür anschaffen wollten. Sie lachten viel, auch über sich selbst, und zum Schluss landete Vera auf Roberts Schoss, schlang ihre Arme um ihn und küsste ihn, wie sie einen Mann geküsst hätte, der nichts von ihr wusste, vollkommen hemmungslos. Das Kind, das sie nicht bekommen würden, hatten sie sozusagen begraben, ohne grosses Getue, ohne Tränen, dafür – wie ihnen schien – mit Stil.
Neun Monate später kam Nadja auf die Welt. Ein echtes Wunder, sagten sie, eines, auf das sie stolz sein durften, weil sie es ohne ärztliche Hilfe vollbracht hatten. Und was für ein Kind! Hübsch war es mit seinen blonden Zapfenlocken und den grossen Augen, die nicht etwa porzellanblau waren wie Roberts Augen oder langweilig braun wie Veras, sondern von feurigstem Schwarz wie jenes der Afrikaner. Sie fanden keine Erklärung dafür in ihrer Verwandtschaft und lernten, sich mit einem entwaffnenden Lächeln auf die Launen des Vererbungsgesetzes zu berufen, wenn jemand sie danach fragte. Auch mit den Bemerkungen über einen Seitensprung oder eine Verwechslung im Krankenhaus lernten sie umzugehen; sie nahmen sie einfach nicht ernst und wunderten sich nur, wie die Leute immer mit denselben Sprüchen aufwarteten. Ja, selbst ihr Entzücken schien ihnen stereotyp.
Nadja war ein Vorzeigekind, in jeder Hinsicht. Als sie fünf Jahre alt war, wurde Vera einmal auf offener Strasse von einer Frau angehalten, die Nadja für Werbespots gewinnen wollte. Sie steckte Vera ein Kärtchen zu und erklärte ihr, dass ihre Tochter supersüss sei und bei den Zuschauern garantiert gut ankommen würde. Vera lehnte ab. Robert und sie hatten ganz andere Ambitionen als Fernsehauftritte für Nadja; sie sahen sie als Ärztin oder Anwältin, nicht als Flittchen in der Medienwelt. Manchmal träumten sie auch, dass sie Chemikerin würde wie ihr Vater, und stellten sich vor, wie sie in weissem Kittel die Korridore eines Pharmakonzerns abschritt.
Als vernünftige Eltern wollten sie, was Nadjas Zukunft anbelangte, unbedingt auf den Wert des Intellekts bauen, der ihnen sicherer und vor allem weniger vergänglich schien als jener ihrer attraktiven Erscheinung. Vom Püppchen zum Teenager, nach dem sich die Männer auf der Strasse umdrehten, durchlief Nadja die Phasen ihrer Entwicklung ohne merkliche ästhetische Einbusse. Das Wort Backfisch war offenbar nicht auf sie gemünzt, nie hatte sie Pickel im Gesicht oder Gewichtsprobleme, nie verzweifelte sie an der Ungerechtigkeit der Welt oder der Sinnlosigkeit des Daseins, sondern nahm alles, das Gute und das weniger Gute, mit einer Selbstverständlichkeit hin, über die Robert und Vera sich oft den Kopf zerbrachen. War es Lebensreife oder – im Gegenteil – unsägliche Frivolität? Gar Gleichgültigkeit? Sie wussten es nicht. Nadja hatte eine derart elegante Art, unangenehme Dinge unter den Tisch zu wischen und ihre Eltern zu überzeugen, dass alles bestens sei. Auch in der Schule bezirzte Nadja Mitschüler und Lehrer, so dass kein Elternabend verging ohne Bemerkungen wie: «Eure Tochter ist wunderbar», oder: «Sie ist der Sonnenschein der Klasse, immer so fröhlich, so begeisterungsfähig und positiv. Es ist eine Freude, mit ihr zu arbeiten.» Robert und Vera konnten dazu nur nicken. Was man ihnen sagte, traf zu, und sie betrachteten es als ihre Aufgabe, dafür zu sorgen, dass es so lange wie möglich auch so bleiben würde.
Mit dem berühmten Ernst des Lebens würde Nadja noch schnell genug konfrontiert werden, dachten sie. Einstweilen aber sollte sie ihre Jugend geniessen, und dies gelang ihr auch in London gut, soweit die Eltern es aus der Ferne betrachten konnten. Nach langem Hin und Her hatten sie sie doch noch für ein Austauschjahr ziehen lassen. Nadja hatte eine ihnen unbegreifliche Studienrichtung gewählt: zu Veras und vor allem Roberts Leidwesen weder Medizin noch Rechts- oder Naturwissenschaften, sondern Englisch. Als Grundstein für eine handfeste Karriere schien ihnen das Fach ziemlich ungeeignet, und sie versuchten auch immer wieder, ihr diese Wahl, die sie nur für eine kurzlebige Marotte hielten, aus dem Kopf zu schlagen. Ohne Erfolg: Englisch würde es sein oder nichts. Mit dieser sturen Haltung setzte sich Nadja schliesslich durch und zog nach dem ersten Unijahr nach London – wo sie Tom schon nach wenigen Wochen kennenlernte.
Am Morgen wurde Vera vom Geruch von Kaffee und gebratenem Bacon geweckt. Die Sonne schien, aber in der Nacht musste es in Strömen geregnet haben, denn der Kiesweg und die Rasenfläche standen stellenweise unter Wasser.
«Das Erste, was Sie sich in Somerset kaufen müssen, sind Wellington Boots», riet ihr Mrs. Moore, als sie ihr den Teller mit Spiegeleiern vorlegte. «Ohne Gummistiefel geht gar nichts, wir sind hier ständig ein bisschen unter Wasser. Auch im Sommer.»
«Das macht mir weiter nicht viel aus. Auch in der Schweiz regnet es ziemlich oft.»
Mrs. Moore, heute in blaugrünem Karorock und weissem Twinset, tischte Toasts, verschiedene Marmeladen- und Honigsorten sowie Joghurts auf und schwatzte, während sie zwischen Küche und Essraum hin- und herging, bald auf Vera, bald auf die Terrier ein, die ihr ungeduldig um die Beine strichen. Was sie am Abend zuvor erlebt hatte, schien Vera in dieser britischen Gemütlichkeit so fern und unwirklich, dass es ihr unpassend vorgekommen wäre, davon zu erzählen.
«Die kleinen Unholde sind heute noch gar nicht draussen gewesen. Nach dem Frühstück werde ich Sie also kurz alleine im Haus lassen müssen, um sie spazieren zu führen.»
«Meine Tochter wird in einer halben Stunde vorbeikommen. Darf ich sie hereinlassen?»
«Selbstverständlich. Sicher möchte sie dabei sein, wenn Sie in Station House einziehen. Wir können dann zu dritt hinfahren, mit den Hunden.»
Mrs. Moore hatte drei Gästezimmer, die sie während der Sommermonate und Schulferien mühelos vermieten konnte. Die Zeit zwischen November und Februar war jedoch schlecht für den Lokaltourismus. Vera war der einzige Gast. Eine Wanduhr tickte, ansonsten war kein Laut zu hören. Bevor sie wieder aufs Zimmer hochging, erlaubte sie sich nach dem letzten Bissen Toast einen Rundgang durch die anderen Räume im Erdgeschoss, die Mrs. Moore ihren Gästen zugänglich machte. An den Wänden hingen Landschaftsaquarelle sowie Stiche von Lilien, Rosen und Lupinen, Kirschen- und Quittenblüten. Interessanter fand Vera die gerahmten Fotos auf Tischchen und Kommoden. Mrs. Moore am Arm eines Mannes, ihres Gatten wahrscheinlich, einmal am Strand, einmal auf einer Wiese oder auf einem Balkon mit Blick auf eine stürmische See. Zwei Kinder in verschiedenen Alterstufen, der Knabe eher schmächtig, dann zu einer Bohnenstange herangewachsen, bei seiner Hochzeit mit einer asiatischen Schönheit und zuletzt – sehr stolz – in Militäruniform; das Mädchen hingegen war von klein auf pummelig und hatte als Teen Piercings in den Brauen und eine grüne Punkfrisur. Mit dieser Wut im Blick, diesen Lippen, die schmollten, war sie vermutlich kein einfaches Kind gewesen. Doch was ging Vera Mrs. Moores Familie an? Nadja würde jede Minute da sein. Schnell ging sie hoch, packte ihre Sachen zusammen und trug den Koffer in den Flur hinunter.
Für das Wiedersehen hätte sich Vera einen Augenblick allein mit ihrer Tochter gewünscht; Nadja musste Mrs. Moore jedoch auf der Strasse getroffen haben, denn Vera hörte sie beide mit den Terriern kommen. Nadja alberte mit den Hunden herum, Vera beobachtete vom Fenster des Wohnzimmers aus, wie sie mit ihnen über den Rasen sprang, als Mrs. Moore zur Tür hereinkam, sich neben sie stellte und nachsichtig meinte: «Sam und Maisy scheinen den Narren an Ihrer Tochter gefressen zu haben – und umgekehrt. Schauen Sie, ist das nicht ein schönes Bild?»
Vera nickte, obwohl sie das Bild nicht besonders schön fand. Die Hunde knurrten erregt, während Nadja vor ihnen einen Zweig schwang, einmal, zweimal, dreimal, bevor sie ihn in hohem Bogen ins Gebüsch warf und sich endlich dem Haus zuwandte.
«Mama», rief sie, als sie Vera sah, «da bist du ja.»
Vera küsste sie auf beide Wangen und drückte sie lange an sich. Ihr Haar roch fremd, und auch die Strickjacke, die sie nun aufknöpfte, hatte Vera noch nie an ihr gesehen. Aber ihr Gesicht war noch dasselbe, eine Spur rundlicher vielleicht, doch fröhlich und aufgeschlossen; ihre Augen leuchteten vor Lebenslust.
«Komm, gehen wir gleich zu Station House. Ich kann nicht erwarten, dir dein neues Zuhause zu zeigen.»
Mrs. Moore fuhr mit ihrem Wagen voraus. Der Weg war weiter, als Vera gedacht hatte. Station House lag ausserhalb des Dorfes an der Bahnlinie der West Somerset Railway, die seit dem neunzehnten Jahrhundert Taunton mit dem Küstenort Minehead verbindet. Die meisten Bahnhöfe auf dieser Strecke werden noch für touristische Zwecke mit Dampf- und Dieselzügen bedient, doch Southcombe gehörte seit der Umleitung der Züge in den Siebzigerjahren nicht mehr dazu.
«Und da wirst du jetzt wohnen, Mama», sagte Nadja aufgeregt, als sie von der Strasse in einen Schotterweg abzweigten und nach etwa hundert Metern ein strenges, aber mit Zierleisten wirkungsvoll aufgeheitertes Steinhaus erblickten. Das ehemalige Haus des Bahnhofvorstehers gefiel Vera auf Anhieb.
Mrs. Moore führte sie durch den Flur in die Küche, die Vera nicht so sehr ihrer Einrichtung wegen begeisterte – diese war eher bescheiden –, sondern wegen des Ausblicks auf eine Wiese, auf der Pferde weideten. Mittendrin stand eine Eiche, auf deren Ästen Raben sassen, zu Dutzenden, so dass es aussah, als trüge der Baum grosse dunkle Blüten.
«Wie herrlich», schwärmte Vera.
«Ja, dieses Haus hat eine spezielle Atmosphäre. 1862 ist der erste Bahnhofvorsteher hier eingezogen, und als der letzte 1973 starb, haben mein Mann und ich es gekauft und dreissig Jahre lang darin gewohnt. Wir liebten Station House sehr.»
Für Vera war das Haus viel zu gross, ein wahrer Luxus, den sie sich auch nur dank des niedrigen Mietpreises leisten konnte. Zwei sogenannte Parlours im Erdgeschoss und drei Zimmer im ersten Stockwerk waren weit mehr, als sie benötigte. Während Mrs. Moore am Schluss die Inventarliste und den Vertrag mit ihr durchging, überlegte sie bereits, welches Zimmer sich am besten als Atelier eignen und wo sie am liebsten schlafen würde. Auch an ein Gästezimmer dachte sie, denn sie rechnete im Laufe der kommenden Monate fest mit dem Besuch von Freunden und Bekannten aus der Schweiz.
Mrs. Moore hatte das Haus schlicht eingerichtet. Die Betten und Schränke sowie das Geschirr stammten von Ikea, den Rest musste sie aus Secondhandläden ergänzt haben. Am meisten entzückten Vera die alten Schiebefenster. Sie kannte solche nur vom Film. Ihre Begeisterung sollte sich allerdings schon bald in Grenzen halten, als sie merkte, wie schlecht diese Fenster gegen Kälte und Regen isoliert waren. Einstweilen aber fand sie es romantisch, in einem echten viktorianischen Haus zu wohnen, und gab sich nach der Unterzeichnung des Mietvertrags ganz der Hoffnung hin, hier ein glückliches und kreatives Jahr zu erleben.
«Aber nun zu dir, Nadja, sag, wie geht es dir, was macht ihr so, Tom und du? Wie war die Feier gestern Abend?», fragte sie, nachdem Mrs. Moore ihre Terrier aus dem Feld zurückgepfiffen hatte und mit ihnen davongefahren war.
Vera sass mit Nadja auf dem Sofa des kleineren Parlours, den sie der Farbe des Spannteppichs wegen fortan das blaue Zimmer nennen sollte, im Gegensatz zum roten Zimmer, dessen rot-orange geblümter Teppich ihr eine Spur zu aufdringlich war. Sie hatte Tee gekocht – ihren ersten englischen Tee –, und nachdem sie beiden eingeschenkt hatte, begann Nadja frisch von der Leber weg zu erzählen. Sie hatte viel nachzuholen. Nicht nur Erfreuliches. Noch immer war für sie kein Job in Aussicht, weder als Lehrerin noch in irgendwelcher Tätigkeit, in der ihre Sprachkenntnisse gefragt gewesen wären.
«Niemand will hier Fremdsprachen lernen, es ist wie verhext. Die Leute scheinen sogar stolz zu sein, nur englisch zu sprechen. Wenn sie erfahren, dass ich drei Sprachen beherrsche und eine vierte halb, schauen sie mich an, als käme ich vom Mars.»
Vera wusste, dass Toms Eltern Nadja vor ein paar Monaten eine Stelle in ihrem Geschäft angeboten hatten, aber Rasenmäher und sonstiges Gartenzubehör waren nicht Nadjas Welt, und von Verkauf und Buchhaltung verstand sie rein gar nichts. Die Schwiegereltern hatten es gut gemeint und Nadjas Absage ohne Probleme akzeptiert.
«Ach, irgendwann wird es mit einem Job schon klappen. Sorgen mache ich mir eigentlich keine. Und wenn ich nichts finde, dann gründen wir halt früher als geplant eine Familie.»
Nadja stellte die Teetasse aufs Tablett zurück und erhob sich.
«Komm, Mama, lass uns in den Garten gehen. Vielleicht kann ich dir ein paar Tipps geben, was du pflanzen könntest, um ihn zu beleben. Der letzte Mieter hat den Garten sehr vernachlässigt. Mrs. Moore hat mir jedenfalls die Ohren vollgeschwatzt von diesem brachen Garten. Und sie hat ja recht; es ist echt schade, ihn derart verwahrlosen zu lassen.»
Nadja und gärtnern! Das war neu. Aber Vera sagte nichts und folgte ihr hinaus. Schweigend standen sie eine Weile im Gras und betrachteten die Sträucher und Bäume entlang der Mauer, die das Grundstück vom Bahnhofareal trennte.
«Die Forsythien müssen dringend gestutzt werden. Auch dort hinten sollte man etwas schneiden, sonst bekommst du zu wenig Sonne. Siehst du? Das Gras ist stellenweise bereits vermoost. Aber aus diesem Erdstreifen da könntest du wunderbare Blumenbeete machen. Wenn du willst, helfe ich dir dabei. Im Dorf kann man jetzt Tulpen-, Narzissen- und Krokuszwiebeln kaufen, es bleibt gerade Zeit genug, sie vor Weihnachten zu pflanzen, damit sie im Frühling blühen.»
«Was du nicht alles weisst! Du machst mich ganz neugierig auf deinen Garten.»
«Erwarte nicht zu viel. Um diese Jahreszeit sehen alle Gärten nach nichts aus. Erst im Februar gehts los, da wirst du staunen. Southcombe wurde dieses Jahr übrigens zum blumenreichsten Dorf der Gegend gekürt. Darauf sind die Einwohner ganz schön stolz.»
«Du auch?»
Nadja blickte auf ihre Stiefelspitzen nieder und sagte zögernd: «Ein bisschen, ja, … ich glaub schon. Aber dir ist kalt, du zitterst ja am ganzen Körper. Gehen wir lieber wieder ins Haus.»
Zusammen packten sie Veras Koffer aus, dann begleitete Vera ihre Tochter bis zum Coop-Laden.
«Soll ich dir noch beim Einkaufen helfen?»
Vera lachte. «Sehe ich denn so hilflos aus?»
«Nein, eigentlich nicht. Also lass ich dich hier, und wir sehen uns heute Abend bei uns. So gegen halb sieben, geht das?»
«Klar. Ich freue mich. Grüss Tom schon mal von mir.»
«Mach ich. Viel Spass beim Einleben.»
Um Viertel nach sechs riegelte Vera Station House ab und fuhr los, auf dem Nebensitz die Champagnerflasche, die sie zur Feier ihres Wiedersehens gekauft hatte, und einen Stapel von Nadjas Lieblingsschokolade aus der Schweiz. Mondlicht schien auf den Schotterweg, gerade hell genug, damit sie die Schlaglöcher umgehen konnte. Die Aussentemperatur betrug laut Thermometer minus zwei Grad, also neun Grad weniger als am Morgen. Vera schauderte. Schon den ganzen Nachmittag hatte sie sich im Haus nicht ganz heimisch gefühlt, jetzt erst merkte sie, dass es wohl an der Kälte gelegen hatte.
Bevor sie in die Church Street einbog, verlangsamte sie das Tempo und erlaubte sich einen Blick zum Haus, vor dem sie am Vorabend die Polizei und den Krankenwagen gesehen hatte. Nichts wies mehr auf den Unglücksfall hin. Die Absperrbänder waren weg, und wo gestern der zugedeckte Leichnam gelegen hatte, stand ein schwarzer Shogun geparkt. An den Fenstern des Erdgeschosses blinkte sogar Weihnachtsbeleuchtung.
Das Leben geht weiter, dachte sie, genau wie damals, als Robert seinem Krebs erlag. In den Wochen nach seinem Tod, ja, noch Monate danach, hatte sie nicht einsehen können, dass Menschen zur Arbeit fuhren, morgens die Geschäfte öffneten und Kinder auf der Strasse lachten, als ob nichts gewesen wäre; es schien ihr der reinste Hohn.
Wie schon bei Mrs. Moore erzählte sie auch Nadja und Tom nichts von dem, was sich unweit von ihnen ereignet hatte. Die fröhliche vorweihnachtliche Stimmung in ihrem Haus verbot es ihr; hier und dort hatte das junge Paar die Wände bereits mit Pailletten, Tannenzweigen und Filzengeln geschmückt. Auf einer Schnur waren Weihnachtskarten über dem Kamin aufgereiht. Alles ziemlich kitschig und altbacken, fand Vera, so gar nicht, wie Nadja es von zu Hause aus gewohnt gewesen war. Aber das Haus gehört ja nicht mir, redete sie sich zu, und ich bin nicht gekommen, um die unmögliche Schwiegermutter zu spielen, die an allem etwas auszusetzen hat. Ausserdem kam Tom, wie Nadja ihr einmal erklärt hatte, aus einem alteingesessenen und traditionsbewussten Geschlecht Somersets. Früher oder später würde er wahrscheinlich das Geschäft der Eltern übernehmen, obwohl er vor kurzem eine Stelle in der Computerbranche angetreten hatte und es ihm, laut eigenen Worten, im High-Tech-Bereich einstweilen wohler war als unter Kippanhängern, Kreisregnern und Düngungsmitteln.
Vera mochte Tom und stellte auch jetzt wieder fest, wie charmant und wohlerzogen er war. Nadja mindestens um zwei Kopf überragend, mit rötlichblonder Wuschelmähne und wegen seiner Kurzsichtigkeit immer leicht zusammengekniffenen Augen machte er den Eindruck eines grossen Buben, der nie genau wusste, was man von ihm wollte. Immer trällerte oder pfiff er irgendetwas vor sich hin, und wenn er den Mund auftat, was nicht oft geschah, hatte Vera alle Mühe, ihn zu verstehen, weil er so schnell und leise sprach. Aber offensichtlich liebte er Nadja abgöttisch. Er las ihr jeden Wunsch von den Lippen ab und behandelte sie wie eine Prinzessin. Als Mutter freute sich Vera darüber, auch wenn ihr bisweilen Zweifel kamen, ob es Nadja auf die Dauer guttat, derart verwöhnt zu werden.
Die beiden hatten einen Cottage Pie zubereitet, der für Veras Geschmack zwar zu schwach gewürzt war, sonst aber ganz ordentlich schmeckte. Weder Tom noch Nadja waren begnadete Köche und gaben gern zu, dass sie oft im Pub assen oder sich in Taunton mit tiefgefrorenen Pizzas und Frühlingsrollen eindeckten, die sie dann vor dem Fernseher assen. Immerhin sassen sie heute alle am Tisch, es gab sogar Wein, nachdem sie zuvor mit Champagner auf Veras einjähriges ‹Sabbatical› angestossen hatten.
«Ja, was ich nicht alles tun und erleben möchte in diesem Jahr! Malen, Somerset und Devon erkunden – allein oder mit euch –, mein Englisch aufpolieren und möglichst mich ins Dorfleben mischen.»
«Wir werden dir dabei helfen, Mama. So einfach ist es hier nämlich nicht, unter die Leute zu kommen.»
«Es sei denn», räumte Tom schmunzelnd ein, « du gehst jeden Sonntag in die Kirche. Die Kirche ist der ideale Ort für Bekanntschaften.»
«Da werde ich sicher mal hingehen, aber nicht für den Gottesdienst. Ich habe in meinem Kunstführer gelesen, dass die Holzbänke der Kirche von Southcombe wertvolle mittelalterliche Schnitzereien aufweisen und es sonst noch interessante Dinge darin zu sehen gibt.»
«Nicht wahr, Tom, sogar ein Kirchenfenster von Burne-Jones gibts?»
Tom nickte. «Deren gibt es in der Gegend mehrere. Das von Southcombe ist nicht das schönste, dafür haben wir die skurrilsten Wasserspeier weit und breit und unser Hauptportal zählt mit seinen ornamentalen Reliefs zu den besterhaltenen von ganz Somerset.»
«Na, das klingt vielversprechend. Vielleicht sollte ich nächsten Sonntag eben doch zum Gottesdienst gehen.»
«Ach wo. Mach dir keine Sorgen, Mama. Leute wirst du auch sonst treffen. Der Blumenladen wäre schon mal eine gute Adresse. Mr. Lee kennt jeden im Dorf und er ist recht gesprächig. Und ich bin doch auch da.»
«Hast du schon viele Freunde im Dorf?»
«Freunde ist zu viel gesagt. Bekanntschaften schon, aber bis man sich mit jemandem anfreunden kann, dauert es eine Weile. Ich gehöre seit ein paar Monaten einem Badminton-Club an, das hilft. Wir sind etwa zehn, elf Frauen und treffen uns jeden Mittwochnachmittag im ‹Village Hall› zum Spielen. Das macht Spass, und ab und zu gehen wir auch mal abends nach Taunton zusammen essen. – Durch Tom habe ich natürlich auch ein paar Leute kennengelernt, aber das sind eher Freunde der Familie und gehören einer andern Generation an.»
Im Laufe des Abends erfuhr Vera noch allerlei Nützliches über das Leben in Southcombe und konnte sich auch ein klareres Bild vom Leben machen, das Nadja seit zwei Jahren hier führte. Neben Badminton gehörte Spazieren zu ihren Lieblingsbeschäftigungen, wenn sie nicht im Garten beschäftigt war; und neuerdings hatte sie sich sogar ein Fahrrad gekauft, um Tom an Wochenenden auf Touren zu begleiten.
«Und an Schlechtwettertagen bastle ich ein bisschen oder lese.»
«Basteln, du? Was denn?»
«Ach, allerlei. Ich verziere zum Beispiel Karten mit gepressten Blumenblättern oder Scherenschnitten. Die werden dann an Wohltätigkeitsbasars verkauft. Oder ich stricke Schals, auch das macht Spass.»
Vera erinnerte sich, dass Nadja am Anfang ihren Wegzug aus London bereut und sogar mit dem Gedanken gespielt hatte, in die Grossstadt zurückzukehren. Es war eine spannungsgeladene Zeit zwischen ihr und Tom gewesen. Das Leben in Southcombe sei ihr zu ruhig, schrieb sie, intellektuell zu anspruchslos. Allmählich hatte sie sich jedoch an ihre neue Heimat gewöhnt, und nun schien Vera, als blühte sie auf dem Land regelrecht auf. Aber ob diese Aufgaben sie wirklich erfüllten, war eine andere Frage. Vera hütete sich, schon am ersten Abend nachzuhaken.
Von Robert sprachen sie an diesem Abend nicht. Vielleicht war die Erinnerung an jene Tage vor anderthalb Jahren, als er noch mit ihnen an diesem Tisch gesessen hatte, so präsent, dass sie keiner Erwähnung bedurfte. Wegen der Fotos, die Nadja von ihm im Wohnzimmer aufgestellt hatte, konnte Vera nicht umhin, ständig an ihn zu denken. Wo sie hinblickte, begegnete sie ihm. Hier hielt er seine kleine Tochter im Arm, dort spielte er mit ihr an der Aare. Dann wieder kletterte er auf einen Berg oder winkte aus einem Zugfenster. Oder er stand knietief in einem türkisblauen Wasser, hinter ihm Palmen und die Front eines Hotels: die Malediven. Ihr zwanzigster Hochzeitstag. Dieses Foto schmerzte Vera am meisten.
Vielleicht träumte sie deswegen so intensiv von Robert in ihrer ersten Nacht in Station House: Er war noch ganz jung, sie hielten sich bei der Hand und gingen einem Bahngeleise entlang. Dann befanden sie sich plötzlich vor einem Abgrund, und er begann auf sie einzureden, dass sie ihm doch einen Schlitten kaufe, er wolle wieder ein Kind sein und mit ihr diesen Abgrund hinuntersausen. Er lachte dabei so seltsam, dass Vera Angst bekam. Sie hörte sich im Schlaf schreien. Beim Aufwachen merkte sie jedoch, dass nicht sie, sondern ein Vogel geschrien hatte. Wahrscheinlich eine Eule. Vera setzte sich auf und lauschte. Die Eule musste unweit des Hauses, vielleicht gar auf der Tanne am Ende des Gartens sitzen, jedenfalls hörte Vera die weiteren Schreie sehr deutlich, während sie sich im Dunkeln zu orientieren versuchte. Das Zimmer war ihr aber noch zu fremd, sie konnte weder Tür noch Schrank ausmachen, erkannte nur den Vorhang, der sich im Durchzug bewegte.
Wann hatte sie zum letzten Mal eine Eule schreien hören? Hatte sie als eingefleischtes Stadtkind überhaupt je eine gehört ausser im Zoo oder in einem Film? Wahrscheinlich nicht. Während des Frühstücks kam ihr jedoch in den Sinn, dass sie in einem Skilager im Bündnerland – sie mochte elf oder zwölf gewesen sein – einen Kauz gehört hatte und die Klassenkameraden sie anderntags ausgelacht hatten, weil sie meinte, eine Wildkatze streune nachts ums Chalet.
Als Vera am Morgen aufstand, lag Schnee auf dem Land. Vom Zimmer aus, das sie nach kurzer Überlegung zu ihrem Atelier erkoren hatte, genoss sie die Aussicht auf Weiden, durch die ein Bach floss, sowie, fernab, auf eine Hügelkette. Der Himmel hing tief und war von metallischem Grau. Von der Sonne keine Spur, nur hier und dort, zwischen den Wolken, ein Streifen rosaroter Helle.
Nach dem Frühstück wickelte Vera ihre Pinsel aus dem Futteral, packte Leinwände, Malkasten, Öle und Verdünnungsmittel aus und legte alles nebeneinander aufs Pult, das sie vorsorglich mit Zeitungspapier überzogen hatte. Mit Malen wollte sie sich allerdings noch Zeit lassen. Trotz der Kälte lockte die Gegend, und wenn sie auch noch keine Gummistiefel hatte, so würde sie mit Schweizer Bergschuhen gewiss problemlos wandern können.
Sie täuschte sich. Der Fussweg entlang den Feldern bis ins Nachbardorf, den ihr Nadja empfohlen hatte, wurde schon nach kurzer Zeit lehmig, sie begann sogar einzusinken und machte deshalb lieber kehrt, bevor sie im Sumpf steckenblieb.
Statt ins Haus zurückzugehen, entschloss sie sich zu einem Spaziergang ins Dorf, wo sie sich unter anderem die Kirche von Southcombe näher ansehen wollte. Der Präraffaelit Burne-Jones interessierte sie. Sie hatte kürzlich in einer Ausstellung in Bern sein Werk kennengelernt, grossformatige Bilder am Rande des Kitsches, deren Weltabkehr sie fasziniert, aber auch unangenehm berührt hatte. Nun bot sich ihr die Gelegenheit, ihre zwiespältige Haltung anhand eines Glasfensters zu überprüfen.
Die Kirche St. Michael stand auf einem quadratischen Gottesacker direkt an der High Street zwischen dem Coop-Laden und einem winzigen, zu unregelmässigen Zeiten geöffneten Bistro. Mit ihrem wuchtigen Turm überragte die Kirche das ganze Dorf. Vera öffnete das Eisentor, durchschritt eine von Eiben gesäumte Allee bis zum Hauptportal und betrachtete dieses eine Weile, bevor sie ins Innere des Gebäudes trat. Tom hatte ihre Neugier geweckt. Die einzelnen Figuren der Reliefs stachen scharf aus dem Hintergrund hervor. Vera machte allerlei Fabelwesen aus, die Fratzen rissen und deren Schwänze in Rankenornamente mündeten; diese bündelten sich an der Spitze des Portals und wuchsen zu einem früchteträchtigen Baum zusammen. Ein Apfelbaum, dachte Vera, die Grafschaft Somerset ist ja berühmt für ihren Apfelwein; dessen Herstellung geht bis tief ins Mittelalter zurück.
Die Kirche wies im Innern weitere verspielte Ornamente auf, in Sandstein gemeisselte an den Kapitellen und geschnitzte an den Enden der Kirchenbänke. Bei genauerer Betrachtung entdeckte Vera zwar allerlei Tiere, Affen, Löwen und verschiedene Vögel, darunter sogar einen Pelikan, der sich mit dem Schnabel die Brust aufsticht, um seine Kinder mit dem eigenen Blut zu ernähren, doch mehrheitlich gab es hier Pflanzen. Hierfür hatten die Handwerker ihrer buchstäblich blühenden Fantasie freien Lauf gelassen; sie hatten Rosen, Lilien sowie andere, botanisch undeutbare Blumen wild über die Gebäuderippen und die Kanzeltreppe wuchern lassen. Den legendären ‹Green Man›, aus dessen Mund Weinranken spriessen, fand Vera nicht. Stattdessen fiel ihr in der Kapelle die kleine liegende Figur einer Frau auf. Weizengarben oder Blumen entsprossen ihrem Bauch, und die Brüste verspritzten Milch fontänenartig in alle Richtungen. Ausser einem weit aufgerissenen Mund hatte das Weib keine erkennbaren Gesichtszüge, überhaupt schien sie im Gegensatz zu den Reliefs am Aussenportal wie verwischt von der Hand der Zeit und schimmerte wie hinter einem feinen Schleier durch. Ein Fuss war abgebrochen, und über den ganzen rechten Arm lief ein Riss. Vera hatte noch nie eine solche Gestalt gesehen und war ihr auch in keinem Kunstbuch begegnet. Da die Kirche bis zum 13. Jh. zurückging, musste sie annehmen, dass die Figur, wie auch die meisten Verzierungen, ungefähr aus derselben Zeit stammte.
Burne-Jones’ Kirchenfenster, dessentwegen sie gekommen war, mutete sie inmitten dieser urtümlichen Motive wie ein Stilbruch an. Schrill in den Farben, allzu lieblich in der Gestaltung. Es stellte den Erzengel Michael dar, dem die Kirche geweiht war. Geflügelt und von einer geradezu transzendentalen Anmut, schwebte der Engel auf einer Wolke, den Lockenkopf auf die Erde herabgesenkt, das Flammenschwert aus dem Schaft gezogen und ein Lindwurm, der sich zu seinen Füssen duckte. Vera pflichtete Tom in Gedanken bei; ein Kunstwerk war dieses Fenster nicht. Zu statisch und blutleer verfehlte es seine Wirkung inmitten der wuchernden Üppigkeit der Pflanzenmotive.
Fast schwindlig von den vielen Girlanden und Schnörkeln verliess Vera die Kirche durch ein Seitenportal. Über ihr begannen gerade die Glocken zu schlagen – elf Schläge.
Schneeflocken wirbelten in der Luft und ein unangenehmer Wind blies ihr entgegen. Mit hochgezogenem Mantelkragen wanderte sie eine Weile zwischen den Grabsteinen umher und las im Vorbeigehen Namen und Jahreszahlen. Überall hiess es ‹In Loving Memory of …› oder ‹Sadly Missed by …›, und bald fiel ihr auf, wie zäh der hiesige Menschenschlag sein musste, auch schon vor zweihundert Jahren. Die meisten Menschen waren sehr alt geworden, wenn sie nicht schon in jungen Jahren gestorben waren. Ja, mit wenigen Ausnahmen schien ihr, als stürbe man in Southcombe entweder vor dreissig oder erst weit über achtzig. Seit den Fünfzigerjahren war die Zahl der Einwohner, welche die Hundert überschritten hatten, auffallend angestiegen. Die meisten Gräber, manche davon keltische Kreuze, standen schief im Gras, verfallen und von Moos bedeckt.
Entlang der Mauer, welche den Acker auf der gegenüberliegenden Seite abgrenzte, reihten sich die neueren Gräber, saubere, schlichte Steine mit Blumen, die in dieser Witterung allerdings nicht lange frisch bleiben konnten. Braun und schlaff hingen sie in den Vasen, bereit für die Entsorgung. Bald würde auch die Unbekannte, die vor ein paar Tagen verunglückt war, hier liegen, schoss es Vera durch den Kopf, als sie auf den Ausgang des Gottesackers zustrebte. Der Gedanke versetzte ihr einen Stich ins Herz. Zwar kannte sie weder den Namen dieser Frau noch wusste sie etwas von deren Leben, aber die Tatsache, dass sie um ein Haar Zeugin ihres Todes geworden wäre, schaffte eine Art Verbindung. Sie versprach sich, in ein paar Tagen wiederzukommen und Blumen auf ihr Grab zu legen. Es war, wie sie glaubte, das Mindeste, was sie tun konnte. Doch wo befand sich eigentlich Mr. Lees Blumenladen?
Gleich neben dem Bistro zog eine knallgrüne Aufschrift ihre Aufmerksamkeit auf sich. Heute wollte Vera nichts kaufen, sondern begnügte sich, von der Strasse aus hineinzuspähen und die mit künstlichem Schnee besprühten Bouquets im Schaufenster zu betrachten. Im Ladeninnern leuchteten Rosen und auf verschiedenen Regalen reihenweise rote und weisse Zyclamen. Die Tulpen- und Osterglockenzwiebeln, die ihr Nadja ans Herz gelegt hatte, bot Mr. Lee in grossen Säcken am Eingang feil, mit einem Schäufelchen, das zur Selbstbedienung einlud. Ein andermal vielleicht, dachte Vera, wobei sie zweifelte, ob sie sich während ihres Sabbatjahres aufs Gärtnern einlassen wollte. Die Zeit schien ihr zu schade dafür, sie hatte sich vorgenommen, nur das zu tun, wovon sie seit Jahren träumte: malen und vor allem geniessen, nichts tun zu müssen. Bei Pflanzen musste man aber immer irgendetwas zu einer bestimmten Zeit tun: schneiden, düngen und spritzen, vom Jäten nicht zu reden. Aber Schnittblumen, das war was anderes. Warum nicht sich von Zeit zu Zeit was Buntes und fein Duftendes ins Haus holen, einfach so, zur eigenen Freude?
Einstweilen beschäftigten Vera jedoch ganz andere Dinge als Blumen. Die alten Schiebefenster von Station House waren undicht, das hatte sie zwar schon am ersten Tag zu spüren bekommen, aber nun sanken die Temperaturen auf minus 10 Grad, und die Luft, die durch die Spalten drang, sorgte im Haus für eine kaum auszuhaltende Kälte. Vera drehte alle Heizungen auf, stopfte Wollsocken in die Spalten und lieh sich von Nadja einen elektrischen Heizofen aus. Aber es nützte wenig, das Haus blieb ungemütlich, und Vera ertappte sich dabei, mit Nostalgie an ihre warme Wohnung in Bern zu denken.
Sie hatte den kältesten englischen Dezember seit hundert Jahren erwischt. Die Fernsehnachrichten zeigten dramatische Bilder einer von Schnee, Eis und Sturm lahmgelegten Insel. Die Flughäfen von Heathrow und Gatwick mussten schliessen und in einzelnen Teilen des Landes sogar die Schulen. Wo Streusalz und Kies ausgingen, herrschte Chaos. Somerset schien vom Schlimmsten verschont zu bleiben, aber darin fand Vera wenig Trost; in ihren eigenen vier Wänden erfror sie fast. Längere Zeit still zu sitzen, ob beim Malen oder beim Schreiben von Mails, war unmöglich. Trotz Handschuhen bekam sie sofort klamme Finger und zitterte so sehr, dass sie den Pinsel nicht still halten, geschweige denn die richtigen Computertasten treffen konnte.
Nichts wie raus, lautete deshalb die Devise. In Moonboots und gefüttertem Steppmantel stiefelte Vera durch den Schnee, ging kreuz und quer über die Felder, in denen die Schafe plötzlich nicht mehr so weiss schienen, erkundete Nachbardörfer und Täler. Manchmal zog es sie auch nur den Hügel hinter Southcombe hoch zu Greenhill Park. Das Anwesen stand malerisch am Ende eines Pfads mit Brombeerstauden und Brennnesseln an beiden Seiten.
Auf einem der Prospekte von Mrs. Moore wurde Greenhill Park mit seinen Stallungen und Dependancen als touristische Attraktion gepriesen, nicht so sehr seiner klassizistischen Architektur wegen, sondern weil es anfangs der Neunzigerjahre einmal als Kulisse für einen starbesetzten Thriller gedient hatte. Robert de Niro hatte sich nach einer wilden Verfolgungsjagd durch die englische Countryside hier verschanzt. Von einem Balkon aus hatte er auf Ben Kingsley geschossen, der nach ein paar wankenden Schritten auf der Freitreppe tot zusammengebrochen war. Für die Dreharbeiten hatte man die ersten Zerfallserscheinungen von Greenhill Park noch geschickt kaschiert. Jetzt waren die Fensterscheiben herausgeschlagen, die Türen vernagelt und das Betreten des Gebäudes wegen Einsturzgefahr verboten. Man genoss aber nach wie vor eine gute Aussicht auf die Quantock Hills und umliegenden Weiler. Vera machte während ihrer Ausflüge eine Reihe von Skizzen, die sie später zu Bildern ausarbeiten wollte.
Sie war viel unterwegs in diesen klirrend kalten Dezembertagen, auch weil sie Nadja nicht das Gefühl geben wollte, sie müsse sich um sie kümmern. Nadja hatte anderes zu tun. Karten für den kommenden Weihnachtsbasar basteln, Geschenke einkaufen und eine grössere Dinnerparty für Toms Kollegen vorbereiten. Vera bot ihr spontan ihre Hilfe an, als sie ihr eines Nachmittags auf dem Nachhauseweg zufällig vor dem Pfarrhaus begegnete.
«Nein, nein, das wird schon. Ich komme allein zurecht, danke. Die Zeit vor Weihnachten ist bloss etwas stressig. Es gibt so viel Kleinkram zu erledigen, da verliere ich manchmal die Übersicht.»
«Eben darum. Ich könnte dir doch ein paar Sachen abnehmen. Wir könnten zum Beispiel diese Karten zusammen basteln, dann ginge es schneller.»
«Meinst du? Aber nein, wenn du siehst, was ich mache, kriegst du bestimmt Schreikrämpfe. Verglichen mit den Bildern, die du malst, ist das alles Kindergartenzeug. Das kann ich dir nicht zumuten.»
«Ach, Nadja, sei doch nicht so. Ausserdem verfolge ich auch eigene Interessen mit diesem Angebot. Glaub mir, ein paar Stunden in der Wärme wären ein wahres Geschenk für mich.»
Dieses Argument schien sie zu überzeugen. «Okay, so gesehen hast du recht. Und schliesslich will ich doch auch von meiner Mama profitieren, wenn sie schon in meiner Nähe wohnt. Basteln wir also diese verflixten Neujahrskarten zusammen.»
«Also, wann soll ich kommen?»
«Wann du willst.»
«Wie wärs zum Beispiel mit Montag? So habt ihr erst mal ein ruhiges Wochenende für euch.»
Nadja rechnete stirnrunzelnd nach. «Montag, sagst du. Das ist aber der 21.»
«Und?»
«Der 21. geht nicht.»
Der schroffe Ton ihrer Stimme machte Vera stutzig.
«Nun … so schlag du was vor. Mir ists egal.»
«Der 22.?»
«Abgemacht.»
Sofort hellte sich Nadjas Gesicht wieder auf. «Danke, Mama, wir machen uns dann einen gemütlichen Tag zusammen, nicht wahr?»
«Klar. Doch nun erst mal zurück in meinen Kühlschrank.»
«Ich habe ganz vergessen, dir zu sagen, dass Tom deswegen seine Eltern eingeschaltet hat. Sie sind mit Mrs. Moore befreundet; übermorgen fliegen sie aus Dubai zurück, dann werden sie mit ihr reden, damit sie endlich was unternimmt. Eine bessere Isolation oder so.»
«Ja, das wäre wirklich nötig. Ich frage mich bloss, wie die vorigen Mieter den Winter überlebt haben.»
«Das war ein Mann. Und der hat nur von Frühling bis Herbst in Station House gewohnt. Sonst hätte Mrs. Moore wohl längst was gegen die Kälte getan. Aber ich muss los, Mama. Tom kommt gleich nach Hause, und für High Tea habe ich noch rein gar nichts vorbereitet.»
Mit diesen Worten sprang Nadja davon. Nicht mehr ganz so leichtfüssig wie früher, stellte Vera fest, während sie ihr nachblickte. Ja, Nadja wog eindeutig ein paar Pfund mehr seit ihrem letzten Besuch, und da war auch dieser plötzliche Launenwechsel, eine kurze Verdunkelung, die wohl nichts zu bedeuten hatte, und doch …
2
Er hatte Zeit.
Die ganze Nacht, wenn er wollte. Trotzdem würdigte er die Tote nur eines kurzen teilnahmslosen Blickes, bevor er die Schere an den Kragen ihres Gewandes setzte und es bis zum Nabel aufschnitt. Ein dünner, von Flecken übersäter Oberkörper kam zum Vorschein, winzige Brüste, vorstehendes Brustbein, die Rippen tastbar; alles in allem leichte Arbeit, schätzte er; nicht wie vor drei Jahren, als er zuerst Schicht um Schicht Fett hatte abtragen müssen.
Er mied das Gesicht, während er arbeitete. Früher pflegte er es mit einem Tuch zuzudecken, damit er nicht in Versuchung geriet, es sich einzuprägen. Inzwischen hatte er jedoch gelernt, seine Aufmerksamkeit auf die wenigen Quadratzentimeter zu beschränken, innerhalb deren er operierte. Glitten die Augen dennoch einmal höher als bis zum Kinn hinauf, kniff er sie zusammen und atmete mehrmals tief durch. Er hatte Angst, dass das Gesicht ihn in seinen Träumen heimsuchen würde. Die Erinnerung an die Erste – Judith hatte sie geheissen und keine neunzehn Jahre alt war sie gewesen – konnte ihn noch heute, acht Jahre danach, aus dem Schlaf schrecken. Ihr Gesicht war so freundlich gewesen, wie beseelt von einer grossen Zuversicht. Und die Frische erst, die kaum verblasste Farbe auf Lippen und Wangen. Niemals hätte er bei einer Toten solche Spuren von Lebendigkeit erwartet. Er hatte sich zwingen müssen, die Werkzeuge nicht abzulegen und unverrichteter Dinge abzuhauen. Heute Nacht bestand dazu aber keine Gefahr, er fühlte sich ruhig und seiner Aufgabe gewachsen; dankbar auch, dass er für einmal die Frau nicht persönlich gekannt hatte.
Mit Zeige- und Mittelfinger tastete er die Stellen unterhalb der linken Brust ab, setzte das Messer an und begann langsam die Haut aufzuritzen. Sofort platzte das Fleisch unter der Klinge wie ein schmaler Mund auf. Blut floss kaum; nach vier Tagen hatte er es nicht anders erwartet.
Er arbeitete bedächtig, aber ohne Präzision. Um saubere Arbeit ging es hier nicht. Mit wenigen Schnitten löste er die linke Brust vom Rumpf, dann schabte er Fleischpartikel von den blossgelegten Rippen und brach mit der Zange den Thorax auf. Ein scharfer Geruch, den er nur zu gut kannte, entströmte dem Fleisch. Unwillkürlich trat er einen Schritt zurück. Er begann zu schniefen und wischte sich den Schweiss von der Stirn, bevor er sich besann, mit der Arbeit fortzufahren. Draussen hörte er die dumpfen Schritte und Stimmen von Passanten. Dann die neun Schläge von der Kirche gegenüber. Plötzlich fühlte er sich müde. Er spürte das Bedürfnis, sich zu setzen. Aber halbe Arbeit ist keine Arbeit, er musste die seine zu Ende bringen, das war die Abmachung. Also beugte er sich wieder über die Tote, schob beherzt die Hand unter die Luftröhre und drückte die Lungenflügel gegen das Rippengehäuse. «Verzeih», entfuhr es ihm, als er Aorta und Hohlvene durchtrennte und nach kurzem Wühlen den faustgrossen Herzmuskel mit einem Ruck aus dem Brustkorb riss.
Um zwanzig vor zehn verliess er das Haus. Wenige Minuten später stiess er die Tür des ‹Kings Arms› auf und bestellte einen doppelten Whiskey, den er in einem Zug hinunterkippte. Dann schaute er sich rülpsend um und starrte ins Leere. Eine Schnulze lief im Radio, was Trauriges über unerwiderte Liebe und Einsamkeit.
Ausser ihm befanden sich an jenem Abend drei Gäste im Pub: John Griffiths, der Klempner von Giverton, der alte Klavierbauer Rosenbaum und sein Sohn Josh. Griffiths sass allein am Kamin mit dem Rücken zum Saal. Alle paar Sekunden griff er in seine Chipstüte, ohne den Blick von der Sportzeitung zu heben, während Rosenbaums mit wilden Gebärden ihrem Ärger über Bankenboni und die bevorstehende Erhöhung der Mehrwertsteuer von 17 auf 20 Prozent Luft machten.
Er tauschte mit keinem der Gäste ein Wort. Nach zwei weiteren doppelten Whiskeys glitt er vom Hocker und taumelte unbeachtet hinaus. Es war Viertel nach zehn …
3
… und auf dem Kontinent Viertel nach elf. Jason streifte sich die Armbanduhr vom Handgelenk und stieg in die Dusche. Er wusch sich die Erde von den Händen, den Kaminrauch aus den Haaren, schrubbte Schweiss und Dreck von Beinen, Bauch und Oberkörper und dachte, wie beschissen das Leben doch ist, dass man sich mit dem Schwamm nicht auch gleich die Vergangenheit vom Leib rubbeln kann. Die Albträume würden fortgespült, die Lügen sich wie eine alte Haut von ihm lösen, und da stünde er dann wie neugeboren mit seinen neunundzwanzig Jahren, ein unbeschriebenes Blatt – und frei.
Ja, frei vor allem. Wie die Möwen über ihm, die, vom Schlechtwetter landeinwärts getrieben, einander von den Dächern des Châteaus aus zuheulten. Sie konnten fliegen, wohin sie wollten, diese Biester, der ganze Himmel gehörte ihnen. Doch wie laut sie plötzlich schrien. Verdächtig laut. Hatte er etwa das Fenster offen gelassen? Oder vergessen, das Zimmer zu verriegeln und die Kommode vorzuschieben?
Von Hals bis Kopf eingeseift kletterte Jason aus der Wanne und spähte durch den Spalt der Badezimmertür ins Zimmer. Er liess die Augen über den Spannteppich wandern, sah seine Socken, daneben ein zusammengeknülltes Papiertaschentuch, den Thriller, den er am Vortag zu Ende gelesen hatte, weiter rechts das Bett und schliesslich die Kommodenkante. So weit alles in Ordnung, die Kommode stand an ihrem Platz, und Tür und Fenster waren geschlossen. Wie hätte es auch anders sein können. Er erinnerte sich sofort wieder ans Schlüsseldrehen und Schieben. Undenkbar, sie je zu vergessen. Und doch musste er immer wieder kontrollieren. Ein regelrechter Zwang war das.
Nach der Dusche liess sich Jason aufs Bett fallen und griff zur Fernbedienung. Auf dem Nachttisch hatte er ein Käsebrot und eine Banane bereitgestellt, dazu eine Zweiliterflasche Cola Light. Daraus trank er in kleinen Schlucken, während er sich durch die unverständlichen Reklamen und Shows zappte.
Drei Jahre in der Picardie, und noch immer war die französische Sprache für ihn ein Buch mit sieben Siegeln. Ein paar Floskeln konnte er: «Merci beaucoup», «Au revoir», «S’il vous plaît» und dergleichen; gerade genug, um im Dorf nicht durch Unhöflichkeit aufzufallen und am Sonntagmorgen in der Boulangerie sein Croissant zu erstehen. Mehr benötigte er nicht, er ging ja kaum unter Menschen. Und wenn, dann meist im Schlepptau von Rich and Frances, die ihn zum Tragen ihrer Einkäufe brauchten oder bei der Auswahl neuer Bäume in der Gärtnerei als Ratgeber dabeihaben wollten. Dafür musste er nicht unbedingt wieder hinter die Schulbücher. Rich und Frances sprachen ja auch kaum Französisch. Frances vielleicht etwas mehr als Rich, aber einen fliessenden Satz hatte Jason noch nie aus ihrem Mund gehört. Seit über zwanzig Jahren verlebten die beiden den Sommer in ihrem Château wie auf einer englischen Insel. Irgendwie gings. Die Lokalbehörden schalteten im Notfall einen Dolmetscher ein, wenn es mit der Kommunikation harzte. Wie vor zwei Jahren, als Teile des Grundstücks überschwemmt waren und die Versicherung für die Reparaturkosten des Pools nicht hatte aufkommen wollen. Und wenn ‹Les Anglais›, wie man das Paar in der Gegend nannte, mal Besuch erhielten, dann handelte es sich um Freunde von jenseits des Kanals, um andere ‹Anglais› eben.
Als Rich ihm im Pub von seinem Schloss in Frankreich erzählt hatte und davon, wie heikel es sei, das Gut über die Wintermonate unbewohnt zu lassen, hatte Jason aufgehorcht. Rich hatte getrunken. Er schwafelte, und allzu ernst konnte Jason ihn nicht nehmen, als er begann, sein Château mit Ländereien und Wäldern zu schildern, mit Pool und Tennisplatz und einem Treibhaus, das er für die Zucht von Sukkulenten herrichten wollte. Mit solchen Märchen musste man ihm nicht kommen. Zwei Jahre hinter der Bartheke hatten ihn einiges gelehrt, zum Beispiel, nicht alles für bare Münze zu halten, was man ihm nach ein paar Pints Bier erzählte. Ein Château! So was Hirnverbranntes. Lords wohnen in Schlössern, aber nicht Kerle wie Rich, die am Freitagabend nach der Arbeit im Pub hängenbleiben und dem erstbesten Barman ihr Herz ausschütten. Rich arbeitete in einem jener gläsernen Hochhäuser hinter dem berühmten ‹Gherkin›, in irgendeiner Bank oder Treuhandgesellschaft, genau wusste es Jason nicht. Aber eines war klar: Schlossbesitzer haben es nicht nötig zu arbeiten, also war sicher was faul an Richs Geschichte. Rich hatte aber nicht lockergelassen. Am folgenden Freitag hatte er ein paar Fotos aus der Westentasche gezogen und sie wie ein siegesgewisser Pokerspieler vor Jason ausgebreitet.
«Na, Jason, was denkst du jetzt von meinem Château?»
«Nicht übel, ja.»
Ein Château im klassischen Sinn war es zwar nicht, jedenfalls nicht, was er unter einem solchen verstand; aber mit seinen Säulen am Eingang und den beiden weiten, symmetrisch angelegten Wohnflügeln wirkte das Anwesen durchaus herrschaftlich. Bloss die Natur ringsum schien verkommen, Gestrüpp entlang den Wegen, der Nadelwald stellenweise gelichtet, womöglich von Käfern befallen.
«Und wo befindet sich denn dein Schloss genau?»
«Nicht weit von der Mündung der Somme über St. Valéry. Sagt dir das was?»
«Nee. Null Ahnung.»
«Warst du überhaupt schon mal in Frankreich?»
Jason schüttelte den Kopf. «Früher gingen wir nach Spanien in die Ferien, aber damals war ich noch klein. Ausser der langen Autofahrt ist mir kaum was in Erinnerung geblieben.»
«Und danach?»
«Danach? Nichts. Es braucht Geld, um von England wegzukommen. Das hab ich nicht.»
«Bist du also nie mehr drüben gewesen?»
«Nein.»
«Möchtest du mal weg?»
«Weiss nicht. Vielleicht. Aber ich kann jetzt nicht weiterplaudern. Ich muss arbeiten, sonst schnauzt mich der Boss wieder an. Er ist ohnehin übelster Laune in letzter Zeit, die Frau ist ihm kürzlich davongelaufen. – Kann ich, unter uns gesagt, bestens verstehen. Mit so einem Arsch hält es keine normale Frau aus.»
Nach diesem Gespräch war Rich eine Weile nicht mehr aufgetaucht. Aber Jason hatte ihn und sein Schloss nicht vergessen. Warum hatte Rich gefragt, ob er mal nach Frankreich reisen möchte? Hatte er etwa ein Auge auf ihn geworfen? Er wäre nicht der erste Mann gewesen, der sich von Jason mehr als eine Kumpelfreundschaft erhoffte. Doch da war man bei ihm an der falschen Adresse, das war überhaupt nicht sein Ding. Und überhaupt: Was Rich sich wohl dachte in seinem Alter, mit diesem schütteren Haar, diesen Tränensäcken und kaputten Zähnen? Fast wurde Jason im Nachhinein wütend, wenn er an Rich dachte. Aber das Schloss war verlockend, darüber nachzudenken lohnte sich. Nicht, dass Jason sich vom Luxus blenden liess. Ob Schloss oder Studio, war ihm eigentlich egal. Es ging ihm nur um die Lage. Um die Tatsache, dass das Schloss Hunderte von Meilen weit von seinem Heimatort entfernt lag. Wenn das nicht ein Wink des Schicksals war. Jason zögerte nicht. Als Rich eines Abends das Pub wieder betrat und sein gewohntes Pint bestellte, packte er seine Chance beim Schopf.