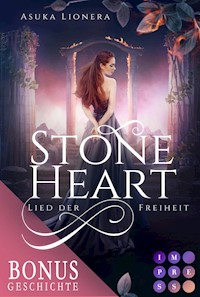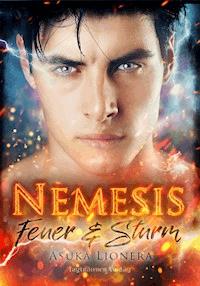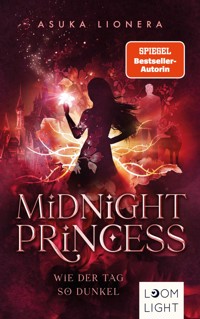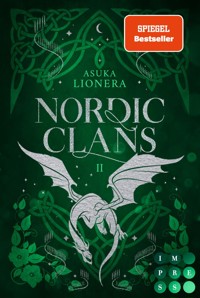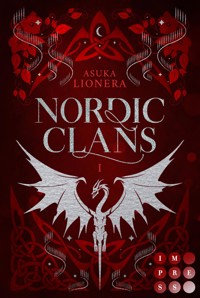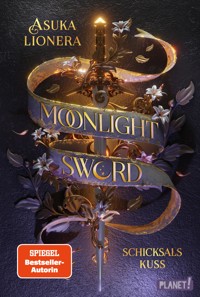8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Carlsen
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
**Tauch ein in das Reich der nordischen Götter und Sagen!** Die Archäologin Emma hält sich mehr schlecht als recht mit unterbezahlten Praktika über Wasser. Als sie sich während einer Expedition in das höhlenartige Gefängnis eines riesigen Wolfs verirrt, scheint sich das Blatt jedoch zu wenden. Denn als Emma das riesige Tier von seinen goldenen Fesseln befreit, sieht sie sich plötzlich einem mysteriösen Mann gegenüber. Ein Wesen, halb Mensch halb Wolf? Diese außergewöhnliche Entdeckung könnte Emmas finanzielle Unabhängigkeit für immer absichern. Doch dann nimmt sie der gut aussehende Fremde in ein Reich voller nordischer Götter mit, das sie ihre wahre Bestimmung entdecken lässt. Und allem voran die Liebe. Die nordische Mythologie einzigartig und neu verpackt »Son of Darkness« ist ein Urban-Fantasy-Liebesroman in zwei Bänden, der mit überraschenden Wendungen aufwartet. Ein Must-Read für Fantasy-Fans von »Thor« und den Mythen Asgards. Einmal angefangen zu lesen, kannst du dich dem Sog dieser außergewöhnlichen und magischen Welt nicht mehr entziehen! Leserstimmen auf Amazon: »Für Liebhaber der Nordischen Mythologie und die, die es werden wollen!« »5 Sterne und mehr!« »Ein Meisterwerk!« »Neues Lieblingsbuch!« //Dies ist ein E-Book-Sammelband zur mystisch-dramatischen Buchserie »Son of Darkness«. Alle Romane der Fantasy-Liebesgeschichte: -- Band 1: Son of Darkness. Göttliches Gefängnis -- Band 2: Son of Darkness. Goldene Bedrohung// »Son of Darkness« ist eine lektorierte Neuauflage von Asuka Lioneras »Fenrir. Weltenbeben«.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Impress
Die Macht der Gefühle
Impress ist ein Imprint des Carlsen Verlags und publiziert romantische und fantastische Romane für junge Erwachsene.
Wer nach Geschichten zum Mitverlieben in den beliebten Genres Romantasy, Coming-of-Age oder New Adult Romance sucht, ist bei uns genau richtig. Mit viel Gefühl, bittersüßer Stimmung und starken Heldinnen entführen wir unsere Leser*innen in die grenzenlosen Weiten fesselnder Buchwelten.
Tauch ab und lass die Realität weit hinter dir.
Jetzt anmelden!
Jetzt Fan werden!
www.impressbooks.de Die Macht der Gefühle
Alle Rechte vorbehalten. Unbefugte Nutzungen, wie etwa Vervielfältigung, Verbreitung, Speicherung oder Übertragung, können zivil- oder strafrechtlich verfolgt werden.
In diesem E-Book befinden sich eventuell Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass sich die Carlsen Verlag GmbH die Inhalte Dritter nicht zu eigen macht, für die Inhalte nicht verantwortlich ist und keine Haftung übernimmt.
Impress Ein Imprint der CARLSEN Verlag GmbH © der Originalausgabe by CARLSEN Verlag GmbH, Hamburg 2020 Text © Asuka Lionera, 2019 Lektorat: Nina Schnackenberg Coverbild: shutterstock.com / © Zdenka Darula / © Szczepan Klejbuk / © kiuikson / Adobe Stock / © rcfotostock / © Niko_Cingaryuk / © Tryfonov Covergestaltung der Einzelbände: Laura Welslau Gestaltung E-Book-Template: Gunta Lauck / Derya Yildirim Satz und E-Book-Umsetzung: readbox publishing, Dortmund ISBN 978-3-646-30233-2www.carlsen.de
Asuka Lionera
Son of Darkness 1: Göttliches Gefängnis
**Wir leben in der Dunkelheit und warten auf den einen Tag, an dem wir endlich strahlen können.**Für die ehrgeizige Archäologin Emma zählt nach der Trennung von ihrem Ex nur eins: die finanzielle Unabhängigkeit. Von der ist sie als schlecht bezahlte Praktikantin jedoch meilenweit entfernt. Bis sie sich während einer Expedition in das höhlenartige Gefängnis eines riesigen schwarzen Wolfs verirrt. Allen Gefahren zum Trotz befreit sie das Tier – und sieht sich plötzlich einem dunkelhaarigen Fremden gegenüber, dessen göttlich blaue Augen nicht von dieser Welt sein können. Emma glaubt eine sensationelle Entdeckung gemacht zu haben. Sie ahnt nicht, dass sich um den gut aussehenden Mann eine uralte Prophezeiung rankt, die mehr als nur eine Welt zu zerstören droht …
Wohin soll es gehen?
Buch lesen
Vita
Das könnte dir auch gefallen
© rini
Asuka Lionera wurde 1987 in einer thüringischen Kleinstadt geboren und begann als Jugendliche nicht nur Fan-Fiction zu ihren Lieblingsserien zu schreiben, sondern entwickelte auch kleine RPG-Spiele für den PC. Ihre Leidenschaft machte sie nach ein paar Umwegen zu ihrem Beruf und ist heute eine erfolgreiche Autorin, die mit ihrem Mann und ihren vierbeinigen Kindern in einem kleinen Dorf in Hessen wohnt, das mehr Kühe als Einwohner hat.
Für Sammy
(2009 – 2016)
Für immer im Herzen.
Prolog
Dies ist keine Geschichte, in der sich das Mädchen in den strahlenden Helden verliebt und alle glücklich bis ans Ende ihrer Tage leben. Liebe ist nicht immer wundervoll. Manchmal ist sie auch zerstörerisch, und die, die lieben, sind bereit, alles zu vernichten, was ihnen im Weg steht.
Diese Erfahrung musste ich schmerzlich am eigenen Leib erfahren.
Ich starre hinaus in die endende Nacht, während ich die Finger so fest um die steinerne Brüstung kralle, dass sie schmerzen. Dort drüben, hinter den verschneiten Bergen, sehe ich bereits den ersten hellen Streif, der einen neuen Tag ankündigt.
Der Tag, der der letzte sein wird. Für mich. Für alle Lebewesen. Für alle Welten.
Und ich bin schuld daran. Ich ganz allein.
Verbissen blinzele ich die Tränen zurück, die mir in den Augen brennen, und schaue der Sonne zu, wie sie langsam den Horizont erklimmt. Das ist also der letzte Sonnenaufgang, den ich jemals erleben werde. Es ist ein wunderschöner Anblick, so anders als in der Welt, die ich bisher mein Zuhause nannte, und doch so ähnlich, dass es mir schier das Herz zerreißt.
Ich trage die Schuld am Tod allen Lebens. Ich bin dafür verantwortlich, dass die Sonne und mit ihr alles Licht für immer verschwinden wird.
Ein Zittern erfasst meinen Körper und ich schlinge beide Arme um mich, im verzweifelten Versuch, es irgendwie zu dämpfen, doch es ist zwecklos. Ich kann mich selbst nicht so halten, wie er es könnte, doch er wird mich nie wieder in seine starken Arme ziehen und festhalten. Nie wieder wird er mir zuflüstern, dass alles gut werden wird und wir nur stark sein müssen. Dass wir jedes Hindernis überwältigen können, wenn wir zusammenhalten.
Doch er ist nicht hier. Er wird nie wieder hier bei mir sein.
Irgendwo dort draußen, weit hinter den Bergspitzen, die gerade von der Sonne geküsst werden, ist der Mann, den ich liebe. So nah, dass ich das Gefühl habe, ich müsste nur die Hand ausstrecken, um ihn zu berühren und doch ist er so unerreichbar fern wie der Horizont. Er ist der Mann, der alle Welten und alle Menschen, die ich kenne, in seinem Zorn vernichten wird.
Nie hätte ich mir träumen lassen, dass ich eines Tages in einer mir fremden Welt auf den Tod warten würde. Und doch spüre ich keinen Hass und keine Angst, nur Bedauern.
Bedauern darüber, dass ich es so weit kommen ließ, denn ich war die Einzige, die ihn hätte aufhalten können.
Es ist zu spät, das Geschehene zu ändern. Doch auch auf die Gefahr hin, dass es hart klingt: Ich bin mir gar nicht sicher, ob ich etwas anders machen würde, wenn ich die Chance dazu bekäme. Abgesehen von der drohenden Apokalypse waren die letzten zwei Monate die schönsten und spannendsten meines Lebens und ich bin froh, dass ich sie mit ihm verbringen durfte.
Auch wenn das bedeutet, dass ich nie wieder einen Sonnenaufgang sehen werde.
Kapitel 1
Zwei Monate zuvor …
Meghan dreht sich zu mir und schürzt die vollen Lippen. Sie muss sich weit zu mir herunterbeugen und mir regelrecht ins Ohr schreien, um die dröhnende Musik zu übertönen. »Und du bist dir wirklich sicher, dass du allein hierbleiben willst?«, fragt sie mich zum gefühlt hundertsten Mal.
Ich verdrehe nur die Augen und gebe ihr mit einer Handbewegung zu verstehen, dass sie endlich verschwinden soll. Diesmal lässt Meg sich nicht lange bitten, hakt sich bei dem Typen, den sie für die heutige Nacht aufgegabelt hat, unter und zerrt ihn aus der Bar. Erst als sie durch die Tür verschwunden sind, spüre ich, wie mir das aufgesetzte Lächeln aus dem Gesicht fällt. Seufzend wende ich mich wieder dem Cocktail zu, der einsam auf dem klebrigen Tisch vor mir steht.
Ich bin es gewohnt, dass sie mich nach ein paar Stunden allein sitzen lässt, wenn ich mit ihr ausgehe. Allein ihr Anblick zieht die Kerle an wie das Licht die Motten. Meistens kann Meg sich abends vor Angeboten kaum retten, während ich unbeachtet in einer Ecke sitze und an meinem alkoholfreien Cocktail schlürfe. Meine heutige Getränkewahl trägt den Namen Don Juan – wie ironisch.
Tja, wenigstens musste ich mir heute nicht von Meg anhören, wie gut ich es doch in meinem Job hätte. Das ist ein Thema, was fast schlimmer ist, als sitzen gelassen zu werden.
Dabei liebe ich meinen Job. Zumindest meistens. Er ist anders, er ist abwechslungsreich, aber oft auch unwahrscheinlich nervig und enttäuschend. Dennoch ist meine Arbeit das, was mich ausmacht und mein Leben zu etwas Besonderem macht. Was mich zu etwas Besonderem macht. Vielleicht bin ich auch selbst schuld, dass mich Meg ständig mit Fragen löchert, immerhin erzähle ich ihr nur von den Sonnenseiten meines Jobs. Langweilige oder gar gefährliche Aspekte wie die brütende Hitze, giftige Skorpione und Stiefel voll scharfkantigem Wüstensand lasse ich meistens aus.
Ich schaue auf den leeren Platz neben mir und angele nach meiner Handtasche, um die Drinks zu bezahlen. Danach muss ich mir ein Taxi rufen, um ebenfalls aus dieser Bar zu verschwinden. Daheim werde ich mir eine DVD schnappen und es mir auf dem Sofa gemütlich machen. Das hätte ich von Anfang an tun sollen. Aber nein, ich ließ mich wieder mal von Meg dazu überreden, mit ihr um die Häuser zu ziehen, weil ich endlich mal wieder im Lande sei.
Ich winke den Kellner herbei und signalisiere ihm, dass ich bezahlen will. Nachdem ich ihm ein nettes Trinkgeld hinterlassen habe, schnappe ich mir meine Tasche und die dünne Jacke und bahne mir einen Weg durch die sich im Takt wiegende Menschenmasse. Schon traurig, dass bei der großen Auswahl nicht ein Kerl für mich dabei war. Ich gebe es ungern zu, aber nachdem ich Monate im heißen Sand der Sahara gebuddelt habe, während mir die Sonne schier die Haut vom Leib brannte, hätte ich echt nichts gegen ein paar nette Stunden mit dem anderen Geschlecht einzuwenden.
Im Geiste wähle ich schon die DVD aus, die ich mir nachher ansehen werde. Irgendwas mit einem halb nackten Channing Tatum und dann ist wieder Autoerotik angesagt. Warum gibt es eigentlich von solchen Promis keine illegalen Pornos im Netz? Das wäre doch mal was!
Aber wieder einmal muss ich allein den Nachhauseweg antreten. Das kommt davon, wenn ich mit Meg losziehe. Neben ihr versinke ich in der Bedeutungslosigkeit. Wer Meg nicht bemerkt, muss entweder blind sein oder sich schon im Delirium befinden. Ich weiß bis heute nicht, warum sie nicht modelt, sondern den ganzen Tag in einem Büro hockt. Eine Schande, dieses Gesicht zu verstecken, das perfekt von ihren schulterlangen, leicht welligen schwarzen Haaren eingerahmt wird. Klein und zierlich wie sie ist, schafft sie es, jeden Kerl mit einer funktionierenden Libido mit einem einzigen Augenaufschlag um den Finger zu wickeln.
Ich bin das komplette Gegenteil. Mit meinen knapp eins achtzig überrage ich einen Großteil der anwesenden Frauen und Männer und die gut fünfzehn Kilo zu viel auf den Rippen tragen auch nicht gerade dazu bei, dass einem bei meinem Anblick das Wort zierlich in den Sinn kommt. Zwar kann ich mit Rundungen an den richtigen Stellen aufwarten, aber allein meine Körpergröße schreckt die meisten schon ab. Hinzu kommt meine kantige Gesichtsform mit dem zu breiten Unterkiefer, die mir schon immer etwas Herbes verliehen hat.
Ich seufze. Nein, süß und zierlich bin ich definitiv nicht. Ich bin zwar kein hässliches Entlein oder gar hoffnungslos entstellt und habe durchaus weibliche Reize, aber im direkten Vergleich zu Meghan bin ich eben … einfach nur ich.
Wenigstens hat die afrikanische Sonne mein langweiliges, straßenköterblondes Haar ein wenig aufgehellt, sodass es jetzt aussieht, als hätte ich mir blonde Strähnchen machen lassen. Zur Feier des Tages trage ich es offen und es reicht mir fast bis zur Hüfte. Es ist ungewohnt, aber auch schön, mal keinen Zopf wegen der Hitze haben zu müssen.
Als ich endlich einen Weg durch die Bar nach draußen gefunden habe, inhaliere ich die kühle Nachtluft. Hier, in einem Vorort von Berlin, riecht sogar die Luft anders. Frischer und klarer als die in Ägypten. Nicht so stickig und geschwängert von feuriger Hitze.
Aber ich habe kein Recht zu jammern. Das ist der Job, für den ich mich entschieden habe und den ich schon mein ganzes Leben lang machen wollte. Klar, als Kind und Jugendliche habe ich mir das ganz anders vorgestellt. Archäologin war für mich etwas Aufregendes. Ständig neue Länder, andere Kulturen, fremde Schätze, die nur darauf warteten, von mir gefunden und geborgen zu werden. Tja, die Realität ist aber nicht so rosarot wie in einem Märchenbuch. Das haben mir zwar schon zum Studienbeginn meine Dozenten klargemacht, aber ich habe mich trotzdem an die Hoffnung geklammert, dass es bei mir … anders sein würde.
Die meiste Zeit verbringe ich damit, mich von der Sonne verbrennen zu lassen, während ich mich durch Kubikmeter Dreck wühle, in der großen Erwartung, ein paar vergilbte Knochen zu finden. Die Hoffnung, auf ein altes Pharaonengrab zu stoßen, habe ich schon lange im heißen Wüstensand begraben. Aber solange ich keine phänomenale Entdeckung mache, werde ich trotz meines Abschlusses mit summa cum laude nur die kleine – beziehungsweise große – Praktikantin bleiben, die die Sonnenschirme hinterherschleppt und mit Sand gefüllte Eimer wegträgt. Und – ganz ehrlich – das halte ich nicht mein ganzes Leben lang aus! Ich will es sein, die die Entscheidung trifft, an welcher Stelle gesucht wird. Ich will diejenige sein, die den alten Legenden der ortsansässigen Einheimischen nachgeht und entscheidet, in welches Land es uns als Nächstes verschlägt.
Doch all das bleibt so lange Wunschdenken, bis ich etwas Großartiges finde. Atlantis oder Avalon oder so, mindestens.
Die Archäologie ist meine Passion, aber an manchen Tagen fühle ich mich in meinem Team wie das fünfte Rad am Wagen, wodurch mir der Spaß an der Arbeit madig gemacht wird.
Ich seufze einmal tief, während ich den Bürgersteig entlanggehe und auf ein Taxi warte.
Was habe ich mir nur dabei gedacht, mich auf Ägypten zu spezialisieren? Es hätte mir doch von vornherein klar sein müssen, dass sämtliche Gräber schon vor Jahrzehnten geplündert oder verwüstet worden sind. Oder schon entdeckt wurden. Es gibt kein zweites Grab von Tutanchamun oder einen weiteren Tempel von Abu Simbel, die ich finden könnte, denn sie wurden bereits gefunden. Alles, was das Team, dem ich angehöre, bisher ausgegraben hat, sind die bleichen Knochenfragmente irgendwelcher vergleichsweise unbedeutenden Menschen, die es zur damaligen Zeit nicht einmal wert waren, einbalsamiert zu werden. Diese Knochen sind so nutzlos, dass wir sie Hunden zum Fressen geben könnten. Und selbst wenn wir Mumien finden, die halbwegs gut erhalten sind, waren diese Menschen einst Würdenträger. Leider sind die Museen bereits voll mit Mumien solcher … na ja … für die Weltgeschichte unwichtiger Personen.
Als ich in der Ferne ein Taxi auf mich zufahren sehe, hebe ich schnell den Arm und winke. Ich steige hinten ein und nachdem ich dem Fahrer meine Adresse genannt habe, lehne ich mich zurück und schließe müde die Augen. Es hat keinen Zweck, mir Gedanken über meine Arbeit zu machen. Jetzt habe ich erst mal für drei Wochen Heimaturlaub, ehe ich zurück in die Hitze muss. Allein beim Gedanken an all den Sand, der mir dann wieder in sämtlichen Körperöffnungen steckt, muss ich mich schütteln. Entschlossen schiebe ich alles, was mit meiner Arbeit zu tun hat, beiseite und freue mich auf die DVD, die mich in meiner Wohnung, zusammen mit einem Gläschen Sekt, erwartet. Ich muss endlich lernen, im Hier und Jetzt zu leben. Und solange ich noch keine Koffer packen muss, sind Gedanken an meine Arbeit tabu.
***
Antriebslos lehne ich mich an die Wohnungstür und kicke die hochhackigen Schuhe weg, ehe ich in die bequemen Hausslipper schlüpfe. Ein Blick auf die Uhr im Flur verrät mir, dass es noch nicht einmal Mitternacht ist. Ich schlurfe durch die Wohnung, lasse Jacke und Handtasche einfach irgendwo fallen und schiebe in der Küche eine Tiefkühlpizza in den Ofen.
Da bin ich schon mal zu Hause und muss trotzdem die Abende und Nächte einsam verbringen … Das ist doch nicht fair! Vielleicht sollte ich das nächste Mal woanders hingehen, aber allein in einer Bar zu sein, wirkt irgendwie erbärmlich.
Lustlos streife ich mit dem Zeigefinger über die Rücken der DVDs. Ich habe noch nicht einmal mehr Lust, einem oberkörperfreien Channing Tatum dabei zuzusehen, wie er seinen gestählten Body zur Musik wiegt. Ich will nur noch ins Bett, nachdem ich gegessen habe, und mich eine Runde selbst bemitleiden.
Ach Quatsch, das bringt doch auch nichts! Entschlossen ziehe ich Magic Mike aus dem Regal, lege die DVD ein und mache es mir auf dem Sofa bequem.
»Nur du und ich heute Abend, Channing«, murmele ich, während ich den Film starte. Ich darf nur nicht die Zeit aus dem Blick verlieren, sonst ist meine Pizza nichts weiter als …
Neben mir fängt mein Handy an zu klingeln und ich zucke zusammen. Wer ruft denn um die Uhrzeit noch an? Ein Blick aufs Display gibt mir die Antwort: Es ist Anthony, mein Boss, der Kopf des Teams, für das ich seit meinem Uni-Abschluss arbeite. Na großartig … Der Abend wird wirklich immer besser.
Kurz denke ich darüber nach, nicht ranzugehen und so zu tun, als wäre ich nicht da oder das Handy von einem schwarzen Loch verschluckt worden. Aber mein Boss ruft mich nie persönlich an. Dafür hat er Assistentinnen und die haben wiederum Assistentinnen, die sich mit Praktikantinnen wie mir abgeben. Seine Nummer habe ich nur für den absoluten Notfall gespeichert, falls ich bei einer Expedition verschüttet oder von einheimischen Kannibalen verschleppt werde oder so.
Mein Finger schwebt über dem weißen Hörersymbol auf grünem Grund, während ich noch das Für und Wider abwäge. Um diese Uhrzeit müsste ich nicht mehr rangehen, aber … was, wenn er ein neues Gebiet gefunden hat? Einen neuen Hinweis, dem wir nachgehen wollen? Ich bin Archäologin, aber mein Herz schlägt auch für Schätze, und das nicht zu knapp. Der Verkauf dieser Schätze sichert mir meinen Lohn, denn das bisschen Unterstützung, das wir von Instituten oder gar dem Staat bekommen, reicht hinten und vorne nicht. Schätze oder reiche Auftraggeber, die den wahren Aufenthaltsort von Excalibur herausgefunden haben wollen und nun unser Team mit der Bergung beauftragen, sind es, die uns finanziell über Wasser halten.
Ich schiebe das Hörersymbol auf dem Display nach rechts. »Hallo?«, frage ich, während ich vor Aufregung am liebsten an den Nägeln kauen würde.
»Emmalynn?«, kommt es undeutlich aus dem Lautsprecher, fast vollständig überdeckt von Rauschen. »Kannst du -ich hö-en?«
Tatsache! Es ist wirklich Anthony persönlich, nicht einer seiner Angestellten.
»Undeutlich, aber ja«, antworte ich lauter, in der Hoffnung, so das Rauschen und Knarzen im Hörer zu übertönen.
»Entschuldige, dass ich dich in deinem Urlaub stören muss«, fährt Anthony fort. Das Rauschen klingt ab, aber es hört sich noch immer so an, als würde er Cabrio ohne Verdeck mit mindestens zweihundert Sachen fahren. »Wir haben einen neuen Auftrag erhalten.«
Auch wenn ich eigentlich enttäuscht darüber sein sollte, dass mein Urlaub so jäh endet, kann ich es doch nicht erwarten, dass er weiterspricht.
»Was und wo?«, stelle ich die wichtigsten Fragen.
Bitte nicht wieder in einem ägyptischen Landstrich, in dem es über fünfzig Grad Celsius heiß wird … Das halte ich nicht noch einmal drei Monate durch.
»Ich hinterlege dein Ticket am Flughafen. Dein Flug geht morgen früh um zehn Uhr.«
»Wohin verschlägt es uns diesmal?«
Es dauert eine Weile, bis er antwortet. »Island. Unser nächster Auftrag erwartet uns in Island. Der Auftraggeber hat uns persönlich angefordert.«
Ich bin zu perplex, um zu antworten. Island? Was soll es denn da geben? Ich drehe mich um und suche auf dem Globus, der neben der Couch steht, nach dem kleinen Land.
»Anthony, ich glaube nicht, dass ich … dafür qualifiziert bin«, sage ich. »Mein Fachgebiet ist das ägyptische Altertum. Ich weiß nicht, wie ich euch in Island helfen soll. Das ist … so gar nicht ägyptisch.«
»Keine Angst, Emmalynn, wir werden schon eine Aufgabe für dich finden.«
Toll. Das klingt nach Packesel und Catering-Service.
Gerade als ich zu einer Ausrede ansetzen will, fährt Anthony fort: »Ich muss Schluss machen. Wir warten in Island auf dich. Unser Flug geht schon in einer halben Stunde und wir nehmen die Team-Maschine. Für dich wäre es nicht mehr zu schaffen, deshalb geht dein Flug morgen früh mit einer Standardmaschine. Sei pünktlich!«
Ohne meine Antwort abzuwarten, drückt er das Gespräch weg und ich höre nur das tut-tut-tut im Hörer.
Ich umklammere mein Handy so fest, dass meine Finger schmerzen, bis mir wieder einfällt, dass ich für das Ding sechs Monate sparen musste, um es mir leisten zu können. Was mich wieder zurück zum eigentlichen Problem führt: Auch wenn ich weder eine Qualifikation noch besonders große Lust auf Island habe, muss ich mich doch dem Willen meines Chefs beugen. So kurz nach dem Studium kann ich nicht wählerisch sein, was die Aufträge angeht, sondern muss so viel Erfahrung in der Feldforschung sammeln wie möglich. Denn sonst werde ich nie wieder einen Auftrag bekommen oder Mitglied eines Teams sein, sondern bestenfalls eine unterbezahlte Gehilfin.
Ich schalte den Fernseher wieder aus – bis zum nächsten Mal, Channing! –, schlinge die halb gare Pizza im Stehen hinunter und gehe dann ins Schlafzimmer. Dort stehen die Koffer und Taschen des Ägyptenaufenthalts noch so, wie ich sie hingestellt habe. Kaum etwas, was ich dort zum Anziehen mithatte, werde ich nach Island mitnehmen können. Da oben werde ich dicke Winterkleidung brauchen … Auf so etwas bin ich nicht vorbereitet, aber ich habe auch keine Zeit mehr, erst noch Kleidung zu kaufen. Neue Klamotten würde mir noch nicht einmal Amazon Prime bis dahin liefern können und die Läden haben mittlerweile auch schon geschlossen.
In knapp zehn Stunden geht mein Flug, bis dahin muss ich meine Sachen gepackt haben.
Ich durchwühle meine Schränke, werfe Kleidungsstücke hinter mich und finde im hintersten Winkel tatsächlich ein paar dicke Jacken, Pullis und sogar Thermounterwäsche, die ich vor Jahren für einen Skiurlaub gekauft, dann aber doch nicht angezogen habe. Hastig leere ich die Koffer – mein Schlafzimmer sieht mittlerweile aus, als wäre viermal nacheinander eingebrochen worden – und stopfe die Ausrüstung für Island hinein.
Island … Was es da wohl zu entdecken gibt? Ob wir direkt auf Island oder einer der Vorinseln sein werden? Ich werde mich überraschen lassen müssen.
Nachdem ich mich bettfertig gemacht habe, liege ich noch lange wach und grübele über die bevorstehende Expedition nach. Island ist wirklich ein ungewöhnliches Ziel. Mir fällt auch nichts ein, für was dieses Land stehen würde. Keine großen Könige, keine sagenumwobenen Schätze oder Legenden. Klar, es gab die Wikinger, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass wir wegen ein paar verwitterter Äxte oder Essensschalen in ein abgelegenes und selbst für Touristen – im Vergleich zu Spanien, Italien oder Portugal – eher uninteressantes Land geschickt werden.
Es muss aber einen Grund geben, warum es unser Team gerade dorthin verschlägt. Vor allem, weil der Aufbruch so überstürzt kommt. Normalerweise planen wir neue Expeditionen über Wochen hinweg – und reisen nicht von einem Tag auf den anderen los. Entweder es gibt dort etwas wirklich Großes zu entdecken oder der Auftraggeber ist äußerst zahlungswillig.
Kapitel 2
Wie immer vor einer neuen Expedition, beginnt mein Morgen hektisch. In aller Eile überprüfe ich mein Gepäck, fordere ein Taxi an, das mich zum Flughafen bringen soll, esse zwei Scheiben Toast und sammele dann alles für mein Handgepäck zusammen. Reisepass, Geldbörse, Handy, Schlüssel, Schlafbrille.
Ich bin noch dabei, das Handgepäck in die dafür vorgesehene Tasche zu stopfen, als es schon an der Tür klingelt, trotzdem wuchte ich die zwei Koffer nach draußen in den Hausflur, schnappe mir die Handgepäcktasche und schließe die Wohnung ab. Meghan habe ich gestern Abend noch eine Nachricht geschickt, dass ich schon wieder losmüsse.
Anstatt mir mit dem Gepäck zu helfen, trommelt der Taxifahrer ungeduldig mit den Fingern aufs Lenkrad. Die Fahrt zum Flughafen dauert zum Glück nicht lange und verläuft schweigend.
Dort angekommen hole ich mir das Ticket am Schalter ab und gebe mein Gepäck auf. Noch knapp eine halbe Stunde, bis es losgeht. Ein unruhiges Kribbeln macht sich in meinem Bauch breit. So nervös war ich schon lange nicht mehr vor einer Reise. Bestimmt nur, weil es diesmal ein so ungewöhnliches Ziel ist.
Der Check-in verläuft zügig und ich finde schnell meinen Sitzplatz. Knapp vier Stunden wird der Flug dauern und ich werde in der Zeit etwas Schlaf nachholen.
***
In der isländischen Hauptstadt Reykjavík erhalte ich einen Anruf von Anthony. Nachdem er sich pflichtschuldig nach meinem Befinden erkundigt hat – und ich ihm genauso pflichtschuldig geantwortet habe –, teilt er mir mit, dass ich wie befürchtet mit einem kleinen Flugzeug auf eine der größeren Nebeninseln (oder war es eine Halbinsel?) fliegen muss. Den Namen der Insel habe ich auch nach dreimaligem Nachfragen nicht verstanden und gebe es schließlich auf. Es reicht, zu wissen, dass die Tickets wie immer schon gebucht sind und ich nur zum richtigen Flieger muss.
Ich bin die einzige Passagierin, was mich stutzig macht. Zumindest hilft mir der Pilot – ich hoffe jedenfalls, dass er einen Pilotenschein hat – mit den Koffern und redet dann auf Isländisch mit mir, wovon ich nicht ein einziges Wort verstehe. Diese Sprache klingt so anders als alles, was ich bisher gehört habe, und es gelingt mir nicht, die Worte durch ähnliche einer anderen Sprache zu erschließen. Also lächele ich unverbindlich, nicke und hoffe, dass er keine Antwort von mir erwartet.
Bei jedem Schlenker, den das kleine Flugzeug macht, sackt mein Magen ab und ich rechne damit, dass wir abstürzen. Ich kralle die Hand in den »Angstgriff« an der Tür und zwinge mich, ruhig zu atmen. Währenddessen plappert der Pilot weiter fröhlich auf mich ein. Am liebsten würde ich ihn anschreien, dass er die Klappe halten solle, doch ich beiße die Zähne zusammen.
Als wir endlich auf der kleinen Rollbahn landen, kann ich gar nicht schnell genug aus diesem Sarg der Lüfte rauskommen. Ich schnappe mir meine Koffer, verabschiede mich vom Piloten und sehe zu, dass ich so weit weg von diesem Flugzeug wie nur möglich komme. Ohne viel Zeit zu verlieren, steigt er zurück in die Maschine und startet die Motoren, um zurück zur Hauptinsel zu fliegen. Irgendwann werde ich auch wieder von der Insel runter müssen, was bedeutet, dass ich noch mal in so ein Ding werde einsteigen müssen. Mit großen Flugzeugen habe ich keine Probleme, aber dieses Teil, das bei jedem Luftzug irgendwo klappert, ist alles andere als vertrauenserweckend.
Als sich meine Atmung wieder beruhigt hat, fische ich mein Handy aus der Tasche und wähle Anthonys Nummer. Nur die Mailbox geht ran und ohne etwas draufzusprechen, drücke ich das Gespräch weg.
Als Nächstes wähle ich nacheinander die Nummern seiner Assistentinnen, die ihn meistens auf die Expeditionen begleiten. Auch dort habe ich kein Glück und langsam werde ich nervös. Das darf doch nicht wahr sein! Ich sitze hier im Nirgendwo mit nicht einmal einem Dach über dem Kopf und habe keine Ahnung, wohin ich gehen soll. Das Rollfeld, auf dem wir vorhin gelandet sind, ist umgeben von Wäldern. Nirgends sehe ich ein Haus, geschweige denn so etwas wie einen Flughafen.
Meine Finger zittern bereits, als ich durch das Telefonbuch scrolle und jeden anrufe, der zum Team in Ägypten gehört hat. Die beiden, die ich erreiche, sagen mir, dass sie leider nicht mit in Island seien und mir nicht helfen könnten.
Ich schaue auf meine Armbanduhr. Sie zeigt kurz nach vier Uhr am Nachmittag an, weil ich sie noch nicht zwei Stunden zurückgestellt habe. Hier haben wird es erst kurz nach zwei, aber dennoch liegt ein diesiges Zwielicht über der Insel, als wäre es schon abends.
»Hallo? Ist hier jemand?«, rufe ich so laut ich kann. Als Antwort höre ich in der Ferne nur einige Vögel zwitschern.
Was mache ich jetzt? Ich sitze hier auf einer Insel fest, die ich nicht kenne.
Um meine Hände aufzuwärmen, stecke ich sie unter die Achseln. Mir bleibt gar nichts anderes übrig, als hier zu warten, bis Anthony oder einer der anderen auftaucht. Mit den beiden Koffern werde ich mich nicht durch den Wald kämpfen, schließlich weiß ich nicht einmal, in welche Richtung ich mich wenden muss. Aber kann ich wirklich hier warten? Was, wenn die Nacht anbricht und mich noch immer niemand vermisst? Wie kalt wird es in Island? Gibt es gefährliche Tiere?
Wieso hat man uns so wichtige Informationen nicht während des Studiums beigebracht?
Ich traue mich noch nicht, danach zu googeln, auch, weil ich den Akku meines Handys nicht zu sehr strapazieren will. Wenn er leer ist, habe ich ein echtes Problem.
»Ganz toll, Emma«, murmele ich zu mir selbst. »Wo hast du dich da wieder reingeritten?«
Die letzten Jahre war ich immer mal wieder in Situationen, die mich an den Rand eines Nervenzusammenbruchs gebracht haben. Das bringt ein Aufenthalt in anderen Ländern, weit abseits der Touristengebiete, nun mal mit sich. Aber hier, mitten im Nirgendwo, zu erfrieren, stand nicht auf meiner Liste der Dinge, die ich unbedingt erleben muss. Darauf könnte ich dankend verzichten.
Immer wieder schaue ich auf mein Handy. Keine Nachrichten, keine Anrufe. Doch das Batteriesymbol weist mich mit einem aufgeregten Blinken darauf hin, dass mir nur noch knapp 25 % Akku bleiben. Shit.
Die Zeit vergeht quälend langsam. Minuten kommen mir wie Stunden vor und die Kälte beginnt durch meine Kleidung zu kriechen. Um mich aufzuwärmen, jogge ich um meine Koffer herum, mache immer wieder Pausen, um zu versuchen, Anthony oder irgendeinen der anderen zu erreichen, doch ich habe immer noch kein Glück. Stellenweise habe ich sogar gar keinen Empfang, weshalb ich mein Handy in die Höhe halte und ziellos durch die Gegend laufe.
Ich zwinge mich wieder dazu, ruhig zu atmen, und gehe in Gedanken die Survivalregeln durch, die mir das Team am ersten Tag eingebläut hat.
Regel Nummer 1: Bleibe immer am vereinbarten Treffpunkt, bis dich jemand holen kommt.
Regel Nummer 2: Gehe auf keinen Fall allein los – erst recht nicht, wenn du die Gefahren nicht abschätzen kannst.
Regel Nummer 3: Setze Prioritäten und verwalte deine Ressourcen sinnvoll.
Tja, leider habe ich keinerlei Ressourcen, die ich sinnvoll verwalten könnte. Ich habe weder etwas zu essen noch zu trinken. Irgendwo in meinem Koffer stecken ein kleines Schweizer Taschenmesser und ein Feuerzeug, aber da hört es auch schon auf. Auf ein Überlebenstraining abseits jeglicher Zivilisation bin ich nicht vorbereitet. Selbst mitten in der Wüste hatten wir Kühlboxen, Radios, Generatoren und Solaranlagen, die uns mit dem nötigsten Strom versorgt haben – um die Ventilatoren zu betreiben.
Aber diese Gegend hier in Island ist so roh und unberührt, dass ich mir nicht einmal sicher bin, ob die hiesigen Einwohner überhaupt wissen, was Strom ist. Von Internet ganz zu schweigen. Ich weiß nicht einmal, ob es hier überhaupt Einwohner gibt.
Als es immer dunkler wird und ich immer unruhiger werde, treffe ich eine Entscheidung. Erneut wähle ich alle Nummern durch, erreiche aber wieder niemanden. Obwohl ich genau weiß, dass ich einen Fehler mache, suche ich mir die unverzichtbarsten Dinge aus den beiden Koffern und stopfe sie in meine Handgepäcktasche: Handy, Schweizer Taschenmesser, Feuerzeug, Geldbörse, Knirps. Anschließend ziehe ich so viele Lagen Kleidung übereinander an wie möglich, schultere die Tasche und gehe wahllos in eine Richtung los.
Grillenzirpen und das entfernte Rufen eines Uhus sind die einzigen Geräusche, die ich höre, zusammen mit dem lauten Klopfen meines Herzens. Ich schlage mich durch das Unterholz, in der Hoffnung, bald auf eine Siedlung zu stoßen, schließlich kann diese Insel doch nicht komplett unbewohnt sein, immerhin gibt es hier ein Rollfeld für Flugzeuge und einen Kiesweg, der von dort wegführt. Allerdings verläuft er sich irgendwo zwischen dichtem Gestrüpp, als wäre er eine lange Zeit nicht benutzt worden.
So groß wird diese Insel schon nicht sein, dass ich mich verlaufen könnte.
Das Piepen meines Handys lässt mich innehalten. Hastig streife ich die Handschuhe ab und fische es aus meiner Jackentasche. Ein Blick aufs Display und ich weiß, was los ist: Der Akku macht schlapp. Das darf doch wohl nicht wahr sein! Doch das Batteriezeichen blinkt mich unerbittlich weiterhin an. Ich erwäge kurz, noch einmal einen Anruf zu wagen, aber verwerfe die Idee gleich wieder. Das würde den Akku endgültig killen.
Ich habe die Wahl zwischen zwei Optionen. Eine davon ist, zurückzugehen und dort auf Hilfe zu warten. Vorausgesetzt, ich finde den Weg zurück … Die zweite ist, weiter ziellos in den dichten Wald hineinzulaufen und zu hoffen, bald auf irgendeine Form von Zivilisation zu treffen.
Beide Wege bergen Risiken, die ich nicht abschätzen kann. Beide können schiefgehen.
Ich kaue auf meiner Unterlippe, während ich die Möglichkeiten noch mal durchgehe. Ach, scheiß drauf! Jetzt bin ich schon so weit gekommen, da werde ich doch nicht umdrehen! Entschlossen schiebe ich die Zweige des Gebüschs, das mir im Weg steht, beiseite und mache einen Schritt nach vorne.
Da, wo ich eigentlich Boden unter meinen Füßen spüren müsste, ist jedoch nichts. Ehe ich realisieren kann, was los ist, verliere ich das Gleichgewicht, spüre ein flatterndes Gefühl im Magen und falle in eine tiefe Schwärze hinab.
Kapitel 3
Autsch …
Das ist das Erste, was mir durch den Kopf schießt, als ich langsam wieder zu mir komme. Unter Gesicht und Händen spüre ich Geröll und spitze Steine und mein Körper scheint nur noch aus Schmerzen zu bestehen, die in Wellen durch mich hindurchschießen und mich daran erinnern, dass ich nicht tot bin. Mühsam richte ich mich auf.
Als ich wieder halbwegs bei Sinnen bin, mache ich eine kurze Bestandsaufnahme. Die dicke Kleidung hat größere Verletzungen verhindert. Nur am rechten Bein und an beiden Händen habe ich einige Schrammen. Wie mein Gesicht aussieht, weiß ich nicht. Ich spüre Nässe an meinem Schienbein und taste danach. Meine Hose ist an der Stelle aufgerissen, aber die Wunde scheint nur oberflächlich zu sein. Eine glatte Schramme, die zum Glück nicht tief ist und aus der nur ein paar Blutstropfen hervorquellen, weiter nichts. Prellungen habe ich sicherlich auch davongetragen, aber ich komme auf die Beine.
Als mich Schwindel überkommt, kneife ich die Augen zu und stütze mich an der Felswand ab.
Na toll! Ich bin nicht nur mitten im Nirgendwo gestrandet, sondern nun auch noch einen Abhang hinuntergefallen. Hier unten wird mich garantiert niemand finden …
Ich schaue nach oben, kann aber die Kante der Klippe nicht erkennen. An den Felsen emporzuklettern, versuche ich gar nicht erst. Es würde nur damit enden, dass ich mir das Genick breche, da bin ich mir sicher.
Aber was dann? Ich sehe mich um.
Ganz in der Nähe entdecke ich auch meine Tasche, die den Sturz anscheinend ebenfalls heil überstanden hat. Als ich näher komme, sehe ich, dass sich hinter der Tasche ein großes Loch in der Felswand auftut. Ist das eine Höhle?
Unsicher mache ich einige Schritte darauf zu. Dort drin könnte ich geschützt vor Wind und Wetter die Nacht abwarten und gestärkt einen Weg zurück nach oben suchen. Vorausgesetzt, dass noch niemand sonst in dieser Höhle haust und keine ungeladenen Gäste haben will …
Momentan aber scheint diese Höhle meine beste Option zu sein. Auf jeden Fall besser, als schutzlos unter freiem Himmel die Nacht zu verbringen. Morgen früh, nachdem die Sonne aufgegangen ist, wird es mir bestimmt leichter fallen, einen Weg aus der Schlucht zu finden.
Ich hole das Feuerzeug aus der Tasche und betrete mit einem flauen Gefühl im Magen die Höhle. Das Herz klopft mir bis zum Hals, als ich mich Meter für Meter weiter in das Gestein vortraue. Hier drin ist es logischerweise noch dunkler als draußen und die mickrige Flamme meines Feuerzeugs schafft es nicht annähernd, genügend Licht zu spenden. Viel schlimmer noch: Das flackernde Feuer wirft gruselige Schatten an die Steinwände, die meine Unruhe nur noch verstärken. Ich beginne zu zittern und will nichts lieber tun, als umzudrehen, doch mein Überlebenswille treibt mich vorwärts. Außerhalb der Höhle werde ich erbärmlich frieren oder bei meinem Glück von irgendetwas gefressen werden.
Beinahe blind taste ich mich mit den Händen voran, rutsche immer wieder am klebrig-nassen Gestein ab und erschrecke, als ich etwas Pelziges unter meinen Fingern spüre. Mit einem Schrei springe ich zurück und halte schützend das Feuerzeug vor mich.
Als ich sehe, dass es nur Moos ist, in das ich gegriffen habe, fasse ich mir mit der Hand an die Brust, um mein wild klopfendes Herz zu beruhigen.
»Ganz ruhig, Emma«, murmele ich. »Hier drin ist nichts, was dir gefährlich werden könnte. Das ist nur Moos, nichts weiter.«
Trotzdem weigern sich meine Beine beharrlich, auch nur noch einen einzigen Schritt zu tun. Mir solls recht sein. Dieser Platz ist so gut wie jeder andere. Also lasse ich mich nieder, ziehe den Pulli unter meiner Jacke aus, breite ihn unter mir aus, damit ich nicht auf dem blanken Boden sitzen muss, und ziehe die Beine an den Körper.
Es ist stockdunkel um mich herum. Ein Feuer kann ich nicht machen, da ich kein Holz habe, und das Feuerzeug will ich auch nicht überstrapazieren. Aber wie es aussieht, habe ich Glück im Unglück. Nichts außer mir scheint in dieser Höhle zu hausen. Wenigstens etwas. Nicht auszudenken, was mit mir passieren würde, wenn hier irgendein …
Ein tiefes Knurren ertönt hinter mir und jeder Muskel in meinem Körper verspannt sich. Augenblicklich richten sich sämtliche Härchen auf meinen Armen und im Nacken auf, doch erst als ich einen Lufthauch spüre, der meine Haare ein Stück nach vorne weht, kommt wieder Leben in mich. Ängstlich wirbele ich herum …
… und starre in hellblaue Augen, die in der Dunkelheit zu leuchten scheinen.
Auf allen vieren krabbele ich ein Stück rückwärts, bis ich an die hinter mir liegende Wand pralle. Meine Finger zittern, als ich ihnen befehle, nach dem Feuerzeug zu tasten, das in meiner Hosentasche steckt. Beim Versuch, es anzuzünden, fällt es mir aus der schweißnassen Hand und ich schaffe es nicht, erneut danach zu greifen. Reglos wie ein Reh, das in die Flinte des Jägers starrt, sitze ich da und bin gefesselt von den leuchtenden Augen, die die einzige Lichtquelle sind.
Als erneut das Knurren ertönt und bis in meinen Körper zu pulsieren scheint, halte ich mir mit beiden Händen die Ohren zu.
Scheiße, in was bin ich da nur hineingeraten? Ich könnte jetzt gemütlich daheim auf der Couch liegen und Channing Tatum dabei zusehen, wie er sein Shirt zerreißt, aber nein, stattdessen sitze ich am Ende der Welt in einer Höhle fest und diene gleich als Abendbrot für irgendeine heimische Bestie.
»Bitte, friss mich nicht!«, stammele ich, doch ich wage nicht, die Augen zu öffnen, sondern erwarte jederzeit den Schmerz, wenn das Biest seine Zähne in mich schlägt. Hoffentlich wird es nicht zu sehr weh tun …
Sekunde um Sekunde vergeht und als nichts geschieht, öffne ich vorsichtig ein Auge und spähe in die Dunkelheit. Langsam nehme ich auch die Hände von den Ohren, in denen ich mein Blut rauschen höre.
So schnell es meine schwitzigen Hände zulassen, durchwühle ich die Hosentaschen nach meinem Handy. Scheiß auf den Akku! Ich muss wissen, ob das Vieh verschwunden ist. Als ich das Handy in der Hand halte, drücke ich den Standby-Knopf und sofort wird meine Umgebung in ein diffuses Licht getaucht. Vorsichtig schwenke ich das Gerät erst nach links, dann nach rechts und leuchte so die Höhle aus.
Gerade als ich aufatmen und beschließen will, dass die Gefahr vorüber ist, begegne ich erneut dem Blick aus den hellblauen Augen. Ich schlucke angestrengt, als ich das Monster sehe, zu dem sie gehören, und wage es nicht, auch nur einen Muskel zu rühren.
Völlig ruhig mustert es mich aus gut fünf Metern Entfernung. Die spitzen Ohren sind aufgerichtet und der Kopf leicht zur Seite geneigt. Sein mitternachtschwarzes Fell schimmert im Licht des Displays silbrig.
Ein schwarzer Wolf. Na großartig.
Mit langsamen, fast zeitlupenartigen Bewegungen versuche ich, mehr Distanz zwischen das Tier und mich zu bringen. Deshalb rutsche ich ein Stück zur Seite, weg von der Wand, doch als ich gut einen Meter zurückgerobbt bin, zieht der Wolf die Lefzen nach oben und bleckt die Zähne, mit denen ich auf keinen Fall Bekanntschaft machen will. Wieder erstarre ich – und als ich mich nicht mehr bewege, mustert der Wolf mich erneut mit diesem nahezu fragenden Gesichtsausdruck.
Warum bleibt er dort einfach sitzen? Ich habe mich ihm doch quasi auf dem Silbertablett serviert, indem ich einfach in seine Höhle gestolpert bin. Eine so leichte Mahlzeit wird er auf dieser Insel nicht alle Tage bekommen. Warum hat er also noch nicht seine spitzen Zähne in mich geschlagen?
Vielleicht denkt er darüber nach, ob er mich auf einmal schafft oder lieber häppchenweise zerteilen soll, für schlechte Zeiten.
Und dann sehe ich es. Vorsichtig halte ich das Handy ein Stück höher, um mehr Licht zu bekommen. Lange wird das Ding nicht mehr durchhalten … Aber eben habe ich etwas im Fell des Wolfs aufblitzen sehen, was dort nicht hingehört. Es sah aus wie … ein Draht. Ein Kupferdraht, wie von einer Falle.
Ehe ich es mir wieder anders überlegen kann, strecke ich zögerlich die freie Hand aus. »Ich tue dir nichts«, sage ich leise. »Wenn du mir nicht wehtust, tue ich dir auch nicht weh.«
Wie blöd ist das denn? Rede ich hier gerade wirklich mit einem Wolf darüber, dass er mir nichts tun soll? Anscheinend habe ich mich beim Sturz doch schlimmer verletzt, als ich angenommen habe …
Zentimeter für Zentimeter strecke ich ihm die Hand entgegen, rutsche auf den Knien langsam vor – immer darauf bedacht, ja keine ruckartigen Bewegungen zu machen. Ich schlucke gegen einen dicken Kloß im Hals an und bete, dass er mein Zittern nicht sieht. War es nicht so, dass Wölfe Angst riechen können? Wenn dem so ist, habe ich ein Problem, denn ich muss bis zum Himmel danach stinken. Ich habe keine Ahnung, warum ich mich ihm überhaupt nähere, aber es scheint mir der einzige Weg zu sein. Wenn ich versuche zu fliehen, wird er mich anfallen, da bin ich mir sicher. Wenn ich aber das Gegenteil von dem tue, was er erwartet, vielleicht … habe ich dann eine Chance, das hier unbeschadet zu überstehen.
Als meine Finger nur noch eine Handbreit von seiner Schnauze entfernt sind, kneife ich die Augen zu und befehle mir, ruhig und gleichmäßig zu atmen. Ein hoffnungsloses Unterfangen.
Ich spüre, dass der Wolf an meiner Hand schnuppert, merke seinen Atem, den er einsaugt und ausstößt, und kann mich nur mit Mühe davon abhalten, schreiend die Hand wieder zurückzuziehen. Jede Sekunde rechne ich damit, dass er seine Fänge in mein Fleisch schlägt und mich verspeisen wird. Doch dann spüre ich etwas Nasses an meiner Handfläche und öffne vorsichtig die Augen. Seine Nase … Er drückt seine Nase gegen mich. Darf ich das als gutes Zeichen werten?
In diesem Moment verfluche ich in Gedanken meine Eltern dafür, dass ich nie einen Hund haben durfte. Vielleicht wäre ich dann eher in der Lage, das Wissen für meine Zwecke zu nutzen, um das Verhalten des Wolfes jetzt zu deuten, doch so muss ich mich ganz allein auf meinen Instinkt und meine innere Stimme verlassen. Und die flüstert unablässig, dass ich ihm helfen solle.
Ich lege das Handy auf den Boden und strecke auch die andere Hand nach ihm aus. Im fahlen Displaylicht brauche ich eine Weile, bis ich den kupfernen Draht erneut sehe. Vorsichtig teile ich sein dichtes Fell und taste nach der Drahtschlinge. Als ich die Finger darumlegen, stutze ich. Es ist kein Draht, wie ich bisher angenommen habe. Es ist viel weicher, fast wie eine Art Stoff. Eher wie ein … Seil.
Mit spitzen Fingern ziehe ich es ein Stück zu mir und betrachte es stirnrunzelnd. Ein Draht hätte von einer Falle stammen können, aber ein Seil? Zwischen meinen Fingern schimmert es sogar golden und sieht kostbar aus. Könnte das eine Leine sein, weil der Wolf vielleicht jemandem gehört?
Als er sieht, dass ich das Seil mustere, stößt der Wolf ein leises Winseln aus.
»Ist ja schon gut«, murmele ich und wühle in den tiefen Hosentaschen nach dem Schweizer Messer. »Ich werde es dir jetzt abnehmen.«
Ich ziehe die Klinge heraus, die im Schein des Displays aufblitzt. Sofort fängt der Wolf an zu knurren und weicht von mir zurück, die hellblauen Augen starr auf das Messer gerichtet.
»B-Beruhige dich! Ich will dir nichts tun!«
Doch meine Worte bewirken rein gar nichts. Wie von Sinnen starrt er das Messer an. Mit gesenktem Kopf und gesträubtem Nackenfell steht er dort und bleckt die Zähne.
»Ich will doch nur das Seil durchschneiden. Ich werde dich nicht verletzen.«
Natürlich erreiche ich damit nichts. Wie soll dieses Tier mich auch verstehen können? Wieder erstarre ich für einen Moment vor Angst. Zum ersten Mal sieht der Wolf richtig gefährlich aus und ich spiele mit dem Gedanken zu fliehen. Bis ich mich jedoch hochgerappelt und umgedreht hätte, wäre er mir schon zehnmal in den Rücken gefallen. Also bleibe ich sitzen und wende den Blick nicht von ihm ab, ohne ihm dabei jedoch direkt in die Augen zu sehen. Ich versuche, so wenig Angst wie möglich zu zeigen.
Das Messer habe ich bereits zur Seite gelegt, aber das beruhigt ihn nicht im Mindesten. Noch immer fixiert er abwechselnd mich und das Taschenmesser, das zwar nicht mehr in meiner Hand, aber noch in meiner Reichweite liegt. Um es ganz wegzupacken, fehlt mir der Mut.
So komme ich nicht weiter. Ich kann nicht zurück, also bleibt mir nur der Weg nach vorn. Ich beiße die Zähne zusammen und strecke erneut die Hand nach dem Wolf aus, ignoriere sein wütendes Knurren so gut es geht. Entschlossen greife ich nach dem Seil, das an seinem Hals herunterhängt. Es scheint um seinen ganzen Körper gewickelt zu sein. Sicherlich stört es ihn und behindert ihn in seinem Bewegungsradius – garantiert einer der Gründe, warum ich noch an einem Stück bin. Aber vielleicht schlägt er sich die Idee, dass ich besonders gut schmecke, aus dem Kopf, wenn ich ihn von dem Ding befreie.
Ich ziehe das Seil weiter zu mir, bis es lose zwischen uns hängt, aber ein Ende kann ich immer noch nicht sehen. Zumindest hat er aufgehört zu knurren.
Damit fängt er jedoch wieder an, als ich nach dem Messer greife. Diesmal zögere ich nicht, mache keine langsamen Bewegungen, sondern setze es schnell an das goldene Seil an.
Als er das Messer aufblitzen sieht, beschließt der Wolf, mich nun doch verspeisen zu wollen. Er setzt zum Sprung an, sein Maul weit aufgerissen.
»Pfui, böser Wolf!«, schreie ich, während ich im nächsten Moment das Seil durchtrenne und das Messer von mir werfe.
Welch glorreiche letzte Worte … Damit werde ich garantiert nicht in die Geschichtsbücher eingehen.
Abgesehen von diesem Gedanken ist mein Kopf wie leer gefegt. Vor meinem inneren Auge zieht nicht mein bisheriges Leben vorbei, wie ich immer angenommen habe. Da ist rein gar nichts – nur das riesige Tier, das im Begriff ist, mich zu zerfleischen.
Der Wolf springt auf mich zu, doch plötzlich richten sich seine bis eben noch angelegten Ohren nach oben und er reißt die Augen auf. Wäre die Situation nicht so gefährlich, hätte ich über seinen verdutzt wirkenden Gesichtsausdruck gelacht.
Hastig krabble ich von ihm weg, meine schweißnassen Hände verlieren den Halt und ich das Gleichgewicht. Ich rutsche nach hinten und knalle mit dem Kopf gegen die Felswand.
Kapitel 4
Es ist dunkel.
Und es ist kalt.
Sollte da nicht irgendwo ein helles Licht sein, auf das ich zugehen muss, wenn ich doch tot bin? Wo ist das bitte? Kann nicht einmal bei meinem Tod alles normal laufen?
Diese hämmernden Kopfschmerzen … Ich dachte eigentlich, dass alle Schmerzen mit einem Mal verschwinden, sobald man das Zeitliche gesegnet hat.
Es fühlt sich an, als würde ein Stein auf mir liegen, der mir die Luft zum Atmen nimmt. Aber ich muss doch nicht mehr atmen …? Doch meine Lunge schreit immer lauter nach Sauerstoff.
Ich befehle meinen Händen, sich zu bewegen, und – tatsächlich! – sie folgen meinem Befehl. Langsam zwar, aber sie tun es.
Zuerst ertaste ich nur den kalten Stein, auf dem ich liege.
Als Nächstes versuche ich zu ergründen, was mir das Atmen so schwer macht.
Wenn ich immer noch lebe, brauche ich Luft. Und eine Aspirin. In genau dieser Reihenfolge. Alles andere kann warten, bis ich wieder halbwegs klar im Kopf bin.
Es schmerzt, meine Arme zu heben. Meine Muskeln ächzen unter dieser simplen Bewegung, als hätte ich sie seit Ewigkeiten nicht benutzt. Es fühlt sich an, als wäre ich in eine Müllpresse geraten, die sämtliche meiner Knochen in fein säuberliche Splitter zerquetscht hat, und als ob es meinen Muskeln gerade noch so gelingt, alles zusammenzuhalten.
Nachdem ich es endlich geschafft habe, meine Arme anzuheben, versuche ich, das, was auf mir liegt, runterzuschieben. Ich erwarte, ebenfalls kaltes Gestein zu spüren, doch … meine Finger ertasten etwas ganz anderes. Es fühlt sich fast so an wie … Haut. Warme Haut.
Ich zwinge mich, die Augen zu öffnen. Sofort kneife ich sie jedoch wieder zu, weil die Helligkeit, die vermutlich vom Höhleneingang auf mich fällt, darin brennt. Helligkeit? In dieser Höhle war es stockdunkel, als ich dem Wolf begegnet bin.
Alles dreht sich in meinem Kopf, hinzu kommt das ununterbrochene Hämmern hinter den Schläfen.
Erneut zwinge ich die Lider dazu, sich zu öffnen und lasse die Hände an dem Gewicht auf mir entlanggleiten. Das kann keine Haut sein … Was sollte sich denn hier nach Haut anfühlen? Vielleicht ein sehr glatter Gesteinsbrocken? Aber der wäre nicht warm …
»Hilfe«, krächze ich und winde mich unter dem Gewicht auf mir.
Schnell beiße ich mir auf die Zunge. Das Letzte, woran ich mich erinnere, ist ein Wolf, dem ich als Appetizer dienen sollte. Vielleicht wäre es besser, wenn ich keine lauten Geräusche mache. Kurz gehe ich sämtliche Körperteile durch: Alle noch da und keines fühlt sich angeknabbert an. Abgesehen von den Kopfschmerzen und dem verdammten Gewicht auf mir, fühle ich mich gut.
Mit beiden Händen versuche ich, es von mir zu schieben, aber es bewegt sich keinen Zentimeter. Panik kriecht in mir auf, als ich immer heftiger nach Luft schnappen muss und meine Bewegungen werden hektischer, auch wenn meine Muskeln dagegen protestieren.
Ein Knurren, das direkt über mir ertönt und meinen Körper vibrieren lässt, beendet abrupt meine Bemühungen. Was zum …?
Das, was auch immer auf mir liegt, bewegt sich plötzlich, richtet sich auf und ich kann endlich frei durchatmen …
… zumindest hätte ich das gekonnt, wenn ich nicht gleich wieder die Luft anhalten würde.
Mit weit aufgerissenen Augen starre ich nach oben. Die Helligkeit stört mich gerade nicht im Geringsten, denn ich bin viel zu sehr damit beschäftigt, nicht in Schnappatmung zu verfallen. Mein Kopf fühlt sich an, als würde er jede Sekunde explodieren, weil er das, was meine Augen sehen, nicht verarbeiten kann.
Über mir … da ist … ein … Mann …
Er muss es gewesen sein, der bis eben mit seinem ganzen Gewicht auf mir lag und sich nun auf die Ellenbogen stützt. Blinzelnd schaut er auf mich hinab, als wäre er mindestens genauso überrascht wie ich und würde mich zum ersten Mal sehen. Na ja, das tut er womöglich auch, schließlich bin ich ihm noch nie begegnet. Denn – Holla, die Waldfee! – daran würde ich mich garantiert erinnern!
Sein Anblick löscht beinahe die traumatischen Erlebnisse der letzten Stunden aus meinem Gedächtnis. Vielleicht freut sich mein Gehirn auch nur über etwas Ablenkung, nachdem ich fast verspeist wurde – ich weiß es nicht, aber meine Gedanken überschlagen sich gerade.
Dabei sehe ich nicht viel von ihm, nur das Gesicht und die Schulterpartie, aber das reicht aus, um mein Herz ein paar Takte schneller schlagen zu lassen. Am meisten fesseln mich jedoch die funkelnden blauen Augen, aus denen er mich mit undurchdringlichem Blick mustert. Die Lippen hat er zu einem schmalen Strich zusammengepresst und die dunklen Brauen sind zusammengezogen, wodurch sich eine steile Falte zwischen ihnen bildet.
»W-Wer …?«, stammele ich, weil ich zuerst die Fähigkeit zu sprechen wiedergefunden habe.
Sofort verengen sich seine Augen zu Schlitzen. Er stößt sich ab und springt von mir runter. Ich rappele mich ebenfalls hoch – sehr zum Missfallen meiner geprellten und nun lautstark protestierenden Muskeln – und beobachte sein merkwürdiges Verhalten. In einiger Entfernung bleibt er hocken und fixiert jede noch so winzige Bewegung meinerseits. Wie eine Bogensehne scheint sein Körper angespannt zu sein – oder wie der Körper eines Raubtiers auf der Jagd.
Apropos Körper: Der ist vollkommen unbekleidet und – Donnerlittchen! – mir gefällt durchaus, was ich da sehe. Nicht übertrieben muskulös, aber auch nicht schlaksig – eher wie ein Tänzer. Ein sehr heißer und – wenn mir meine Augen keinen Streich spielen – gut bestückter Tänzer.
Ähm … Was tue ich hier gerade?
Mit brennenden Wangen lasse ich den Blick schnell wieder in unverfänglichere Gefilde wandern und bleibe an seinem Gesicht hängen. Seine rabenschwarzen Haare fallen ihm bis zu den Augen, sind heillos zerzaust und … Moment, was ist das? Da … bewegt sich etwas auf seinem Kopf.
Ich kneife die Augen zusammen und beuge mich ein Stück nach vorne, um es besser sehen zu können. Das sind keinesfalls Haare, die sich da scheinbar unkontrolliert auf seinem Kopf bewegen … Hier in der Höhle ist es vollkommen windstill. Aber was …?
Ich schnappe hörbar nach Luft, als ich erkenne, was es ist: Ohren. Spitz, groß und genauso schwarz wie die Haare ragen sie auf seinem Kopf empor und zucken bei jedem Geräusch, das ich mache.
Ach. Du. Heilige. Scheiße.
Ich halluziniere. Ganz eindeutig. Eine andere Erklärung gibt es dafür nicht.
Wahrscheinlich habe ich mir den Kopf irgendwo angeschlagen und nun fantasiere ich von einem nackten Kerl, der Wolfsohren hat. Das kommt davon, wenn man allein durch die Walachei wandert, ohne sich vorher Channing Tatum zu Ende angesehen zu haben … Untervögelt zu sein und Nahtoderfahrungen im Nirgendwo vertragen sich einfach nicht.
Ich weiche weiter zurück, bis ich mich mit dem Rücken gegen die Felswand presse. Das Herz klopft mir bis zum Hals, während ich den Typen mit offen stehendem Mund anstarre. Im Grunde rechne ich damit, dass er sich jede Sekunde wie eine Fata Morgana in Luft auflöst, doch je länger ich ihn mustere, desto realer kommt er mir vor. Aber wo kommt er auf einmal her? Und warum ist er nackt? (Nicht, dass ich mich über Letzteres beschweren würde … Rein rhetorische Frage!)
Ich habe so viele Fragen, aber ich traue mich nicht, auch nur eine einzige davon zu stellen. Wenn ich ihn fragen würde, was das da auf seinem Kopf ist, müsste ich mir eingestehen, dass ich es tatsächlich sehe. Ich würde mich selbst als Verrückte abstempeln. Denn das kann unmöglich real sein! Aber wie schlimm muss ich mir den Kopf angeschlagen haben, um so etwas zu fantasieren? Ich meine, ein nackter Mann, okay, das könnte ich noch auf mein fehlendes Sexualleben schieben, aber ein nackter Mann mit spitzen Wolfsohren? Das ist selbst für meine Vorstellungskraft zu viel …
Nachdem er mich die ganze Zeit über angestarrt hat, senkt er seinen Blick und schaut auf seine Hände. Ich tue es ebenfalls und erschrecke, als ich sehe, dass seine Finger spitz zulaufen, beinahe so, als hätte er … Krallen.
Das wird ja immer besser … Nicht nur spitze Ohren, nein, auch noch Krallen …
Was ist denn das für ein verrückter Fetisch, den ich mir da einbilde? Aber Einbildung oder nicht, ich würde mich bedeutend wohler fühlen, wenn ich etwas hätte, womit ich mich im Notfall verteidigen könnte. Wo habe ich gestern Nacht nur mein verdammtes Taschenmesser hingeworfen?
Suchend lasse ich den Blick über den Höhlenboden gleiten. Der Mann mir gegenüber sieht nicht so aus, als würde er es sanft angehen lassen – eher, als hätte er schon einige Schlachten gesehen und in dunkle Abgründe geschaut. Da ist keinerlei Wärme in seinen Augen, deren Blick immer noch abschätzend auf seinen Händen ruht, als sähe er sie zum ersten Mal. Mit dem trainierten Körper würde er mich sicher in Sekundenschnelle überwinden, selbst wenn ich das Taschenmesser hätte … Und ich bezweifele, dass ich in meiner Panik irgendetwas Lebenswichtiges treffen könnte. Vielleicht wäre es besser, klare Verhältnisse zu schaffen.
Ich kratze all meinen Mut zusammen und räuspere mich. Augenblicklich rucken seine spitzen Ohren in meine Richtung und nur den Bruchteil einer Sekunde später sieht er mich an. Mein mühsam gesammelter Mut verpufft unter seinem stahlharten Blick. Was habe ich mir nur dabei gedacht, seine Aufmerksamkeit wieder auf mich zu lenken? Aber ich darf jetzt keinen Rückzieher machen!
»W-Wer bist du?«, frage ich und bin froh, dass mir kein »Was bist du?« entfleucht ist.
Das wäre meine nächste Frage, obwohl ich glaube, dass ich sie lieber nicht stellen sollte … Der Kerl sieht nicht so aus, als wäre er an einer Konversation interessiert. Und höchstwahrscheinlich versteht er mich sowieso gar nicht. Immerhin sind wir auf Island und er sieht nicht aus wie einer aus meinem Team und …
»Du …«, murmelt er. Seine Stimme klingt rau, als hätte er sich drei Tage und Nächte auf einem Rockkonzert die Seele aus dem Leib geschrien – oder für eine sehr lange Zeit nicht gesprochen. »Du bist das Weib von letzter Nacht.«
Weib? Also, ich muss doch sehr bitten!
»Was … Was hast du mit mir gemacht?«, fährt er fort, bevor ich etwas erwidern kann. Sein Blick ruht auf seinen Händen, die er vor seinem Gesicht nach allen Seiten dreht, wandert dann den Arm hinauf zur Schulter. Dann schaut er mich wieder an und für einen Moment verschlägt mir das aufgebrachte Funkeln in seinen Augen die Sprache. »Welche Magie hast du angewandt, um mich in diesen Körper zu bannen, Weib? Mach es rückgängig, auf der Stelle!«
»Ich habe gar nichts gemacht!«, fauche ich ebenso wütend zurück. »Du hast doch auf mir gelegen, also hast du was mit mir gemacht! Ich will eigentlich gar nicht so genau wissen, was du gemacht hast und was das sollte … Und überhaupt, sehe ich etwa so aus, als würde ich Magie beherrschen? So etwas gibt es nicht. Von wo bist du denn abgehauen?«
Wenn ich mir die Frage selbst beantworten müsste, würde ich tippen auf »Forschungslabor mit verrücktem Wissenschaftler, der Tiere und Menschen kombinieren will« oder »Heilanstalt aus dem Mittelalter«. Und ich bete inständig, dass keine der beiden Möglichkeiten tatsächlich zutrifft …
Er starrt mich an, als hätte ich aramäisch rückwärts mit ihm gesprochen. Genervt verdrehe ich die Augen und versuche, auf die Füße zu kommen, nachdem ich mir sicher bin, dass er mich nicht jeden Moment anfallen wird. Beim ersten Versuch dreht sich alles um mich herum und ich stütze mich mit beiden Händen ab. Ich schließe die Augen, bis das Schwindelgefühl abklingt, und atme einmal tief durch. Mir dröhnt der Schädel – sicherlich bekomme ich eine fiese Beule am Hinterkopf –, doch ich muss mich zusammenreißen. Ich bin schon viel zu lange in dieser Höhle. Mein Team sucht mich sicherlich schon und ist ganz krank vor Sorge.
Ich habe keine Zeit, um sie weiter mit diesem Kerl zu vertrödeln!
Auch wenn er so aussieht, als ob er dringend Hilfe nötig hätte … Ich werfe ihm einen abschätzenden Blick zu. Sein Gefasel über Magie und die Art, wie er seine eigenen Hände anstarrt, lassen mich daran zweifeln, dass er allein zurechtkommt. Draußen ist es immerhin bitterkalt und er hat nichts an. Er mag seltsam sein – vielleicht auch sehr seltsam –, aber kann ich ihn einfach so hier zurücklassen …?
Ach, verdammt!
Ich habe einfach ein viel zu großes Herz … Und ich könnte es nicht mit meinem Gewissen vereinbaren, wenn ich einen derart heißen Kerl im Nirgendwo erfrieren ließe. Ich sollte ihm zumindest eine kleine Starthilfe geben. Außerdem brauche ich dann nicht die unhandlichen Winterklamotten zurück zum Rollfeld zu schleppen. Eine klassische Win-win-Situation.
»In der Tasche da drüben habe ich ein paar Klamotten, die du haben kannst«, sage ich zu ihm und ärgere mich im gleichen Moment über mich selbst.
Er sieht aus, als wäre er verwirrt und hilflos, trotz seiner körperlichen Stärke.
»Ich mache mich dann auf und suche einen Weg aus dieser Schlucht heraus. Du kannst ja hingehen, wohin du willst. Also, man sieht sich.«
Hoffentlich nicht, füge ich in Gedanken hinzu.
Zunächst muss ich auskundschaften, wie ich am besten aus dieser Schlucht herauskomme. Bis dahin könnte ich die Tasche hierlassen, um unnötigen Ballast …
»Diese Schlucht und diese Höhle sind ein Gefängnis. Es gibt keinen Weg nach draußen«, sagt er, ohne auf mein Angebot einzugehen.
»Ja, klar, was auch immer«, gebe ich zurück.
Undankbarer Mistkerl! Wütend schlucke ich jedwedes Mitleid, das ich bis eben noch verspürte habe, hinunter. Anstatt sich darüber zu freuen, dass ich ihm helfen will, gibt er nur kryptisches Zeug von sich. Wieder ein Indiz dafür, dass er nicht ganz beisammen ist.
Kopfschüttelnd wende ich mich von ihm ab und hebe mein Handy auf. Wie erwartet, ist der Akku tot, und egal, wie sehr ich darauf herumdrücke, das Handy macht keinen Zuck mehr.
Verdammt! Wie soll ich denn jetzt mit meinem Team in Kontakt treten? Ich blöde Kuh habe mir keine Nummer irgendwo notiert, sondern mich nur auf mein Handy und das integrierte Telefonbuch verlassen. Seit ich klein war, habe ich keine Telefonnummer mehr auswendig gelernt. Jetzt, wo die Technik versagt, bin ich aufgeschmissen. Und so was passiert natürlich, wenn ich mitten in der Walachei festhänge, ist ja klar!
Vielleicht habe ich bei Tageslicht mehr Erfolg, mein Team zu finden. Wie lange scheint in Island die Sonne? Wenn mich nicht alles täuscht, nur für ein paar Stunden am Tag. Ich hätte vorgestern wenigstens ein bisschen Zeit mit Recherche verbringen sollen … Ich fühle mich gerade hilflos und allein. Von dem Kerl mit den seltsamen Ohren einmal abgesehen.
Die Ohren! Die habe ich ja ganz vergessen.
Ich drehe mich wieder zu ihm um und beobachte ihn eine Weile dabei, wie er nun doch in meiner Tasche wühlt und einige Kleidungsstücke so zwischen seinen Klauen emporhält, als befürchte er, sie könnten jede Sekunde explodieren.
Als ich ihn dabei erwische, wie er an meiner Unterwäsche schnuppert, wird es mir zu bunt.
»He, was machst du da?«
Energisch gehe ich auf ihn zu und er lässt den Slip fallen. Seine Ohren zucken, als er sich wieder auf mich konzentriert, und ich bin außerstande, den Blick von den spitzen Dingern zu lösen. Bei allem Respekt für meine Situation, aber das kann ich mir unmöglich einbilden!