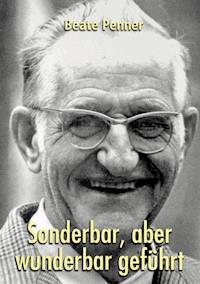
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Heinrich Epp wird in einer Zeit geboren, wo Revolution, Bürgerkrieg, Anarchie, Typhus und Hunger in Russland kein Verschonen, kein Erbarmen und keine Rücksicht kennen, sondern nur Willkür gegen Jung und Alt. Zusammen mit seiner Familie durchlebt er schwere Zeiten. Als der 2. Weltkrieg einbricht, wird er von seinen Lieben getrennt. Die Umstände führen ihn nach Deutschland und von da nach Paraguay. Seine komplette Familie bleibt in Russland. Durch all die Jahre erkennt Heinrich immer wieder: Sonderbar, aber wunderbar hat der Herr mich geführt!
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 208
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Für meinen Opa Epp, der in mir die Liebe zur Geschichte geweckt hat.
Und für seine Schwestern Greta und Liese, die ich bei meinem Besuch in Lienen im Jahre 2014 kennen und lieben gelernt habe. Dank ihrer Aufzeichnungen und ihrer Erzählungen war es mir möglich, die Geschichte von der Familie meines Großvaters aufzuschreiben.
Inhaltsverzeichnis
Prolog
Kapitel I
Kapitel II
Kapitel III
Kapitel IV
Kapitel V
Kapitel VI
Kapitel VII
Kapitel VII
Kapitel VIII
Kapitel IX
Kapitel X
Kapitel XI
Kapitel XII
Kapitel XIII
Kapitel XIV
Kapitel XV
Kapitel XVI
Epilog
Anhang
Prolog
Anna läuft es eiskalt über den Rücken. Soeben hat sie das Brotblech runter fallen lassen, und zwar mit vier großen Broten. Sie hatte es auf den Vierfuß in den Ofen stellen wollen, doch es ist so schwer gewesen, sie hat mit ihren 12 Jahren nicht genug Kraft dafür gehabt. In diesem Moment spürt sie auch schon einen Schlag am Hinterkopf. Was sie befürchtet hat, trifft ein: Ihre Stiefmutter hat gesehen was passiert ist und ist mit ihrer Holzlatsche gleich zur Stelle. Doch beinahe schlimmer als der Schlag sind die Worte, die sie hören muss. „Kannst du nicht aufpassen, du faules Mädchen!“ Mehr hört Anna nicht. Die Stiefmutter verlässt schimpfend den Raum und Anna lässt sich zu Boden fallen.
Tränen steigen in ihre Augen. Erst hat sie mit Mühe und Not den Teig geknetet. Danach hat sie den Ofen mit Stroh geheizt und dann den Vierfuß in die heiße Glut befördert. Beim Raufstellen des Bleches ist das Unglück passiert: Sie hat das Gleichgewicht verloren. Ein Brot ist in die Glut gefallen, die anderen drei liegen zusammengefallen auf dem Fußboden. Um diese wird Anna sich später kümmern.
In diesem Moment ist ihr einfach nur nach Weinen zumute. Sie weint, weil sie müde ist. Von um fünf ist sie bereits auf den Beinen, weil die Kühe gemolken werden mussten. Danach hat sie ihre Geschwister für den Tag fertig gemacht, um gleich darauf mit dem Brotbacken anzufangen. Und nun ist die ganze Mühe umsonst! Anna laufen die Tränen über die Wangen. Sie weint aber auch, weil sie nicht nur müde, sondern auch sehr traurig ist. Wie schon so oft in den letzten drei Jahren, fragt sie Gott: „Warum Gott? Warum musste meine Mama sterben?“ Warum, warum… hallt es in ihrem Kopf wieder. Noch hat sie nie eine Antwort auf ihre Fragen erhalten.
Ihre liebe Mutter ist 1901 gestorben. Sie war nach der Geburt ihres letzten Kindes nicht mehr so richtig hoch gekommen. Ein Jahr später war sie dann ganz sanft eingeschlafen. Woran genau sie gestorben war, hat man der Neunjährigen nicht gesagt. Anna erinnert sich, dass sie ihren Papa am Sarg ihrer Mutter sitzen sah und er hemmungslos weinte. Anna war die Älteste, ihre Schwestern waren sieben und fünf und ihre Brüder drei und ein Jahr alt. Annas heile Welt war damals zusammen gebrochen. Wie würde es weitergehen? Wer würde für sie waschen, kochen und nähen? Wer würde des Abends mit ihnen singen und ihnen eine Gute-Nacht-Geschichte erzählen? Wer würde da sein, wenn sie aus der Schule kam? Die Fragen hatten kein Ende genommen. Annas kleine Kinderseele war unbeschreiblich traurig gewesen.
Mit fünf Kindern unter zehn Jahren hatte Vater Gerhard keine Wahl gehabt. Er musste sich um die Wirtschaft kümmern. Von irgendetwas mussten sie ja leben. Er hatte keine Zeit, den Haushalt zu führen und sich um die Kinder zu kümmern, und er hatte auch absolut keine Ahnung davon. In der mennonitischen Gesellschaft, in der er lebte, war es nichts Fremdes, wenn ein Witwer bald nach dem Tod seiner Frau wieder heiratete. In seiner Trauer und Verzweiflung hatte er sich beraten lassen. Wer würde einen Witwer mit fünf kleinen Kindern heiraten? Die Helene Ridiger aus einem nah gelegenen Dorf käme aus guter Familie, sei ein gutes Mädchen und wäre bereit ihn zu heiraten. Gerhard selber hatte sie überhaupt nicht gekannt. Nicht einmal ihre Familie. Doch er hatte nicht viel Zeit gehabt, er brauchte jemanden für seine Kinder. Und dass dieses junge Mädchen sich für einen Witwer mit fünf kleinen Kindern entschied, bewies doch eindeutig, dass sie ein gutes Herz hatte, so hatte er gedacht.
Doch schon bald nach der Hochzeit hatte Gerhard Thielmann gemerkt, dass er einen großen Fehler begangen hatte. Helene war die einzige Tochter und furchtbar verwöhnt. Sie hatte noch nie einen Haushalt geführt und machte auch keine Anstalten, es zu lernen. Doch das Allerschlimmste war, dass ihr die Liebe zu den Kindern gefehlt hatte und immer noch fehlte. Noch am Hochzeitstag hatte sie Anna ein Riesentheater gemacht, weil diese eine von den Tassen der Hochzeitsgeschenke in die Hand nahm. Helene hatte Anna angeschrien. Diese war rausgegangen und hatte geweint.
Was habe ich getan?, hatte er mehr als einmal gedacht, wenn er in die Nähe seiner launischen jungen Frau gekommen war. Er hatte sich selber angeklagt. Doch nun war es zu spät gewesen. Eine Heirat war in seiner Gesellschaft ein Bund fürs Leben. An Scheidung hatte er nicht einmal gedacht. Er selber war auch so sehr mit seiner Arbeit beschäftigt gewesen, dass er längst nicht alles gemerkt hatte, was in seinem Hause vor sich gegangen war.
Am schlimmsten hatte es Anna getroffen. Sie war die Älteste, und doch noch viel zu jung für die Arbeit, die die Stiefmutter von ihr verlangte: Sie musste sich um ihre kleinen Geschwister kümmern, sie waschen, anziehen und füttern. Sie musste des Morgens alle Betten machen; nicht mal ihr eigenes machte die Stiefmutter selber. Sie musste melken, das Vieh besorgen und es zum Viehhirten treiben. Und währenddessen schlief die Stiefmutter. Das einzige, was sie gern und oft tat, war stricken.
Annas Brüder waren bald nach der Hochzeit krank geworden. Anna hatte den Arzt holen wollen, doch die Stiefmutter hatte sie daran gehindert. Das sei nicht nötig, hatte sie gesagt. So waren Annas Brüder elend dahingesiecht, bis sie irgendwann starben. Anna hatte ihr Bestes gegeben, ihnen zu helfen. Doch es war nicht genug gewesen.
Der Geruch des Brotes im Feuer holt Anna zurück in die Wirklichkeit. Sie hat sich eigentlich mit ihrem Schicksal abgefunden. Sie kann eh nichts an den Umständen ändern. Doch in Situationen wie diese beim Brotbacken kommt ihr alles hoch. Die Warum-Fragen nehmen kein Ende.
Sie rappelt sich auf – wie so oft schon. Sie liebt ihre Geschwister und auch ihren Papa. Sie muss durchhalten, wenn nicht für sich selber, dann für die Geschwister. Anna wischt sich mit der Schürze die Tränen weg und bekommt dadurch noch etwas Mehl in die Augen. „Auch das noch“, schimpft sie leise. Sie hebt den Brotteig auf und formt die Brote neu. So lecker werden sie nicht mehr werden, aber backen kann man sie noch.
Eines nimmt sie sich wieder einmal vor: Sie wird nicht aufgeben. Sie wird durchhalten. Aber sollte sie eines Tages heiraten und eigene Kinder oder vielleicht sogar Stiefkinder haben, wird sie diese gut behandeln!
I.
Es war Juni 1912. Alexanderwohl lag in der schönsten Sommerpracht. Die Apfel- und Birnbäume waren mit Früchten überschüttet und die Weizenfelder versprachen eine gute Ernte zu geben. Bis dahin dauerte es nicht mehr lange. In den Gärten blühten die verschiedensten Blumen und Sträucher. Nachts war ein kleiner Regen gefallen. Die Morgensonne ließ alles noch in besonders schönen Farben erscheinen. Anna war auf dem Weg zum Hof von Johann Epp. Dies also wird mein neues Zuhause, dachte sie bei sich, als sie durch das Gartentor trat. Aus der kleinen Anna war eine hübsche, tüchtige und, trotz aller schlimmen Erfahrungen, eine selbstsichere Frau geworden.
Jedes Dorf hat seine eigene Geschichte. Als die Siedler aus Alexanderwohl 1820 von Preußen nach Russland zogen, begegneten sie unterwegs Zar Alexander. Sie standen in gespannter Erwartung, als das Oberhaupt von Russland an ihnen vorbeikam, die Kutsche halten ließ und mit der rechten Hand winkte. „Ich wünsche euch Glück zu eurer Reise. Grüßt eure Brüder, ich bin da gewesen“, hatte Zar Alexander den Ansiedlern zugerufen. Aus diesem Grund hatten die Siedler ihr Dorf „Alexanderwohl“ genannt, denn Zar Alexander hatte ihnen Wohl gewünscht. Schon seit dem Jahr 1804 hatten Mennoniten in der Ukraine in der Kolonie Molotschna Dörfer angelegt. Alexanderwohl war wunderschön gelegen und hatte sich prächtig entwickelt.
In diesem Dorf wohnte Anna. Eigentlich hatte sie sich immer vorgenommen, nicht so jung zu heiraten. Doch die Situation zu Hause war immer mehr eskaliert. Die Stiefmutter war immer feindseliger und die Arbeit immer mehr geworden, denn fast jedes Jahr kam ein Kind zur Welt. Auch für diese hatte Anna sorgen müssen. Sie hatte wie eine Magd in dem Haus ihres Vaters gearbeitet und auch noch mit ihren 20 Jahren waren harte Schläge von ihrer Stiefmutter keine Seltenheit gewesen.
Als dann vor einigen Wochen Johann Epp, ein Witwer, bei ihnen auf den Hof gekommen war und um ihre Hand angehalten hatte, hatte sie nicht lange gezögert. Um dieser Hölle, zu der sich ihr Zuhause für sie verwandelt hatte, zu entrinnen, würde sie diesen fremden Mann heiraten. Johann hatte zwei Kinder, David war fünf Jahre alt und Lenchen drei. Die Mutter von diesen Kleinen war vor kurzem an Tuberkulose gestorben. Es starben viele Leute in ihrer Gegend, entweder an Lungentuberkulose oder an Knochentuberkulose. Bisher war noch kein Heilmittel gefunden worden, das diese ansteckenden Krankheiten bekämpfte. Johann war ein leidgeprüfter Mann. Nicht nur seine Frau war an dieser Krankheit gestorben, sondern auch vier seiner Geschwister und seine Mutter. Und bei Lenchen, seiner dreijährigen Tochter, schöpfte man Verdacht, dass sie bereits auch an dieser Krankheit leide.
Anna und Johann hatten vor der Hochzeit nicht viel Kontakt gehabt. Anna konnte nicht von ihrer großen Liebe sprechen. Aber Johann schien ihr vertrauenswürdig und es beeindruckte sie, wie er mit seinen Kindern umging. Er hatte immer so einen liebevollen Blick, wenn er zu ihnen sprach.
An diesem Morgen, als sie durch den Garten von Johanns Vater ging, nahm Anna sich wieder einmal vor, dass sie zu Johanns Kindern gut sein würde. Sie wollte ihnen ihre Mutter ersetzen. Diese kleinen Menschen sollten nicht so eine schwere Kindheit erleben, wie sie es selber hatte müssen.
„Anna, kommst du?“, hörte sie die Stimme ihres zukünftigen Mannes, die sie aus ihren Tagträumen riss. Sie wollten noch einige Kleinigkeiten in ihrem Häuschen beenden, bevor sie sich für die Feier vorbereiteten. Deshalb war sie auf den Hof gekommen. Anna ging zu Johann und lächelte ihm zu. Gemeinsam gingen sie am großen Haus von Johanns Vater vorbei. Sie würden auf dem Hof von Vater Epp wohnen, in einem kleinen Lehmhaus im Hinterhof. Das war im Dorf nicht unüblich, dass verheiratete Kinder auf dem Hof blieben, um irgendwann dann den ganzen Betrieb zu übernehmen. Vater Epp wohnte im Moment mit der Familie seines Sohnes Abram zusammen im großen Haus.
Vater Epp war ein fleißiger Mann gewesen. Diesen Hof hatte er sich in jungen Jahren gekauft. Erst hatte er selber in dem kleinen Lehmhaus gewohnt. Mit der Zeit und großer Mühe hatte er sich das große Wohnhaus mit dem anliegenden Stall gebaut. Nun war er taub und gelähmt.
Das Lehmhaus war nicht sehr geräumig. Aber Anna freute sich auf ihr neues Zuhause. Während Johann noch einige Möbel zurechtstellte, beobachtete Anna ihn. Er war ungefähr 1,90 Meter hoch und etwas hager. Was ihr an ihm besonders gefiel, waren seine Augen. Sie strahlten einen tiefen Frieden aus. In diesem Moment begegneten sich ihre Augen. Und Anna fühlte, dass sie bei diesem Mann sicher geborgen war und war sich sicher, dass sie ihn lieben lernen würde.
•••
„Johann, wir müssen etwas mit Lenchen tun“, sagte Anna einige Monate später zu ihrem Mann. Sie saßen in ihrer großen Stube und Anna war mit Handarbeit beschäftigt. Der Herbst hielt Einzug und die Abende waren schon recht kühl. Es gab immer viel zu tun: Unterwäsche, Kleider, Hemden und Hosen – alles musste sie selber nähen und wenn etwas kaputt war, flicken. Doch für Anna war das kein Problem. Sie hatte das ja zu Hause auch schon immer alles getan. „Warum meinst du, Anna?“, fragte Johann. Er saß in seinem großen Stuhl und ruhte sich von der Tagesarbeit aus.
„An ihren Ellenbogen zeigen sich komische Geschwüre. Ich habe sie beobachtet, und sie werden von Tag zu Tag schlimmer. Sie hat leicht erhöhte Körpertemperatur und scheint meistens sehr müde zu sein.“ Dass Lenchen auch von der Tuberkulosekrankheit infiziert war, hatten sie im Verdacht gehabt, und diese Symptome ließen daran keinen Zweifel mehr. Es gab so viele Erkrankungsfälle in ihrer Gegend. „Ich weiß nicht mehr, was ich tun soll.“
Johann beobachtete seine Dreijährige und sagte nach kurzem Zögern: „Ich werde morgen früh mit Abram die Arbeit besprechen und dann fahren wir zum Arzt.“ Sein Blick war auf einmal müde. Würde auch noch seine Tochter dieser Krankheit zum Opfer fallen? Würde er noch mehr liebe Menschen verlieren? Seine sonst so mutige und stramme Körperhaltung rutschte zusammen und sein Blick glitt in die Ferne. Was er wohl denkt?, fragte Anna sich. Im Stillen betete sie, dass Gott Lenchen am Leben halten und ihr wieder Gesundheit schenken sollte.
Seit vier Monaten waren sie nun schon verheiratet. Anna fühlte sich sehr wohl in ihrem neuen Zuhause. Sie war glücklich, so glücklich wie noch nur selten zuvor. Sie fühlte sich geliebt. Und, das wusste noch nur Johann, sie war schwanger. Schon bald würde sie nicht nur zwei Stiefkinder haben, sondern auch ein leibliches Kind. Ihr Herz machte einen Sprung vor Freude, wenn sie daran dachte.
Eine große Sorge, die allerdings immer noch stark ihr Herz drückte, waren ihre Geschwister. Diese waren ja bei der Stiefmutter geblieben. Wie ging es ihnen? Wie würden sie ihr Leben meistern, wenn die ältere Schwester nicht mehr da war? Die jüngste, Liese, konnte sehr schlecht sehen. Wiederholt hatte die Stiefmutter sie mit „blinde Henne“ beschimpft, wenn sie gestolpert oder ihr etwas runtergefallen war. Wie würden sie mit all den Demütigungen klarkommen?
Doch sehr oft hatte sie nicht Zeit, sich Sorgen zu machen. Ihre neue Familie nahm alle Zeit in Anspruch. David und Lenchen hatten sie sofort in ihr Herz geschlossen. Lenchen hatte sie vom ersten Tag an „Mama“ gerufen. Dies hatte in Anna komische Gefühle geweckt, aber sie hatte sich riesig gefreut. Das war ein Vertrauensbeweis.
In diesem Moment kam Lenchen auf sie zu und kletterte auf ihren Schoß. „Erzählst du mir eine Geschichte, Mama? Die von dem Lämmchen?“, fragte sie und schaute Anna mit ihren hellblauen Augen bittend an. Lenchens Lieblingsgeschichte war die Geschichte vom Verlorenen Schaf. Sie konnte sie immer und immer wieder hören. Anna erzählte sie ihr und danach stimmte Johann das bekannte Kinderlied „Weil ich Jesu Schäflein bin“ an. Lenchen hatte eine klare Stimme und sang sehr gerne, genau wie ihr Vater.
Bevor Anna Lenchen ins Bett legte, tupfte sie die Geschwüre noch einmal mit Wasser sauber. „Das tut weh, Mama“, wimmerte Lenchen. „Ich weiß mein Schatz, morgen fahren wir zum Arzt, um ihm deine Geschwüre zu zeigen. Dann wird alles gut. Das verspreche ich dir, Lenchen.“ Sie gab ihrer Tochter einen Kuss auf die Stirn und deckte sie zu.
Beim Hinausgehen dachte sie bei sich: Habe ich eben zu viel versprochen? Bin ich mir wirklich so sicher, dass es für Lenchen Heilung gibt? Sie hoffte es von ganzem Herzen. Sie würde ihr Bestes geben.
•••
„Es sieht nicht gut aus. Lenchens Geschwüre haben sich schon ziemlich weit entwickelt.“ Das waren die Worte des Arztes, nachdem er Lenchen untersucht hatte. Annas Herz klopfte wie wild. Sie hatte es befürchtet, und doch hatte sie im Stillen auf eine Mut machende Antwort gehofft. „Was kann ich tun?“, fragte sie den Arzt. Irgendwie müsste es doch eine Möglichkeit geben, der kleinen Lenchen zu helfen.
„Lenchen wird neue Wunden bekommen, sobald sie einmal fällt. Sie sollte nicht viel toben, um vorzubeugen, dass die Geschwüre überhand nehmen. Und sie sollte sich möglichst im Trockenen aufhalten. Die Tuberkulose wird in der Luft übertragen. Bei hoher Feuchtigkeit besteht auch für die anderen Familienmitglieder die Gefahr, angesteckt zu werden.“ Anna erschrak. Daran hatte sie noch nicht einmal gedacht. War es möglich, dass sie auch schon infiziert war? Wenn sie es war, dann auch das Baby, das in ihrem Leib heranwuchs. Denn sie wusste von anderen Fällen, dass Schwangere die Krankheit auf ihre Babys übertrugen. Im Stillen schickte sie ein Stoßgebet zum Himmel.
Beim Hinausgehen steckte Lenchen ihre kleine Hand in die von Anna und schaute sie mit ängstlichen Augen an. „Es wird alles gut, mein Mädchen“, tröstete sie Lenchen, obwohl sie sich dessen nicht so sicher war.
•••
Anna behütete Lenchen mit der allergrößten Sorgfalt. Sie durfte selten draußen mit David toben. Sie las ihr viele Bücher vor und beschäftigte sie so gut wie möglich drinnen. Das mit der trockenen Luft war allerdings ein echtes Problem. Die Wände des kleinen Lehmhauses waren nass und der Fußboden auch. Anna lüftete so oft sie konnte und bemühte sich sehr.
David war ein Musterkind, gehorsam und verständnisvoll. Anna war für ihn bald die erste Vertrauensperson. Alles vertraute er ihr an.
Johanns älterer Bruder Abram wohnte mit seiner Familie im Herrenhaus, zusammen mit Vater Epp. Alle zusammen erledigten sie die Arbeit in Haus und Hof. In Alexanderwohl hatte jeder Bauer hinter dem Fluss, der am Dorf vorbeilief, einen großen Obstgarten, der genauso breit wie das Grundstück war. Jeder Hof hatte in der Regel Apfel-, Birnen-, Pflaumen- und Aprikosenbäume. Das Obst wurde entweder frisch gegessen, gedörrt und für den Winter aufbewahrt, oder es wurde Sirup und Marmelade gekocht. Gefallenes Obst wurde dem Vieh zum Fraße hingeworfen. Die Kinder hatten die Aufgabe, das Obst in Körben zu sammeln. Auch David half schon kräftig mit.
Anna war glücklich. Wenn sie nicht in der Küche war, verarbeitete sie Obst oder nähte für die Familie. Zu tun gab es immer genug. Viel Zeit verbrachte sie auch mit den Kindern. Johann war gut zu ihr. Manchmal, wenn er sie mit seinen freundlichen Augen ansah, verspürte sie ein Kribbeln. Einige Monate nach ihrer Hochzeit verspürte sie nicht nur große Sympathie dem Mann gegenüber, den sie geheiratet hatte, sondern auch schon Liebe und großen Respekt.
Sie dankte Gott für die Wendung, die es in ihrem Leben gegeben hatte. Und sie freute sich auf ihr Baby, ihr Bauch wurde immer runder. Gott zeigte ihr, dass er es sehr gut mit ihr meinte.
•••
Ende März 1913 saß Familie Epp am Ofen und wärmte sich. Obwohl der Winter bereits verabschiedet worden war, herrschten draußen noch winterliche Temperaturen. Die Winterabende verbrachten sie in der Regel als Familie. Es war für Anna die schönste Zeit des Tages. Johann hatte beide Kinder auf dem Schoß, sang mit ihnen und lehrte ihnen Bibelverse. Anna saß mit einer Hose in der Hand und wollte sie flicken. David spielte gern draußen und da gab es immer wieder Kleidungsstücke in Ordnung zu bringen.
Doch irgendwie war sie an diesem Abend nicht so ganz bei der Sache. Ihr Bauch drückte immer mehr. Das Sitzen fiel ihr schwer. Sie stand auf, um einige Schritte zu gehen. Und da fingen die Stiche und das Ziehen im Unterleib an. Es würde also bald soweit sein – der langersehnte Moment der Geburt ihres ersten Kindes, dem sie mit Freude, aber auch mit großer Angst entgegen gesehen hatte.
Sie gab Johann durch ein Zeichen zu verstehen, dass die Kinder ins Bett müssten. Der sprang sofort auf und machte sich auf den Weg, die Hebamme zu holen. Sowohl Anna als auch Johann waren unruhig. Kam es doch oft vor, dass eine Mutter bei der Geburt starb. Johann hatte Angst davor, er wollte nicht noch eine Frau verlieren.
Doch es ging alles gut. Bevor der Morgen anbrach, hielt Anna einen gesunden Sohn im Arm. Sie nannten ihn Gerhard, wie Annas Vater. Die Geburt war schwer gewesen, aber das Gefühl, ein eigenes Kind in den Armen zu wiegen und zu stillen, ließ die schweren Stunden bald in den Hintergrund rücken.
David und Lenchen nahmen das neue Familienmitglied mit Freuden auf. Lenchens Geschwüre wurden weniger und sie war viel weniger kränklich. Nach einer Visite sagte der Arzt zu Anna: „Sie haben Erstaunliches vollbracht! Es ist unglaublich, wie sich Lenchens Zustand verbessert hat.“ Anna erwiderte darauf: „Ich habe mein Bestes gegeben, aber Gott ist es, der Heilung schenkt.“ Darauf erwiderte der Arzt nichts, denn er war ein bekennender Atheist.
Nicht nur gesundheitlich, sondern auch wirtschaftlich lief es in der Familie Epp gut. Das Glück schien auf ihrer Seite zu sein, würde manch einer sagen. Doch sowohl Anna als auch Johann sagten dazu: „Wir leben in der Gnade Gottes und sind dankbar für den reichlichen Segen!
II
Alexanderwohl lag still in der Abenddäm-merung. Man schrieb Juli 1920. Ein Beobachter, der dieses Dorf vor acht Jahren besucht hatte, würde es nicht wiedererkennen. Auf der breiten Dorfstraße, an beiden Seiten der Straße hohe Bäume und zu jeder Seite die Gartenzäune, regte sich nichts. Das lebhafte Treiben, das man gewöhnlich um diese Jahreszeit kurz vor Sonnenuntergang beobachtet hatte, war nicht mehr da. Totenstille. Zwischendurch ein müdes Schreien einer Kuh. Wo waren die weiten Weizenfelder geblieben? Die Felder waren kahl. Wo war die heitere Dorfgesellschaft, die sich regelmäßig, wenn nicht auf der Straße dann in ihrer prächtigen Kirche versammelte?
Im Hause Epp saß man beisammen. Trotz der Tatsache, dass die Familie bereits gewachsen war, herrschte auch bei ihnen Stille. Gerhard waren Anna, Johann (Hans) und Abram gefolgt. Zusammen mit David und Lenchen, ihren Stiefkindern, hatte Anna nun schon sechs Kinder. Und sie stand kurz vor der Geburt ihres fünften Kindes. Anna sah nicht gut aus. Ihr Gesicht war blass, abgemagert und hohläugig. Ihre einstige Fülle in den Wangen war verschwunden.
Leise stimmte Johann das Lied an „Wenn der Heiland, wenn der Heiland, als König erscheint…“ Die Kinder stimmten leise mit ein. Das Singen mit ihrem Vater gehörte im Moment zu den besten Augenblicken in ihrem Leben. Anna strich mit der Hand über ihren runden Bauch. „Was wird die Zukunft uns bringen, mein Kleines?“, sagte sie ganz leise zu ihrem Baby.
Wenn sie es vor acht Jahren als ein Segen empfunden hatte, dass sie wirtschaftlich vorankamen und gesund waren, dann sah sie es heute als größtes Geschenk an, dass sie noch alle am Leben waren. Sie hatten weder bestellte Felder, noch Arbeit, noch genug zu essen. Heute Abend zum Beispiel hatte jedes Kind einen gerösteten Zwieback erhalten, mehr nicht. Johann und sie waren leer ausgegangen. David war mittlerweile schon dreizehn Jahre alt. Er hätte viel mehr gebraucht, um satt zu werden und sich richtig zu entwickeln. Doch mehr war nicht da.
Und Familie Epp war kein Einzelfall in der Ukraine. Die gesamten mennonitischen Dörfer hatten schreck-liche Zeiten hinter sich, und die Zukunft sah nicht rosiger aus. Politisch gesehen war die Lage chaotisch und unkontrollierbar, und das seit mehr als vier Jahren. Erst war der 1. Weltkrieg ausgebrochen, dann hatte Zar Nicolaus II., den die Mennoniten eigentlich verehrten, ein Gesetz erlassen, dass alle Großgrundbesitzer enteignet werden sollten, besonders auch die Deutschen, denn sie waren ja Russlands Feinde. Als dann die Kerenski Regierung den Zar gestürzt hatte, war für die Mennoniten ein kleines Licht am Horizont erschienen. Die Zeiten versprachen besser zu werden. „Du wirst sehen, Anna“, hatte Johann zu seiner Frau gesagt, „es wird wieder leichter. Diese Regierung möchte sogar, dass wir als Mennoniten politisch aktiv werden, dass wir mitdenken und mitarbeiten. Auch brauchen wir uns vor keiner Enteignung mehr fürchten.“ Anna hatte damals gerade ihren sechs Wochen alten Hans gestillt. Johann hatte so zuversichtlich gesprochen, dass sie ihm gerne geglaubt hatte.
Doch Johanns Optimismus hatte sich als falsch erwiesen. Es wurde nicht leichter, sondern nur noch viel schlimmer. Die Kerenski Regierung wurde schon bald gestürzt und die Bolschewiken übernahmen das Ruder. Unter ihrer Regierung zog Terror, Gewalt, Plünderung und Mord ein. „Reichtum ist Verbrechen und Eigentum Diebstahl“, so lautete das Motto in dieser Anarchie. Besonders schwer betroffen waren die mennonitischen Siedlungen in der Ukraine. Alles, was nicht niet- und nagelfest war, nahmen die Banden unter der Führung ihres Helden Machno mit: Schmuck, Kleider, Mehl, Schinken, Butter und Pferde. Mennoniten wurden ohne Anklage festgenommen, gefoltert und erschossen.
Anna liefen die Tränen über die Wangen. Bei all den schweren Ereignissen, die sie in den letzten Jahren gemacht hatte, vergaß sie, dass sie im Kreise ihrer Familie saß. Sie dachte an die liebe Tante Sawatzky im Nachbardorf, die zusammen mit ihren drei Töchtern überfallen und dann vergewaltigt wurden. Die siebzehnjährige Lisa war nicht nur mit den entsetzlichen Erinnerungen zurückgeblieben, sondern auch noch mit einem Kind im Bauch. Ein Kind von einem Verbrecher! Ein Kind, das in solch einer furchtbaren Situation gezeugt wurde!
Weiter dachte Anna an Familie Sukkau, die komplett ausgerottet wurde; die Eltern mit ihren sieben Kindern. Niemand war am Leben geblieben. In der Nachbarkolonie Chortitza waren in dem Dorfe Eichenfelde in einer Nacht alleine 81 Männer und vier Frauen umgebracht worden. Das hatte Anna nur gehört; Freunde oder Bekannte hatte sie in diesem Dorf nicht. Das Furchtbare dieser Situation überstieg Annas Vorstellungsvermögen.





























