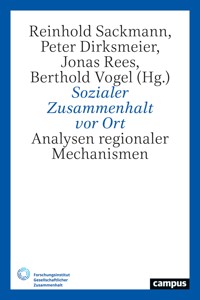
Sozialer Zusammenhalt vor Ort E-Book
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Campus Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Gesellschaftlicher Zusammenhalt
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2024
Gesellschaftlicher Zusammenhalt besteht nicht von selbst, sondern ist auf bestimmte Mechanismen seiner Genese angewiesen. Davon ausgehend beschäftigen sich die Beiträge dieses Bandes mit der Frage, welche Mechanismen dies konkret sind und wie sie sich hervorbringen lassen. Auf der Grundlage einer eigenen repräsentativen Panelstudie diskutieren sie, wie soziale Kohäsion auf lokaler Ebene etabliert und aufrechterhalten werden kann. Zugleich verdeutlichen ihre Analysen die Vielfalt der empirischen Erklärungsansätze gesellschaftlichen Zusammenhalts.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 350
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Reinhold Sackmann, Peter Dirksmeier, Jonas Rees, Berthold Vogel (Hg.)
Sozialer Zusammenhalt vor Ort
Analysen regionaler Mechanismen
Campus VerlagFrankfurt/New York
Über das Buch
Gesellschaftlicher Zusammenhalt besteht nicht von selbst, sondern ist auf bestimmte Mechanismen seiner Genese angewiesen. Davon ausgehend beschäftigen sich die Beiträge dieses Bandes mit der Frage, welche Mechanismen dies konkret sind und wie sie sich hervorbringen lassen. Auf der Grundlage einer eigenen repräsentativen Panelstudie diskutieren sie, wie soziale Kohäsion auf lokaler Ebene etabliert und aufrechterhalten werden kann. Zugleich verdeutlichen ihre Analysen die Vielfalt der empirischen Erklärungsansätze gesellschaftlichen Zusammenhalts.
Vita
Reinhold Sackmann ist Professor für Soziologie mit dem Schwerpunkt Sozialstrukturanalyse an der Universität Halle-Wittenberg und Forschungsdirektor des Zentrums für Sozialforschung Halle (ZSH). Peter Dirksmeier ist Professor für Kulturgeographie am Institut für Wirtschafts- und Kulturgeographie der Leibniz Universität Hannover sowie Sprecher des Forschungsinstituts Gesellschaftlicher Zusammenhalt am Standort Hannover. Jonas Rees ist Professor für Politische Psychologie an der Universität Bielefeld. Berthold Vogel ist geschäftsführender Direktor des Soziologischen Forschungsinstituts (SOFI) an der Georg-August-Universität Göttingen.
Übersicht
Cover
Titel
Über das Buch
Vita
Inhalt
Impressum
Inhalt
Peter Dirksmeier, Reinhold Sackmann, Jonas H. Rees und Berthold Vogel: »Gleich und gleich gesellt sich gern«: Lokalen gesellschaftlichen Zusammenhalt verstehend erklären
Abstract
1.
Einleitende Bemerkungen: Gesellschaftlicher Zusammenhalt als politisch-soziale Leitvokabel
2.
Mechanismen des Zusammenhalts: Eine Annäherung
3.
Mechanismen des Zusammenhalts: Möglichkeiten ihrer Theorie
4.
Stadt, Region, Land, das Lokale: Empirische Kategorien räumlicher Varianzen der kohäsiven Mechanismen
Literatur
Reinhold Sackmann, Jonas Rees und Jakob Hartl: Methodische Grundlagen des Regionalpanels
Abstract
1.
Ziele des Regionalpanels
2.
Erhebungsdesign des Regionalpanels
2.1
Untersuchungsorte und Stichprobengröße
2.2
Fragebogeninhalte und Kontextdaten
2.3
Erhebung und Rücklauf
3.
Methodenexperimente
3.1
Mixed-Mode online und Papier
3.2
Mehrsprachigkeit
3.3
Koproduktion
3.4
Überprüfung Gewichte, Grundgesamtheit Magdeburg
4.
Fortführungsperspektiven
Literatur
Reinhold Sackmann und Ina Mayer: Raummuster sozialen Zusammenhalts in Deutschland
Abstract
1.
Soziale Räume und Zusammenhalt
1.1
Soziale Räume
1.2
Zusammenhalt
2.
Messung von Zusammenhalt
2.1
Konzept
2.2
Konfirmatorische Faktorenanalyse
3.
Verteilungsmuster sozialen Zusammenhalts in lokalen Gesellschaften
4.
Limitationen
5.
Fazit
Literatur
Angelina Göb und Peter Dirksmeier: Zentren des Zusammenhalts: Urbane Nachbarschaften als Kohäsionskapital
Abstract
1.
Zugänge zum lokalen Zusammenleben
1.1
Begegnungen in und mit der Nachbarschaft
1.2
Das Nachbarschaften und die Nachbarschaftlichkeit
2.
Untersuchungsmethoden und Untersuchungsräume
2.1
Quantitativer Zugang
2.2
Qualitativer Zugang
2.3
Ergebnisse der quantitativen Analyse
2.4
Ergebnisse der qualitativen Analyse
2.4.1
Nachbarschaft aus Sicht der Bewohner:innen in Linden-Süd
2.4.1.1
Zum Nachbarschaftsverständnis und zu nachbarschaftlichen Normen
2.4.1.2
Zur Identifikation mit der Nachbarschaft und dem Nachbarschaften
2.4.1.3
Nachbarschaftlicher Zusammenhalt und Zusammenhalt in der Nachbarschaft
2.4.2
Nachbarschaft aus Sicht der Bewohner:innen im Sahlkamp
2.4.3
Nachbarschaft aus Sicht der lokalen Akteur:innen in Linden-Süd und im Sahlkamp
3.
Diskussion
Literatur
Michael Windzio, Liz Weiler, Betina Hollstein und Jan-Philip Steinmann: Wechselseitige Bewertungen sozialer Milieus. Erste empirische Befunde zum Einfluss von Netzwerken und moralischen Orientierungen
Abstract
Einleitung
1.
Theoretischer Hintergrund: Von Klassen und Schichten über Lebensphilosophien zu sozialen Produktionsfunktionen
1.1
Individualisierung und Neuordnung der sozialen Großgruppen
1.2
Die Lebensphilosophien bei Gerhard Schulze
1.3
Soziale Produktionsfunktionen
1.4
Konträre Moralvorstellungen
1.5
Bewertungen sozialer Milieus
1.6
Milieukoalitionen in Ost- und Westdeutschland
2.
Daten und Methoden
3.
Ergebnisse
4.
Schlussfolgerungen
Anhang 1
Die Vignetten mit den milieuspezifischen Lebensphilosophien, Prozentanteil in der Analysegesamtheit. Die Wohnzimmerbilder können auf Anfrage zugeschickt werden.
Anhang 2
Moraldimensionen nach Haidt (2012), eigene Faktorlösungen
Anhang 3
Literatur
Angelina Göb: Was hält uns zusammen? Das Regionalpanel als Ausgangspunkt einer Krisen- und Selbstbestimmung
Abstract
1.
Das Modell von Krise und Routine und die Methode der objektiven Hermeneutik
2.
Zur interessensgeleiteten Explikation und interaktionalen Einbettung der Fallgestalten
2.1
Die Zusammenhaltsfrage
2.2
Die offene Fragebogenfrage: Positionierung von und durch Themen
2.3
Die erste Krise: Positionierung zur Teilnahmeaufforderung
2.4
Die zweite Krise: Positionierung zur Fragebogenfrage
3.
Fazit und Ausblick
3.1
Ergebnisse
3.2
Diskussion und Desiderata
Literatur
Jakob Hartl, Nathalie Schönburg und Lukas Theinert: Wahlverhalten und Zusammenhalt in Magdeburg 2021
Abstract
1.
Rechte Landnahme in der Stadt
2.
Zusammen gegen rechtsradikale Parteien?
2.1
Vertrauen zwischen Menschen und Institutionen
2.2
Ambivalente Identifikation(en)
2.3
Politische Wirksamkeit im Kollektiv?
3.
Datenbeschreibung
3.1
Magdeburg im Kontext ostdeutscher Städte
3.2
Operationalisierung Zusammenhalt und Subdimensionen
3.3
Operationalisierung Deprivation, Urbanität, Segregation
4.
Ergebnisse
5.
Diskussion und Fazit
Literatur
Jann-Friedrich Hesse, Andreas David Schmidt, Julian Schweer, Maike Reinhold und Berthold Vogel: Wie viel Mittelstadt braucht der sozialräumliche Zusammenhalt?
Abstract
1.
Infrastrukturen und Zusammenhalt: Bezahlbarer Wohnraum im Fokus
2.
Empirische Einblicke: Zufriedenheit mit Wohnraum im Vergleich der Mittelstädte
2.1
Methodenreflexion im Kontext von Zufriedenheitsforschung: Trotz Restriktionen relevante Hinweise für Wohnraumqualität
2.2
Bezahlbarer Wohnraum im regionalen Vergleich: Zufriedenheit in Dörfern deutlich höher als in Städten
2.3
Keine homogene Beurteilung von bezahlbarem Wohnraum entlang soziodemografischer Merkmale in den Mittelstädten
2.4
Qualitative Kontextualisierung: Thema Wohnen spielt für viele Befragte eine wichtige Rolle
3.
Die Mittelstadt als Bindeglied zwischen Großstadt und ländlichem Raum – ein Ort des Zusammenhalts?!
Literatur
Jan-Hinrik Schmidt und Hannah Immler: Lokalbezogene Medienrepertoires und zusammenhaltsbezogene Einstellungen
Abstract
1.
Angebotsspektrum und Nutzung regionaler Medien
1.1
Angebotstypen
2.
Mediennutzung
3.
Erkenntnisinteresse und Datengrundlage
4.
Empirische Befunde
4.1
Mediennutzung und lokalbezogene Informationsrepertoires
5.
Soziodemografische Merkmale der Medienrepertoire-Klassen
6.
Medienrepertoires und zusammenhaltsbezogene Einstellungen
6.1
Zusammenhaltsindex
6.2
Gefühlsmäßige Verbundenheit
6.3
Einschätzung der eigenen Nachbarschaft
6.4
Gefährdungswahrnehmungen von Zusammenhalt
7.
Fazit
Literatur
Michael Papendick, Jonas Rees und Leon Walter: Geteilte Erinnerungen: Zur Bedeutung historischer Bezugspunkte für den lokalen Zusammenhalt
Abstract
1.
Methodik
2.
Ergebnisse
2.1
Inhalte lokaler Erinnerungskulturen
2.2
Bewertung der erinnerten Kontexte
2.3
Zusammenhänge mit lokalen Identifikationen
3.
Diskussion
Literatur
Dieter Rink und Annegret Haase: Sozialer Zusammenhalt vor Ort. Analysen regionaler Mechanismen. Ein Kommentar aus stadtsoziologischer Perspektive
Abstract
1.
Zum Konzept des Zusammenhalts
2.
Zu den Befunden des Regionalpanels
3.
Fazit
Literatur
Autor:innen
»Gleich und gleich gesellt sich gern«: Lokalen gesellschaftlichen Zusammenhalt verstehend erklären
Peter Dirksmeier, Reinhold Sackmann, Jonas H. Rees und Berthold Vogel
Abstract
Sozialwissenschaftliche Erklärungsmodelle für gesellschaftlichen Zusammenhalt sollten denkbare erklärende Variablen beinhalten, gleichzeitig aber einfach gehalten sein, um überhaupt erst sinnvolle Argumente anbieten zu können. Der Beitrag entwickelt insbesondere ein Konzept von Zusammenhalt zwischen Gruppen, die sich in bestimmten abgrenzbaren Raumausschnitten wie Städten, Stadtteilen, Regionen oder Dörfern finden, die wiederum je nach ihrer Lokalisation und Positionierung untereinander mehr oder weniger kohäsiv sein können. In Anlehnung an Toblers »erstes Gesetz der Geographie«, nachdem alles mit allem zusammenhänge, nahe Dinge aber enger als ferne, wird sodann eine Einteilung von Mechanismen des Zusammenhalts in nahe und ferne vorgenommen. Zweitere lassen sich empirisch nur schwer erfassen und sind in ihrer Erklärungskraft vermutlich stark begrenzt. Mechanismen, die auf Nähe oder Nahbarkeit in sozialer wie räumlicher Hinsicht abstellen, sind dagegen von weitaus größerer Bedeutung. Sie stehen im Zentrum der Analysen, die im vorliegenden Sammelband zusammengetragen sind. Nach einer Übersicht über die gesammelten Beiträge werden potenzielle Ansatzpunkte für eine Theorie der Mechanismen des gesellschaftlichen Zusammenhalts skizziert und empirische Kategorien räumlicher Varianzen kohäsiver Mechanismen diskutiert. Das Lokale weist dabei aus Sicht der Autoren besondere Relevanz für gesellschaftlichen Zusammenhalt auf und ist eine wichtige Maßstabsebene des Regionalpanels.
Keywords: Erklärungsmodelle; Theorien; Mechanismen; Nähe; Zusammenhalt
1.Einleitende Bemerkungen: Gesellschaftlicher Zusammenhalt als politisch-soziale Leitvokabel
Ein wesentlicher Aspekt der Vielschichtigkeit der Gegenwartsgesellschaft manifestiert sich in der simplen Einsicht, dass alles mit allem zusammenhängt. Die multiple Interdependenz ganz verschiedener Teile der Gesellschaft erlaubt gleichzeitig die wenig ansprechende Diagnose, dass sich soziale Wirklichkeiten verändert haben und Institutionen an Griffigkeit und Kohäsionskraft verloren haben. Hinzu kommen Verteilungskonflikte unterschiedlicher Art, die im Prinzip wenig komplex sind, aber tief in das Leben der Menschen eingreifen. Im Ergebnis erscheint die soziale Kohäsion der Gesellschaft gefährdet. Gesellschaftlicher Zusammenhalt sei zwar politisch ausgesprochen wünschenswert, faktisch aber kaum (mehr) zu erreichen. Politische Parteien jedweder Couleur überbieten sich in der Ausschmückung von zu gehenden Pfaden und Implementierungsvorschlägen von politischen Maßnahmen, um den Zustand sozialer Kohäsion doch noch herzustellen (Hradil 2022: 8). Regierungsprogramme und Koalitionsverträge seit dem Jahr 2009 formulieren mehr oder minder direkt, dass die Sicherstellung des gesellschaftlichen Zusammenhalts eine wesentliche Aufgabe zukünftigen Regierungshandelns darstelle (Deitelhoff u. a. 2020). Letztlich ist dieser politische Diskurs um Zusammenhalt nicht spezifisch deutsch. Er spiegelt sich beispielsweise ebenfalls in der Big Society Cameron’scher Provenienz, die die Befähigung und Kompetenz, das soziale Leben aus eigener Kraft und mit eigenen Ressourcen gestalten zu können, und Kohäsion für die einzelnen Gesellschaftsmitglieder bedeuten sollte, letztlich aber die Neoliberalisierung weiter Gesellschaftsbereiche vorantrieb, wie Bulley und Sokhi-Bulley (2014: 452) konstatieren: »[T]he ultimate aim is to produce a population of efficient, responsible, productive and self-governing individuals and communities.« Ungeachtet der ontologischen Frage, was gesellschaftlicher Zusammenhalt überhaupt sei oder sein könne, stellt sich dessen Herstellung in der Gegenwartsgesellschaft offensichtlich als genuine Sisyphus-Aufgabe dar.
Wir leben nach der oft zitierten Diagnose des Soziologen Andreas Reckwitz in einer Gesellschaft der Singularitäten, die analog zur Big Society weniger Gleichförmigkeit denn markanten Individualismus prämieren würde. Dieser erzielbare Individualismusgewinn bemisst sich allerdings wieder an den allgemeinen Strukturen und Praktiken der konformen Mehrheit (Reckwitz 2021). Er wäre ohne diese schlichtweg nicht erzielbar. Individualistische Metaphern wie Singularität, Besonderung oder die Simmel’sche Extravaganz (Simmel 2020) existieren nur im Verhältnis zur scheinbar konformen Masse und hängen fundamental mit ihr zusammen. Die wiederum in dieser Abhängigkeit erkennbar werdende Relationalität ist damit eine der grundlegendsten Figuren der spätmodernen Gesellschaft und zum Beispiel in der soziologischen Theorie des Relationalen von Pierre Bourdieu prominent. Der sprichwörtliche butterfly effect bringt diese Situation auf den Punkt. Demnach sei es nicht ausgeschlossen, dass der Flügelschlag eines Schmetterlings in einem Teil der Welt zu einem Wirbelsturm in einem anderen Teil des Planeten führe (Lorenz 1993: 179). Für die sozialwissenschaftliche Beobachtung der Gesellschaft bedeutet diese Einsicht der (meteorologischen) Chaostheorie, jederzeit mit der überraschenden und nicht theoriekompatiblen Kontingenz des Realen zu rechnen und sie in mögliche Erklärungen der jeweils spezifischen beobachteten Phänomene miteinzubeziehen. Die Tatsache, dass alles wiederum alles andere beeinflusst, verlangt nach einer methodischen Quadratur des Kreises in den Sozialwissenschaften: Erklärungsmodelle sollten denkbare erklärende Variablen beinhalten, gleichzeitig aber einfach gehalten sein, um die unendliche Komplexität dieser Sinndeutungen möglichst weit zu reduzieren und so überhaupt erst sinnvolle Erklärungen anbieten zu können. Der US-amerikanische Geograf Waldo R. Tobler hat dieses letztlich basale sozialwissenschaftliche Phänomen in sein berühmtes »erstes Gesetz der Geographie« übersetzt, nachdem zwar alles mit allem zusammenhinge, so wie der brasilianische Schmetterling in Edward Lorenz’ berühmt gewordenem Beispiel das texanische Wetter beeinflusst, die räumliche Distanz allerdings eine logische Hierarchie der Einflussfaktoren erlaube: »I invoke the first law of geography: everything is related to everything else, but near things are more related than distant things« (Tobler 1970: 236).
Das anthropologische Empfinden von Distanz erscheint mit Bezug auf Toblers Diktum als ein wesentliches Differenzierungskriterium für Mechanismen, die gesellschaftlichen Zusammenhalt im weitesten Sinne evozieren. Das Konzept des gesellschaftlichen Zusammenhalts ist dabei nicht gleichbedeutend mit sozialer Kohäsion (Zick/Rees 2020). Wichtig ist die Frage, welches Kollektiv als zusammenhaltend adressiert wird. Grundsätzlich bestehen hier zwei Möglichkeiten – Zusammenhalt in Gruppen und Zusammenhalt zwischen Gruppen (Zick/Rees 2020): Eine abgrenzbare Gruppe von Menschen ist kohäsiv, hält zusammen und lässt sich von außen auch so beobachten. Der Begriff der social cohesion lässt sich in diesem Fall auf die Qualität des inneren Beziehungsgeflechts von sozialen Gruppen, den Einstellungen und Haltungen der einzelnen Mitglieder, aber auch der Gruppe als Ganzes gegenüber beziehen (Friedkin 2004). Die empirische Detektion von sozialer Kohäsion läuft dabei Gefahr reine Tautologie zu sein, wenn von der bloßen Existenz der Gruppe auf Kohäsion geschlossen wird, die die Erkennbarkeit der Gruppe wiederum überhaupt erst gewährleistet. Mit anderen Worten: Erkennt man eine Gruppe, dann ist sie auch kohäsiv. Der Zusammenhalt kann aber auch ein gesellschaftlicher sein, dann nämlich, wenn die Kohäsion zwischen den Gruppen betrachtet wird. Dies ist ein eher ökologisch geprägter Zugang zu gesellschaftlichem Zusammenhalt, der in diesem zweiten Fall nebeneinander in unterschiedlichen Gruppen im Raum vorkommt. In bestimmten abgrenzbaren Raumausschnitten wie Städten, Stadtteilen, Regionen oder Dörfern finden sich verschiedene Gruppen, die wiederum je nach ihrer Lokalisation und Positionierung untereinander mehr oder weniger kohäsiv sein können. Der Intergruppenzusammenhalt in diesen begrenzten Raumausschnitten erscheint in diesem Fall als sozialwissenschaftlich operationalisierbarer und messbarer gesellschaftlicher Zusammenhalt.
Das im Forschungsinstitut Gesellschaftlicher Zusammenhalt (FGZ) insbesondere von Rainer Forst (2020) ausgearbeitete Verständnis von gesellschaftlichem Zusammenhalt zielt gegenüber diesen zwei skizzierten und im sozialwissenschaftlichen Diskurs tradierten Wegen der Auffassung von Kohäsion auf einen Mittelweg in der Bestimmung des gesellschaftlichen Zusammenhalts. Im Kern wird dabei auf ein über wechselseitige Bezogenheit im Handeln der Mitglieder bestimmbares Gemeinwesen abgestellt, das einen Gemeinschaftsbezug aufweist und über kooperative und integrative Verfahren und diskursive Ressourcen verfügt, die dieses Handeln, Kooperieren und Integrieren begleiten, thematisieren und evaluieren (Forst 2020). Im Gegensatz zu vorangehenden Arbeiten zur sozialen Kohäsion ist damit nicht eine abgrenzbare soziale Gruppe oder das im weitesten Sinne ökologische Verhältnis zwischen Gruppen angesprochen, sondern eine größere soziale Entität mit nur mehr verschwommenen Grenzen, die aber dennoch Mechanismen und Verfahren kennt, um Zusammenhalt diskursiv und praktisch herzustellen.
2.Mechanismen des Zusammenhalts: Eine Annäherung
Mögliche Mechanismen des Zusammenhalts lassen sich in einer ersten Annäherung in Anlehnung an Toblers Gesetz in nahe und ferne Mechanismen einteilen. Ferne Mechanismen sind nur schwer empirisch fassbar und lassen sich kaum abschließend definieren. Mit Bezug auf Edward Lorenz’ meteorologisches Schmetterlingsbeispiel (Lorenz 1993) wäre das Wetter ein denkbarer ferner Mechanismus für gesellschaftlichen Zusammenhalt. Niemand würde Wetterbedingungen an einem Ort ernsthaft als einen wichtigen Mechanismus für die Entstehung von gesellschaftlichem Zusammenhalt betrachten. Und dennoch sind die meteorologischen Gegebenheiten nicht völlig entkoppelt von der Gesellschaft. Klimatische Bedingungen spielen beispielsweise in der Ethnologie seit jeher eine Rolle in der Erklärung von bestimmten Wirtschaftsformen von ethnischen Gruppen. Die Kulturökologie hat in diesem Feld wichtige Arbeiten geleistet (Casimir 1993). Dass das Wetter tatsächlich messbaren Einfluss zumindest auf die Zufriedenheit mit politischen Leistungen nimmt, zeigen Michael Mutz und Sylvia Kämpfer anhand von ALLBUS-Daten (Mutz/Kämpfer 2011). Die Einschätzungen der Probanden in Bezug auf Demokratiezufriedenheit, der zukünftigen Wirtschaftslage und der Zufriedenheit mit den Leistungen der Bundesregierung, alles Aspekte, die in einem weiteren Sinne mit gesellschaftlichem Zusammenhalt verbunden sind, variieren mit der am Befragungstag herrschenden Wetterlage. Es zeigt sich, dass sonnige Tage zu einer überdurchschnittlichen Zufriedenheit beziehungsweise zu einer positiveren Einschätzung der Wirtschaftslage führen, während Regentage zu pessimistischeren Einschätzungen und geringerer Zufriedenheit führen (Mutz/Kämpfer 2011). Analog könnte sonniges Wetter sich ebenfalls positiv auf die Wahrnehmung des gesellschaftlichen Zusammenhalts auswirken oder die Bereitschaft für altruistisches Handeln erhöhen (Isen/Levin 1972). Solche hier nur angedeuteten Möglichkeiten für denkbare ferne Mechanismen des gesellschaftlichen Zusammenhalts lassen sich empirisch nur schwer erfassen und sind in ihrer Erklärungskraft vermutlich stark begrenzt.1
Empirische Mechanismen des gesellschaftlichen Zusammenhalts, die auf Nähe oder Nahbarkeit in sozialer wie räumlicher Hinsicht abstellen, sind dagegen von weitaus größerer Bedeutung und stehen im Zentrum der Analysen, die in dieser Anthologie zusammengetragen sind. Solche denkbaren nahen Mechanismen existieren derer viele, lassen sich in empirischen Untersuchungen gut isolieren und können in diesem Sammelband in ihrer Breite nur angerissen werden. Die Bandbreite möglicher Mechanismen des sozialen Zusammenhalts vor Ort auszuloten ist eine Aufgabe, die mehr als den begrenzten Raum benötigt, den eine Anthologie zu bieten in der Lage ist. Es lassen sich aber sehr wohl wesentliche Determinanten des Zusammenhalts diskutieren, die in verschiedener Weise im Regionalpanel inkludiert sind. Der Beitrag von Reinhold Sackmann und Jonas Rees reißt diese Möglichkeiten des Regionalpanels an. Und es zeigt sich deutlich in Teilen der Gesellschaft eine Irritation, wenn diese direkt nach gesellschaftlichem Zusammenhalt und dessen möglichen Determinanten gefragt wird. Die zahlreichen Zuschriften und Kommentare im Kontext der empirischen Erhebung des Regionalpanels sind ein Zeitdokument und eröffnen Einblicke, die der reinen quantitativen Forschung sonst meist verschlossen bleiben. Angelina Göb analysiert ausgewählte Zuschriften objektiv-hermeneutisch in ihrem Beitrag.
Reinhold Sackmann und Ina Mayer finden bereits mit Blick auf unterschiedliche Gemeindegrößen im Regionalpanel die Tendenz, dass mit sinkender Einwohner:innenzahl des Wohnorts der gesellschaftliche Zusammenhalt ansteigt. Der hier vermutlich zugrundeliegende Mechanismus des sozialen Zusammenhalts verbirgt sich hinter den Eigenschaften kleinerer Siedlungen. Dies können ausgeprägtere und dichtere Sozialkapital- oder Vertrauensbeziehungen sein, die sich unter Umständen aufgrund häufigeren Wiederbegegnens etablieren. Möglich wäre aber auch eine höhere soziale Kontrolle und die latent gegebene Möglichkeit, einen Ruf als Außenseiter, Querulant oder Ähnliches zu erhalten (Lindner 2000), wenn man sich nicht an kohäsiven Handlungen beteiligt. Die Bedeutung der räumlichen Varianz für den gesellschaftlichen Zusammenhalt ist auffallend mit Blick auf die politische Landschaft. Diese Evidenz zu operationalisieren und in spezifische Raummuster des Zusammenhalts zu übersetzen, ist ein wesentliches Anliegen des Regionalpanels. Einen ersten Schritt in diese Richtung gehen Jann-Friedrich Hesse, Andreas David Schmidt, Julian Schweer, Maike Reinhold und Berthold Vogel, die in ihrem Beitrag die räumliche Skalenebene der Mittelstadt auf ihre Rolle als Scharnierfunktion zwischen Dorf und Großstadt in Hinblick auf den gesellschaftlichen Zusammenhalt befragen. Erinnerungskulturen als Mechanismen von Zusammenhalt fokussieren Michael Papendick, Jonas Rees und Leon Walter und stellen fest, dass die Erinnerung an Ereignisse, die gesellschaftlichen Zusammenhalt bedeuteten, sowohl mit der Verbundenheit mit dem Wohnort als auch mit einer positiven Einschätzung des gesellschaftlichen Zusammenhalts in Deutschland korreliert. Erinnerungen spielen eine wichtige Rolle in der Selbstvergewisserungspraxis zur Etablierung von sozialer Kohäsion vor Ort. Dabei kann von einem prozessualen Zusammenspiel der sozialen Erinnerungen, der Gesellschaft und des Ortes ausgegangen werden (Hubner/Dirksmeier 2023), die sich wechselseitig bedingen und verstärken. Symbolische Konflikte, die sich in aber auch zwischen sozialen Milieus abspielen können, rekurrieren genauso auf Kohäsion. Dies zeigt der Beitrag von Michael Windzio, Liz Weiler, Betina Hollstein und Jan-Philip Steinmann deutlich auf.
Die enge Bindung an den unmittelbaren Nahraum und das Lebensumfeld spielt dabei eine wesentliche Rolle. Wie Angelina Göb und Peter Dirksmeier demonstrieren, hängt der gesellschaftliche Zusammenhalt in erster Linie von der Verbundenheit vor Ort ab. Die Nachbarschaft nimmt hier eine Schlüsselstellung ein. Wenn diese sozialnahräumliche Einbettung fehlt, lässt sich gesellschaftlicher Zusammenhalt offensichtlich nur noch schwerlich implementieren. Nachbarschaften sind lokale Gemeinschaften, die als eine Praxis begreifbar sind (Blokland 2021) und zugleich einen wesentlichen Interaktionsraum für die Entstehung von gesellschaftlichem Zusammenhalt bieten. Eine wegweisende Rolle spielen in diesem Kontext die regionalen Angebote an Infrastrukturen, die als »soziale Ordnungsdienste« (Barlösius 2019) erst die Voraussetzungen für gelungene Sozialität auf den verschiedensten räumlichen Maßstabsebenen schaffen. Immer stärker in den Vordergrund rücken dabei die Vernetzungstechnologien und -möglichkeiten, die insbesondere, aber nicht ausschließlich, digitale Medien bieten. Hierbei stehen sowohl die reine Informiertheit als auch Techniken des Vernetzens im Zentrum der sozialwissenschaftlichen Aufmerksamkeit für Mechanismen des gesellschaftlichen Zusammenhalts vor Ort, wie Jan-Hinrik Schmidt und Hannah Immler in ihrem Beitrag argumentieren.
Wesentliche Kategorien für die Konstruktion und Sichtbarmachung von kohäsiven Mechanismen sind gesellschaftliche Ungleichheit und damit einhergehend die relative Deprivation, die sich wiederum im Wahlverhalten in den jeweiligen abgrenzbaren Räumen manifestieren, wie Jakob Hartl, Nathalie Schönburg und Lukas Theinert in ihrem Beitrag verdeutlichen. Grenzen als administrative Grenzen und als nicht-kodifizierte soziale Grenzen (Thiemann u. a. 2010) spielen hier eine wichtige Rolle in der Strukturierung des gesellschaftlichen Zusammenhalts. Sie eröffnen Möglichkeiten der Analyse von ausgrenzenden Wertegemeinschaften und menschenfeindlichen Einstellungen als gefährliche Kohäsionsgeneratoren, die wirkmächtige Mechanismen des gesellschaftlichen Zusammenhalts auf Kosten marginalisierter Gruppen sein können. Dieser Zusammenhalt richtet sich gegen die Anderen und ist in seiner toxischen Wirkung auf Sozialität gleichfalls ein wichtiger Gegenstand der Forschungen des Regionalpanels.
3.Mechanismen des Zusammenhalts: Möglichkeiten ihrer Theorie
Die Frage nach der Theorie der Mechanismen des gesellschaftlichen Zusammenhalts stellt sich als eine komplexe dar. Welche Aspekte und Attribute führen dazu, dass soziale Sachverhalte sich als Mechanismen des Zusammenhalts erweisen oder gerade nicht? Wie sind die Funktionsweisen und Wirkungszusammenhänge strukturiert, die diese Mechanismen miteinander teilen? Diese und ähnliche Fragen können im vorliegenden Einleitungsbeitrag nur angerissen werden und stehen im Zentrum der Forschungsarbeiten des Regionalpanels im FGZ. Zwei von vielen weiteren potenziellen theoretischen Ansatzpunkten seien an dieser Stelle jedoch kurz skizziert. Die von dem Soziologen Hartmut Rosa geprägte Theorie der Resonanz bietet einen ersten möglichen theoretischen Zugriff auf Zusammenhalt fördernde Mechanismen (Rosa 2022). Demnach sind soziale Gemeinschaften immer auch »Resonanzgemeinschaften« (ebd.: 267), die in ähnlichen Weltbeziehungen leben und deren Narrative die Resonanz als Weltbeziehung erst evoziert. Den Verlust von Zusammenhalt in diesen Gemeinschaften könnte man dann als einen Verlust an »narrativer Resonanz und den Verlust eines gemeinsamen Resonanzraumes« (ebd.: 268) verstehen. So einleuchtend sich die Metapher der Resonanz als theoretischer Mechanismus des Zusammenhalts aufdrängt, so ausweichend sind die Ausführungen Hartmut Rosas zu möglichen empirischen Operationalisierungen des stark philosophisch gefärbten Konzepts der Resonanz als ein Gemeinsamkeit stiftendes Band zwischen Individuen. Resonanz ist ein so umfassender Begriff, dass er in Erklärungen des gesellschaftlichen Zusammenhalts oftmals implizit mitschwingt, aber nur selten expliziert wird und sich in der Folge empirischer Zugriffe preisgibt.
Folgt man Zick und Rees (2020), dann ist Zusammenhalt einer Gruppe oder Gesellschaft immer auch ein »Konfliktphänomen« (Zick/Rees 2020: 130), das insbesondere von der Fähigkeit des Gemeinwesens abhängt, interne Konflikte zu moderieren und zu lösen. Mechanismen des Zusammenhalts sind folglich Mechanismen der Konfliktlösung. Wichtige theoretische Ansätze zu solchen denkbaren konfliktären Mechanismen sind in den Arbeiten von Elinor Ostrom zur normenbasierten Kooperation in sozialen Dilemmata zu finden (Ostrom 2021). Gesellschaft sieht sich häufig verschiedenen Formen sozialer Dilemmata gegenüber. Garrett Hardin (1968) gibt ein berühmt gewordenes Beispiel für eine solche soziale Situation. Das Allmende-Dilemma in der Lesart Hardins besteht darin, dass rationale Handlungen Einzelner (Hirten treiben in diesem Fall mehr Tiere auf die allgemein zugängliche Weide, um ihren Gewinn zu maximieren) in den Ruin aller führt. Eine Lösung kann nur über Vertrauenskredite und Kooperation funktionieren, das heißt, bei Beibehaltung der Rahmenbedingungen müssen sich alle Hirten darauf verständigen, weniger Tiere auf die Allmende zu lassen. Der Sozialgeograf David Harvey sieht hier ein Perspektivproblem. Bei sozialen Dilemmata wie dem der Allmende sei nicht das Kollektiveigentum an Weidegrund das Problem, sondern der Privatbesitz von Rindern, der wiederum zu individuell-profitmaximierendem Verhalten führe (Harvey 2021).
Elinor Ostrom findet in ihren empirischen Arbeiten zu Kooperationen nicht die in Hardins Tragik der Allmende aufscheinende Hilflosigkeit des homo oeconomicus, der sehenden Auges in sein Verderben schlittert. Vielmehr ist kooperatives Handeln, in dessen Zentrum Vertrauen steht, empirisch häufig zu beobachten. Dieses Handeln weist das Potenzial auf, soziale Dilemmata zu lösen. Ressourcenausbeutung und -maximierung finden nicht zwangsläufig statt (Ostrom 2010). Kooperationen können scheitern. Sie sind aber dennoch die deutlich häufigere Reaktion auf Dilemmata als egoistisches Handeln (ebd.). Individuen weisen die Tendenz auf, Probleme in der Regel so effektiv wie möglich zu lösen. Ihr Problem ist dabei, dass sie nur über begrenzte Kapazitäten verfügen, um die Struktur der komplexen natürlichen und sozialen Umwelten zu durchdringen (ebd.). Auf Vertrauensbasis ruhendes kooperatives Handeln ist den Arbeiten Ostroms zufolge ein wichtiger und häufiger Mechanismus des gesellschaftlichen Zusammenhalts. Dagegen weisen Gruppen, denen Kooperation nicht gelingt, keine Kapazitäten zum Kommunizieren auf. Sie finden keine Möglichkeit, um Vertrauen aufzubauen und sie weisen kein Bewusstsein über eine geteilte Zukunft auf (ebd.). Vertrauen und Verbundenheit sind nach Ostrom folglich wichtige Aspekte des Zusammenhalts als Kooperation. Das Regionalpanel des FGZ berücksichtigt diese Vertrauensaspekte in verschiedenen Items seines Befragungsinstrumentariums und eröffnet damit Möglichkeiten einer gegenstandsbezogenen Theoriebildung, die als erste Annäherung an die Komplexität des normativen Konstrukts des Zusammenhalts als angemessen erscheint.
4.Stadt, Region, Land, das Lokale: Empirische Kategorien räumlicher Varianzen der kohäsiven Mechanismen
Die basale Grundthese des Regionalpanels lässt sich mit Tobler (1970) als die Annahme formulieren, dass alles mit allem zusammenhängt, nahe Determinanten hingegen enger mit dem gesellschaftlichen Zusammenhalt verbunden sind als ferne. Diese Korrelation weist vermutlich eher einen kurvilinearen denn linearen Charakter auf. Ferne Mechanismen sind kaum messbar oder bedeutungslos, nahe Mechanismen sind von großer Bedeutung und Stärke. Sie weisen Kipppunkte auf, an denen sich der ursprünglich sozial erwünschte gesellschaftliche Zusammenhalt in ein Problem von zu starker, exkludierender Kohäsion wandelt. Diese kann sich zum Beispiel gegen räumlich nahe, aber sozial ferne (oder sowohl räumlich als auch sozial ferne) gesellschaftliche Minderheiten richten (Zick/Rees 2020). Das Regionalpanel geht von der Annahme aus, dass sich Auftreten und Intensität der Mechanismen des Zusammenhalts neben der Dualität von sozialer und räumlicher Ferne/Nähe zusätzlich in der räumlichen Qualität unterscheiden. Von zentraler Bedeutung sind die räumlichen Semantiken von Stadt, Region, Land und lokaler Gesellschaft. Diese räumlichen Begriffe sind nicht disjunkt. Sie weisen aber unterschiedliche Qualitäten auf, die verschiedene Mechanismen des gesellschaftlichen Zusammenhalts erst ermöglichen oder inhibieren. Die Gesellschaft schafft völlig unterschiedliche Formen des Zusammenhalts, je nachdem ob das Zentrum einer Metropole, eine prosperierende Region oder eine mit Abwanderung und ökonomischem Niedergang kämpfende ländliche Gemeinde betrachtet wird (Kersten u. a. 2022). Mit dieser Feststellung lässt sich das Regionalpanel als ein empirisches Instrument charakterisieren, das mit räumlichen Varianzen seines zu detektierenden Gegenstandes rechnet.
Eine wesentliche erste räumliche Semantik, die für die Analyse der Mechanismen sozialen Zusammenhalts große Relevanz aufweist, ist Stadt. Die Kategorie der Stadt bietet mannigfaltige räumliche Voraussetzungen und Besonderheiten für die Etablierung oder Inhibierung von gesellschaftlichem Zusammenhalt. Die Forschungen zu diesen Zusammenhängen stehen im FGZ noch am Anfang (Dirksmeier 2022). Deutlich häufiger sind im internationalen Kontext Arbeiten zu sozialer Kohäsion und den Eigenschaften des Stadtraumes. Auffällig sind empirische Ergebnisse, die zeigen, dass eine kompakte bauliche Umwelt negativ mit sozialer Kohäsion korreliert. Eine hohe Dichte und große bauliche Mischung wirken somit hemmend auf den Gruppenzusammenhalt in der Stadt. Allerdings kann die urbane Vitalität in Form von lokalen Initiativen und Aktivitäten der Bewohner:innen diesen Effekt wieder aufheben (Mouratidis/Poortinga 2020). Kollektive Wirksamkeit im Sinne von Robert Sampson u. a. (1997) modifiziert so auf der einen Seite über Interventionen und Initiativen die urbane Landschaft. Auf der anderen Seite entsteht zugleich gesellschaftlicher Zusammenhalt.
Von der kanadischen Stadtforscherin Jane Jacobs stammt die These, dass urbane Vitalität zu mehr Kohäsion führe. Dies ist auch der Grund, warum sie in ihren Arbeiten vehement den rigiden Umgang mit Slums in den US-amerikanischen Großstädten kritisiert (Jacobs 1992). Es ginge dieser Stadtplanung einzig um die Substituierung der Slums durch Projekte, die ein höheres Steueraufkommen generieren können. Dies geht in der Regel mit einem Wandel der Bevölkerungsstruktur und einer Absenkung notwendiger Sozialhilfezahlungen einher. Mitunter zerstört dieser Umbau die funktionierenden und kohäsiven Nachbarschaftsstrukturen in diesen Vierteln (ebd.). Empirisch ist Jane Jacobs’ These bis dato noch wenig verifiziert worden. Kostas Mouratidis und Wouter Poortinga (2020) finden vielmehr einen Widerspruch zwischen Vitalität und Kohäsion im Stadtteil. In dichten Stadtvierteln findet sich eine größere Vielfalt der Kontakte und mehr Interaktion. Diese sind eher mit strong ties als Inseln quasi dörflicher Verbundenheit in den Metropolen (Pahl 1966) und geringem Zusammenhalt zwischen den jeweiligen eng verbundenen Dyaden und Gruppen assoziiert. Die dichten, nachgefragten, diversen und urbanen Stadtviertel in den Städten erhöhen damit die Interaktionschancen und -wahrscheinlichkeiten. Sie verringern gleichzeitig den sozialen Zusammenhalt. Hier trifft zu, was Elinor Ostrom in Bezug auf soziale Kooperationen zwischen Gruppen an bestimmten Orten mit »›[o]ne size fits all‹ policies are not effective« (Ostrom 2010: 642) bezeichnet hat: Die individualisierenden Urbanitätseffekte verlangen gleichfalls nach jeweils auf sie zugeschnittenen, passgenauen Lösungen.
Die zweite im Kontext des Regionalpanels wesentliche Raumsemantik ist die Region. Im Zusammenhang mit dem gesellschaftlichen Zusammenhalt erscheint Region mitunter als eine räumliche Skalenebene, die sich gut für appellative Hinweise auf Gefährdungen des Zusammenhalts nutzen lässt, wie etwa die häufig zu vernehmende Andeutung, dass die zunehmende regionale ökonomische Disparität in Europa den sozialen Zusammenhalt gefährde (Immarino u. a. 2019). Region kann sich dabei auf unterschiedlichste Skalenebenen beziehen, von kleinen Ortsteilen bis hin zu supranationalen Gebilden. Sie ist nach Pierre Bourdieu eine »mentale Repräsentation« (Bourdieu 1991: 231) mit religiösen etymologischen Anleihen, die es vor allen Dingen erlaube, die Region in ihren Grenzen zu erkennen und damit gerade auch festzulegen, wer oder was nicht zur Region gehöre. Die Suche nach den Grenzen der Region übersetzt sich dann in einen performativen Diskurs des Regionalismus (Bourdieu 1991), der diese Grenzen als quasi natürliche erscheinen lassen kann. Ein manifestes Ergebnis des politischen Regionalismus in Europa sind beispielsweise die NUTS-Regionen (Nomenclature of Territorial Units for Statistics) der 1970er Jahre in der EU. Sie sind sowohl Ergebnis eines performativen Diskurses zur Etablierung einer technischen Lösung zur Angleichung europäischer Regionalstatistiken als Grundlage für politische Maßnahmen als auch eine integrative Lösung, die über finanzielle Unterstützung von ökonomisch schwächeren Regionen sozialen Zusammenhalt in Regionen und zwischen Regionen schaffen soll (Paasi u. a. 2018).
Dass eine regionale Adressierung von gesellschaftlichem Zusammenhalt über Förderpolitiken keinesfalls profan ist, demonstriert Philip Manow am Beispiel der großen regionalen Varianz der Leave-Voten im Rahmen des Brexit-Referendums in Großbritannien. Beim Brexit-Referendum stimmten Menschen in Regionen mit niedrigen Löhnen, hoher Arbeitslosigkeit und einer lediglich historisch bestimmbaren ökonomischen und industriellen Stärke vorwiegend für Leave. Damit wurde in sozioökonomisch problematischen Regionen systematisch mehr für den Austritt Großbritanniens aus der EU gestimmt. In Großbritannien lässt die Migration die Beschäftigung von Brit:innen als Arbeiter:innen sinken, insbesondere im Baugewerbe, in der Landwirtschaft, im Bergbau und in der Industrie. Leave-Voten finden sich auch in Regionen mit hohen Armutsraten und hoher Einkommensungleichheit. Auf der Individualebene findet sich hier ein hohes Maß an Migrationsfeindschaft, die sich in Leave-Voten übersetzte (Manow 2018). Dies sind die abgehängten Regionen in Großbritannien, in denen sich gesellschaftlicher Zusammenhalt als Exklusion und Zusammenhalten gegen als fremd wahrgenommene Andere manifestiert. Damit lässt sich konstatieren, dass sich ein exkludierender Regionalismus dort Bahn brach, wo die Gesellschaft stark von supranationalen monetären Zuwendungen profitierte.
Die dritte wesentliche Raumsemantik neben der Stadt und der Region ist das Land beziehungsweise der ländliche Raum. Problematisch ist hier zunächst die in der Forschung seit den 1960er Jahren für den Globalen Norden konstatierte Verwischung von urban und rural. Das Dorf als Insignie des Ländlichen hat längst ausgedient. Es findet sich im ländlichen Raum wie in der Stadt. Die Globalisierung und Modernisierung weisen dem Dorf und dem Land einen Status als Residualkategorie zu (Nell/Weiland 2019). Dennoch wird dem Dorf traditionell eine Rolle als Fluchtpunkt von sozialer Ordnung und gesellschaftlichem Zusammenhalt zugeschrieben (Cloke u. a. 2000). Insbesondere die britischen Rural Studies erkennen eine enge Verbundenheit von Ländlichkeit und Zusammenhalt. Ländliche Räume können dann als besonders rural gelten, wenn es ihnen gelingt, einen Sinn für Gemeinschaft oder Zusammenhalt in ihren Gemeinden zu stiften (Halfacree 2006). Damit schwingt im Diskurs um sozialen Zusammenhalt und Ländlichkeit in den Rural Studies eine strukturelle Kopplung mit: Der ländliche Raum benötigt zu dessen definitorischer Festlegung die soziale Qualität von kohäsiven Gemeinden. Die Daten des Regionalpanels erlauben hier tiefere Einblicke für die vier ausgewählten ländlichen Gemeinden Eisdorf, Jübar, Willebadessen und Markt Winzer. Die Analysen von Reinhold Sackmann und Ina Mayer legen zumindest den Anfangsverdacht nahe, dass Ländlichkeit und gesellschaftlicher Zusammenhalt in Deutschland nicht völlig entkoppelt zu denken sind (siehe auch den Beitrag zur Mittelstadt von Jann-Friedrich Hesse u. a.).
Eng verbunden mit den drei skizzierten räumlichen Semantiken von Stadt, Region und Land ist die Idee des Lokalen und der lokalen Gesellschaft. Das Lokale ist als eine Art Metapher des Globalen zu verstehen, das immer nur wieder als Lokales erfahrbar wird. Michel Serres führt hier die blühenden Kirschbäume in Frankreich und Japan als Beispiel an (Serres 2005). Die Kirschblüte ist ein globales Phänomen. Sie zeigt sich aber immer nur lokal. Beides ist unhintergehbar miteinander verwoben und dies gilt auch für die menschliche Kommunikation. Wie Rudolf Stichweh akzentuiert, vollzieht sich die Verschränkung von Globalem und Lokalem »in jedem einzelnen kommunikativen Akt« (Stichweh 2000: 200). Mit dieser Betonung der Omnipräsenz des Lokalen und der lokalen Gesellschaft als eine Gesellschaft aus Interaktionen zeigt sich deren Bedeutung für ein Verständnis des gesellschaftlichen Zusammenhalts. Globales und Lokales stehen in Wechselbeziehung, allerdings kann für den lokalen Zusammenhalt gerade die Ausprägung und Struktur der lokalen Gesellschaft von großer Bedeutung sein. So verletzen gegenwärtige Haltende von versklavten Subjekten in Indien mit der Ausbeutung von Menschen eklatant die allgemeinen Menschenrechte. Sie können aber dennoch anerkannte und einflussreiche Mitglieder der lokalen Gesellschaft sein, die für deren Kohäsion und Normen einstehen und diese in gewisser Weise garantieren (Choi-Fitzpatrick 2017). In diesem Fall stehen sich die Kohäsion der lokalen Gesellschaft und das globale Normengerüst diametral entgegen und die globalen ökonomischen Beziehungen werden vor Ort als extreme Ausbeutung erfahrbar.
Das Lokale weist also große Relevanz für gesellschaftlichen Zusammenhalt auf und ist eine wichtige Maßstabsebene des Regionalpanels. Mit Joanna Pfaff-Czarnecka (2005: 494–496) lässt sich diese Bedeutung des Lokalen in vier Aspekte verdichten: Das Lokale als kleinräumige Einheit erlaubt Ordnung über den Zugriff von Administrationen. Das Lokale ist Ausdruck der »Interaktionsverdichtungen« (Stichweh 2000: 202) und personaler Beziehungsnetzwerke. Das Lokale stiftet Identität und damit eine Basis für die Herstellung von gesellschaftlichem Zusammenhalt und das Lokale erlaubt als Repräsentation die kommunikative Bezugnahme und Adressierung (Pfaff-Czarnecka 2005: 494–496). Welchen Einfluss das Lokale auf die Etablierung des gesellschaftlichen Zusammenhalts nimmt, ist letztlich eine noch offene und bedeutsame Frage für die Sozialwissenschaft. Wir hoffen, dass das Regionalpanel und die im vorliegenden Band versammelten ersten Analysen einen Beitrag zu ihrer Beantwortung leisten können.
Literatur
Barlösius, Eva (2019), Infrastrukturen als soziale Ordnungsdienste. Ein Beitrag zur Gesellschaftsdiagnose, Frankfurt am Main.
Blokland, Talja (2021), Community as Urban Practice, Cambridge.
Bourdieu, Pierre (1991), Language and Symbolic Power, Cambridge.
Bulley, Dan/Sokhi-Bulley, Bal (2014), »Big Society as big government: Cameron’s governmentality agenda«, British Journal of Politics and International Relations, Jg. 16, H. 3, S. 452–470.
Casimir, Michael J. (1993), »Gegenstandsbereiche der Kulturökologie«, in: Schweizer, Thomas/Schweizer, Margarete/Kokot, Waltraud (Hg.), Handbuch der Ethnologie, Berlin, S. 215–239.
Choi-Fitzpatrick, Austin (2017), What Slaveholders Think. How Contemporary Perpetrators Rationalize What They Do, New York.
Cloke, Paul/Milbourne, Phil/Widdowfield, Rebekah (2000), »Homelessness and rurality: ›out-of-place‹ in purified space?«, Environment and Planning D: Society and Space, Jg. 18, H. 6, S. 715–735.
Deitelhoff, Nicole/Groh-Samberg, Olaf/Middell, Matthias/Schmelzle, Cord (2020), »Gesellschaftlicher Zusammenhalt – Umrisse eines Forschungsprogramms«, in: Deitelhoff, Nicole/Groh-Samberg, Olaf/Middell, Matthias (Hg.), Gesellschaftlicher Zusammenhalt. Zur Analyse eines sperrigen Begriffs, Frankfurt am Main, S. 130–151.
Dirksmeier, Peter (2022), Social Cohesion in Postcolonial Singapore: Effects of Anti-Immigrant Attitudes and Authoritarianism, RISC Working Paper No. 3. Leipzig: Research Institute Social Cohesion. fgz-risc.de/wp-3
Forst, Rainer (2020), »Gesellschaftlicher Zusammenhalt. Zur Analyse eines sperrigen Begriffs«, in: Deitelhoff, Nicole/Groh-Samberg, Olaf/Middell, Matthias (Hg.), Gesellschaftlicher Zusammenhalt. Zur Analyse eines sperrigen Begriffs, Frankfurt am Main, S. 41–53.
Friedkin, Noah E. (2004), »Social cohesion«, Annual Review of Sociology, Jg. 30, S. 409–425.
Glaeser, Edward L./Tobio, Kristin (2007), »The rise of the sunbelt«, NBER Working Paper 13071.
Halfacree, Keith H. (2006), »Rural space: constructing a three-fold architecture«, in: Cloke, Paul/ Marsden, Terry/ Mooney Patrick H. (Hg.), Handbook of Rural Studies, London, S. 44–62.
Hardin, Garrett (1968), »The tragedy of the commons«, Science, Jg. 162, H. 3859, S. 1243–1248.
Harvey, David (2021), Rebellische Städte. Vom Recht auf Stadt zur urbanen Revolution, Berlin.
Hradil, Stefan (2022), »Wieviel Gemeinschaft benötigt der gesellschaftliche Zusammenhalt heute?«, Soziologische Revue, Jg. 45, H. 1, S. 5–14.
Hubner, Elena/Dirksmeier, Peter (2023), »Geography of placemories: deciphering spatialised memories«, Cultural Geographies, Jg. 30, H. 1, S. 103–121.
Immarino, Simona/Rodriguez-Pose, Andrés/Storper, Michael (2019), »Regional inequality in Europe: evidence, theory and policy implications«, Journal of Economic Geography, Jg. 19, H. 2, S. 273–298.
Isen, Alice M./Levin, Paula. F. (1972), »Effect of feeling good on helping: cookies and kindness«, Journal of Personality and Social Psychology, Jg. 21, H. 3, S. 384–388.
Jacobs, Jane (1992), The Death and Life of Great American Cities, New York.
Kersten, Jens/Neu, Claudia/Vogel, Berthold (2022), Das Soziale-Orte-Konzept. Zusammenhalt in einer vulnerablen Gesellschaft, Bielefeld.
Lindner, Rolf (2000), »Stadtkultur«, in: Häußermann, Hartmut (Hg.), Großstadt. Soziologische Stichworte, Opladen, S. 258–264.
Lorenz, Edward N. (1993), The Essence of Chaos, London.
Manow, Phillip (2018), Die Politische Ökonomie des Populismus, Berlin.
Mouratidis, Kostas/Poortinga, Wouter (2020), »Built environment, urban vitality and social cohesion: do vibrant neighborhoods foster strong communities?«, Landscape and Urban Planning, 204: 103951.
Nell, Werner/Weiland, Marc (Hg.) (2019), Dorf. Ein interdisziplinäres Handbuch, Berlin.
Mutz, Michael/Kämpfer, Sylvia (2011), »…und nun zum Wetter: Beeinflusst die Wetterlage die Einschätzung von politischen und wirtschaftlichen Sachverhalten?«, Zeitschrift für Soziologie, Jg. 40, H. 4, S. 208–226.
Ostrom, Elinor (2010), »Beyond markets and states: polycentric governance of complex economic systems«, American Economic Review, Jg. 100, H. 3, S. 641–672.
Ostrom, Elinor (2021), Governing the Commons. The Evolution of Institutions for Collective Action, Cambridge.
Paasi, Anssi/Harrison, John/Jones, Martin (2018), »New consolidated regional geographies«, in: Paasi, Anssi/Harrison, John/Jones, Martin (Hg.), Handbook on the Geographies of Regions and Territories, Cheltenham, S. 1–20.
Pahl, Raymond Edward (1966), »The rural-urban continuum«, Sociologia Ruralis, Jg. 6, H. 3, S. 299–329.
Pfaff-Czarnecka, Joanna (2005), »Das Lokale als Ressource im entgrenzten Wettbewerb: das Verhandeln kollektiver Repräsentationen in Nepal-Himalaya«, in: Heintz, Bettina/Münch, Richard/Tyrell, Hartmann (Hg.), Zeitschrift für Soziologie, Sonderheft »Weltgesellschaft«, Stuttgart, S. 479–499.
Reckwitz, Andreas (2021), Das Ende der Illusionen. Politik, Ökonomie und Kultur in der Spätmoderne, Berlin.
Rosa, Hartmut (2022), Resonanz. Eine Soziologie der Weltbeziehung, Berlin.
Sampson, Robert J./Raudenbush, Stephen W./Earls, Felton (1997), »Neighborhoods and violent crime: a multilevel study of collective efficacy«, Science, Jg. 277, H. 5328, S. 918–924.
Serres, Michel (2005), Atlas, Berlin.
Simmel, Georg (2020), »Die Großstädte und das Geistesleben«, in: Dirksmeier, Peter/Stock, Mathis (Hg.), Urbanität, Stuttgart, S. 33–43.
Stichweh, Rudolf (2000), Die Weltgesellschaft. Soziologische Analysen, Frankfurt am Main.
Thiemann, Christian/Theis, Fabian/Grady, David/Brune, Rafael/Brockmann, Dirk (2010), »The structure of borders in a small world«, PLOS One, Jg. 5, H. 11: e15422.
Tobler, Waldo R (1970), »A computer movie simulating urban growth in the Detroit region«, Economic Geography, Jg. 46, supplement 1, S. 234–240.
Zick, Andreas/Rees, Jonas H (2020), »Gesellschaftlicher Zusammenhalt – Eine sozialpsychologische Sicht auf das Konzept und aktuelle gesellschaftliche Herausforderungen an den Zusammenhalt«, in: Deitelhoff, Nicole/Groh-Samberg, Olaf/Middell, Matthias (Hg.), Gesellschaftlicher Zusammenhalt. Zur Analyse eines sperrigen Begriffs, Frankfurt am Main, S. 130–151.
Methodische Grundlagen des Regionalpanels
Reinhold Sackmann, Jonas Rees und Jakob Hartl
Abstract
Beim Regionalpanel handelt es sich um einen neuen Datensatz zur Untersuchung von sozialem Zusammenhalt in lokalen Gesellschaften. Der Artikel beschreibt und begründet das methodische Design der Mixed-Mode Erhebung (Online- und postalische Papierfragebogen). Bei der neuen Längsschnittuntersuchung wurden zwölf Zufallsstichproben in den Untersuchungsorten Bad Grund, Bielefeld, Einbeck, Gladbeck, Hannover, Ingolstadt, Jübar, Magdeburg, Merseburg, Passau und Willebadessen gezogen. Damit werden regional vergleichende Studien verschieden großer Kommunen auch auf Stadtteilebene möglich. In Methodenexperimenten wurde geprüft, welche Effekte auf die Teilnahmebereitschaft mehrsprachige Fragebögen und Elemente von Koproduktion mit Kommunalvertreter:innen hervorbringen.
Keywords: Erhebungsdesign; Koproduktion; Mehrsprachigkeit; Tailored Design Method; Zusammenhalt
In den letzten zwanzig Jahren ist nach einem Jahrhundert des theoretischen Reflektierens über gesellschaftlichen Zusammenhalt zunehmend der Versuch zu beobachten, mit den Mitteln der empirischen Sozialforschung unser Wissen über dessen Mechanismen, Ursachen und Folgen zu verfeinern. In Deutschland hat sich insbesondere die Bertelsmann-Stiftung als Pionierin im Bereich der empirischen Forschung zum Zusammenhalt hervorgetan. Anhand der Untersuchungsmethoden des Projekts »Radar gesellschaftlicher Zusammenhalt« bzw. den darin durchgeführten Umfragen wollen wir zunächst kurz auf die Stärken und Schwächen des derzeitigen Stands der Forschung eingehen. Eine Stärke liegt im systematischen Versuch einer indikatorengestützten Operationalisierung von Zusammenhalt, denn so wird das Phänomen von einem abstrakt-normativen zu einem konkret mess- und quantifizierbaren. Allerdings gibt es bisher nach unserem Stand keine handhabbare Kurzversion zur Messung der Dimensionen von Zusammenhalt (vgl. Sackmann und Mayer in diesem Band). Quantitative Erhebungen fanden darüber hinaus bislang überwiegend mit dem Mittel einer für Nationalgesellschaften repräsentativen Stichprobe statt (Brand/Follmer/Unzicker u. a. 2020; Dragolov u. a. 2014; Schiefer u. a. 2012; Unzicker 2022; für eine international vergleichende Untersuchung siehe auch Dragolov u. a. 2013). Während sich mit einem solchen Untersuchungsdesign Vergleiche und Rangreihen zwischen Bundesländern (beziehungsweise Ländern im Falle von Dragolov u. a. 2013) im Querschnitt anstellen lassen, bleiben Fragen der lokalen Erzeugung von gesellschaftlichem Zusammenhalt nur schwach konturiert. Eine Fallstudie zur Stadt Bremen (Arant u. a. 2016) und ein Städtevergleich zwischen Dessau, Dortmund, Lippstadt und Rostock (Gesemann u. a. 2019) versuchen zwar, diese Ebene einzubeziehen. Es fehlen bisher aber Studien, die auch systematisch den Zusammenhalt in Dörfern untersuchen. Insbesondere fehlen Studien, die empirisch fundierte Aussagen über die Gegebenheiten »vor Ort« (statt »bundesweit«) ermöglichen. In diesem zum »Radar gesellschaftlicher Zusammenhalt« grundsätzlich verschiedenen Ansatz liegt aus unserer Sicht ein enormes Potenzial des Regionalpanels für die Zusammenarbeit mit Praktiker:innen und Akteur:innen vor Ort, das wir im weiteren Verlauf des Kapitels an verschiedener Stellen ausführen und veranschaulichen wollen (siehe insbesondere 3.3 Koproduktion). Weiterhin mangelt es bisher an echten Längsschnittstudien, die mit Wiederholungsbefragungen arbeiten. So sind Verläufe und Entwicklungen nicht oder nur eingeschränkt zu interpretieren und Kausaleinflüsse auf individueller Ebene nicht zu ermitteln. Hier liegt aus unserer Sicht eine weitere Stärke des Regionalpanels, denn seine methodische Anlage erlaubt auch Aussagen über echte Veränderungen auf individueller Ebene und deren Zusammenhänge mit der zeitlich nachgelagerten Veränderung anderer Wahrnehmungen und Verhaltensweisen. Schließlich wurden auch Mehrebenendesigns bisher nicht systematisch verwendet, um mittels Kontextvariablen, zum Beispiel auf Ebene von Stadtteilen, Unterschiede und Gemeinsamkeiten im gefühlten oder gelebten Zusammenhalt zu erklären (Ansätze hierzu gibt es nur bei Arant u. a. 2016). Solche Analysen sind kein bloßer Selbstzweck zur methodisch anspruchsvollen Modellierung auf unterschiedlichen Ebenen gelagerter Effekte. Ein genaueres Verständnis davon, welche Kontextfaktoren wie mit dem Zusammenhalt vor Ort interagieren, kann auch ganz konkret in die Entwicklung praktischer Interventionen einfließen beziehungsweise diese informieren.
1.Ziele des Regionalpanels
Im Rahmen des Forschungsinstituts Gesellschaftlicher Zusammenhalt (FGZ) wurde mit dem »Regionalpanel« eine neue Primärdatenquelle geschaffen, die insbesondere für die Grundlagenforschung zur Untersuchung von Mechanismen der Erzeugung und Folgen von sozialem Zusammenhalt auf der lokalen Ebene ein wertvolles Instrument zur Verfügung stellen soll. Damit sollen einerseits die umrissenen Lücken in der aktuellen Datenlage geschlossen werden. Andererseits soll durch die Kooperation mit Städten und Kommunen von vornherein eine enge Anbindung an die Praxis vor Ort sichergestellt werden. Der modulare Aufbau des Regionalpanels ermöglicht nicht nur, dass Kooperationspartner:innen für sie selbst praxisrelevante Fragestellungen einbringen. Er stellt auch sicher, dass das Instrument flexibel genug bleibt, um auf weitere sich ergebende Fragestellungen an einzelnen Erhebungsorten oder über Erhebungsorte hinweg zu reagieren.
Das Design der Erhebung sollte Fallvergleiche a) zwischen Siedlungen unterschiedlicher Größe (Dorf/Kleinstadt, Mittelstadt, Großstadt), b) in einer Tiefenschärfe erlauben, die auch eine repräsentative Binnendifferenzierung auf Stadtteilebene ermöglicht, um c) eine Anreicherung der Befragungsdaten um aussagekräftige Merkmale des lokalen Kontextes mit Daten der amtlichen Statistik für ein Mehrebenendesign zu erlauben. Durch Wiederholungsbefragungen sollte d) eine Rekonstruktion von Prozessen der Erzeugung und Folgen gesellschaftlichen Zusammenhalts in individuellen Entwicklungen im Zusammenspiel mit Veränderungen von lokalen Kontexten realisiert werden. Das Untersuchungsdesign des Regionalpanels greift mit diesem Vorgehen soziologische Ansätze auf, die als Antwort auf die Kritik entbetteter Individualvariablenansätze mit dem Mechanismen-Konzept die Komplexität des lokal eingebetteten Zusammenspiels individueller Prozesse mit kollektiven Eigendynamiken, Institutionalisierungen und materialen Lebenswelten erfassen wollen (Hedström 2008). Methodisch wird mittels eines vergleichenden Multifall-Designs offengehalten, ob es, wie die neue Stadtsoziologie annimmt, zu Eigenlogiken von Kommunen kommt, die nicht allein auf strukturelle Merkmale zurückzuführen sind (Berking/Löw 2008).





























