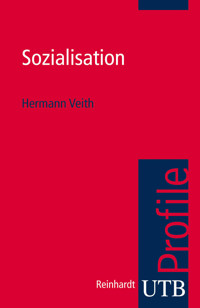
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: UTB
- Kategorie: Bildung
- Serie: utb Profile
- Sprache: Deutsch
Wie entwickelt sich die menschliche Persönlichkeit? Wie beeinflussen Familie und Peers den Sozialisationsprozess? Welche theoretischen Erklärungsmodelle sind von Bedeutung? Hermann Veith beantwortet Studienanfängern alle wichtigen Fragen zur Sozialisation. Ein kompakter Einstieg in das Thema, das in zahlreichen modularisierten Studiengängen (Erziehungswissenschaften, Soziologie, Psychologie) Kernbestandteil der Lehre ist.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 118
Veröffentlichungsjahr: 2008
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
0,0
Bewertungen werden von Nutzern von Legimi sowie anderen Partner-Webseiten vergeben.
Legimi prüft nicht, ob Rezensionen von Nutzern stammen, die den betreffenden Titel tatsächlich gekauft oder gelesen/gehört haben. Wir entfernen aber gefälschte Rezensionen.
Ähnliche
UTB 3004
Eine Arbeitsgemeinschaft der Verlage
Böhlau Verlag · Köln · Weimar · Wien Verlag Barbara Budrich · Opladen · Farmington Hills facultas.wuv · Wien Wilhelm Fink · München A. Francke Verlag · Tübingen und Basel Haupt Verlag · Bern · Stuttgart · Wien Julius Klinkhardt Verlagsbuchhandlung · Bad Heilbrunn Lucius & Lucius Verlagsgesellschaft · Stuttgart Mohr Siebeck · Tübingen C. F. Müller Verlag · Heidelberg Orell Füssli Verlag · Zürich Verlag Recht und Wirtschaft · Frankfurt am Main Ernst Reinhardt Verlag · München · Basel Ferdinand Schöningh · Paderborn · München · Wien · Zürich Eugen Ulmer Verlag · Stuttgart UVK Verlagsgesellschaft · Konstanz Vandenhoeck & Ruprecht · Göttingen vdf Hochschulverlag AG an der ETH Zürich
Prof. Dr. Hermann Veith, lehrt Pädagogik mit dem Schwerpunkt Sozialisationsforschung unter besonderer Berücksichtigung
des Jugendalters, Universität Göttingen
Lektorat/Redaktion im Auftrag des Ernst Reinhardt Verlages: Ulrike Auras, München
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über <http://dnb.d-nb.de> abrufbar.
UTB-ISBN 978-3-8252-3004-3 (Print), 978-3-8385-3004-8 (E-Book)
ISBN 978-3-838-53004-8 (E-Book)
ISBN 978-3-497-01966-3
© 2008 by Ernst Reinhardt, GmbH & Co KG, Verlag, München
Dieses Werk einschließlich seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung
außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne schriftliche Zustimmung
der Ernst Reinhardt, GmbH & Co KG, München, unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere
für Vervielfältigungen, Übersetzungen in andere Sprachen, Mikroverfilmungen und die
Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Reihenkonzept und Umschlagentwurf: Alexandra Brand Umschlagumsetzung: Atelier Reichert, Stuttgart Satz: Arnold & Domnick, Verlagsproduktion, Leipzig Druck: Friedrich Pustet, Regensburg
ISBN 978-3-8252-3004-3 (UTB-Bestellnummer)
Ernst Reinhardt Verlag, Kemnatenstr. 46, D-80639 München Net: www.reinhardt-verlag.de E-Mail: [email protected]
Inhaltsverzeichnis
TitelImpressumEinleitung1 - Warum sind wir zur Selbstbestimmung gezwungen?2 - Wie beeinflusst uns die Gesellschaft?3 - Welche Entwicklungsbedeutung hat die Familie?4 - Was lernt man eigentlich in der Schule?5 - Wie wichtig sind die Anderen?6 - Wie entwickelt sich die Persönlichkeit?7 - Was ist denn schon „normal“?AnhangSachregister
Einleitung
Mit dem Begriff der „Sozialisation“ verbindet sich die Vorstellung, dass die gesellschaftlichen
Verhältnisse, in denen Menschen aufwachsen und leben, ihre Kompetenz- und Persönlichkeitsentwicklung
nachhaltig beeinflussen. Neben der Familie und der Schule werden in der Regel Freunde,
Peergruppen und Medien als die wichtigsten Bedingungsfaktoren des biografischen Lernens
wahrgenommen. Die Tatsache jedoch, dass man selbst im Alltagshandeln unentwegt in
sozialisatorisch wirksame Praktiken verstrickt ist, gerät bei dieser umweltzentrierten
Betrachtungsweise sehr leicht in Vergessenheit.
Stellen Sie sich deshalb einmal folgende Situation vor: Sie steigen gut gelaunt in
eine U-Bahn und wünschen den Mitfahrenden einen „schönen guten Morgen“. Sehr wahrscheinlich
wird Ihr Gruß unerwidert bleiben. Das heißt aber nicht, dass er wirkungslos war –
im Gegenteil. Wenn Sie sich umsehen, werden Sie entdecken, wie einige Fahrgäste schon
längst dabei sind, ein Spontanpsychogramm über Ihre Person anzufertigen: Musiker,
Zeitungsverkäufer, Obdachloser, Fahrkartenkontrolleur? Da nichts von alledem auf Sie
zutrifft, ist der Fall für die anderen schnell erledigt: „Stadtneurotiker!“ Sie nehmen
diese Typenzuschreibung ganz intuitiv zur Kenntnis und fühlen sich mit einem leichten
Anflug von Peinlichkeit und Kränkung missverstanden. Ohne dass auch nur ein Wort gewechselt
wurde, sehen Sie sich aufgefordert, Ihre Heiterkeit hinter der umgänglicheren Maske
demonstrativer Gleichgültigkeit zu verbergen. Man wünscht, in der kalten Behaglichkeit
der morgendlichen Rushhour einfach nicht gestört zu werden. Darum gibt man Ihnen schweigend
zu verstehen, dass Ihre Begrüßungsformel deplatziert ist und Sie mit Ihrer beschwingten
Art zu weit gegangen sind, wenn auch nur geringfügig, aber immerhin. Sie haben nichtsahnend
eine ungeschriebene Norm der Massengesellschaft übertreten und die Anonymitätsregel
verletzt, die das Leben der Großstadtmenschen von solchen Bekanntschaftsritualen entlastet.
Ihr Fauxpas wird Ihnen allerdings verziehen, vorausgesetzt, Sie sind bereit, auf Anschlusshandlungen
zu verzichten und lautlos in der Menge abzutauchen.
Es sind gerade diese winzigen Normverstöße, welche die immense Wirkmacht alltagspraktischer Ordnungen anschaulich werden lassen. Denn würde man sich nicht darauf verlassen können, dass
die Menschen, denen man tagtäglich begegnet, unsere Sicht der Welt und der
darin geltenden Regeln zumindest ungefähr teilen, wäre der kommunikative Orientierungs-
und Verständigungsaufwand nicht zu bewältigen. Mit jedem Schritt vor die Wohnungstür
würde man in das Laufrad einer sich schier endlos drehenden Fragemaschinerie einsteigen:
„Wie geht es Ihnen?“, „Was machen Sie?“, „Wo wollen Sie hin?“ – oder noch irritierender:
„Wer sind Sie eigentlich überhaupt?“ Damit nicht genug, denn schon nach wenigen Sekunden
würde man selbst den anderen mit den gleichen Fragen auf die Nerven gehen.
Bekanntermaßen handeln wir jedoch unter den Normalitätsbedingungen unserer Alltagspraxis
etwas anders. Wir wissen, dass Fremde sich in der U-Bahn nicht grüßen müssen. Zur
erfolgreichen „Kommunikation“ genügt der unverwandte Blick ins Leere. Es reicht, einfach
so zu tun, als ob sich die Art, wie wir uns verhalten, von selbst versteht –und tatsächlich
verhalten sich alle so. Dass dieses so funktioniert, ist die Wirkung von Sozialisation. Man kennt intuitiv die Normen und Prinzipien, die „regeln“, was zu tun ist, und
man weiß, welche Relevanz dabei andere Menschen und Dinge haben. Wir wissen, ohne
uns darüber Klarheit zu verschaffen, dass wir „Individuen“ und „Subjekte“ sind –eine
für andere Gesellschaften unvorstellbare Form des In-der-Welt-Seins. Wir senden starke
Ich-Botschaften, wenn wir uns über objektive Sachverhalte unterhalten. Wir fordern
die Anerkennung unserer persönlichen Rechte, wenn wir uns mit anderen über soziale
Praktiken verständigen und sprechen mit großer Ernsthaftigkeit über unsere subjektiven
Erlebnisse. Auch das ist in anderen Kulturen keineswegs selbstverständlich. Ganz offenbar
bewegen wir uns, in dem, was wir tun und denken, in gesellschaftlich vorgespurten
Bahnen. Wir haben im praktischen Miteinander gelernt, wie „man“ sich verhält und was
„man“ wie gebrauchen darf. In einigen Fällen geschieht dieses, wie in der U-Bahn,
ganz indirekt und beiläufig, in anderen werden konkrete pädagogische Absichten und Verhaltenserwartungen wirksam.
Tatsächlich bilden und entwickeln sich unsere Handlungsfähigkeiten und damit in Verbindung
unser Selbst- und Weltverständnis in den unterschiedlichen sozialen Praktiken, in
die wir vom ersten Lebenstag an eingebunden sind: Kaum ist man geboren, wird man gemessen
und gewogen. Während die Eltern noch damit beschäftigt sind, das Individuelle an ihrem
Kind zu entdecken, hat die Verwandtschaft längst das Familientypische ausgemacht:
„Die Fingerchen hat sie von der Oma, die Haarfarbe von Opa, als er noch jung war.“
Die Bekannten interessieren sich für das Geschlecht und kommentieren den Namen, das
Klinikpersonal überwacht den Gesundheitszustand, die Behörden bescheinigen
die Geburt, der Stadtanzeiger will ein Foto und die Babybranche wirbt mit ihren Begrüßungsgeschenken
um Kundschaft. So folgen alle Abläufe einer bestimmten Ordnung, und jeder macht sich
gemäß der Eigenlogik des Sozialsystems, dem er sich zugehörig fühlt, sein ganz spezielles
Bild von dem Neuankömmling.
Wie Säuglinge dieses rührige soziale Treiben und Einbinden um sie herum erleben, lässt
sich – auch aus wissenschaftlicher Sicht – nur hypothetisch rekonstruieren. Können
Babys ihre Mitmenschen schon als Personen erkennen oder empfinden sie nur ihre eigenen,
mit ersten sinnlichen und kulturellen Bedeutungsfragmenten angereicherten leiblichen
Aktivitätszustände? Klar ist aber, dass ihnen die Welt durch ihre Bezugspersonen nahe
gebracht wird. Im wechselseitigen Geben und Nehmen der ersten Lebensmonate lernen
sie, ohne sich dessen bewusst zu sein, wie man sich in der Gegenwart anderer sinnvollerweise
verhält. Sie übernehmen die körperlichen Bewegungsschemata ihrer Handlungspartner
und stellen sich mit ihrem ganzen Organismus physisch, psychisch und pragmatisch auf
ihre Umwelt ein. Als Kleinkinder entwickeln sie sodann ganz allmählich die Fähigkeit,
ihr eigenes Verhalten an den Absichten und Erwartungen ihrer Handlungspartner auszurichten
und die elementaren Ordnungszusammenhänge ihrer Lebenswelt zu verstehen. Sie entdecken
physikalische Kausalzusammenhänge, soziale Regelmäßigkeiten und kulturelle Sinnstrukturen.
Je mehr die Heranwachsenden dabei lernen, ihre eigenen Tätigkeiten zu reflektieren
und selbstbestimmt zu handeln, desto komplexer werden die Formen der sozialisatorischen
Auseinandersetzung mit der Umwelt und der eigenen Person.
Definition
Von Sozialisation spricht man in diesem Zusammenhang, weil sich die Persönlichkeit
mit ihren Sprach- und Handlungsfähigkeiten stets unter historischen Kulturbedingungen
in gesellschaftlich strukturierten Lebenswelten entwickelt.
Dieses Buch richtet sich an all diejenigen, die einen ersten, aber nicht oberflächlich
bleibenden Einblick in die Grundfragen der Sozialisationsforschung gewinnen möchten.
Das ist deshalb nicht ganz einfach, weil sich dieses Forschungsfeld quer über den
gesamten Bereich der sozial- und humanwissenschaftlichen Disziplinen erstreckt. Darüber
hinaus gibt es kein einheitliches Theoriekonzept, sondern viele verschiedene, sich
teilweise auch widersprechende Erklärungsansätze. Warum
das so ist, wird deutlich, wenn man sich das Ziel der modernen sozialisationstheoretischen
Diskussion vor Augen führt.
Kernaussage
Sozialisationstheoretiker wollten und möchten verstehen, unter welchen gesellschaftlichen
Bedingungen die Verinnerlichung sozialer Normen individuelle Autonomie ermöglicht,
oder aber zur Entwicklung eingeschränkter Handlungsfähigkeiten führt.
Ausgehend von der Frage, warum in den Sozialwissenschaften nicht nur von Entwicklung,
sondern von Sozialisation die Rede ist (Kapitel 1), wird ein analytisches Rahmenmodell
beschrieben (Kapitel 2), mit dessen Hilfe das Zusammenspiel von gesellschaftlichen
und individuellen Entwicklungsbedingungen anschaulich dargestellt werden kann. Darauf
aufbauend werden in den Kapitel 3, 4 und 5 die unterschiedlichen Vergesellschaftungspraktiken
in den wichtigsten Sozialisationskontexten – Familie, Schule und Peergruppe – skizziert.
Ein kleiner Exkurs zur Rolle der Medien leitet über zu den Grundfragen der Kompetenz-
und Persönlichkeitsentwicklung (Kapitel 6). Was dabei als „normal“ gelten kann, ist,
wie in Kapitel 7 gezeigt werden wird, keineswegs selbstverständlich. Zur Weiterbeschäftigung
mit den angesprochenen Themen findet sich am Ende eines jeden Kapitels ein Informationsteil
mit allgemeinen Literatur- und Websiteempfehlungen. Im Glossar schließlich werden
einige für das Thema Sozialisation wichtige Grundbegriffe erklärt.
Kernaussage
Wer im Erziehungs- und Bildungsbereich beschäftigt ist, übernimmt für andere Menschen
Verantwortung. Die Entscheidungen, die in der pädagogischen Praxis zumeist schnell
und vor allem zielsicher getroffen werden müssen, bedürfen dabei stets der fachlichen
Begründung und Legitimation. Zur professionellen Planung, Beurteilung und Auswertung
von Handlungsstrategien in den unterschiedlichen Praxis- und Berufsfeldern ist deshalb
theoriegeleitetes Wissen über den Sozialisationsprozess unerlässlich.
1
Warum sind wir zur Selbstbestimmung gezwungen?
Gesellschaften benötigen zu ihrer eigenen Stabilität und Erneuerung handlungsfähige
Personen. Moderne Sozialsysteme sind dabei in besonderer Weise auf eigenständige,
verantwortungsbewusst und reflexiv agierende Individuen angewiesen. Die zur Teilhabe
am sozialen Leben wichtigen Kompetenzen können durch Sozialisation und Bildung erworben
werden. Allerdings gibt es dafür keine Garantie.
Kernaussage
Auch unter günstigen äußeren Lebensumständen sind biografische Risikoentwicklungen
möglich und umgekehrt können Menschen in schwierigen Verhältnissen durchaus alltagstaugliche
Handlungsfähigkeiten und Subjektautonomie entwickeln. Dieses hängt unter anderem damit
zusammen, dass der Sozialisationsprozess von den sich entwickelnden Subjekten selbst
aktiv mitgestaltet wird.
Es gibt keine kausale Determination der Person durch die Umwelt. In fast allen einschlägigen
Veröffentlichungen werden heute deshalb ausdrücklich die Eigenaktivitäten des Individuums bei der Aneignung kultureller Wissensbestände, sozialer Normen und
alltagspraktischer Handlungsroutinen hervorgehoben (Geulen 2005, Grundmann 2006, Zimmermann
2006). Im Mittelpunkt dieses Kapitels stehen die entsprechenden konzeptionellen Grundlagen
der modernen Sozialisationsforschung. Ausgehend von einer begriffsgeschichtlich angelegten
Problembeschreibung werden das Sozialisationskonzept konkretisiert und die wichtigsten
Bezugstheorien genannt. Schließlich wird begründet, warum sozialisationstheoretisches
Wissen praktisch nützlich ist.
Am Anfang war das Wort
Der Begriff „Sozialisation“ leitet sich wortgeschichtlich aus dem englischen Verb
„to socialize“ ab. Dieses findet sich erstmals 1828 im Oxford Dictionary in der Bedeutung
von „to render social, to make fit for living in society“ (Clausen 1968, 21). Da man
Begriffe besser versteht, wenn man den Kontext kennt, in dem sie verwendet werden,
soll zunächst kurz beschrieben werden, wie das Wort Sozialisation alltagssprachlich
aufkam und in die wissenschaftliche Diskussion einsickerte.
1. Das Wort „Sozialisation“: Bekanntermaßen hat die Industrialisierung in England deutlich früher eingesetzt als
in anderen Staaten. Mit der Auslagerung der gewerblichen Produktion aus den Hauswirtschaftsbetrieben
entwickelten sich überall neue Formen der Arbeitsteilung. Im Räderwerk der dampfgetriebenen
Maschinen und mechanisierten Fabrikanlagen wurden – bildlich gesprochen – die traditionellen
Lebensordnungen der agrarständischen Welt zerrieben. Die moderne Zeitordnung war nicht
mehr zyklisch wie das Kalenderjahr, sondern linear, zukunftsgewandt und fortschrittsorientiert.
Dabei war es immer weniger möglich, die zur Lohnarbeit benötigten Kompetenzen im alltäglichen
Miteinander zu erlernen. Um „fit“ zu werden, und das hieß ganz elementar, um die eigenen
individuellen Existenzgrundlagen sichern zu können, war es auch im gesellschaftlichen
Interesse erforderlich, dass die Einzelnen ihr Verhalten den veränderten Arbeits-
und Lebensbedingungen anpassten. Für den Erwerb entsprechend sozial verwertbarer und
nützlicher Qualifikationen und Alltagspraktiken wurde das Verb „to socialize“ gebräuchlich.
Kernaussage
Um in der Gesellschaft einen Platz zu finden und etwas aus sich und seiner Persönlichkeit
zu machen, war man als Individuum auf sich selbst gestellt, zur Selbstbestimmung gezwungen.
Statt einer Gemeinschaft qua Herkunft einfach anzugehören, sah man sich nun der Gesellschaft
mit ihren unterschiedlichen sozialen Systemen, Organisationen und Gruppen gegenüber.
Wer integriert sein wollte, musste lernen, wie man sich außerhalb der familiären Lebenswelt
als Schüler in der Schule, als Erwerbstätiger im Betrieb, als Staatsbürger im politischen
System oder als Nachbar im Wohnviertel zu verhalten hatte. Für diese Form des kontinuierlichen
und auf immer
unterschiedlichere normative Kontexte bezogenen biografischen Rollenlernens wurde
es am Ende des 19. Jahrhunderts üblich, das Substantiv „socialization“ zu verwenden.
2. Der wissenschaftliche Begriff „Sozialisation“: Zur selben Zeit setzte sich in der wissenschaftlichen Diskussion die Auffassung durch,
dass die Persönlichkeitsentwicklung maßgeblich durch die „gesellschaftlichen Verhältnisse“
beeinflusst wird (Marx/Engels 1845/46). Kurz vor der Jahrhundertwende erschienen fast
zeitgleich mehrere Veröffentlichungen, in denen der Begriff „Sozialisation“ ausdrücklich
vorkommt (Veith 2008). Das war kein Zufall. Tatsächlich sahen die Zeitgenossen, dass
die industriegesellschaftlichen Konflikte und Verwerfungen – der Gegensatz zwischen Reichtum und Armut, die zunehmende Verstädterung und die
Arbeitsmigration – nicht nur die Grundlagen der alten Ständeordnung, sondern das kapitalistische
System selbst erschütterten.
Für den französischen Soziologen und Erziehungswissenschaftler Emile Durkheim (1858–1917) gab es keinen Zweifel, dass der Individualismus des modernen Industriezeitalters
archaische psychische Willenskräfte mit ambivalenten sozialen Folgen entfesselte.
Denn die Wirtschaftsgesellschaft weckte mit ihren verlockenden Angeboten ein schier
unbändiges Verlangen nach immer neuen Glücksgütern. Da die breite Masse der Bevölkerung
jedoch vom Konsum ausgeschlossen blieb, waren Klassenspannungen unvermeidbar. Beides,
der gierige Eigennutz und die Zuspitzung der sozialen Frage, waren brandgefährlich,
weil sie die ohnehin porösen lebensweltlichen Fundamente der Gesellschaft unterspülten.
Durkheim war überzeugt, dass ohne gemeinsam geteilte Wertbindungen die Egomanie der
Selbstsüchtigen alle sozialen Dämme durchbrechen würde. Die Ursache dafür sah er aber
nicht, wie viele seiner Kollegen, in einem angeborenen Machttrieb oder einer vererbten
Charakterschwäche und Verderbtheit, sondern ganz eindeutig im Autoritäts- und Geltungsverlust elementarer, das soziale Gemeinschaftsleben ordnender Institutionen (Durkheim 1893).
Ohne Solidarität und verbindliche Konventionen – so sein Argument – fehlten die sozialen
Triebkräfte zur Entwicklung fester innerer Werthaltungen.
Kernaussage
Das moralische Regelbewusstsein ist nicht angeboren, vielmehr entstehen und entwickeln
sich die individuellen Normvorstellungen erst im Verlauf des Sozialisationsprozesses.
Mit dieser Prämisse war die moderne sozialisationstheoretische Diskussion eröffnet.
3. Das theoretische Modell: Durkheim selbst konkretisierte diesen Grundgedanken mit Hilfe der Unterscheidung
von individuellen und sozialen Ich-Strukturen. Während im „individuellen Ich“





























