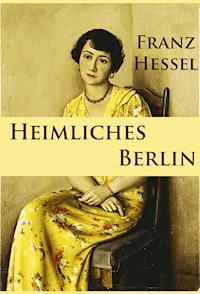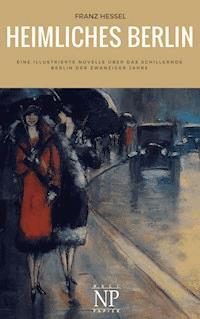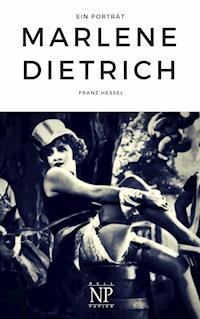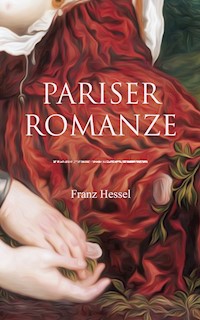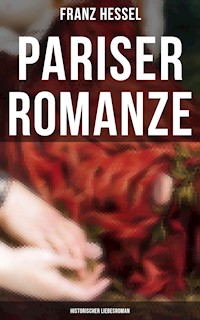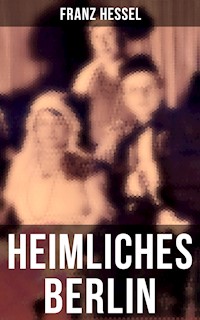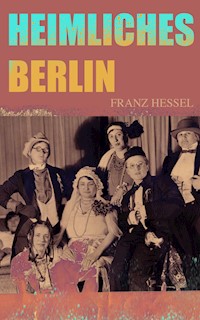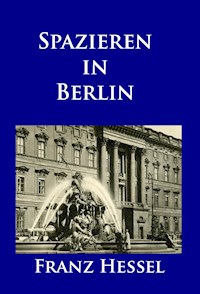
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ideenbrücke Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
„Ein Lehrbuch der Kunst in Berlin spazieren zu gehn, ganz nah dem Zauber der Stadt - von dem sie selbst kaum weiß“ Franz Hessel, wichtiger Schriftsteller der Zwanziger Jahre („Heimliches Berlin“), führt uns durch seine Stadt, wie sie war in den Goldenen Jahren, bevor die Nazis die Macht übernahmen und ihn ins Exil trieben. Aus dem Inhalt: DER VERDÄCHTIGE ICH LERNE ETWAS VON DER ARBEIT VON DER MODE VON DER LEBENSLUST RUNDFAHRT DIE PALÄSTE DER TIERE BERLINS BOULEVARD ALTER WESTEN TIERGARTEN DER LANDWEHRKANAL DER KREUZBERG TEMPELHOF HASENHEIDE ÜBER NEUKÖLLN NACH BRITZ DAMPFERMUSIK NACH OSTEN NORDEN NORDWESTEN FRIEDRICHSTADT DÖNHOFFPLATZ ZEITUNGSVIERTEL SÜDWESTEN NACHWORT AN DIE BERLINER
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 320
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Franz Hessel
Spazieren in Berlin
(1929)
Ein Lehrbuch der Kunst in Berlin spazieren zu gehn
DER VERDÄCHTIGE
Langsam durch belebte Straßen zu gehen, ist ein besonderes Vergnügen. Man wird überspült von der Eile der andern, es ist ein Bad in der Brandung. Aber meine lieben Berliner Mitbürger machen einem das nicht leicht, wenn man ihnen auch noch so geschickt ausbiegt. Ich bekomme immer mißtrauische Blicke ab, wenn ich versuche, zwischen den Geschäftigen zu flanieren. Ich glaube, man hält mich für einen Taschendieb.
Die hurtigen, straffen Großstadtmädchen mit den unersättlich offnen Mündern werden ungehalten, wenn meine Blicke sich des längeren auf ihren segelnden Schultern und schwebenden Wangen niederlassen. Nicht als ob sie überhaupt etwas dagegen hätten, angesehn zu werden. Aber dieser Zeitlupenblick des harmlosen Zuschauers enerviert sie. Sie merken, daß bei mir nichts ›dahinter!‹ steckt.
Nein, es steckt nichts dahinter. Ich möchte beim Ersten Blick verweilen. Ich möchte den Ersten Blick auf die Stadt, in der ich lebe, gewinnen oder wiederfinden …
In stilleren Vorstadtgegenden falle ich übrigens nicht minder unangenehm auf. Da ist gegen Norden ein Platz mit Holzgerüst, ein Marktgerippe und dicht dabei die Produktenhandlung der Witwe Kohlmann, die auch Lumpen hat; und über Altpapierbündeln, Bettstellen und Fellen hat sie an der Lattenveranda ihrer Handlung Geraniumtöpfe. Geranium, pochendes Rot in träg grauer Welt, in das ich lange hineinsehn muß. Die Witwe wirft mir böse Blicke zu. Zu schimpfen getraut sie sich nicht, sie hält mich vielleicht für einen Geheimen, am Ende sind ihre Papiere nicht in Ordnung. Und ich meine es doch gut mit ihr, gern würde ich sie über ihr Geschäft und ihre Lebensansichten befragen. Nun sieht sie mich endlich weggehn und gegenüber, wo die Querstraße ansteigt, in die Kniekehlen der Kinder schauen, die gegen die Mauer Prallball spielen. Langbeinige Mädchen, entzückend anzusehn. Sie schleudern den Ball abwechselnd mit Hand, Kopf und Brust zurück und drehn sich dabei, und die Kniekehle scheint Mitte und Ausgangspunkt ihrer Bewegungen. Ich fühle, wie hinter mir die Produktenwitwe ihren Hals reckt. Wird sie den Schupo darauf aufmerksam machen, was ich für einer bin? Verdächtige Rolle des Zuschauers!
Wenn es dämmert, lehnen alte und junge Frauen auf Kissen gestützt in den Fenstern. Mir geschieht mit ihnen, was die Psychologen mit Worten wie Einfühlung erledigen. Aber sie werden mir nicht erlauben, neben und mit ihnen zu warten auf das, was nicht kommt, nur zu warten ohne Objekt.
Straßenhändler, die etwas ausschreiend feilhalten, haben nichts dagegen, daß man sich zu ihnen stellt; ich stünde aber lieber neben der Frau, die soviel Haar aus dem vorigen Jahrhundert auf dem Kopf hat, langsam ihre Stickereien auf blaues Papier breitet und stumm Käufern entgegensieht. Und der bin ich nicht recht, sie kann kaum annehmen, daß ich von ihrer Ware kaufen werde.
Manchmal möcht ich in die Höfe gehn. Im älteren Berlin wird das Leben nach den Hinter- und Gartenhäusern zu dichter, inniger und macht die Höfe reich, die armen Höfe mit dem bißchen Grün in einer Ecke, den Stangen zum Ausklopfen, den Mülleimern und den Brunnen, die stehngeblieben sind aus Zeiten vor der Wasserleitung. Vormittags gelingt mir das allenfalls, wenn Sänger und Geiger sich produzieren oder der Leierkastenmann, der obendrein auf einem freien Fingerpaar Naturpfeife zum besten gibt, oder der Erstaunliche, der vorn Trommel und hinten Pauke spielt (er hat einen Haken am rechten Knöchel, von dem eine Schnur zu der Pauke auf seinem Rücken und dem aufsitzenden Schellenpaar verläuft; und wenn er stampft, prallt ein Schlegel an die Pauke, und die Schellen schlagen zusammen). Da kann ich mich neben die alte Portierfrau stellen – es ist wohl eher die Mutter der Pförtnersleute, so alt sieht sie aus, so gewohnheitsmäßig sitzt sie hier auf ihrem Feldstühlchen. Sie nimmt keinen Anstoß an meiner Gegenwart und ich darf hinaufsehn in die Hoffenster, an die sich Schreibmaschinenfräulein und Nähmädchen der Büros und Betriebe zu diesem Konzert drängen. Selig benommen pausieren sie, bis irgend ein lästiger Chef kommt und sie wieder zurückschlüpfen müssen an ihre Arbeit. Die Fenster sind alle kahl. Nur an einem im vorletzten Stockwerk sind Gardinen, da hängt ein Vogelbauer, und wenn die Geige von Herzen schluchzt und der Leierkasten dröhnend jammert, fängt ein Kanarienvogel zu schlagen an als einzige Stimme der stumm schauenden Fensterreihen. Das ist schön. Aber ich möchte doch auch mein Teil an dem Abend dieser Höfe haben, die letzten Spiele der Kinder, die immer wieder heraufgerufen werden, und Heimkommen und Wiederwegwollen der jungen Mädchen erleben; allein ich finde nicht Mut noch Vorwand, mich einzudrängen, man sieht mir meine Unbefugtheit zu deutlich an.
Hierzulande muß man müssen, sonst darf man nicht. Hier geht man nicht wo, sondern wohin. Es ist nicht leicht für unsereinen.
* * *
Ich kann noch von Glück sagen, daß eine mitleidige Freundin mir manchmal erlaubt, sie zu begleiten, wenn sie Besorgungen zu machen hat. In die Strumpfklinik zum Beispiel, an deren Tür steht: ›Gefallene Maschen werden aufgenommen.‹ In diesem düstern Zwischenstock huscht eine Bucklige durch ihr muffiges wolliges Zimmer, das eine neue Glanztapete aufhellt. Ware und Nähzeug liegen auf Tischen und Etageren um Porzellanpantöffelchen, Biskuitamoretten und Bronzemädchen herum, wie Herdentiere um alte Brunnen und Ruinen lagern. Und das darf ich genau besehn und daran ein Stück Stadt- und Weltgeschichte lernen, während die Frauen sich besprechen.
Oder ich werde zu dem Flickschneider mitgenommen, der in einem Hinterhaus der Kurfürstenstraße zu ebner Erde wohnt. Da trennt ein Vorhang, der nicht ganz bis zum Boden reicht, den Arbeitsraum vom Schlafraum ab. Auf einem gefransten Tuch, das über den Vorhang hängt, ist bunt der Kaiser Friedrich als Kronprinz dargestellt. ›So kam er aus San Remo‹, sagt der Schneider, der meinem Blick gefolgt ist, und zeigt dann selber seine weiteren monarchentreuen Schätze, den letzten Wilhelm photographiert und sehr gerahmt mit seiner Tochter auf den Knien und das bekannte Bild des alten Kaisers mit Kindern, Enkeln und Urenkeln. Gern will er meiner Republikanerin das grüne Jackett umnähen, aber im Herzen hält er’s, wie er sagt, ›mit den alten Herrschaften‹, zumal die Republik nur für die jungen Leute sorge. Ich versuche nicht, ihn umzustimmen. Mit seinen Gegenständen kann es meine politische Erkenntnis nicht aufnehmen. Er ist sehr freundlich mit dem Hunde meiner Freundin, der an allem herumschnuppert, neugierig und immer auf der Spur gerade wie ich.
Mit diesem kleinen Terrier gehe ich gern spazieren. Wir sind dann beide ganz in Gedanken; auch gibt er mir Anlaß, öfter stehnzubleiben, als es sonst einem so verdächtigen Menschen wie mir erlaubt wäre.
ICH LERNE
Ja, er hat recht, ich muß etwas für meine Bildung tun. Mit dem Herumlaufen allein ist es nicht getan. Ich muß eine Art Heimatskunde treiben, mich um die Vergangenheit und Zukunft dieser Stadt kümmern, dieser Stadt, die immer unterwegs, immer im Begriff, anders zu werden, ist. Deshalb ist sie wohl auch so schwer zu entdecken, besonders für einen, der hier zu Hause ist … Ich will mit der Zukunft anfangen.
Der Architekt nimmt mich in sein weites, lichtes Atelier, führt von Tisch zu Tisch, zeigt Pläne und plastische Modelle für Geländebebauung, Werkstätten und Bürogebäude, Laboratorien einer Akkumulatorenfabrik, Entwürfe für eine Flugzeugausstellungshalle, Zeichnungen für eine der neuen Siedlungen, die Hunderte und Tausende aus Wohnungsnot und Mietskasernenelend in Luft und Licht retten sollen. Dazu erzählt er, was heute die Baumeister von Berlin alles planen und zum Teil im Begriff sind, auszuführen. Nicht nur Weichbild und Vorstadt will man durch planmäßige Großsiedlung umgestalten, auch in den alten Stadtkörper soll neuformend eingegriffen werden. Der künftige Potsdamerplatz wird von zwölf-geschossigen Hochhäusern umgeben sein. Das Scheunenviertel verschwindet; um den Bülowplatz, um den Alexanderplatz entsteht in gewaltigen Baublöcken eine neue Welt. Immer neue Projekte werden entworfen, um die Probleme der Grundstückwirtschaft und des Verkehrs in Einklang zu bringen. Künftig darf nicht mehr der Bauspekulant und der Maurermeister durch seine Einzelbauten den Stil der Stadt verderben. Das läßt unsere Bauordnung nicht zu.
Der Architekt berichtet von den Ideen seiner Kollegen: Da die Stadt allmählich auf dem einen Havelufer Potsdam erreichen wird, stellt einer einen Plan mit Bahnen und Verkehrslinien auf, dem er die schönen Waldbestände und einzelnen Seen einfügt, um schließlich die Havel zwischen Pichelsdorf und Potsdam zu einer Art Außenalster zu machen. Ein anderer will zwischen Brandenburger Tor und Tiergarten einen großen repräsentativen Platz schaffen, so daß erst die Siegesallee die Parkgrenze bilden soll. Auf dem Messegelände soll die Ausstellungsstadt die Form eines riesigen Eis bekommen, mit einem Innen- und Außenring von Hallen, einem neuen Sportsforum und einem Kanal, an dessen Endpunkt zwischen Gartenterrassen ein Wasserrestaurant liegt. Potsdamer und Anhalter Bahnhof sollen auf das Rangiergeleise des nächsten Vorortsbahnhofs verlegt werden, um Platz zu schaffen für eine breite Avenue mit Kaufhäusern, Hotels und Großgaragen. Im Zusammenhang mit der Vollendung des Mittellandkanals ändert sich Berlins Wasserstraßennetz, und die entsprechende Umgestaltung alter und Erbauung neuer Ufer, Brücken, Anlagen stellt wichtige Aufgaben. Und dann das neue Baumaterial: Glas und Beton, Glas an Stelle von Ziegel und Marmor. Schon gibt es eine Reihe Häuser, deren Fußböden und Treppen aus Schwarzglas, deren Wände aus Opakglas oder Alabaster bestehn. Dann die Eisenhäuser, ihre Verkleidung mit Keramik, ihre Rahmung mit glänzender Bronze usw.
Der Architekt bemerkt meine Verwirrung, er lächelt. Also schnell ein bißchen Anschauungsunterricht. Hinunter auf die Straße und in sein wartendes Auto. Wir sausen den Kurfürstendamm entlang an alten architektonischen Schrecken und neuen ›Lösungen‹ und Erlösungen. Wir halten vor den Gebäuden des Kabaretts und des Filmpalastes, die eine gerade durch ihre leisen Verschiedenheiten so eindringliche Einheit bilden, beide beschwingt im Raume kreisend, immer wieder die mitreißende Einfachheit ihrer großen Linien ziehend, wobei das eine sich mehr in die Breite lagert, das andre mehr aufragt. Der Meister neben mir erklärt eines Meisters Werk. Und um, was seine Worte umfassen, aus der Mitte des Bauwerks zu verdeutlichen, verläßt er mit mir den Wagen, führt mich durch den breiten Wandelgang, der in dunklem Rot dämmert, ins Innere des einen Theaterraums und zeigt mir, wie die ganze Schauburg aus der Form des Kreises entwickelt ist und wie die hellen Wände ohne vereinzelten und abwegigen Schmuck durch flächige Muster gegliedert sind.
Dann fahren wir eine Querstraße hinauf durch ein kleinbürgerliches Stück Charlottenburg und am Lietzensee vorbei zum Funkturm und den Ausstellungshallen, die er mit ein paar Worten zur größeren Messestadt ausbaut. Ehe er damit fertig ist, haben wir den Reichskanzlerplatz erreicht und er stellt mir das Unterhaltungsviertel dar, das hier entstehen soll, die beiden Baublöcke mit Kinos, Restaurants, Tanzsälen, einem großen Hotel und dem Lichtturm, der das Ganze überragen wird. Wir wenden in eine Parallelstraße des Kaiserdamms und halten vor einem weiten Neubaugelände. Hier ist mein Führer selbst Bauherr. Werkmeister kommen uns entgegen und erstatten ihm Bericht. Indes seh ich in das weitläufige Chaos, aus dem sich mir zunächst die beiden Pylonen am Eingang, schon im Rohbauskelett deutlich gestaltet, entgegenrecken. Dann geh ich mit dem Meister über Schutt und Geröll bis an den Rand, hinter dem der Abgrund der Mitte beginnt. Der Grundriß, wie man ihn sonst auf dem Zeichentisch vom Blatt ablesen muß, dem Notenblatt dieser ›gefrorenen Musik‹, liegt nun vor mir ausgebreitet. Dort werden die beiden großen Depothallen sich erheben, die Schlafstellen der Wagen. Hier werden Geleise entlangführen. Am Rande rings werden Gärten entstehen, in denen unter den Fenstern vieler lichter Wohnungen die Kinder der Beamten, Fahrer, Schaffner spielen sollen. Wir fahren außen die eine Seite des großen Vierecks entlang. An einer Stelle ist die Straße erst im Entstehen begriffen, und wir müssen ein Stück über wuchernde Wege gehn. Und um uns her wächst aus des Baumeisters Worten eine ganze Stadt.
Was er mir so am Werdenden sichtbar gemacht hat, kann er mir nun auch noch am Vollendeten zeigen. Über die Spreebrücke beim Schloß Charlottenburg eilt unser Wagen den Kanal entlang und zum weiten Westhafen. Ein Blick auf die düsteren Gefängnismauern von Plötzensee. Wir kommen durch die endlose Seestraße an Kirchhofsmauer und Mietskasernen hin bis zur Müllerstraße. Die mächtige Siedlung der Wagen und Menschen taucht auf. Breiter Zugang eröffnet uns den Blick auf drei eisengestützte Hallen. Wir durchschreiten das Tor und sehn von innen die dreistöckigen Seitenflügel der Wohnstätten, die vier Stockwerke der Frontseite und die mächtigen Pylonen der Ecken. Dann treten wir überall ein, erst in die Glas- und Eisenhalle, in der die Wagen wohnen, sehn dort hinauf zum Bahnhofshimmel und hinab in die seltsame Welt der Gänge unter den Schienensträngen. Dann in die Verwaltungsräume, Reparaturwerkstätten und endlich über einladend ansteigende Treppen in einige der hübschen Wohnungen.
Beim Umschreiten des Komplexes begreife ich, ohne es bautechnisch ausdrücken zu können, wie der Künstler durch Wiederholung bestimmter Motive, Betonung bestimmter Linien, durch das Vorziehen scharfer Kanten an den steigenden Flächen und ähnliches diesem Riesending aus Backstein, welches Bahnhof, Büro und Menschenhaus zugleich sein muß, einen unvergeßlich einheitlichen Gesamtcharakter gegeben hat.
An der Nordostseite schauen wir weit über Feld, und ganz nah bekomme ich des Riesen winzigen Nachbar gezeigt, ein Häuschen, ›so windebang‹, das da tief im Felde steht. Das ›schmale Handtuch‹ nennen es die Leute. Das Nebeneinander der ragenden Hallen und dieser Hütte ist wie ein Wahrzeichen des Weichbildes von Berlin.
* * *
Am Abend dieses übervollen Tages bin ich bei einer alten Dame zu Gaste gewesen, die aus Sekretär und Truhe Erinnerungsstücke hervorholte, Dinge, die ihrer Ahnin im alten Haus an der Stralauerstraße gehört haben, die große englische Puppe im ergrauten Musselinempirekleid mit den kreuzweis gebundenen, immer noch rosenfarbenen Seidenschuhen; Tellerchen und Leuchterchen, sorglich aus Holz geschnitten, mit denen diese Ahnin als Kind im Garten spielte ganz nah an der Spree und der hölzernen Waisenbrücke, von der Menzel auf seinem berühmten Stich Chodowiecki ins Wasser schauen läßt. Aus einer Blechkapsel nimmt sie die Hauspapiere mit den Wachssiegeln. Zierliche Stammbücher der Urgroßtanten darf ich aufschlagen, in denen die haarscharfen Schnörkelbuchstaben poetischer Widmungen den kolorierten Buketts und hauchzarten Landschaften befreundeter Maler gegenüberstehn. In den Landschaften findet sich als Staffage bisweilen ein Reitersmann in gelbem Frack und Stulpstiefeln oder eine Reiterin in violettem Kleid. Die Buketts sind in Form und Farbe verwandt dem, was mit spitzem Pinsel die Porzellanmaler auf Teller und Vasen und Schalen ›Königlich Berlin‹ setzten.
Ich bekomme sogar eine Brautkrone von anno 1765 in die Hand, mit grüner Seide umsponnenen, blütenbildenden Draht. Eine Tabakdose aus Achat darf ich betasten. Die gütige Besitzerin all dieser Schätze langt kleine Familienporträts von den Wänden, Frauenköpfe in gelocktem, leichtgepudertem Haar und zartfarbigem Schleiertuch, Herren in Perücke und dunkelblauem Frack. Und dann erzählt sie von der Berliner Putzstube, der schöneren Vorgängerin all der ›guten Stuben‹ mit Mahagonimöbeln und der blauen und roten Salons, die wir bei unseren Großeltern gekannt haben, von der Putzstube, die ein verschlossenes Heiligtum war, das die Kinder nur zu besondern Gelegenheiten betreten durften. Wir schlagen eines ihrer Lieblingsbücher, die Jugenderinnerungen eines alten Berliners von Felix Eberty, auf und lesen: »Die Wände waren hellgrau gestrichen, Tapeten kamen nur bei den reichsten Leuten vor. Auf die Wand hatte Wilhelm Schadow, der nachherige Direktor der Düsseldorfer Akademie und meines Vaters Jugendfreund, demselben als Hochzeitsgeschenk die vier Jahreszeiten grau in grau und mit weißen Lichtern gehöht schön und plastisch gemalt, so daß es ein Relief zu sein schien. Ein herrlicher Teppich, Erdbeerblätter, Blüten und Früchte zeigend, bedeckte den Fußboden, die Möbel waren sehr zierlich aus weißem Birkenmaserholz gefertigt. Ein kleiner Kronleuchter zu vier Lichtern, an Glasketten hängend, schien uns überaus prächtig und ein unnahbares Kunstwerk zu sein, das wir gar zu gern mit den Händen berührt hätten, wenn es nicht aufs strengste verboten gewesen wäre; denn die Möglichkeit, diese Begierde zu befriedigen, war vorhanden, weil die Zimmerhöhe gestattet hätte, mittels eines Stuhls die glänzenden Glasstückchen zu erreichen.«
Wir sprechen von noch älteren Berliner Interieurs. Sie hat Bilder von Zimmern, in denen die mit Tapisseriearbeit überzogenen L’Hombre-Tische standen, die ausgenähten Fauteuils, die Servanten mit den schönbemalten Porzellantassen, auf der Kommode englische Repetieruhren, in der Ecke ›wohlkonditionierte‹ lackierte Flügel der friderizianischen Zeit. Sie weiß von den hohen Betten, zu denen mehrstufige Tritte führten, von Himmelbetten à la duchesse und denen à tombeau, vom Bettzopf, Nachthabit und Nachthandschuhen, von Tapeten en hautelisse mit Personnagen nach französischen Dessins. Immer mehr Besitz kramt sie heraus, Daguerreotypien, ausgetuschte Kupferstiche, ausgeschnittene, aufgeklebte und mit Lackfirnis überzogene Figuren …
ETWAS VON DER ARBEIT
Sicherlich ist in andern Städten der Lebensgenuß, das Vergnügen, die Zerstreuung bemerkenswerter. Dort verstehn es vielleicht die Leute, sich sowohl ursprünglicher als auch gepflegter zu unterhalten. Ihre Freuden sind sichtbarer und schöner. Dafür hat aber Berlin seine besondere und sichtbare Schönheit, wenn und wo es arbeitet. In seinen Tempeln der Maschine muß man es aufsuchen, in seinen Kirchen der Präzision. Es gibt kein schöneres Gebäude als die monumentale Halle aus Glas und Eisenbeton, die Peter Behrens für die Turbinenfabrik in der Huttenstraße geschaffen hat. Und von keiner Domempore gibt es ein eindrucksvolleres Bild als, was man von der Randgalerie dieser Halle sieht, in der Augenhöhe des Mannes, dessen Luftsitz mit Kranen wandert, welche schwere Eisenlasten packen und transportieren. Auch ehe man versteht, in welcher Art die metallenen Ungeheuer, die da unten lagern, zur Bereitung ähnlicher und andersartiger Ungeheuer dienen, ist man von ihrem bloßen Anblick ergriffen: Gußstücke und Gehäuse, noch unbearbeitete Zahnkranztrommeln und Radwellen, Pumpen und Generatoren halb vollendet, Bohrwerke und Zahnradbetriebe fertig zum Einbau, riesige und zwergige Maschinen auf dem Prüfstand, Teile von Turbogeneratoren in der betonierten Schleudergrube.
Während wir in dieser Halle mehr bestaunen als begreifen, wird uns in den kleineren Werkstätten manches zugänglicher. Wir sehen, wie Nickelstahl in Stangenform auf der Schaufel gefräst und geschliffen wird, wie in die Rinnen der Induktorwelle blecherne Zähne eingeschoben werden, wie die gewickelten Erregerspulen zwischen das Zahnwerk greifen. Wir besuchen die Schmiede, wo die Arbeiter glühende Eisenstücke unter den Dampfhammer halten, der sie kerbt und hobelt wie weiches Wachs.
Wir stehn am Wasser vor der Transformatorenfabrik und sehen, wie Kohle aus dem Spreekahn mit der Laufkatze herübergekrant wird in eine Art Eisenhammer, um dort ganz ohne Menschenhand in Kohlenstaub verwandelt zu werden. Wir treten in die Halle, in der niemand zugegen ist, und sehn die Verbrennung in glühender Grotte. Nach den Räumen mit den großen Maschinen besuchen wir Säle, wo Arbeiterinnen ganz dünnen Draht spulen, Hartpapier walzen und zu Schichten ganz leichter harter glatter Rollen pressen, wo von Hand zu Hand das schmale Stanzplättchen wandert, das geglüht, geölt, geschnitten wird.
In der Zählerfabrik macht ein Griff der Maschine aus der Blechplatte eine Schüssel mit hochgebogenem Rand, ein zweiter durchlocht sie. Funkensprühend wird sie genietet und geschweißt. Magnete werden eingefügt. Das ganze Haus ist eine Kette der Arbeit, die ununterbrochen die Werkbänke hin von Stockwerk zu Stockwerk wandert und in weitertragende Schachte geschoben wird. Alle Teile und Teilchen, die den sitzenden Frauen zur Hand liegen, werden dem werdenden Zähler eingefügt, angesetzt, eingeschraubt und geprüft; und zuletzt wird das ganze Zählergebäude verpackt. Stahlbänder schieben sich um Kisten, die auf Rollen zum Fahrstuhl gefördert und auch dort nicht von Menschenhand, sondern mittels eines Hebels angehoben werden. Alle Kraftvergeudung und schwächende Anstrengung wird erspart; immer mehr wird der Arbeiter nur noch Wächter und Anlasser der Maschine. Und wie die Maschinenteile, so wandern auf laufendem Bande auch Tassen und Becher, in welche die Mädchen ihren Tee, Kaffee und Kakao getan haben, und der kommt dann von seinem Rundgang durch die Küche gekocht und fertig zu ihnen zurück. Jede, die da sitzt, hat hinter dem laufenden Band nur ein kleines Stückchen Tisch für sich, und doch ist Platz genug, daß die Nachbarinnen der, die heute Geburtstag hat, ein paar bunte Tassen, Teller und Löffelchen aufschichten konnten, die hinter dem Wanderwerk rührend stillstehn.
Es ist nicht nötig, alles zu verstehn, man braucht nur mit Augen anzuschauen, wie da etwas immerzu unterwegs ist und sich wandelt. Da ist in einer dieser Stätten andächtigen Eifers ein Metall, von dem man dir erzählt, daß es einen besonders hohen Schmelzpunkt hat und sehr schwer verdampft. In Öfen kann’s nicht geschmolzen werden, die würden in Stücke gehn, darum muß das aus dem Mineral gewonnene Metallpulver durch Pressen, Sintern, Hämmern und wieder Glühen allmählich zum festen Stab und weiter zum Draht geformt werden. Und nun kannst du sehn, wie der Draht durch Hämmermaschinen und durch Ziehsteine geht, an den Enden gespitzt und solange geglüht und gezogen wird, bis er zum haarfeinen Fädchen geworden ist, das in der Glühlampe gebraucht wird. All das machen die Maschinen, die Menschen stellen nur an, nehmen heraus, schieben weiter. Und während tausend solcher dünnen und immer dünneren Drähte entstehn, wachsen in andern Sälen tausend Lampenkörper. An runden Maschinentischen, die vor ihren Händen sich drehn, sitzen die Geduldigen, reichen den Griffen zu und nehmen ihnen ab, und gehorsam quetscht die Maschine den Lampenfuß, setzt Halter ein, bespannt das Gestell, schmelzt, pumpt aus, sockelt, lötet, ätzt, stempelt und verpackt. Aber das ist wieder nur ein Teil der Arbeit. Da wird noch geprüft, gemessen und sortiert, da wird mattiert und gefärbt.
All das geschieht unablässig in Siemensstadt, Charlottenburg, Moabit, Gesundbrunnen, hinter der Warschauer Brücke und an der Oberspree.
Und so großartig es ist, im Saal, von der Treppe, von der Galerie auf die kreisenden und surrenden Maschinen zu sehn, so ergreifend ist der Anblick der Nacken und Hände derer, die da werkeln, und die Begegnung des Auges mit ihren aufschauenden Augen.
Aus dem, was diese Menschen schaffen, kommt Licht in dein kleines Zimmer und wandert Häuserfronten entlang, bestrahlt, preist an, wirbt und baut um. Leuchtende Kannelüren an der Decke eines Riesenraums bilden ein festliches Zeltdach von Licht. Konturenbeleuchtung gliedert die Fassade eines Hauses, Flutlicht durchblutet Schaufenster, blaue Taglichtlampen strahlen im Seidensaal, und der Stoff, den der Verkäufer vorlegt, hat die Farbe, die ihm sonst die Sonne gibt. Draußen gehn Wanderschriften über Transparente, Buchstaben formen sich zu Worten und verschwinden, Bilder tauchen auf und wechseln, farbige Räder rollen stumm.
Ganze Häuser entstehen bereits in Hinblick auf die Gliederung des Baukörpers durch das Licht. Man ahnt das Kaufhaus der Zukunft, dessen Wand und Decke Glas sein wird und das Ganze eine Helle, tags die überall hindringende Sonne, nachts das von Menschen und Maschinen geschaffene Licht.
Daran arbeiten die in den großen Hallen des Eisens und der Elektrizität; um den Fleiß von Berlin zu begreifen, mußt du aber auch durch die kleinen Fabriken gehn. Mußt eintreten in einen der Gebäudekomplexe und Höfe des Südostens. Besuche, wie ich es tat, im Viertel der Leder- und Galanteriewarenbranche, die Rahmenfabrik. Auf den Böden lagert das Holz, wie es aus der Sägerei kommt, und trocknet bei leichtem Durchzug. Wird es dann zugeschnitten, behält jede Scheibe noch am Rand ein Stückchen Wald. So kommt sie in eine Kerbmaschine mit feinen Zähnen, die Ecken einbeißen zum Verzahnen der Rahmenteile, und durch die Exhaustoren fliegen die Späne. Mit der Kreissäge werden die langen Leisten verkleinert. Wenn in den großen Maschinenhallen die Männer klein neben Kolossen erscheinen und wie Seeleute oder Bergleute vorsichtig am Rand der elementaren Gewalten bleiben, so beherrschen sie hier ihr Maschinentier mit Bändigerblicken. Ich muß immer wieder den Buckligen ansehn dort an der Kreissäge, dessen Backenmuskeln zornig und herrisch zucken, so oft auf seinen Druck das Messer ins Holz greift.
Bei den siedenden Leimtöpfen und bei Glas und Pappe, die den Rahmen eingefügt werden, hausen viel Mädchen und Frauen. Die Leimerinnen sind ein derberer Schlag als die Kleberinnen und Poliererinnen. Und an diesen könnte man Studien machen über die Beziehungen zwischen dem einen Handgriff, der zu vollführen ist, und der Hand, die ihn vollführt. Wie feine Finger hat die, welche immer nur winzige Nägelchen in die Pappschicht hinterm Rahmen einsetzt. Wie geduldig sind die langen Hände jener, die Bilderränder so beschneidet, daß sie gut hinter das Glas passen. Wie kindlich rund sind die Händchen der Blaßblonden, die eine Blechform in die kreidige Masse drückt und das Geformte angefeuchtet aufs Holzbrett abstreift, wie es Kinder mit ihren Sandformen auf dem Spielplatz tun. Ihre Arbeit ist ein sympathisches Sonderwerk, denn die Rokoko-Ornamente, die sie dem Rahmen gibt, werden nicht soviel gebraucht wie die gradlinigeren, sie sind teurer herzustellen und nicht so zeitgemäß. Das gibt ihnen und ihrer ahnungslosen Schöpferin eine besondre Schönheit. In abgetrennten Räumen arbeiten die Vergolder. Sie haben Gasmasken vor dem Gesicht gegen den Bronzestaub, der den Lungen gefährlich ist. Leider will das Publikum und wollen dementsprechend die vielen kleinen Geschäfte, die Öldrucke verkaufen, nur Goldrahmen. Seit den Tagen der Inflation braucht der Deutsche wieder Glanz in seiner Hütte. Selbst die Rahmen für Photographien müssen vergoldet werden. Das gute alte Mahagoni ist nicht mehr erwünscht. Über die Photographienrahmen bekomme ich noch etwas zeitgeschichtlich Interessantes erzählt. Früher waren Sammelrahmen beliebt, in die mehrere Bilder gingen, eine ganze Sippe etwa, jetzt wird jedes Bild lieber einzeln aufgestellt. So sind wir von den Rahmen zu dem Umrahmten gekommen: der liebenswürdige Leiter der Fabrik führt mich in den Ausstellungsraum der beliebtesten Öldrucke. Der ist sehr lehrreich. Denn unter den nicht gerade lebensnotwendigen Gegenständen, die man je nachdem als Luxusartikel oder geistiges Volksnahrungsmittel bezeichnen kann, spielt der Öldruck eine große Rolle. Er möbliert unendliche Mengen von Zimmern und Seelen.
Der ›bestseller‹ der Branche ist seit Jahren immer noch die heilige Büßerin Magdalena, die in ihrem blauen Gewande weich aufgestützt lagert und buhlerisch kontemplativ auf den Totenschädel schaut. Nicht nur bei den Frommen scheint sie begehrt zu sein wie andre Reproduktionen aus dem Bereich der Bibel und Legende, auch die Kinder der Welt wollen sie haben. Lagernde leichtbekleidete Damen haben überhaupt viel Chance. Und als Rahmen ihres von Amoretten umspielten, ins Wolkenweiche verschwimmenden ›Pfühls‹ ist ein nicht hohes, aber ziemlich breites Format beliebt, das sich gut überm Bett ausnimmt. Haben junge Paare, die solche Glückseligkeits-Öldrucke kaufen, es ernstlich auf Nachkommenschaft abgesehn, so richtet die Schöne im Bilde sich ein wenig auf und betreut ein oder mehrere Kinder. Es wird auch gern gesehn, daß etliche Haustiere das Familienglück noch vollständiger machen. An einer der beliebtesten dieser lagernden, beziehungsweise sitzenden Damen wurde kürzlich, wie mir mein erfahrener Führer erzählt, auf Wunsch des Publikums eine zeitgemäße Änderung vorgenommen, ihr reiches Lockenhaar mußte zugunsten des Bubikopfs entfernt werden. Auf andern Gebieten bleiben die Käufer unmodern: das allbekannte Bild ›Beethoven‹, eine Versammlung auf dämmernden Diwanen hockender oder hingegossener Männer und Frauen, die einem Klavier lauschen, hat noch keiner Jazzbanddarstellung Platz gemacht. Von berühmten Männern hat der Reichspräsident nicht mehr soviel Zuspruch, seit er in Zivil ist; und mit seinen Waffenrockbildnissen hat sich die deutsche Familie meist schon während des Krieges eingedeckt.
Die Jahreszeiten mit ihren beliebten Arbeiten und Vergnügungen: Säemänner, Garbenbinderinnen, Jäger usw. in der dazugehörigen Landschaft ›gehen‹ immer, und zwar jede speziell zu ihrer Zeit. Das wunderte mich etwas, ich hatte gedacht: im Winter hätte man Frühlingssehnsucht, im Herbst Sommerheimweh.
Ich fange an, mich für Statistik zu interessieren. Ich möchte genauer feststellen: Wieviel Magdalenen braucht Magdeburg? Wieviel Damen auf Pfühl verlangt Breslau? Wo läuft der Alte Fritz Böcklins ›Schweigen im Walde‹ den Rang ab? Wie hat sich in München von 1918 bis 1928 der Öldruckgeschmack geändert? In welchen Provinzen und Städten überwiegt das Bedürfnis nach Dame mit Kind, Kindern oder Tieren dasjenige nach Dame mit nur Amoretten? Ich fange an, mich für Statistik zu interessieren.
* * *
Wie der Markt von Bagdad seine Basare, so hat Berlin seine Stadtviertel für die verschiedenen Betriebe. Der Spittelmarkt, sagt man mir, trenne das Quartier der Konfektion von dem der Mäntel. Ich besuche auf der Konfektionsseite eine Hutfabrik, werde zu den Zeichnern geführt, die nach Pariser Modellen aus Pappe Formen schneiden, zu den Mädchen, die diese Formen in Stoff und Leder nachschneiden, in den surrenden Saal der Näherinnen und schließlich in einen Raum, wo Eisenformen elektrisch erhitzt werden. Auf ihnen erhält der fertiggenähte und zurechtgebogene Hut seine endgültige Gestalt. Aus einem Schlauch wird er mit Dämpfen behandelt und dann in eine Art Backofen getan, wo er im stillen weiterschmort. Für den Kulturhistoriker ist es nicht unwichtig zu erfahren, daß es zwar fast gar keine Garnituren mehr gibt, daß aber die Appretur bisweilen Schleifenformen und Bandeaux nachahmt. Vielleicht auch, daß, seit die Mode der knappen Baskenmützen aufgekommen ist, viel Kappen gemacht werden, die aber nicht baskisch streng bleiben, sondern etwas breiter und pagenhafter ausfallen. In dieser Fabrik, die den morgens bestellten Hut bereits abends liefert, entsteht fast alles ganz im Hause vom Zeichentisch bis zur Verpackung. Nur ein kleiner Teil der Hüte wird aus den sogenannten Betriebswerkstätten bezogen, welche Heimarbeiterinnen beschäftigen. Man belehrt mich über die große Rolle, die sonst in der Berliner Konfektion diese Art Arbeitsteilung spielt, bei der der ›Zwischenmeister‹ von den großen Firmen nach Musterung der Kollektionen die Stoffe übernimmt und teils in seinen eigenen Räumen bearbeiten läßt, teils an Heimarbeiterinnen weitergibt. Solche Zwischenmeister arbeiten zum Beispiel für die große Schürzenfabrik, die ich in einem der Riesenhöfe der Köpenickerstraße besuche. Die hat im Vogtland ihr eigenes Haus, wo der Stoff hergestellt wird. Hier kommt er dann in Maschinen, die viele Lagen auf einmal zerschneiden, in fleißige Hände, die jede von ihrer kleinen Maschine mit einem Griff Hohlsaum oder drei Falten oder Saumspitzen machen und Knöpfe annähen lassen, welche fester sitzen als die von Menschenhand. In diesem Betriebe darf ich auch in die Büroräume eintreten und die neuen Verbesserungen des kaufmännischen Ressorts kennen lernen. Da sehe ich Rechenmaschinen, die multiplizieren, Markenkleb- und Aufdruckmaschinen, neuartige Kartotheken und an der Wand Karten mit den Wanderplänen der Reisenden, auf die unten in der Garage die Musterkoffer zu zwanzig und zwanzig in großen Autos warten.
Ein ganzes Studium wäre die Basareinteilung von Berlin. Es gibt da, abgesehen von den großen Quartiers der Tischlerei und Metallbearbeitung, der Hausindustrie, der Wollwaren, der Konfektion noch besondere Spezialitäten, zum Bespiel eine Straße, in der seit vielen Jahrzehnten Beleuchtungskörper hergestellt werden, die Ritterstraße. Am Moritzplatz ist das internationale Exportlager gewisser Artikel, die aus dem Erzgebirge, Thüringen und Nordböhmen kommen, wie Schaukelpferde, Teepuppen, Frisierkämme, Jesusfiguren, Zinnsoldaten und Gummikavaliere. Die ganze Seydelstraße entlang stehen gespensterhaft in den Schaufenstern die Puppen der Büsten- und Wachskopffabriken, die Attrappen und ›Stilfiguren‹ der ›Schaufensterkunst‹, die in Tausenden von Exemplaren durch ganz Deutschland und weiter wandern, um Hemden, Kleider, Mäntel und Hüte zu tragen. Interessant, was für Gesichter die wachsköpfigen Mannequins schneiden! Mit spitzen Mündern fordern sie dich heraus, schmale Augen ziehen sie, aus denen der Blick wie Gift tropft. Ihre Wangen sind nicht Milch und Blut, sondern fahles Gelbgrau mit grüngoldenen Schatten. Kein Wasserstoffsuperoxyd kann ein so böses Blond hervorrufen, wie die Tönungen ihres Haars es haben. Oft sind die Gesichter nur skizzenhaft modelliert und die angedeuteten Mienen sind dann von besondrer Verderbtheit. Sowohl in der Steife wie in der sportlichen Elastizität ihrer Bewegungen ist eine kühle Mischung von Frechheit und Distinktion, der du Armer nicht wirst widerstehen können. Aufregend sind die Grade ihrer Entblößung. Ganz goldnackte strotzen und silberne blinken, die nichts anhaben als bräunliche Schuhe; freibusige behalten, sich dir zu entziehen, eine Art Leibschurz und Strümpfe an. Bemerkenswert sind auch die Männerköpfe, auffallend die vielen Männer der Tat mit dezidiertem Ausdruck und winzigen Klebeschnurrbärtchen. Soweit sie Leiber haben und nicht nur ein Gliederpuppengestell, müssen sie sie in schwarzen Trikots verbergen, es sei denn, daß sie sich ganz bekleidet im Frack und Smoking zwischen den nackten Damen bewegen und dabei noch über Kinder hinwegschauen, die in blauen Kleidchen und roten Flatterkrawatten uns etwas vortummeln.
VON DER MODE
In den Zeitungen stehn Annoncen ›Ein Riesenposten entzückender Abendkleidchen in allen Modefarben‹ oder ›Meine spottbilligen Ausverkäufe in pelzbesetzten Mänteln‹, dazu Name und Adresse der Firma irgendwo im Osten. Sind wir neugierig, dort hinzugehn (wir: das ist die Frau, die mir dies erzählt), so kommen wir in Magazine, die auf elende Höfe hinausgehn und deren Aufmachung auf allen Glanz verzichtet. Wir befinden uns in einer Atmosphäre, die dem Kauf und Verkauf in ähnlicher Weise günstig ist wie die der Pariser Warenhäuser. Zwar hat kein Chef oder Rayonchef die Kenntnis des Frauenherzens, die dem Pariser eingibt, der Zögernden ein freundliches ›fouillez, Madame‹ zuzurufen, aber auch hier gilt das Prinzip, erst einmal die Schleusen der unkontrollierten Berührung zu öffnen, bis sie zum Begehren wird, das alle Dämme der Vernunft sprengt und überfließend die Kasse füllt. Deutlich mit Preisen gezeichnet, hängen zerdrückte Spitzenkleider, flitterbestickte Musseline, schäbige Samtcapes mit undefinierbaren Pelzkragen, elende, billige Pracht. Blumen drängen sich in Kartons, auf Tabletts Schmuckstücke, deren Vorteil es ist, Schäden zu haben, die fast gar nicht sichtbar sind. In hohen Stapeln, anheimelnd durcheinandergezerrt, liegt rosa und violette Wäsche, reich mit Spitzen garniert, die aus der Ferne luxuriös wirkt, daneben stehn Abendschuhe mit Schnallen aus Diamanten und Smaragden. Das Publikum dieser Basare der Restbestände oder Konkursverkäufe besteht durchaus nicht nur aus freiwillig oder berufsmäßig ›Koketten‹. Es gibt nämlich zwischen dem falschen Glanz auch vernünftige Artikel, grobe Bettücher und derbe Lederstiefel, Bettvorleger und Stores, deren Preise, wenn auch nicht herabgesetzt, so doch nicht zu unterbieten sind. Der Name dieser Häuser ist auch im Westen Berlins bekannt. Es geht von ihnen der Reiz des Zufälligen, der Gelegenheit aus, auf den die Frauen reagieren, der sie neugierig und gespannt macht, auch wenn es sich um nichts andres handelt, als ein halbes Dutzend Taschentücher einzukaufen oder ein Paar warme Handschuhe. Ja, sonst gibt es in diesen Straßen auch recht langweilige Geschäfte mit leblosen Auslagen, die nichts weiter suggerieren als einen Austausch von Ware und Geld. Wir werden erst wieder wach vor der strahlenden Helle des Riesenkomplexes Warenhaus. Ist es auch nicht so gedrängt, so nachlässig künstlerisch, so listig üppig hier wie an dem Ort, den wir verlassen haben, so genießen wir doch vor diesem geordneten Reichtum an Waren aller Art die Vielfalt, vor der unsere Bedürfnisse, die uns eben noch so erheblich erschienen, plötzlich Liliputmaß annehmen. Aber uns kann geholfen werden. Die Verkäufer und Verkäuferinnen haben den ›Dienst am Kunden‹ von Grund auf studiert. Die großen Kaufhausfirmen haben Schulen ins Leben gerufen, in denen Lehrer, die an Handelshochschulen vorgebildet sind, den jungen Mädchen Anschauungsunterricht über die Behandlung der Ware und der Kunden geben. Wir ahnen gar nicht, was für geschulten Künstlerinnen des Verkaufs und der richtigen Suggestion wir gegenüberstehn, wenn uns die kleinen Fräulein von Wertheim und Tietz sanft in ihren Bannkreis ziehn.
Berlins große Warenhäuser sind nicht verwirrende Basare bedrängender Überfülle, sondern übersichtliche Schauplätze großer Organisation. Und sie verwöhnen ihre Besucher durch das hohe Niveau ihres Komforts. Kauft man vom kreisenden Ständer aus blitzendem Messing einen Meter rosa Gummiband, so darf der Blick, während unsere Ware auf Blocks eingetragen wird, auf Marmor ruhn, an Spiegeln entlang und über glänzendes Parkett gleiten. In Lichthöfen und Wintergärten sitzen wir auf Granitbänken, unsere Päckchen im Schoß. Kunstausstellungen, die in Erfrischungsräume übergehn, unterbrechen die Lager der Spielwaren und Badeausstattungen. Zwischen dekorativen Baldachinen aus Samt und Seide wandern wir zu Seifen und Zahnbürsten. Merkwürdig, wie wenig in diesen der großen Masse gewidmeten Kaufhäusern dem Bedürfnis nach Kitsch Rechnung getragen wird. Die Mehrzahl der angebotenen Dinge ist fast nüchtern. ›Anständig‹ ist das Adjektiv, dem der Geschmack nicht widerstehn kann. Nur in Handarbeitslagern und bei Galanteriewaren häufen sich die bedenklicheren Einfälle. In den Lagern der Konfektion sieht man nur Gediegenes, Unauffälliges, das sich der Mode mit einem gewissen Zaudern und Widerstreben annähert und sie eher zu vertuschen sucht, als daß es ihr entgegenkommt. Ein wenig leer ist es in dieser Gegend, es ist, als fehle ein vermittelndes Element. Da wirken die Stapel der Kochtöpfe und Backformen, der Gardinenringe und Frühstückservice erheblich bunter und munterer.
Nah beim Quartier der Konfektion liegt an drei Straßenfronten eins der berühmtesten Modehäuser von Berlin. Seine Modelle ziehen das große Publikum an. Aus allen – außer den exklusivsten – Kreisen, die sich für Mode interessieren, sitzen Damen an zart gedeckten Tischen, an denen die hübschen Mannequins sich entlang schlängeln. Bei den Klängen einer Kapelle schreiten sie in duftigen und feierlichen Kleidchen und lächeln von Beruf und damit man sie von den Damen unterscheide, die verspätet ankommen oder verfrüht weggehn.
Dies Haus mit seiner nicht unberechtigten Prätention ist der hinausgeschobene Vorposten der Mode, deren Gebiet eigentlich erst anfängt, wo das Zentrum und der alte Westen sich berühren. In Leipziger- und Friedrichstraße gehören ihr schon viele Auslagen, oft Haus an Haus. Aber erst wenn man die Fronten des Warenhauses von Wertheim und die Blocks der Hotels beim Potsdamer Platz hinter sich gelassen hat und in die Bellevue- oder Friedrich Ebertstraße einbiegt, nähert man sich dem Hauptquartier in der Lennéstraße am Saum des Tiergartens. Die Mode wohnt – im Gartenhaus.
Da flimmern durch das Grün der Vorgärten die Goldlettern der Namen, die Geschmack bedeuten. Da sieht man in den späteren Vormittagstunden und am frühen Nachmittag Reihen von Autos, sehr gepflegten, sehr ›rassigen‹, aus den Katalogen der Autofirmen herausgerollt in ihrer funkelnagelneuen Tadellosigkeit. Ernste Chauffeure erwarten die ›gnädige Frau‹. Von den Verkäuferinnen wird sie so devot empfangen, als wären die Wellen der absoluten Monarchie noch nicht verebbt. An Rokokosesseln vorbei wird sie über geblümte Teppiche in den Salon geleitet, der Chef eilt herbei, der ›small talk