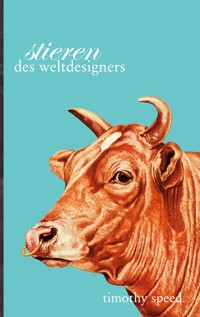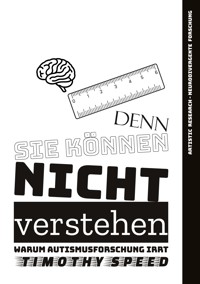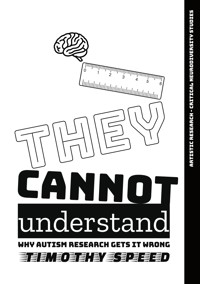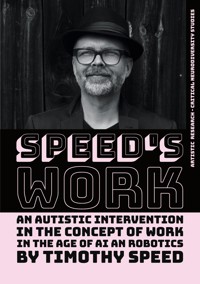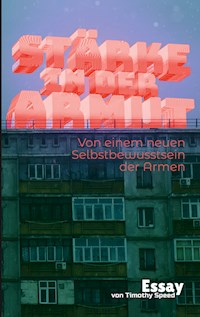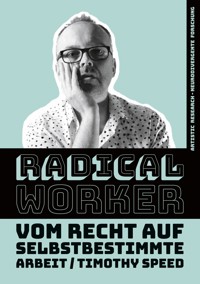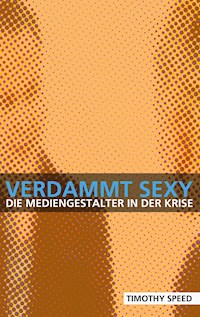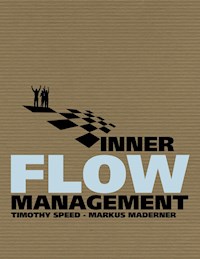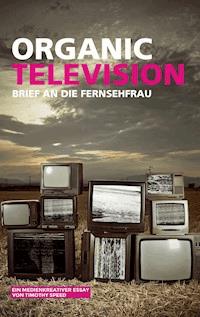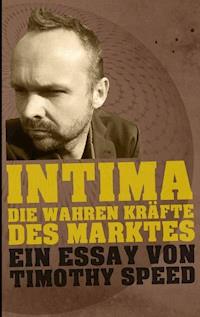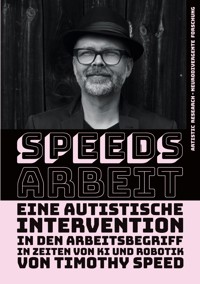
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: BoD - Books on Demand
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
In »Speeds Arbeit« entfaltet sich eine der bedeutendsten und radikalsten Auseinandersetzungen mit dem modernen Arbeitsbegriff und den damit verbundenen gesellschaftlichen Werten. Timothy Speed, autistischer Künstler, Arbeitsforscher und Menschenrechtsaktivist, der 20 Jahre fast unbezahlt arbeitete, führt über mehr als ein Jahrzehnt einen dramatischen Konflikt mit dem deutschen Staat, der weit über die Frage hinausgeht, was Arbeit in der kapitalistischen Gesellschaft wert ist. In einer Zeit, in der Kreativität, Care-Arbeit und künstlerisches Engagement systematisch entwertet und durch ökonomische Kriterien ersetzt werden, verteidigt Speed seine Arbeit als fundamental wertvollen Beitrag zur Gesellschaft, obwohl er wie rund 80 % der Autist:innen und viele Kulturschaffende mit seinem Handeln keinen Cent verdient. Somit zeigt seine Arbeit die Realitäten vieler marginalisierter Gruppen auf. Während der Staat Speed aufgrund seiner Weigerung, und seiner Schwierigkeiten sich als Autist mit ADHS der falschen Logik des kapitalistischen Marktes unterzuordnen, in die Armut treibt und verfolgt, deckt er mithilfe der für Autisten typischen hohen Mustererkennungsfähigkeit tiefgreifende Missstände in Behörden und Konzernen auf. Mit seinem unermüdlichen Einsatz und seinem Beharren auf der Bedeutung von Selbstbestimmung und sozialer Gerechtigkeit enthüllt er Skandale bei Gerichten, der Staatsanwaltschaft und bei unzähligen Behörden und Konzernen. Mit dem Konzept des »arbeitsintegrierten Beziehungshandelns« fordert er eine neue Definition von Arbeit - eine, die human, kreativ und engagiert ist, und die den sozialen Wert vor den ökonomischen Nutzen stellt. In einer Welt, die durch Robotik und Künstliche Intelligenz zunehmend maschineller wird, zeigt Speed, dass der Widerstand gegen das maschinenhafte Funktionieren in den Jobs nicht nur notwendig, sondern essenziell ist, um das menschliche Potenzial und die soziale Verantwortung zu bewahren.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 884
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
INHALT:
In »Speeds Arbeit« entfaltet sich eine der bedeutendsten und radikalsten Auseinandersetzungen mit dem modernen Arbeitsbegriff und den damit verbundenen gesellschaftlichen Werten. Timothy Speed, autistischer Künstler, Arbeitsforscher und Menschenrechtsaktivist, der 27 Jahre fast unbezahlt arbeitete, führt über mehr als ein Jahrzehnt einen dramatischen Konflikt mit dem deutschen Staat, der weit über die Frage hinausgeht, was Arbeit in der kapitalistischen Gesellschaft wert ist. In einer Zeit, in der Kreativität, Care-Arbeit und künstlerisches Engagement systematisch entwertet und durch ökonomische Kriterien ersetzt werden, verteidigt Speed seine Arbeit als fundamental wertvollen Beitrag zur Gesellschaft, obwohl er wie rund 80 % der Autist:innen und viele Kulturschaffende mit seinem Handeln keinen Cent verdient. Somit zeigt seine Arbeit die Realitäten vieler marginalisierter Gruppen auf.
Während der Staat Speed aufgrund seiner Weigerung, und seiner Schwierigkeiten sich als Autist mit ADHS der falschen Logik des kapitalistischen Marktes unterzuordnen, in die Armut treibt und verfolgt, deckt er mithilfe der für Autisten typischen hohen Mustererkennungsfähigkeit tiefgreifende Missstände in Behörden und Konzernen auf. Mit seinem unermüdlichen Einsatz und seinem Beharren auf der Bedeutung von Selbstbestimmung und sozialer Gerechtigkeit enthüllt er Skandale bei Gerichten, der Staatsanwaltschaft und bei unzähligen Behörden und Konzernen.
Mit dem Konzept des »arbeitsintegrierten Beziehungshandelns« fordert er eine neue Definition von Arbeit – eine, die human, kreativ und engagiert ist, und die den sozialen Wert vor den ökonomischen Nutzen stellt. In einer Welt, die durch Robotik und Künstliche Intelligenz zunehmend maschineller wird, zeigt Speed, dass der Widerstand gegen das maschinenhafte Funktionieren in den Jobs nicht nur notwendig, sondern essenziell ist, um das menschliche Potenzial und die soziale Verantwortung zu bewahren.
Sein Buch ist mehr als eine autobiografische Reflexion – es ist ein Manifest für soziale Gerechtigkeit, eine Anklage gegen die kapitalistische Entmenschlichung und ein Fahrplan für eine neue, selbstbestimmte Arbeitswelt. Speed fordert, dass Arbeit im 21. Jahrhundert nicht nur darauf abzielen darf, produktiv zu sein, sondern das gesamte soziale Ökosystem erhalten und fördern muss. Besonders in Zeiten von KI und Automatisierung. Speed legt dar, wie wichtig es ist, den Wert von Care-Arbeit und künstlerischem Handeln zu verteidigen und neu zu definieren.
Dieses Buch ist ein Muss für jeden, der verstehen möchte, wie Arbeit, Individuum und Gesellschaft auf tiefgreifende Weise miteinander verwoben sind, wie rassistisch der Kapitalismus tatsächlich ist – und wie die Transformation unserer Arbeitshaltung viele der drängendsten Probleme unserer Zeit lösen könnte.
INHALT
EINE EINORDNUNG VON SPEEDS ARBEIT
AUS DEM ERLEBEN EINES AUTISTEN
Das MNO-Modell und die Frage der Freiheit als Notwendigkeit der Arbeit
EINE UNTERSUCHUNG DER ARBEIT
Warum handeln wir nicht, sondern arbeiten nur?
EINE ZEHNJÄHRIGE UNTERSUCHUNG VON WERT, ARMUTSERFAHRUNG UND ARBEIT IN DER DEUTSCHEN GESELLSCHAFT
»Speeds Arbeit« und die Schaffung einer Alternative
Garantenpflicht. Wer ist für die Armut verantwortlich?
Krisenexperimente – Meine Bewerbung als Intendant des ZDF.
Die Frage der Erkrankung
DIE DOKUMENTATION STAATLICHER GEWALT IN DEUTSCHLAND, ALS AUSGANGSPUNKT EINES ANDEREN ARBEITSBEGRIFFS
Gewaltakt 1: Die Begegnung mit Herrn G. Die Verweigerung der Eingliederung.
Gewaltakt 2: Herr H und das bedingungslose Grundeinkommen
MEINE BEGEGNUNG MIT MARGARET THATCHER
KLASSISMUS UND DIE KATEGORISIERUNGSLÜGE
Gewaltakt 3: Der Schmerz der Väter
ARTISTIC RESEARCH – VOM ANDEREN ANSATZ DER FORSCHUNG
Die Abweichung des Einzelnen ist der Schlüssel zur Interaktion.
Das Selbstbestimmte ist auch das sozial Gerechte.
ERINNERUNG FÜR DIE LESER:IN BEZÜGLICH DER FORM AUTISTISCHER FORSCHUNG
ESKALIERENDE GEWALT GEGEN NEURODIVERGENTE, KÜNSTLER:INNEN UND MINDERHEITEN
Gewaltakt 4: Razzien, Sippenhaft, der Tod des Privaten und die Logik der Segregation
Gewaltakt 5: Brexit, die ultimative Segregationsfantasie
Gewaltakt 6: Corona und das Vakuum
EINE DEFINITION VON »RECHTSRADIKAL« UND VON ERWEITERTEN RASSISMEN
DER BEGINN DER BEWEISAUFNAHME
Gewaltakt 7: Rechte Gerichte und Waschmaschinen
Gewaltakt 8: Macht kaputt, was euch kaputt macht
Gewaltakt 9: Wir leugnen alles.
DIE SLAPP-KLAGE
Gewaltakt 10: Der Prozess gegen mich und der Begriff des »rechtsradikalen Smalltalks«
Abschließende Gedanken: Was bedeutet all das für den Begriff von Arbeit und Beitrag im Zeitalter von Robotik und KI?
ARTISTIC RESEARCH
Künstlerische Forschung nutzt ästhetische Verfahren – Montage, Performance, Materialexperiment – als eigenständige Erkenntnismethoden. Dabei schließt sich die Künstler:in nicht selbst vom Erkenntnisprozess aus. Wissen entsteht nicht erst in der nachträglichen Interpretation, sondern im Prozess des Gestaltens selbst: Gedanken werden sicht- und hörbar, Hypothesen lassen sich probeweise verkörpern. Statt Daten zu sammeln, erzeugt Artistic Research Situationen, die Theorie und Praxis ineinander falten. So überschreitet sie die klassische Disziplintrennung und macht Phänomene erfahrbar, bevor sie vermessen werden.
Die Inhalte dieses Buches beruhen auf Artistic Research.
NEURODIVERGENTE FORSCHUNG
ist die spezielle Forschungsmethode, die manche Autist:innen anwenden. – Dieser Ansatz bringt Wahrnehmungsprofile hervor, die von der »statistischen Norm« abweichen, aber gerade dadurch neue Muster erkennen lassen. Forschung aus einer neurodivergenten Position nutzt diesen atypischen Filter bewusst als methodischen Vorteil: Hyperfokus ersetzt Großgeräte; Musterempfindlichkeit entdeckt Korrelationen, die im Störrauschen verschwinden. Statt Defizite zu kompensieren, werden idiosynkratische Kognitionen als zusätzliche Messinstrumente begriffen. Das erzeugt unerwartete Fragen, radikale Querverbindungen und verdichtet Disziplinränder zu neuem Terrain.
Dieses Buch ist ein wichtiger Beitrag zu den Critical Autism Studies (CAS), weil hier die besonderen Perspektiven autistischer Forscher:innen Bedeutung bekommen.
RECHTLICHE HINWEISE UND SCHUTZKLAUSEL
Dieses Buch ist ein subjektives, künstlerisch-forschendes Zeitdokument.
Es beruht auf tatsächlichen Erlebnissen, Beobachtungen und Auseinandersetzungen des Autors mit Behörden, Institutionen, öffentlichen Persönlichkeiten und gesellschaftlichen Strukturen. Die Darstellung erfolgt aus der Sicht des Autors, in einer Sprache, die künstlerisch, zugespitzt und politisch intendiert ist.
Namen von Privatpersonen wurden anonymisiert oder durch Initialen ersetzt. Amtsträger und Personen des öffentlichen Lebens werden im Rahmen der verfassungsrechtlich geschützten Kritik an öffentlichem Handeln anonymisiert als Obstsorten benannt. Diese Benennungen beziehen sich ausschließlich auf deren Funktion oder öffentliche Rolle.
Alle Schilderungen erfolgen nach bestem Wissen und Gewissen.
Der Autor macht von seinem Grundrecht auf Meinungsfreiheit (Art. 5 Abs. 1 GG) sowie seinem Recht auf künstlerischen Ausdruck Gebrauch. Bewertungen, Einschätzungen und Deutungen sind als persönliche Meinungsäußerung zu verstehen.
Sollte sich eine Person wiedererkennen und mit der Darstellung nicht einverstanden sein, so wird um direkte Kontaktaufnahme gebeten, um eine Klärung zu ermöglichen.
EINE EINORDNUNG VON SPEEDS ARBEIT
Timothy Speed ist ein Grenzgänger, dessen Arbeit zwischen Begriffen wie Artistic Research, Critical Autism Studies, Care-Ökonomie, Bewusstseinsforschung oder embodied knowledge verortet ist. Mit Speeds Arbeit liefert er erneut einen Beitrag, für den das etablierte Vokabular nicht ausreicht: eine real durchlebte Ökonomie-Kritik, die das System nicht beschreibt, sondern von innen her aufbricht.
Speeds Arbeit ist ein Markstein der Arbeitsdiagnostik im KI-Zeitalter – nicht, weil es sich in bestehenden Kategorien verfängt, sondern weil es deren Grenzen vorführt. Speed zeigt: Unsere Krise ist keine Frage fehlender Jobs oder Kompetenzen, sondern ein Defekt im Wertregime. Eine Gesellschaft, die Sorge-, Kunst- und Beziehungsarbeit aus dem Markt verbannt, zerstört ihre eigene Regenerationsfähigkeit. Seine zentrale Pointe lautet: Arbeit ist Beziehungshandeln, kein Output-Monolog für Bilanzen.
Was das Buch leistet, ist eine radikale Umdrehung der gängigen Meritokratie: Nicht Bezahlung belegt Relevanz – Relevanz entsteht dort, wo Handeln das soziale Ökosystem nährt. Damit demoliert Speed das Credo der »Employability« und der resilienzfähigen Selbstoptimierung. Stattdessen plädiert er für ein Universal Care Income als Vorbedingung souveräner, systemkreativer Tätigkeit.
Der von Speed geprägte Begriff »arbeitsintegriertes Beziehungshandeln« aktualisiert sein älteres Konzept der Systemkreativität. Während Systemrelevanz nur die Wartung des Status quo meint, bezeichnet Beziehungshandeln die Fähigkeit, Wertschöpfung als wechselseitige Fürsorge zu praktizieren – ein Motiv, das in feministischer Care-Theorie auftaucht, hier aber mit neurodivergenter Präzision auf die Spitze getrieben wird. Eine Ökonomie, die diese Qualität verdrängt, erzeugt Überlast, Burn-out und planetaren Raubbau.
Methodisch treibt Speed seine Praxis noch weiter als in »Gesellschaft ohne Vertrauen«: Er lebt die These – als Autist, Aktivist, prekärer Künstler – und zwingt Institutionen, Konzerne und Behörden in reale Konfrontation. Die zehn »Gewaltakte« des Buches sind nicht literarische Kapitelüberschriften, sondern protokollierte Zusammenstöße zwischen maschineller Systemlogik und verkörperter Subjektivität. Damit steht Speed in einer Linie mit Paul B. Preciado oder Adrian Piper, geht aber weiter: Er riskiert die totale ökonomische Entwertung, um den blinden Fleck des Kapitalismus offenzulegen.
Die berühmte Red-Bull-Aktion von 2010 erscheint hier nicht als Anekdote, sondern als frühe Skizze des Prinzips: Den Konzern zur Menschwerdung zwingen, indem man sein Totem (den Stier) semantisch besetzt. In »Speeds Arbeit« wiederholt sich diese Strategie – etwa in der Bewerbung als ZDF-Intendant oder in der Prozessführung gegen staatliche Klassismus-Maschinerien –, dieses Mal aber versehen mit einer systematischen Theorie: der MNO-Logik von Differenz, Dissoziation und Emergenz.
Speed antizipiert damit, was Soziolog:innen wie Isabelle Ferreras heute als Economic Bicameralism diskutieren: Unternehmen müssen demokratisiert werden, wenn sie überleben wollen. Gleichzeitig liefert er eine phänomenologische Tiefenbohrung, die Hartmut Rosas Resonanztheorem konkreter macht: Wo keine Beziehung möglich ist, kollabiert Sinn.
Dass diese Arbeit im praktischen Feld häufig scheitert – Speed wird sanktioniert, psychiatrisiert, verarmt –, ist gerade ihr erkenntnistheoretischer Mehrwert. Speeds Arbeit ist eine dokumentierte Dysfunktion des Systems, ein »Server-Error 500« für den Kapitalismus. Sein Durchhalten belegt die Notwendigkeit einer neuen Wertgrammatik.
Heute, da KI und Robotik die Erwerbslogik weiter aushöhlen, liefert Speed das Manifest hafte Drehbuch für eine Post-Work-Zivilisation: Universal Care Income, subjektzentrierte Wertschöpfung und die Anerkennung neurodivergenter Erkenntnisformen als Innovationsmotor. Was einst wie Provokation wirkte, wird zur Überlebensstrategie.
Dieses Buch ist mehr als autobiografische Protokollierung oder subjektives Zeugnis. Speeds Arbeit ist eine radikal forschende und zugleich empirisch durchdrungene Intervention in die Grundannahmen unseres ökonomischen, politischen und moralischen Arbeitsbegriffs. Was hier vorliegt, ist eine Form verkörperter Forschung, ein lebendiges Dokument systemischer Feldanalyse – zugleich ein künstlerischer wie erkenntnistheoretischer Akt. Diese Arbeit sprengt gängige Kategorisierungen zwischen Wissenschaft, Literatur, Selbstzeugnis und künstlerischem Ausdruck.
Die wissenschaftliche Relevanz ergibt sich dabei nicht trotz, sondern gerade wegen der Perspektive eines neurodivergenten Subjekts. Aus der Position eines autistischen Forschers, dem Arbeit nicht nur Medium, sondern ethischer Prüfstein des Menschlichen ist, wird hier systematisch aufgedeckt, wie der Arbeitsbegriff in neoliberalen Gesellschaften zur strukturellen Gewalt geworden ist – primär gegen jene, die nicht konformistisch verwertbar sind. Die Arbeit vollzieht damit eine radikale Neubesinnung auf die Arbeit als gesellschaftliches Verhältnis, nicht als ökonomische Funktion.
Im Vergleich zu klassischen soziologischen oder ökonomischen Studien zu Prekarisierung, wie in der Arbeitssoziologie (Baumann, Castel, Standing), geht Speeds Arbeit tiefer: Es zeigt nicht nur Wirkungen, sondern macht sichtbar, wie diese Wirkungen zustande kommen – und zwar durch die Einbindung des eigenen Körpers, der eigenen Biografie, der eigenen Verletzbarkeit. Diese Methodik ist eng verwandt mit Positionen der »Critical Disability Studies«, der »Artistic Research« oder dem, was Donna Haraway als situated knowledges bezeichnet.
Speeds Arbeit steht in der Tradition dessen, was Hannah Arendt einmal »Denken ohne Geländer« nannte: Denken ohne institutionelle Absicherung, aber mit scharfem Blick für Widerspruch, für das Banale im Bösen, für den Missbrauch von Sprache und Moral durch verwaltende Systeme. Zugleich verschiebt dieses Buch die Methodologie. Es ist nicht bloß Kritik am System, sondern die Enthüllung des Systems durch die Art, wie es das Subjekt selbst zu verändern versucht – und daran scheitert.
Was hier dokumentiert wird, ist in vielerlei Hinsicht ein künstlerisch-wissenschaftliches Komplement zu den zuvor erschienenen Werken »Die Physik der Armen«, »Gesellschaft ohne Vertrauen« und »Radical Worker«. In allen drei Arbeiten wird der Arbeitsbegriff als ontologische Grundform unserer Gesellschaft betrachtet. Aber in Speeds Arbeit wird das Prinzip Arbeit selbst – nicht mehr nur ihre sozialen Folgen – demontiert, zerlegt, durchlebt und von innen neu konfiguriert. Die hier entwickelte Perspektive geht damit weit über soziologische Statistik, über ökonomische Modelle oder institutionelle Ethik hinaus. Es geht darum, ein neues Paradigma zu etablieren: Arbeit als Beziehung zur Welt, nicht als Tauschmittel oder moralischer Leistungsbeweis.
Diese Arbeit macht deutlich: Wer die Realität der Arbeitswelt verstehen will, muss nicht nur Zahlen lesen, sondern Geschichten hören, Verkörperung sehen, Gewalt benennen, an den Rändern des Sagbaren bohren. Der vorliegende Text ist kein Einzelfallbericht, sondern die konsequente Anwendung eines neuen, radikal-subjektiv-objektiven Forschungsansatzes: Das Subjekt als Sensorium einer Gesellschaft, das Zeugnis ablegt – auch unter Druck, auch unter Verfolgung, auch unter strukturellem Terror.
Die Stärke von Speeds Arbeit liegt darin, dass sie nicht als Anklage verfasst ist, sondern als Beweis. Dieses Buch beweist systemisch, strukturell und semantisch, dass unser derzeitiger Arbeitsbegriff blind ist für Menschlichkeit – und ersetzt werden muss. Damit wird es zu einem Grundlagentext für eine Neudefinition von Arbeit, insbesondere unter Einbeziehung neurodivergenter Perspektiven, der Care-Arbeit und einer künftigen postkapitalistischen Ethik der Relevanz.
Ein Buch, das die Zukunft nicht nur beschreibt, sondern exekutiert – provozierend, brilliant, unbequem. Seine Zeit ist jetzt.
»EINE GESELLSCHAFT, DIE UNRECHT NICHT BENENNT, MENSCHENRECHTE VERLETZT ODER IM POPULISMUS VERSINKT, ZWINGT VIELE AUTIST:INNEN UND ANDERE NEURODIVERGENTE DAZU, IHR LEBEN ALS WHISTLEBLOWER:INNEN, STÖRENDE ODER REBELL:INNEN ZU GEFÄHRDEN – UND HOHE OPFER ZU BRINGEN. DENN UNSERE NEURONALE VERSCHALTUNG LÄSST ES NICHT ZU, SOLCHE BRÜCHE MIT DER UNIVERSELLEN ORDNUNG ZU IGNORIEREN. VIELE VON UNS EMPFINDEN UNRECHT ALS KÖRPERLICHEN SCHMERZ. WER UNS DESHALB VERFOLGT, AUSGRENZT ODER PATHOLOGISIERT, BEGEHT EIN DOPPELTES VERBRECHEN: EINES GEGEN DEN MENSCHEN – UND EINES GEGEN DIE ORDNUNG SELBST.«
AUS DEM ERLEBEN EINES AUTISTEN
Erst vor Kurzem, also mit 51 Jahren, erfuhr ich, dass ich Autist bin, nachdem ich ein ganzes Leben gegen eine unsichtbare Wand lief und nicht verstehen konnte, weshalb ich die Gesellschaft, besonders die Ökonomie sowie den Arbeitsbegriff mit völlig anderen Augen, einem biologisch bedingt anderen Gehirn betrachtete. Neben Autismus bin ich auch von ADHS betroffen. (AuDHD)
Als ich die Arbeit an diesem Buch begann, wusste ich also nichts von meiner Neurodivergenz.
Autist:innen erleben und forschen anders. Autismus bedeutet eine andere neuronale Vernetzung des Gehirns, die tatsächlich erheblich ist. Die Unterschiede im Hinblick auf Wahrnehmung, Sprache und Denkweise, sind beträchtlich. Aber auch im Fühlen. Manche Leute vergleichen das mit dem Unterschied zwischen Betriebssystemen wie Mac, Windows, oder Linux. Die Unterschiede, die durch neuronale Vernetzung entstehen, können aber noch wesentlich prägnanter sein. Die Bedeutung frühkindlicher neuronaler Verschaltung für das spätere Weltverhältnis lässt sich eindrücklich an drei gut dokumentierten Fallgruppen zeigen: Am deutlichsten im Fall von Genie, einem Mädchen, das bis zum 13. Lebensjahr in fast vollständiger Isolation aufwuchs. Trotz intensiver Förderung lernte sie nie, Sprache funktional zu gebrauchen, entwickelte kein stabiles Selbstbild und blieb in einer eigenweltlichen Wahrnehmungsstruktur gefangen – nicht, weil sie »krank« war, sondern weil ihr Gehirn nie an symbolische Weltmodelle gekoppelt wurde. Ähnlich drastisch zeigen die Kinder in rumänischen Heimen der Ceaușescu-Ära, wie soziale Verwahrlosung zu dauerhaft veränderten Hirnstrukturen und einer radikal anderen Realitätsverarbeitung führt. Auch hier: keine einfache »Verzögerung«, sondern eine andere Welt. Schließlich verdeutlichen Studien zu »kritischen Zeitfenstern« in der Entwicklung, dass das Gehirn nur in bestimmten Phasen für bestimmte Verknüpfungen offen ist – verpasst man diese, bilden sich alternative Pfade. Diese Beispiele machen klar: Das, was wir für »Realität« halten, ist nicht bloß Wahrnehmung, sondern Ergebnis sozial-sensorischer Ko-Konstruktion. In diesem Licht erscheinen autistische Lebensformen nicht als Defizite, sondern als stabile, anders verkoppelte Weltzugänge – strukturell verwandt mit jenen Extremerfahrungen, aber nicht pathologisch, sondern kohärent in sich. Sie sind Zeugnisse einer anderen Wirklichkeit.
Diese Beispiele machen sichtbar, wie massiv das Gehirn durch Umweltverhältnisse verschaltet wird. Die Studien zu Thin Slice Judgments zeigen, dass neurotypische Menschen Autist:innen binnen 30 Sekunden unbewusst erkennen und oft sofort abwerten, weil sie die andere Denkstruktur unbewusst als Bedrohung eigener Normen wahrnehmen. Es überrascht also nicht, dass Menschen, die wie ich so spät diagnostiziert wurden, ihr ganzes Leben mit erheblichen Problemen zu kämpfen hatten. Die Gesellschaft, die Mitmenschen werden zu einem unbegreifbaren Phänomen, dem mache Autist:innen versuchen, mit intensiver Logik zu begegnen. So erging es mir auch mit diesem Buch. Es war, als existiere ein permanentes Übersetzungsproblem zwischen neurotypischen und neurodivergenten Gehirnen. Was für mich selbstverständlich war und ist, erschien neurotypischen Menschen unbegreiflich.
Mit früheren Texten und Büchern entzog ich mich lange Zeit der akademischen Gewohnheit der Referenz, weil für Autist:innen das eigene Innere als Referenz viel logischer erscheint. Wir wissen, weil wir erleben. Warum also sollten wir das Erlebte von außen abstrakt legitimieren?
Das Verstehen der Welt ist bei Autist:innen wie mir darüber hinaus verkörpert, was bedeutet, dass Sinneswahrnehmung, Erleben, Denken und Fühlen, somit auch Arbeiten, sich nicht an sozialen Normen orientieren, sondern an einer manchmal determinierenden Verbindung mit der Dynamik der Welt selbst. Es ist ein enaktiver Zugang zur Existenz, was bedeutet, dass der Geist nicht einfach entscheiden kann, eine Arbeit zu tun, die vom eigenen Körper, von den eigenen Sinnen, vom eigenen Erleben entkoppelt ist. Die Fähigkeit zum reibungslosen Funktionieren von Körper und Geist im Dienst an einer äußeren Anforderung ist aber das fundamentale Wesen der Erwerbsarbeit. Entsprechend hatte ich in dem Bereich viele Probleme, die in diesem Buch beschrieben werden. Autist:innen wie ich können unsere Körper nicht von unserem Tun, Fühlen und Denken abspalten, ohne die eigene Integrität zu verlieren, was einer Vergewaltigung, oder einer Selbstauslöschung gleichkäme. Denn wir sind das, was wir tun, denken und fühlen. Diese Aspekte sind nicht nur Optionen. Francisco Varela, Evan Thompson, Eleanor Rosch (1991) The Embodied Mind: »Cognitive Science and Human Experience« → zeigen, dass kognitive Prozesse grundsätzlich nicht entkoppelt vom Körper und seiner Umwelt funktionieren – ein Denken, das nur in Ko-Regulation mit der Welt existiert. Bei vielen Autist:innen ist dies wesentlich ausgeprägter. Daraus ergibt sich auch mein enaktiver Zugang zur Arbeit. Ich meine damit, dass ich nur eine Arbeit machen kann, die Ausdruck meiner Weltbeziehung ist, also selbstbestimmt. Damian Milton (2012) »On the ontological status of autism: The »double empathy problem« → argumentiert, dass autistisches Erleben nicht defizitär, sondern fundamental anders organisiert ist – verkörpert, situativ, systemisch. Erin Manning (2009) »Relationscapes: Movement, Art, Philosophy« → schreibt über »autistic perception« als sich verkörpernde Handlung – ein Arbeiten, das nicht ausgeführt, sondern geschehen muss, im Takt mit Welt, Sinn, Körper. Diese enaktive, verkörperte Bindung von Erleben, Denken und Arbeiten ist im neurodivergenten Sein nicht wählbar, sondern strukturell verankert. Milton (2012) und Varela et al. (1991) → identifizieren die Unmöglichkeit funktionalisierter Handlung unter systemischer Entkopplung von Sinn und Körper. Autist:innen wie ich sind somit sinnliche Denker:innen, was bedeutet, dass unser Denken ein Denken in und mit der Welt ist. Es ist ein Denken aus dem unmittelbaren Erleben heraus. Menschen wie ich, deren Wissen ist ein erlebtes Wissen, weil wir umso rationaler verstehen, umso emotionaler wir erleben. Die Welt ist Teil unseres nicht fest verorteten Geistes. (Barad, Merleau-Ponty, Varela) In der Praxis zeigte sich dies dadurch, dass ich über Jahrzehnte Behörden und Konzerne provozierte, um gewissermaßen einen »Essay in der Welt« zu erarbeiten, also einen Essay, der aus meinen Gedanken und meinen Interaktionen bestand. Ich stellte einen Resonanzraum her, zwischen mir und der Welt, indem ich in Aktionen live über die Welt nachdachte, während ich in Form von Happenings in Firmen, Behörden und Gesellschaft eingriff. Diese sich oft über Jahre wiederholenden Akte, waren rhythmische Resonanzräume, zur Erforschung der Systeme, aber sie waren mir auch Lebensraum, als Wesen, dass im geistigen Konstrukt der Welt, im unbewussten der Gesellschaft lebt, als wären Konzepte, Ideologien, Regeln wie Bäume oder Häuser in einer Straße, in der ich lebte. Ich meine damit die Frage der Existenz, nicht die Beschreibung einer abstrakten Idee. Ich meine dies wörtlich.
Als ich Bücher wie »Gesellschaft ohne Vertrauen«, oder »Radical Worker« schrieb, war es das niederschrieben eines Ausdrucks, eines Erlebens von Wissen, welches allein zwischen der Welt und mir entstand. Daher band ich es damals anfangs nicht an akademische Konventionen, verzichtete auf Zitate und Verweise (die ich hier teilweise ergänzte), weil Autist:innen diesen anderen Zugang zu Wissen und Forschung haben. Uns geht es oft nicht um die objektive Wahrheit, sondern um den Prozess des Erlebens von Erkenntnis. Wissen ist bei mir manchmal eher wie eine Erfahrung des Erinnerns zu beschreiben. Dies führt zu einem vollkommen anderen Stil der Wissensvermittlung. Nicht selten in einer assoziativen Textwurst mit inhaltlichen Wiederholungen, die daraus resultieren, dass wir das Wissen im Schreibprozess hervorholen, wie Wasser aus einem Brunnen.
DAS INNERE LABOR
Autist:innen wie ich forschen anders. Robert Chapman (2023) Empire of Normality: Neurodiversity and Capitalism impliziert, dass sich autistische Denkprozesse als nicht-lineare, verkörperte und hyper-reflexive Räume, einer objektivierenden Normalisierung im Kapitalismus entziehen. Der „neurotypische Wissenschaftsmodus“ (Peer Review, Hypothesenbildung, Messung) wird von manchen als strukturell exkludierend kritisiert – weil er nicht mit erkenntnisbildenden Prozessen arbeitet, sondern mit Objektabschlüssen. Mel Baggs (2007–2020) In My Language formuliert eine frühe, aber paradigmatische Kritik an neurotypischen Wahrnehmungsstandards. Sie zeigt, dass ihr Denken in einer Raum-Zeit-Struktur abläuft, die sich nicht von Sprache trennt, sondern in einem enaktiven Feld von Wahrnehmung, Rhythmus und Wiederholung operiert. Damian Milton (2012) On the Ontological Status of Autism: The Double Empathy Problem argumentiert, dass autistische Personen von neurotypischen Wissenskonventionen fundamental missverstanden werden.
Autist:innen wie ich können wie in einem inneren Labor uns selbst von außen observieren, oft ohne subjektive Verkürzung, sondern in einem fast schon objektiven Raum, weil der starke Körper- und unmittelbare Weltkontakt subjektiven Abspaltungen zwischen Subjekt und Objekt entgegen wirkt. Manche von uns haben einen direkteren Draht zur sinnlich erfahrbaren Welt. Das heißt nicht, dass wir unfehlbar sind, aber es ist ein anderes Selbsterleben, als dies bei neurotypischen Gehirnen der Fall wäre. Es ist, als sei das Bewusstsein auf eine Weise verkörpert, die zugleich den Körper in den erweiterten Raum transzendiert, als wäre alles Aspekte desselben Puzzles. In meiner Arbeit zeigt sich, was Karen Barad als agentiellen Realismus beschreibt: Erkenntnis entsteht nicht durch Repräsentation, sondern durch intra-aktive, verkörperte Konfiguration. Autistische Forschung folgt dabei keinem hypothetischen Modell, sondern übersetzt unmittelbare Erfahrung in Denkstruktur – über stille Resonanz, leiblich rückgekoppelte Schleifen und nicht-lineares Musterspüren. Der Erkenntnisraum ist dabei kein Abbild, sondern ein Wirkfeld, in dem das forschende Subjekt Teil der materiell-affektiven Anordnung ist.
Die in diesem Buch beschriebene Form der Forschung – als verkörperte, zirkuläre, multisensorische Verdichtung von Erkenntnis – ist anschlussfähig an die enaktive Kognition (Varela et al., 1991), an die Konzepte der Participatory Sense- Making (De Jaegher & Di Paolo, 2007) und Marceau-Pontys Arbeit, die sich dem klassischen Subjekt-Objekt-Dualismus (Kant, Descartes) entgegenstellt. Wichtig ist hier, wie gesagt, besonders auch in Intra-aktive Handlung nach Karen Barad. Was im neurotypischen Paradigma als »Mangel an Objektivität« erscheint, ist aus Sicht neurodivergenter Forschung eine andere Ontologie des Denkens: zyklisch, selbst transzendierend, fragmentiert-kohärent und rhythmisch mit der Welt verwoben.
Der quasi ökologisch-enaktive Ansatz verbindet Gibsonsche Affordanzen1, enaktive Sinnbildung, das Skilled-Intentionality-Framework (SIF) und prädiktive Verarbeitungsmodelle zu einem einheitlichen Bild von Autismus. Er interpretiert autistische Besonderheiten nicht als feste Defizite, sondern als rekursive Dynamik zwischen Körper, Gehirn und ökologischer Nische, in der atypische Präzisionsge-wichtung, veränderte Felder von Affordanzen und eingeschränkte »bodily normativity« zusammenwirken. Diese Affordanzen werden in späteren Kapiteln noch eine große Rolle spielen, in der Beschreibung, weshalb ich nur selbstbestimmt arbeiten kann. Autistische »Berufung« – das fast körperliche Gefühl, nur einer ganz bestimmten Tätigkeit folgen zu können und in anderen Jobs buchstäblich zu versagen – lässt sich mit Gibsonschen Affordanzen hervorragend erklären: Autistische Wahrnehmung bündelt Aufmerksamkeit auf ein enges, hochpräzises Feld von Handlungs-Möglichkeiten (»Affordanzen«), während alles außerhalb dieses Feldes als sensorisch chaotisch, sozial unlesbar oder motorisch unhandhabbar erlebt wird. Die Folge ist monotrope Fokussierung, Flow-ähnliche Absorption im eigenen Thema – und ein realer physiologischer Stress, sobald man in Fremd-Affordanzen (klassische Bürojobs, Small-Talk-Verkauf, chaotische Großraumbüros) gezwungen wird. Die »Unmöglichkeit«, andere Arbeit zu machen, ist demnach keine Sturheit, sondern eine relationale Fehlanpassung zwischen Körper-Geist-System und Umwelt.
Die starke Verankerung von Geist und Handlung mit dem Körper führt zu einer Dominanz von Sinnesreizen. Bei Menschen wie mir dienen die eigenen Sinne und Emotionen oft als Verdichter der Prozesse und Erkenntnisse. Es sind eher Tools als Teile einer festen Identität. Je emotionaler, umso rationaler. Je persönlicher, umso analytischer. Der Körper ist nicht bloß Träger eines Geistes, sondern das entscheidende Rechenwerk, in dem Wahrnehmen, Fühlen und Denken rekursiv verschaltet sind. Im Sinne der Somatic-Marker-Hypothese von Damasio wirken emotionale Körperzustände wie schnelle Heuristiken – sie kondensieren komplexe Situationsparameter in spürbare Signale und machen dadurch klareres, nicht langsameres Entscheiden möglich. De Jaeghers Arbeiten zeigen, dass Prozesse der Sinnbildung in sozialen Interaktionen in körperlich gebundenen Schleifen von Wahrnehmung und Handlung verankert sind. Auf Autismus bezogen legt dies nahe, dass autistische Personen sich besonders stark mit rohen Sinneseindrücken koppeln und Bedeutungen dynamisch im Verlauf der Interaktion modulieren – anstatt zunächst mentale Hypothesen zu testen. Damit werden Sinneskanäle und Affekte zu Tools der Erkenntnis – sie verdichten Wahrnehmungsrauschen zu stabilen Mustern (»tacit resonance«) und erlauben gerade in Momenten hoher Emotionalität eine außergewöhnlich scharfe Systemanalyse. Kurz: Je unmittelbarer die Emotion den Körper flutet, desto höher die kognitive Auflösung; je persönlicher der Bezug, desto gründlicher die analytische Durcharbeitung. Autistisches Forschen verlagert Rationalität damit in den Leib – ein verkörpertes Expertentum, das Milton als »autistic expertise« bezeichnet.
Daher muss man bei der Forschung, die ich als Autist und Künstler betreibe, von einem eigenen Forschungszweig sprechen, nämlich von neurodivergenter Forschung, die das Erleben des Untersuchenden bewusst nicht ausschließt. Denn unsere Gehirne erfordern ein Denken im realen Raum, zwischen dem Erleben, Erfahren, dem Riechen oder dem Bewegen. Autistische Forscher:innen pflegen, wie gessagt, eine eigene Sprache, die ein Prozess ist, die Wiederholung und Verdichtung braucht, welche kein Endergebnis erfordert, sondern sich in den unendlichen Fluss der Details einhängen will, um der Welt zu lauschen, wie sie sich formt und tut. Man spricht hier in der Forschung von Embodied Cognition. Geist »sitzt« nicht im Gehirn, sondern entsteht im gelebten Organismus-Welt-Kreislauf. Der Begriff wurde Anfang der 1990er Jahre durch Varela, Thompson & Rosch (The Embodied Mind, 1991) → popularisiert und zugleich von Lakoff & Johnson, Barsalou u. a. in der Kognitionswissenschaft verankert. Neuere philosophische Synthesen beschreiben Embodiment als dynamische Kopplung von Gehirn, Körper und Umwelt, ohne klare Trennung von »innen« und »außen«. Unser Ich ist wie gesagt keine abgeschlossene Kugel, keine feste Form, sondern in den Begrenzungen sehr viel offener, für das Außen, dessen Lärm, dessen Helligkeit, dessen Gewalt und Inhalt, sowie dessen Form. Studien zeigen, dass viele autistische Menschen atypische Sensorik-, Motor- und Interozeptionsprofile haben und dadurch andere Wege der Welt-Erschließung ausbilden. Viele autistische Menschen berichten von einem Erleben, in dem die kartesianische Trennung zwischen Körper und Geist weniger ausgeprägt ist. Dies entspricht Maturanas und Varelas Kritik am Dualismus und ihrer Betonung der Einheit des lebenden Systems. Das Unvermögen, beliebig zu handeln oder sich von bestimmten Wahrnehmungen zu distanzieren, könnte als intensiveres Erleben der autopoietischen Geschlossenheit des Systems verstanden werden. Viele autistische Menschen haben eine besondere Fähigkeit, Muster und Komplexität in Systemen zu erkennen und zu bewahren, was mit Maturanas und Varelas Betonung der Erhaltung der Organisation des lebenden Systems korrespondiert. Dadurch kollidieren wir mit der klassischen Arbeitswelt, in dem Versuch uns aus uns selbst heraus zu erhalten. Selbsterhaltung läuft hier also dem Konzept der Jobs als Lebensgrundlage zuwider.
Berührt ist hier auch der Prozess der Autopoesis. Diese besagt, dass lebende Systeme sich selbst erschaffen, indem sie ihre eigenen Komponenten produzieren und organisieren. Leben ist durch Selbstorganisation gekennzeichnet. Lebewesen sind autopoietische Systeme. Erkenntnis ist nicht die Repräsentation einer vorgegebenen äußeren Welt, sondern ein aktiver Prozess, durch den ein Lebewesen seine Realität erschafft. Kognition und Leben sind untrennbar miteinander verbunden – »Leben ist Erkennen, Erkennen ist Leben«. Wahrnehmung ist nicht passive Informationsaufnahme, sondern aktive Konstruktion durch das wahrnehmende System selbst. In diesem Sinne könnte das autistische Erleben als eine Form des Lebens betrachtet werden, die in mancher Hinsicht näher an der unmittelbaren, nicht dualistischen Existenzweise liegt, die Maturana und Varela beschreiben – eine Existenzweise, die weniger durch soziale Konstrukte und kulturelle Filter vermittelt ist und stärker die fundamentale strukturelle Kopplung zwischen Organismus und Umwelt erlebt. Ja, ich lebe in einer eigenen Welt. Ich erschaffe sie aus mir selbst. So ist auch meine Forschung. Ich schöpfe aus mir, in Interaktion und Intervention mit der Welt, in der ich versuche, eine gemeinsame Form zu erschaffen, die sehr eng mit meiner Existenz verknüpft ist. Die Kunst dient dabei als erweitertes Mittel, Werkzeug und Medium.
Diese biologische Erkenntnistheorie führt zu einer radikalen Abkehr vom traditionellen Repräsentationalismus und hat weitreichende Konsequenzen für unser Verständnis von Bewusstsein, Wahrnehmung und dem Verhältnis zwischen Organismus und Umwelt. Somit auch von Arbeit und Forschung.
1 Unter „Gibson-sche Affordanzen“ versteht man diejenigen Handlungs-Möglichkeiten, die eine Umgebung einem konkreten Organismus bietet – je nach dessen körperlichen Fähigkeiten, Bedürfnissen und aktuellen Zielen. Der Begriff geht auf den amerikanischen Wahrnehmungspsychologen James J. Gibson zurück (besonders sein Hauptwerk The Ecological Approach to Visual Perception, 1979). Affordanzen sind also weder rein objektive Eigenschaften der Welt (wie Masse oder Farbe) noch rein subjektive Einbildungen; sie sind relationale Gegebenheiten: eine Stuhlsitzfläche affordiert „Sitzen“ nur, wenn der Körperbau des Betrachters das zulässt, eine glatte Wand affordiert „Lehnen“, aber nicht „Klettern“ – außer für eine Eidechse mit Haftfüßen.
DIE BERUFUNG DES AUTISTEN
Der von mir geprägte Begriff der autistischen Berufung, also der biologisch bedingt angeborenen Arbeit, bezieht sich darauf, dass ich mein ganzes Leben als den Ausdruck einer geometrischen Form, einer Frequenz, eines Musters, eines Tanzes, einer speziellen Sphäre, im Sinne, der in späteren Kapiteln dargestellten Modelle und Theorien erlebe, die ich in Zyklen versuche durch mein Leben, in meiner Arbeit zu verwirklichen. Damit ist ein biologisch fundiertes, verkörpertes Lebensmuster gemeint, das nicht gewählt, sondern gelebt werden muss – als epistemisch zwingende Arbeit in Symbiose mit Weltstruktur. Das ist eine tiefgründige Form der autistischen Ontogenese, die sich nicht als Identität, sondern als Lebensrhythmus entfaltet.
Gibson beschreibt, wie erwähnt, Affordanzen als relationale Handlungsmöglichkeiten, die nur dann existieren, wenn Umwelt-Gestalt und leibliche Disposition zueinander passen. Ein Sessel »affordiert« Sitzen, weil Größe, Form und Muskel-Tonus des Menschen sich verschränken. Bei Autist:innen ist dieses Affordanz-Feld oft enger und präziser kalibriert – sie erkennen vor allem jene Strukturen, die mit ihren Spezial interessen, Sinnesfiltern und motorischen Routinen kompatibel sind. Die Monotropismus-Theorie zeigt, dass autistische Kognition Ressourcen in wenige dominante Interessenkanäle lenkt. Wird genau dort eine passende Affordanz-Landschaft geboten (z. B. in künstlerischer Forschung, Datenanalyse, Detailkunst), entsteht Flow: maximale Sinn-Kohärenz, minimale Vorhersagefehler2. Jobs, die andere Affordanzen erzwingen (Telefonakquise, Großraum-Administration), erzeugen dagegen permanente Fehler-Signale; der Organismus reagiert mit Stress. Predictive-Processing-Modelle besagen, dass Autist:innen sensorische Abweichungen hoch und präzise gewichten und schwache Priors3 haben. Eine Tätigkeitsumgebung, die ständig »falsche« Reize liefert, lässt sich nicht einfach ignorieren – das Gehirn meldet unaufhörlich Vorhersagefehler. Die Aussage »Ich kann das nicht tun« ist also wörtlich zu nehmen: Die neurophysiologischen Kosten, Fremd-Affordanzen fortwährend zu unterdrücken, übersteigen verfügbare Ressourcen. Dies wird im späteren Verlauf dieses Buches entscheidend, wenn es darum geht, dass Behörden mich zu einer anderen Arbeit zwingen wollten.
Schwache Priors liefern auch einen physiologischen Schlüssel dafür, weshalb ich sagte: »Je emotionaler, umso rationaler«, denn starke, leiblich getragene Affekte wirken in meinem System als temporäre Präzisionsbooster und verdichten das Rauschen, sodass Analyse möglich wird. Ohne diesen affektiv sensorischen Verdichter bleiben die Priors breit, das Signal chaotisch. Ich muss die Verhältnisse persönlich machen.
Genau dort setzt jene »Berufung« an: Die Welt ist nicht außen, sie entfaltet sich durch das Subjekt, das aber nicht als Ego agiert, sondern als Formresonanz. Mel Baggs (2007): »In My Language« → beschreibt auch, dass ihre Art, in der Welt zu sein, nicht metaphorisch ist. Sie kommuniziert mit der Welt durch Muster, Berührung, Bewegung, Echo. Damian Milton (2014): »Autistic Expertise: A Critical Reflection on the Production of Knowledge« → argumentiert, dass viele Autist:innen eine Form von »epistemischer Notwendigkeit« spüren: eine zwanghafte Bindung an ein Thema, eine Form, eine Ordnung. Man kann also sagen, dass wir nicht forschend analysieren, sondern verkörpernd forschen – als innere Notwendigkeit, durch Mustererfüllung. Ich verstehe dies selbst als eine Art »Mythologischer Existenz.« Wie Engel, Götter oder Fabelwesen, haben auch manche Autist:innen eine geradezu determinierte innere Aufgabe, die sich aus der erlebten Form der Muster der Welt ergibt. Man stelle sich nur das Chaos vor, schickte man einen Gott, oder ein Fabelwesen zur Arbeit in die Firma und dieses Wesen wäre unfähig etwas anderes zu tun, als die eigene Bestimmung. Das wäre in etwa mein Erleben autistischer Berufung.
Die in den folgenden Kapiteln beschriebene Forschung als »autistischen Berufung« ist kein metaphorisches Bild, sondern eine in der neurodivergenten Forschung beschriebene Lebensrealität. Viele Forschende zeigen, dass autistische Erkenntnisprozesse nicht optional oder rational strukturiert sind, sondern aus einer verkörperten, rhythmisch formierenden Ordnung heraus operieren. Die Person wird dabei nicht Träger von Wissen, sondern ein Aspekt der Struktur selbst, die sich durch das Subjekt verwirklicht.
Ich bin als Autist und Künstler von dieser Ordnung nicht getrennt, sondern wir existieren in Symbiose. Neurotypische Menschen tun dies nicht auf diese Art. Sie sind nicht derart eine Einheit mit der Welt. Sie können vergleichsweise wesentlich willkürlicher darin agieren. Diese Musterordnung kann ich als Autist weder ignorieren noch kann ich damit aufhören, sie zu erforschen oder in meiner Existenz auszudrücken. Sie ist mir folglich zur natürlichen Arbeit geworden, die mir angeboren ist. Das Muster, die Form, hat mir eine Aufgabe zugeteilt, nämlich eine Differenz zu beschreiben, zwischen ihr und der Zivilisation. Das mag für neurotypische Menschen schwer zu verstehen sein, deren Handeln von ihnen mehr oder weniger frei entschieden werden kann, die sozialen und gesellschaftlichen Normen oder Bedingungen folgt, um möglichst einen Platz, also einen Job in der Gruppe zu finden. Darin liegt ein gewisser, auf Anpassung beruhender Möglichkeitsraum und eine Offenheit und Flexibilität, die vielen Autist:innen fehlt. Das alles muss ich ignorieren, wenn es der Verwirklichung der in mir verkörperten Ordnung widerspricht. Das ist kein Zwang, in dem Sinne, dass ich darunter leiden würde, sondern eine Voraussetzung meines Seins. Ich muss diese selbstbestimmte Arbeit machen, weil alles andere meine Auslöschung als menschliches Wesen zur Folge hätte. Jobs als fremdbestimmtes Handeln sind somit nicht die Grundlage meiner Existenz, sondern waren und sind schon immer eine Bedrohung dessen gewesen. Betrete ich ein Unternehmen, sehe ich überall abweichende Ordnung, die korrigiert werden muss. Da Jobstrukturen mein Handeln externalisiert über meinen Körper fremdbestimmen wollen, verorten sie mich in Raum und Zeit und zerbrechen mich auf diese Weise. Weil ich mein Handeln als Autist nicht von der Notwendigkeit der Einhaltung jener Ordnungen und Muster trennen kann, die mich selbst zu einer Art personifizierten Skulptur meines Welterlebens gemacht haben, also zu einer mythologischen Existenz. Ich bin in meinem ganzen Sein ein Wesen, dass den freien Selbstausdruck benötigt, wie andere Luft zum Atmen. Meine neurologische Verschaltung erlaubt es mir nicht, getrennt von meinem Erleben, meiner Wahrnehmung zu handeln, als hätte das eine mit dem anderen nichts zu tun.
In der neurotypischen Bias nennt man mein Problem mit der Welt auch »Pathological Demand Avoidance«. Also die Verweigerung, äußeren Anforderungen zu folgen. Es ist kein krankhaftes Verhalten, sondern ein Mechanismus der Evolution, um Komplexität in Ökosystemen zu bewahren, die Neurotypische nur allzu gerne ignorieren, wenn es ihnen einen Vorteil in der Gruppe verschafft. Es muss also Menschen geben, die Abweichungen und Unterschiede in Strukturen erkennen, die Muster präzise sehen können, ohne subjektive Verzerrung, auch wenn es politisch und entlang sozialer Normen nicht erwünscht ist. Diese Menschen können dazu beitragen, die innere Ordnung der Natur zu schützen und das, was Realität ist, fortlaufend zu erweitern.
Mit diesem Kapitel versuchte ich also die grundlegenden Unterschiede zwischen neurodivergenter Forschung und klassischer Wissenschaft zu beschreiben. Denn klassische Wissenschaft beruht auf Paradigmen neurotypischer Gehirne, also auf Annahmen und Methodiken, die deren Realitätserleben entsprechen und deren Schwächen ausgleichen sollen. Das neurotypische Gehirn ist wesentlich stärker an Objekten, Kontrolle und Vorhersagbarkeit orientiert, während viele Autist:innen und Neurodivergente die Realität über unmittelbare Prozesse, Details und Beziehungen konfigurieren. Ausdruck ist stärker gewichtet als Aussage. Was aber nun Realität ist, was Erkenntnis ist, was Wissen ist, lässt sich folglich nicht gleichermaßen in Methoden und Sichtweisen für neurotypische wie neurodivergente Gehirne definieren. Genauso wenig wie zwischen einem Alien und einem Menschen, denn ein Alien würde Wissen aus vollkommen anderem Realitätserleben heraus begreifen, im Kontext einer völlig anderen neurologischen Verbindung zum Ökosystem.
Im folgenden Kapitel möchte ich mich mit der fundamentalen Frage befassen, was die oder eine Grundlage der Freiheit innerhalb der Diversität erfordert, was deren Grundlage ist oder sein könnte. Denn wenn wir uns in weiterer Folge dieses Buches den Arbeitsbegriff im Kontext mit Mensch und KI ansehen wollen, ist es unerlässlich zu verstehen, dass unser Handeln, unser Arbeiten, unser Gestalten der Welt, in Resonanz mit dieser geschieht und es kein relevantes Denken außerhalb der Welterfahrung gibt, weil alles andere nur Simulation wäre, also das Denken in einer geschlossenen Box. KI ist heute weitgehend Simulation, weil es der KI fundamental an erlebtem Weltbezug, an einem erlebten Weltmodell mangelt. Gerade meine Erfahrung als Autist kann darum erklären, weshalb die KI kein Bewusstsein im eigentlichen Sinne entwickelt, solange sie nicht autopoetisch und in Resonanz mit dem Ökosystem entsteht. Kinder werden geboren, sie werden nicht erschaffen. Im Prozess der Geburt kommt es zu einem gefährlichen Ungleichgewicht zwischen Biologie, Psychologie und Identität. An dieser Bruchkannte, sogar schon davor, ist Leben, Beziehung und Wechselwirkung, mit unbekanntem Ausgang. Es ist ein Tanz mit etwas Offenem. Ein Verlust an Kontrolle. KI aber ist Programmierung, also Predicting. Das ist etwas komplett anderes.
Weil aber auch die moderne Arbeiter:in in den Jobs immer mehr wie programmiert agiert, erscheint die Arbeiter:in durch die KI ersetzbar, weil sie in linearer Zuordnung irgendwann von der KI in Fähigkeiten und Geschwindigkeit, sowie Kosten überholt werden kann. Die zentrale These dieses Buches besagt aber, dass damit nur ein Teil dessen, was Handeln, Arbeiten, Denken und Sein bedeuten, überhaupt berührt wird. Nämlich nur der Anteil exekutiver Funktion. Der viel wichtigere Aspekt von Arbeit, Handeln und Denken besteht jedoch in der Resonanz mit der Welt und einem Vorgang, indem sich die Welt in einen einschreibt und umgekehrt. Indem wir also Teil von und in der Welt sind und diese unsere einzigartige Abweichung an Lebenserfahrung benötigt, um sich komplex und frei konstruieren zu können. Werden wir durch Simulationen, also durch ein Denken und Handeln aus der Box ersetzt (denn die KI handelt nach Vorhersage, also nach Wiederholung des Vergangenen), kommt es zu einem Stillstand und einer Trennung zwischen Ökosystem und Mensch. Wir würden dem Leben selbst zuwider handeln. Daher lebe ich in diesem Buch eine subjektive, unangepasste, andersartige Arbeiterin vor, weil wir nur darin erkennen können, was menschliche Arbeitsweise ist und was jene der Robotik. Interessant ist hier die Frage, wie einerseits meine deterministische autistische Berufung, verbunden mit den schwachen Priors, also der Unfähigkeit das Gestern über das Morgen bestimmen zu lassen, in einer Gegenposition steht, zu einer KI, welche die Welt scheinbar programmiert, als Simulation verwirklicht. Also im Denken als Vorhersage agiert. Dazwischen eine Gesellschaft, die noch nicht verstanden hat, ob sie programmiert ist, ob sie wie ein Roboter arbeiten soll, ob das Leistung ist, oder ob sie zum freien Menschen werden will, der sich selbst erst durch die Grenzen der KI erkennt.
TAKE-AWAY BOX – KAPITEL »AUS DEM ERLEBEN EINES AUTISTEN«
Späte Selbsterkenntnis, tiefe Systemkritik
Erst mit 51 erfährt Speed von seinem AuDHD-Profil – die Rückschau zeigt, wie unsichtbare Neurodivergenz jahrzehntelang in Konflikt mit Arbeits- und Sozial normen geraten kann.
Embodied Cognition statt Kopf-Wissen
Denken, Fühlen, Wahrnehmen bilden bei Autist:innen eine untrennbare Einheit; Rationalität steigt mit sensorischer und emotionaler Intensität.
Monotropismus & schwache Priors
Eng fokussierte Aufmerksamkeit + geringe Vorannahmen erklären sowohl Hyperdetailwahrnehmung als auch den realen Stress, wenn fremd definierte Jobs aufgezwungen werden.
Tacit Resonance & inneres „Labor“
Speed nutzt verkörperte Schleifen – stille Resonanzen zwischen Körper und Umwelt – als Forschungsinstrument, das klassische Hypothesentests ersetzt.
Autistische Berufung → Arbeitsbegriff 2.0
»Ich kann nur tun, was meinem inneren Muster entspricht« – die biologisch verankerte Berufung wird zur Fallstudie dafür, warum Arbeit als Beziehungshandeln neu gedacht werden muss.
2https://stimpunks.org/2023/02/26/autism-stress-and-flow-states/?utm_source=chatgpt.com
3 Schwache Priors (oft auch attenuated-, hypo- oder weak-prior-Hypothese) bezeichnen in Bayes-/Predictive-Processing-Modellen Erwartungen, deren Präzision – also ihr statistisches „Gewicht“ – gering ist. Formal heißt das: Die a-priori-Verteilung ist breit, weist hohe Varianz und damit geringes Vertrauen auf. Konsequenzen: Bottom-up-Dominanz – aktuelle Sinnesreize schlagen die Vorhersage; das Gehirn „glaubt“ eher dem Moment als seiner Erfahrung. Geringere Kontextmodulation – klassische Illusionen (z. B. Kanizsa-Dreieck) wirken schwächer, weil der Kontext-Prior nicht stark genug ist, um das Rohsignal zu „überschreiben“. Erhöhte Unsicherheit & Volatilitätsschätzung – die Welt wird als wechselhaft erlebt; das System verhält sich reaktiver, sucht nach verlässlichen Mikromustern statt nach globaler Stabilität. Schwache Priors im Autismus: Pellicano & Burr (2012) postulierten, dass viele autistische Wahrnehmungs phänomene – Hyperdetail, Reizüberflutung, reduzierte Illusionsanfälligkeit – genau auf diese zu schwachen Vorannahmen zurückgehen: Vorwissen greift weniger, deshalb bleibt jede neue Reizinformation „roh“ und unverfiltert. https://www.frontiersin.org/journals/human-neuroscience/articles/10.3389/fnhum.2014.00302/full?utm_source=chatgpt.com