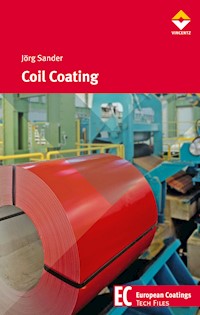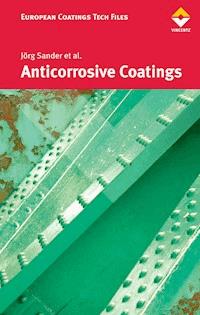Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Als Jürg Hollander, ambitionsloser Philosophiedozent und erprobter Liebhaber von Fernbeziehungen, erfährt, dass der Bundespräsident an seiner Fakultät eine Rede über Freiheit und Verantwortung halten wird, erzählt er davon seinem scheinbar einzigen Freund Jamel. Aber etwas stimmt nicht mit ihm. Mit Jamel? Oder mit Hollander?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 252
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Für Inga
Inhaltsverzeichnis
Prolog
Die Silberstreifen am Horizont sind meist toxische Materialien, die gut reflektieren
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
In der Nachgeburt der Schrecken sucht das Geschmeiß nach neuer Nahrung: Ingeborg Bachmann
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Nur zwischen den Steinen liegt es sich weich
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Jede Geburt ist blutig
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Wer stirbt, verdient den Tod: Jegor Gaidar
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Dort, wo ich herkomme, gibt es kein Entkommen
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Epilog
Prolog
Ich sitze im Erkerzimmer an Mareiles Schreibtisch. Die Morgensonne wandert langsam von der breiten Fensterbank zur Tischplatte, auf der ein kleiner Stapel meiner Bücher liegt. Mareile ist nicht da. Sie ist zur Arbeit. Das Erkerzimmer ist nicht in unserer Wohnung. Es ist nicht einmal in der Nähe unserer gemeinsamen Wohnung. Vor sechs Monaten ist Mareile hier eingezogen, hierher, in eine Kleinstadt, deren Name mir nichts sagt.
Alles um mich herum ist entweder neu oder trägt für mich das Versprechen des Neuanfangs. Ein Neuanfang ohne mich. Ich werde in zwei Tagen wieder ins Ruhrgebiet fahren. Zu Jamel, über den ich unaufhörlich nachdenken würde, wäre da nicht Mareile, über die ich nachdenken muss. Darüber, was es bedeuten soll, dass sie nun hier wohnt, eine neue Arbeit im Welcome-Center der Universität angenommen hat und auch noch ihr alternder griechischer Liebhaber zufällig in einem der Nachbarorte wohnt.
Zufällig ist nicht das richtige Wort. Und doch kommt Jamel mir wieder in den Sinn, während ich aus dem Erkerfenster schaue und die Studentinnen betrachte, die sich im Gebäude gegenüber auf den Balkonen sonnen. Ich vermute, es sind Studentinnen. Offensichtlich ist das Gebäude ein Studentenwohnheim, denn es gibt zwei Hochschulen in dem Ort hier. Wilhelm Liebknecht wurde in dieser Stadt geboren, geht mir wie unzusammenhängend durch den Kopf. Gibt es das, Unzusammenhängendes? Also Jamel.
Im Land seines Vaters Martin Arh-Zidiane ist er nie gewesen. Er kannte die Geschichte von Sklaverei und Revolution in Haiti. Eine unvollendeten Revolution.
Wie alle Revolutionen. Unvollendet wie Arh-Zidianes eigene Geschichte, aber davon wollte Jamel lange nichts wissen.
Das Land Janahs hat er besucht, das Land Ben Bellas.
Das Haus ihrer Eltern in der Kabylei hat er vergeblich gesucht. Algerien kennt ihn nur als Fremden.
Wer also ist Jamel? Ist seine Geschichte meine Geschichte? Hat die alte indische Frau in Berlin, die uns alle doch am besten kennt, Recht mit ihren Worten von dem gefräßigen, schwarzen Tier in uns? Oder suche ich im Leben anderer, vorzugsweise in ihrem Scheitern, nur etwas, das mir Erleichterung verschafft?
Ich versetze mein Notebook in den Energiesparmodus und werfe einen letzten Blick auf eine Studentin im Bikini. Eine blonde. Ungesehen werde ich gleich unter ihrem Balkon den Weg zum Einkaufszentrum einschlagen. Ich werde fürs Abendessen Thunfischsteaks kaufen. Bis Mareile gegen sieben von der Arbeit zurückkommt, habe ich die Salatherzen zerpflückt und den Ingwer gehackt.
Der Weißwein wird eiskalt sein.
Es ist der Vorabend meines fünfunddreißigsten Geburtstags.
I. Die Silberstreifen am Horizont sind meist toxische Materialien, die gut reflektieren
1
Ich hangelte mich von Semester zu Semester. Seitmeiner Dissertation, die ich vor einigen Jahren abgeschlossen hatte, erhielt ich an meiner Heimatuniversität halbjährlich einen neuen Lehrauftrag für zwei Seminare. Und jedes Sommersemester kam ein Grundkurs Philosophiegeschichte dazu. Davon den Lebensunterhalt zu bestreiten war ein gewisses Kunststück. Dennoch unternahm ich keinerlei Anstrengungen, meine akademische Position zu verbessern. Ich war weder ehrgeizig noch zielstrebig.
Und ich wollte mich nicht mehr als nötig integrieren, nicht ins Bildungssystem, nicht in die westliche Wertegemeinschaft. Ein Studienkollege attestierte mir einmal ein gewisses Misstrauen gegenüber der Gattung als solche. Besagter Studienkollege machte damals zusätzlich zu seinem Medizinstudium, nebenbei sozusagen, auch noch seinen Magister in Philosophie und sitzt heute auf einer eigens für ihn eingerichteten Professur für Philosophie und Neurologie irgendwo in Kanada, forscht, hält Vorlesungen und schreibt ein Buch nach dem anderen. Den Kontakt zu ihm habe ich natürlich rechtzeitig abgebrochen.
Immerhin hatte ich nach sechs Semestern kontinuierlicher Seminartätigkeit ein kleines Büro direkt neben dem Frauenklo ergattert. Vorher vom Reinigungspersonal als Abstellraum genutzt, roch der zellenartige Raum noch immer ein wenig nach Toilettenreiniger. Das einzige Fenster ließ sich aufgrund eines nicht durchschaubaren technischen Defekts nicht öffnen. Da aber eine meiner zentralen Eigenschaften die Anpassungsfähigkeit ist, verblieb als wirkliches Problem nur mein eher gespanntes Verhältnis zu Professor Dr. Armin Reth. Der war leider Dekan des Fachbereichs und der Platzhirsch unserer philosophischen Fakultät. Ungeliebt und gefürchtet unter den Philosophiedozenten und wissenschaftlichen Mitarbeitern, galt er im Kreis seiner ausgewählten Studenten und Studentinnen als der Philosoph mit dem unzweifelhaft größten geistigen Geweih (unter den Lebenden). Und medial lag er – angesichts scharfsinniger Beiträge zu Risikoabwägung und Ethikfragen in der postindustriellen Gesellschaft – gut im Rennen. Die digitale Revolution machte ihm ein wenig zu schaffen, pflegte er Kanttexte doch weiterhin ausschließlich mit Buntstiften zu markieren und die Existenz von Textverarbeitungsprogrammen oder gar Screenreadern unbeirrbar zu ignorieren. Aberselbstich musste zugeben, dass seine Vorlesungen unterhaltsam waren und das weit über die Pflichtteilnehmer hinaus angelockte Publikum nie in seinem Gespanntsein auf den nächsten geistreichen Argumentationshieb gegen den allgemeinen Menschenverstand oder den seiner philosophischen Widersacher enttäuschte.
Ich wusste, dass Reth wenig übrig hatte für meine philosophischen Schwerpunkte und ihre in seinen Augen Sozialneid schürenden Implikationen. Jeder wusste das. Ich war zwar nur ein geistig erodierender Schreibtischrevolutionär, aber Reth konnte seine antikommunistischen Feinjustierungen jedes Semester aufs Neue an mir vornehmen. Themenvorschläge für Seminare mussten bei ihm persönlich eingereicht werden. Er saß in seinem Nadelstreifenanzug am Schreibtisch und überflog die Antragsblätter während man noch im Raum stand.
Mittel und Zweck. Der kategorische Imperativ zwischen Moral und Widerstand, intonierte er beunruhigend melodisch. Das soll ein Thema für ein Hauptseminar sein?
Ich blickte an ihm vorbei auf den Vorplatz des Fakultätsgebäudes und konnte im Stehen den rechtwinkligen Springbrunnen sehen. Die ineinander verschachtelten Beckeninnenwände waren blau gestrichen. Wenn im Sommer das Wasser lief, sah das sehr schön aus.
Ich kann mich nicht erinnern, in das für den Titel des Hauptseminars vorgesehene Feld irgendetwas anderes als eben diesen eingetragen zu haben, murmelte ich.
Zwei Studentinnen gingen am Springbrunnen vorbei.
Und ich kann mich nicht erinnern, sagte Reth, das wir eine Kooperation mit unserer studentischen Antifa-Fraktion zur philosophischen Ausfütterung ihrer geistigen Leerräume eingegangen sind.
Er grinste, gut amüsiert von sich selbst. Würde ich jetzt die Tür zur Waffenkammer öffnen, dann mit ungewissem Ausgang. Intellektuell wie beruflich. An diesen Punkt gelangten unsere Themenabsprachen unweigerlich, was ihm offensichtlich die Stimmung hob. Er griff nach einem Buntstift und begann ihn anzuspitzen.
Ich seufzte ein defensives Seufzen und behauptete: Der Schwerpunkt liegt – wenn Sie das Exposé lesen, wird das deutlich – auf der philosophiegeschichtlichen Rekonstruktion der Begriffe Mittel und Zweck. Politische Aspekte können erst auf der Abschlusssitzung einbezogen werden.
Reth gab einen Laut von sich, der sowohl die Befriedigung über eine gelöste Aufgabe als auch die Enttäuschung über ihre Geringfügigkeit ausdrückte.
Ein gedehntes Ah-Ja mit wohligem Basston am Ende.
Und dann: Da habe ich noch eine hübsche Idee. Ändern wir den Untertitel doch in Der kategorische Imperativ zwischen Moral und Wirklichkeit. Das erlaubt dann auch ein paar epistemologische Bezüge.
Ohne meine Antwort abzuwarten, begann er mit seinem Buntstift ein paar Korrekturen vorzunehmen. In Rot.
Es war am Ende des letzten Sommersemesters, Reth hatte anhaltenden Spaß an unserem Subordinationsverhältnis. Bei jeder zufälligen Begegnung und nur, wenn es niemand anderes sehen konnte, ließ er – ich dachte erst das sei jetzt wohl ein zwanghaftes Gesichtszucken, vielleicht das erste Anzeichen von entgleistem Größenwahn – eine Art Grimasse aufblitzen, eine nur punktuell auftretende Verzerrung der Gesichtsteile, ein mimisches Blockieren, so wie ein rostiger Fleischwolf kurz klemmt und sich dann weiterdreht. Und am vorletzten Tag der Vorlesungszeit, ich hatte gerade meine Besenkammer abgeschlossen und wollte nach Hause, hielt er mich auf dem Gang vor dem Dekanat an.
Kollege Hollander! (Kurze Grimasse.) Auf ein Wort!
Kollege. Ich blieb wie angewurzelt zwei Schritte vor ihm stehen und sah mir seine blau-gelbe Krawatte an.
Haben Sie schon gehört? Fürs Wintersemester ist uns unser lieber Dr. Privatdozent Hurracker abhanden gekommen!
Ja, Herr Professor Dr. Reth, hab ich schon gehört. Reha nach Schlaganfall.
Also? Ich wartete. Hurracker war unser großer Hegel-Experte.
Nun, da müssen wir alle wohl aushelfen...
So?
Sehen Sie, fuhr Reth fort und beugte sich tatsächlich leicht zu mir vor, ohne mit einem einfachen Schritt die Distanz zwischen uns zu verringern. Das ist doch eine gute Gelegenheit. Sie haben die Einkünfte für ein Seminar mehr und könnten gezielt Ihren Defiziten beim Deutschen Idealismus zu Leibe rücken...
Ich beugte mich ebenfalls leicht vor.
Welche Defizite?, schnurrte ich.
Er ließ einen belustigten Kehlkopflaut hören. Dann kurze Grimasse.
Um so besser!, rief er, und ich fürchtete, er könnte jetzt doch noch den Schritt machen und mir auf die Schulter klopfen.
Hauptseminar. Hegel für Fortgeschrittene!, flüsterte er, als sei die Ehre, die mir zuteil wurde, besser noch geheim zuhalten. Hurracker plante hauptsächlich die Phänomenologie des Geistes zu behandeln. Und zwar nicht nur die Einleitung. Unsere liebe Frau Grünbein wird Ihnen die Unterlagen, die unser lieber Kollege so freundlich war, uns zur Verfügung zu stellen, im Laufe der Woche postalisch zusenden.
Er schaute mich genießerisch an, so als erwarte er, erste Anti-Hegel-Pusteln auf meiner Stirn aufblühen zu sehen. Gut, ein bisschen panische Rötung spürte ich da schon.
Reth schaute mich immer noch an. War´s das?, dachte ich mir. Schöne Semesterferien, dann?
Ach, und Hollander, nur so am Rande, machen Sie aus Hegel keinen Vorläufer der marxistischen Dialektik.
Sie wissen schon, was ich meine. Ich spiele mit dem Gedanken, mir von ihren Sitzungen berichten zu lassen. Ich könnte einen Hiwi teilnehmen lassen. Inkognito. Mit falschem Bart.
Er machte diese Bartgeste, zog die Hand von seinem Kinn an abwärts. In seinen Vorlesungen ein sicherer Lacher.
Na, Sie wissen schon!, rief er und ließ mich stehen. Ich beugte mich zurück, lief rasch in die entgegengesetzte Richtung.
Die Semesterferien waren also gelaufen. Paranoide Wahnvorstellungen und Fluchtreflexe würden die nächsten Monate bestimmen: Auswanderungsphantasien, Internetpornos, Houllebecq lesen. Ich fragte mich, ob die gebraucht gekaufte Ausgabe von Hegels Phänomenologie noch irgendwo in zweiter Reihe in meinem Regal stand, oder ob sie damals nach den Magisterprüfungen der Säuberungswelle zum Opfer gefallen war. Noch auf dem Heimweg krochen mir Hegel-Sätze in den Sinn und blieben wie fette schwarze Insekten in meinem Bewusstsein kleben.
Der Gegenstand ist in einer und derselben Rücksicht das Gegenteil seiner selbst: für sich, insofern er für Anderes und für Anderes, insofern er für sich ist.
Ich bog mit dem Fahrrad gerade bei Möbel Kraft in die Altendorfer Straße, da drängte mich ein riesiger, dem Nichts entsprungener Sattelschlepper von der Fahrbahn, dessen sinnliche Gewissheit sowohl an sich als auch für sich etwas von einer einfachen Negation ausstrahlte. Dem Monstrum ausweichend krachte ich über den Bordstein seitlich auf den Gehweg, rammte beinahe eine Litfaßsäule und kam direkt vor einem Straßencafé in einem Pulk kaum bekleideter, junger Frauen zum Stehen.
Das Selbstbewusstsein erreicht seine Befriedigung nur in einem anderen Selbstbewusstsein... hätte ich fast gesagt. Sie kicherten trotzdem und gingen zur Seite, damit ich weiter rollen konnte.
Als ich zuhause ankam, klingelte das Telefon. Das Display zeigte Nummer unterdrückt an. Immer, wenn Mareile von ihrer Kykladeninsel anrief, stand da Nummer unterdrückt. Sie war im Sonderurlaub, was bedeutete: die meiste Zeit auf Amorgos. Berufliche Neuorientierung.
Hallo, mein Maulwurf... ich bin´s...
Hallo, mein Schmetterling, du bist´s...
Die Verbindung war einigermaßen schlecht.
Bei euch auch schon beim Baden über angeschwemmte Flüchtlinge gestolpert? Womöglich noch lebendige?
Sie gab mir den allgemeinen Lagebericht (Meer blau, Himmel blau, 30 Grad im Schatten, nein, keine Flüchtlinge, Amorgos sei zu weit weg von der türkischen Küste). Dann erzählte sie mir von ihren neuesten Überlegungen zu ihrer beruflichen Zukunft.
Die letzten Jahre hatte sie als Sachbearbeiterin in einer Sprachenschule gearbeitet, die Lust verloren und sich für ein Jahr eine Auszeit nehmen können.
Unbezahlt, natürlich. Die freie Zeit neigte sich jetzt dem Ende zu, aber Mareile wollte nicht wieder zurück ins alte Tätigkeitskästchen. Also schrieb sie jetzt Bewerbungen. So zwischen Strand und Tanzbar. Bei einem Café Frappé in ihrem Stammcafé, zwischen zwei Flirts mit einem der jungen griechischen Kellner, durchsuchte sie das Job-Angebot von Zeit-online, und da sie die Anforderungen in den Stellenanzeigen nicht wirklich ernst nahm, bewarb sie sich auf so ziemlich alles, egal ob Mobilitätskoordinatorin an einer Technischen Universität oder Hubschrauberpilotin.
Ich bewunderte ihre Kaltschnäuzigkeit.
Da ihre Post bei mir ankam, und ich sie öffnen durfte, berichtete ich ihr telefonisch von den ersten eintreffenden Absagen.
Egal, die Masse macht´s, prophezeite sie mir siegessicher, wird schon noch.
Oder ich eröffne ein Bordell hier auf Amorgos...
Aha. Du als Puffmutter?
Als Edelprostituierte.
Mareile kicherte klingelnd. Das Unterseekabel gab einen Echoeffekt dazu.
Ich suche mir die Kunden selbst aus! Du hast natürlich extra Erlaubnis!
Extra Erlaubnis?
Ja, wie heißt das? Exquisite Rechte...
Du meinst, ich darf umsonst?
Genau! Alle anderen müssen Schlange stehen und zahlen!
Alle?
Stille am anderen Ende der Leitung. Ich stellte mir vor, wie sie an dem öffentlichen Fernsprecher stand, der wiederum am Dorfplatz der Chora montiert war, direkt neben der kleinen Post. Ich wusste mittlerweile von ihrer Affäre mit einem älteren Griechen, einer Urlaubsbekanntschaft. Allerdings wohnte dieser mir auf Anhieb unsympathische Mensch nicht in der sicheren Entfernung eines griechischen Eilands mit Blick auf die türkische Küste, sondern in Hessen.
Alle außer mir und deinem Rollator-Griechen, half ich ihr. Sie druckste herum, gab konsonantfreie Laute von sich. Ich weiß auch nicht, hörte ich sie. Er ist halt so verliebt in mich... Und, naja, ich bin eben körperlich angezogen von ihm.
Ihr Frührentner war angeblich mit Sixpack unterwegs.
Ich dagegen hatte an Muskeln nur das notwendige Mindestmaß, um die Chipstüte aufzukriegen.
Gelegentlich versuchte ich ein paar Liegestützen. Aber ohne rechten Eifer.
Wie läuft´s denn mit Reth?, fragte sie, um abzulenken.
Gut. Ich habe ihn fast soweit, dass er denkt, ich sei doch kein vernunftbegabtes Wesen.
Du musst auf ihn zugehen.
Ich könnte ihn auf ein Glas Benzolsäure einladen.
Mareile versuchte oft, mir positive Anstöße zu geben.
Da kann sie dann sehr hartnäckig sein. Also versuchte ich wiederum, ihre konstruktiven Vorschläge (Du musst noch einmal nachfragen; Wart nicht einfach ab, sondern ruf da an; usw.) ins Leere laufen zu lassen.
Diesmal halfen vielleicht ein paar Fakten.
Reth hat mir ein Hegel-Seminar fürs nächste Semester aufgetragen. Du weißt doch: Hegel! Eine Zeitlang hatte ich auf dem Klo dieses kleine Hegelbüchlein liegen. Differenz der Systeme von Fichte und Schelling, oder so ähnlich. Weißt du noch? Das hast du doch immer weggelegt, wenn du duschen wolltest.
Das lag da Monate. Höchstens zwei Zeilen habe ich jedes Mal geschafft, bei Verstopfung vielleicht drei.
Und jetzt ein Hegel-Seminar. Außerdem hat er mir einen Berichterstatter angekündigt.
Berichterstatter?, fragt sie arglos, und es summt in der Leitung.
Einer seiner Studenten, der ihm dann mitteilt, ob ich meinen Lehrauftrag nicht für politische Propaganda missbrauche. Reth würde sagen, zur Aufhetzung im Sinne totalitaristischer Fehlschlüsse.
Ah.
Das Ah klang wie ach, komm, du spinnst. Ja, kann sein, dachte ich mir. Also sagte ich etwas versöhnlicher: Dieses Hegel-Seminar macht mich ein bisschen nervös. Auf jeden Fall wäre es ein Fest für Reth, wenn ich mich da blamiere.
Das klappt schon, meinte Mareile.
Das mit dem Blamieren?
Quatsch. Das mit dem Seminar.
2
Vorletzte Ferienwoche. Um 12 war Sprechstunde. Für den Nachmittag plante ich weitere Hegel-Lektüre in der Bibliothek, zwischendurch Milchkaffee in der Cafeteria. Ich war immer bemüht, keine Termine vor 12 zu haben, um nicht früh aufstehen zu müssen. Es gab Kollegen, die legten ihre Seminare auf 8:15. Manche einfach aus Gehässigkeit den Studenten gegenüber.
Manche auch, weil sie der Meinung waren, nur ein mit Arbeit ausgefüllter Tag sei ein gelungener Tag.
Rudolf Janisch zum Beispiel. Der zitierte bei diesem Thema immer wieder gern den angeblichen Napoleon-Spruch über das Schlafbedürfnis von Männern, Kindern und Idioten. Ich unterdrückte den Gedanken an Janisch, schlüpfte in den alten, aber gut erhaltenen Mantel meines Großvaters und verließ meine Zwei-Raum-Küche-Diele-Bad-Dachgeschosswohnung und schloss ab. Bei mir jedenfalls gab´s am frühen Morgen keine Seminare. Und sogar die dienstägliche Sprechstunde um 12 hatte ich schon bereut, wenn ich vorher den Abend (und die halbe Nacht) mit Jamel zugebracht hatte.
Reth hatte mir aufgetragen, mich um die Bewerber für die freie Stelle als Studentische Hilfskraft zu kümmern. Jetzt, wo Sie schon ein Hegel-Seminar geben, können Sie sich doch weiter unentbehrlich machen! Für Lappalien hatte Hochwürden keine Zeit. Bezahlt wurde ich für dergleichen zwar nicht, aber der Gute Wille zahlt sich ja bekanntlich auch irgendwann aus. Also hatte ich die Bewerber gesichtet, würde heute noch die Vorstellungsgespräche führen und schließlich jemanden empfehlen, der als einzige Bedingung das Grundstudium gemeistert haben sollte. Der Job bestand im Wesentlichen aus Kopieren und Sortieren für Frau Grünbein, Sekretärin und Seele des Dekanats. Beim Aushändigen der eingegangenen Bewerbungsformulare hatte sie mir zugeraunt: Wenn möglich, dann einen jungen Antonio Banderas. Ich versprach ihr, mir alle Mühe zu geben und lud dann aber fünf Studentinnen und nur einen männlichen Bewerber ein.
Ich angelte mein altes Samsung-Handy mit der Aldi-Prepaid-Karte aus der Manteltasche, um zu prüfen, wie ich zeitlich so im Rennen lag. 11:35. Da konnte ich es langsam angehen lassen. Fünfzehn Minuten bis zur Universität. Ich fand mein 250-Euro -Fahrrad zwischen den ganzen Spitzenfahrrädern im Hof und drehte das Zahlenschloss auf Monat und Tag meiner Geburt.
Das Universitätsgelände war in den frühen sechziger Jahren noch ein Stück Brachland hinter dem Güterbahnhof gewesen. Nach und nach wurden damals die letzten Zechen auf dem Stadtgebiet geschlossen, der Güterverkehr nahm ab, auch das Schmiedewerk direkt an der Ruhr musste seinen Herzschlag anhalten. Angeblich hatte er die feinen Nerven der Bewohnern in den besseren Vierteln im Süden zu sehr strapaziert. Schließlich wurde auch der Güterbahnhof stillgelegt, und der Rat der Stadt sprach sich dafür aus, das Brachland zwischen altem Güterbahnhof und den Kohlevierteln im Norden künftig einer neu zu gründenden Universität zur Verfügung zu stellen. Was dann aus dem Boden gestampft wurde war ein Festungsring von Fertigbauteilen mit rasch ergrauendem Sichtbeton und wehrturmartigen Auswüchsen, geräumig genug für je drei Fahrstuhlschächte. Dazu wurde noch ein Farbleit- und Raumnummernsystem erdacht, das Studenten und Lehrkräfte auf die Suche nach Räumen mit Namen wie R12-S06-B46 schickte.
In den Semesterferien waren einige Umbauarbeiten im geisteswissenschaftlichen Komplex fertig geworden. Verschönerungen am Vorplatz konnte ich nicht feststellen. Vielleicht war der Springbrunnen neu gestrichen worden, aber ich war mir nicht sicher.
Als ich fast an den nun automatischen Schiebetüren des Haupteingangs war, fiel mir eine Bodenplatte auf, die vorher nicht da gewesen war:
EINE KÜNSTLERISCH-ARCHITEKTONISCHE PLATZ-GESTALTUNG REALISIERT ZUM 40-JÄHRIGEN BESTEHEN DER UNIVERSITÄT DURCH SPENDEN VON:
Bankhaus Trinkaus & Burkhardt KGaA
COMMERZBANK Aktiengesellschaft
DEMINEX GmbH
Ferrostahl AG
HOCHTIEF
MASSEBERG GMBH
Norddeutsche Landesbank Girozentrale
Ruhrgas AG
STEAG AG
Westdeutsche Landesbank Girozentrale
Volkswagen Stiftung
Ich versuchte einen großen Schritt über sie hinweg. Wenn das so einfäch wäre, dachte ich noch, als ich – lupus in fabula – Rudolf Janisch seitlich vom Parkhaus her kommen sah. Allein sein federnder Gang war unverkennbar, dazu der kahle Schädel. Grauer Anzug natürlich.
1992 hatte Janisch seinen berüchtigten Artikel für eine weitverbreitete Sonntagsbeilage veröffentlicht.
Janisch hatte darin vehement vier Cambridge-Professoren verteidigt, die sich während der Verlesung der Ehrendoktor-Kandidaten unerwartet erhoben und beim Namen Jaques Derrida ihr non placet gerufen hatten. Über sieben lange Spalten geißelte Janisch seinerseits Derrida als Gift für den Geist junger Leute und behauptete, der französische Philosoph setze die gesamte Zivilisation in Gänsefüßchen. 2005 berief Reth den Privatdozenten Janisch in Absprache mit der Volkswagen-Stiftung auf eine lukrative Stiftungsprofessur für Wirtschaftsethik und Wirtschaftskultur. Seitdem erfreute sich jede neue Generation von Erstsemestern an Seminarthemen wie Ethische Ökonomie, Philosophie in wissensbasierten Unternehmen oder – mein Klassiker – Philosophische Analyse der Außen- und Innenwirklichkeit eines Unternehmens. Aber immer gab es in den ersten Sitzungen bei Professor Janisch auch jemanden, der ein paar Kopien mit seinem berühmten Artikel von 1992 herumgehen ließ. Die Studenten nannten ihn daher nur noch Professor Gänsefüßchen.
Ich steuerte direkt auf den Treppenaufgang zwischen den Fahrstuhltüren zu und nahm immer zwei Stufen gleichzeitig, damit ich sicher sein konnte, nicht von Gänsefüßchen eingeholt zu werden.
Als sie eintrat, war es, als flute helles Licht den Raum. Ich wusste sofort, dass alle weiteren Vorstellungsgespräche irrelevant sein würden.
Was für eine unverzeihliche Diskriminierung wäre es gewesen, dieser Studentin nicht die Stelle als Hilfskraft zu geben, nur weil sie bezaubernd war.
Ich blieb sitzen und tat gelangweilt.
Name?
Rother, Lilly...
Sie hatte grün-braune Augen. Langes, honigblondes Haar, das offen und glatt auf ihre Schultern fiel.
Seitenscheitel. Aber nicht streng.
...und würde gerne die Herausforderung...
Ich nickte ihr aufmunternd zu und konzentrierte mich auf ihr Gesicht. Zweifellos ein bemerkenswert schönes Gesicht. Gleichmäßig natürlich, oval natürlich, junge Haut, empörend makellos, dunkle, zur Nasenwurzel sich verbreiternde, fein über den Wangenknochen auslaufende Augenbrauen, die den umwerfenden Gesamteindruck verstärkten.
Stille trat ein.
Sie hatte offensichtlich alles gesagt, was sie sich vorgenommen hatte und schaute mich nun irritiert an. Sie erwartete ein paar stellenrelevante Fragen.
Flugs angelte ich in meinem Restbewusstsein nach irgendeinem abgehangenen Satz und guckte streng: Kennen sie eigentlich den Unterschied zwischen transzendent und transzendental?
Sie blinzelte. Eine goldene Strähne fiel ihr übers Schlüsselbein.
Ich lächelte ein breites Entwarnungslächeln.
Ist ja auch egal. Gehen Sie davon aus, das mit der Hilfskraftstelle wird schon. Ich melde mich, so in ein paar Tagen.
Damit stand ich auf und beendete das Vorstellungsgespräch. Sie stand auch auf. Sie war genauso groß wie ich. Sie lächelte unschlüssig. Ich reichte ihr die Hand, um sie mal anzufassen,und öffnete mit Schwung die Tür, hinter der eine Versammlung grauer Mäuse erwartungsvoll aufblickte. Den jungen Typen in T-Shirt und Fetzenjeans, lässig im Türrahmen zum Fachschaftraum gelehnt und gutaussehend wie ein Hollywoodschauspieler, würdigte ich keines weiteren Blickes.
Der hat bestimmt einen Schwanz wie ein Massenmörder, dachte ich mir. Und zu den Studentinnen: Die nächste, bitte.
Willkommen in Dr. Hollanders Sprechstunde. Praxis für psychosomatische Phallozentrik.
Das mit den Frauen hat mein Leben bestimmt. Weniger in der Realität als in der Imagination. Ich bin weder ein erfolgsverwöhnter Beischläfer, noch ein notorischer Allesbrenner. Meine gesamte Lebenshaltung gründet auf kreativer Passivität. Das gilt auch für Frauen. Verführung widerfährt mir, ich bin niemand, der auf Eroberungen aus ist. Schon im Studium, wenn ich zwischen den Seminaren in der Cafetria über Käsekuchen und Pappbecherkaffee blicklebte, waren mir die Eindrücke weiblicher Schönheit an sich selbst genug. Ich war der bewegte Unbeweger, wie Hegel es vielleicht formuliert hätte.
Mit Mareile war das anders. Als ich sie auf einer Slawistenparty kennenlernte, war alles so leicht und unvermittelt, als sei ein Schmetterling auf meiner Schulter gelandet. Einer, der nicht sofort wieder weg fliegt. Der genau dort, jetzt und hier, auf deiner Schulter die Sonnenstrahlen genießen will.
Wir redeten über irgendetwas, und es fühlte sich nicht anstrengend an. In einer Ecke gegenüber der Biertheke stand ein Klavier, und sie setzte sich mit mir dahin, weil ich ihr demonstrieren wollte, wie einfach das mit dem Improvisieren ist (auf dem Klavier improvisiere ich immer, weil ich gar nicht richtig Noten lesen kann und in der Regel zu faul bin, mir überhaupt irgendwas ordentlich zu erarbeiten). Aber Mareile ließ sich nichts anmerken, sie gab mir das Gefühl, mein Herumgeklimper über drei notdürftige Blues-Akkorde wäre musikalisch von außerordentlicher Verwegenheit.
Mensch, das ist doch toll. Ich kann ohne Noten gar nichts spielen.
Ich dachte mir, das könnte die richtige Frau sein.
Auch das Tauschen der Telefonnummern danach und der gemeinsame Gang zur Bushaltestelle, obwohl sie doch ein Fahrrad neben sich herschob (weit nach Mitternacht war es auch schon), ergaben sich wie selbstverständlich. Wir standen in der kühlen Novemberluft, wir kannten uns keinen ganzen Tag, wir wussten fast nichts voneinander. Aber dieses etwas mehr als nichts war wie die kleine Scherbe, ohne deren Fund ein zweifelnder Archäologe nicht mehr an die Existenz dieser anderen, immer nur vermuteten Menschheit hätte glauben können.
Dann kam der Nachtbus. Wie wär´s, kommst du mit zu mir? So ein Satz ging mir durch den Kopf, als wir uns mit einer kurzen Umarmung verabschiedeten.
Aber ich sagte ihn nicht. Ich kam mir vor wie ein Kind am Heiligabend. Die Arme schon voller Geschenke und da entdeckt es noch ein allerletztes Paket unter der Weihnachtstanne: Ist das da nicht auch noch für mich?
Eine Wochen später, kurz vor Weihnachten, klingelte das Telefon. Seit der Sache mit Mareile wartete ich nicht mehr, bis der Anrufbeantworter sich meldete, sondern nahm sofort ab. (Was dazu führte, dass ich nacheinander einen Anlageberater der Sparkasse, eine Frau von der Kriegsgräberfürsorge und jemanden abwimmeln musste, der behauptete, für ein neutrales Marktforschungsinstitut anzurufen, dabei weiß doch jeder, dass die letzte Frage immer eine Fangfrage ist, die einen dazu verleitet, irgendwelche Beratungsangebote anzunehmen und schon hat man von montags bis freitags das Wohnzimmer voll mit Versicherungsvertretern.)
Jedenfalls nahm ich den Hörer ab, bevor der Anrufbeantworter meine Ansage abspulte: Leider haben Sie sich verwählt! Sollten Sie der gegenteiligen Ansicht sein, so bedenken Sie, dass die korrekte Bewertung einer Handlung nicht nur von der Handlungsintention abhängt.
Hallo?
Jürg?
Ja, hallo, bist du´s?
Wer?
Na, Mareile!
Ja. Hallo.
Ich war etwas nervös. Aber eigentlich lief das Gespräch ja ganz gut.
Am Telefon ist es oft schwierig, das vertraute Gefühl mit Leuten wiederzufinden, das man bei ihnen normalerweise hat. Aber mit Mareile war das kein Problem.
Ich dachte, ich ruf mal an.
Ja, das dachte ich auch schon mal.
Dass ich anrufe?
Ja. Nein. Dass ich dich anrufe.
Hast du aber nicht.
Ja. Telefonieren ist so eine Sache.
Hm. Ja. Verstehe ich.
Großartig, dachte ich, endlich jemand, mit dem man sich auch am Telefon gut unterhalten kann. Mareile fragte dann, ob ich einen Führerschein hätte. Und ob ich für sie den Umzugswagen fahren könnte, sie wolle jetzt ihre Sachen aus dem Studentenwohnheim in ihre erste eigene Wohnung bringen. Es gibt für einen Geisteswissenschaftler nichts besseres, als sich nützlich machen zu können. Also trafen wir uns zwei Tage später und früh am morgen auf dem Hof von Robben & Wientjes an der Altendorfer Straße. Leider war Glatteis, und es wurden keine Wagen vermietet.
Ein paar Tage später aber klappte es. Wir fuhren zusammen zum Studentenwohnheim, holten woanders noch Sachen ab, und trugen alles in ihre neue Wohnung. Nur wir zwei.
Wieder ein paar Tage später kam mit der Post ihre Einladung zum Abendessen.
Mareile am Klavier. Ich finde sie hinreißend, wenn sie spielt. Die Mondschein-Sonate. Vom Blatt. Die tiefe Ernsthaftigkeit, mit der sie das Stück bis zu Ende spielt ohne aufzuschauen und mich zwischendurch anzusehen, berührt mich tief. Es ist, als sei ich gar nicht da.
Das Klavier steht mitten im Raum auf einer Lichtung zwischen Umzugskisten, blauen Plastiksäcken, noch gerollten, schon halb verschlissenen IKEA-Teppichen und verschiedensten noch mit Kleinkram gefüllten Behältern: Blumentöpfe, Papierkorb, Bananenkisten.
Während Mareile spielt, stehe ich hinter ihr und studiere abwechselnd die winzigen schwarzen Punkte vor ihr (die Noten) und ihren nackten Nacken unter dem hochgesteckten, weizenblonden Haar. Ich würde ihn gern berühren, aber dafür ist es noch zu früh.
Erst wird sie die Sonate zu Ende spielen, dann setze ich mich zu ihr auf das Klavierbänkchen, und wir küssen uns. Dann werden wir in ein billiges indisches Restaurant gehen (mehr eine Imbissstube) und danach unsere erste gemeinsame Nacht verbringen.
3
Großartig, ganz großartig. Ich hörte Bertmann schon durch die geschlossene Tür, noch bevor er klopfte. Kollege Bertmann, langjähriger wissenschaftlicher Mitarbeiter, Schwerpunkt Scholastik und Philosophie der Rennaissance, und eine Art katalysatorisches Kommunikationskörperchen zum Transport von Neuigkeiten, war immer ein Pläuschchen wert. Ich ließ ihn klopfen und tat, als sei das Büro leer. Erwartungsgemäß war er so nicht zu überlisten. Die Tür öffnete sich einen ziemlichen Spalt und sein von Aknespuren gezeichnetes, rundliches Gesicht schob sich, gefolgt von einem sehr kurzen Hals, in Raumüberblicksposition. Ich blickte ihn, die Beine auf dem Schreibtisch, die Tageszeitung in beiden Händen, wortlos an. Hab Sie doch reingehen sehen, Hollander!
Ich unterdrückte den Impuls weiterzulesen und erwartete, Blickkontakt haltend, die neueste Neuigkeit.
Er kommt! Hat zugesagt! Mitte November!
Offensichtlich ging es um die Ringvorlesungen im Wintersemester.
Wer hat zugesagt?
Der Bundespräsident!
Aha. Da konnte der Herr Dekan auf seiner schon langen Liste wieder einen Erfolg verbuchen. Reth war immer auf Großwildjagd für die Ringvorlesungen, sein eigens für seine Gewichtsklasse installiertes Lieblingsspielzeug. Im letzten Jahr hatte er immerhin, diesen Niederländer gewinnen können, der sich gerne vor laufenden Kameras geistig einen runterholte. Ich hatte ihm mal Chomsky vorgeschlagen, aber da war ich noch neu hier.
Ich verströmte selbstredend vollkommenen Gleichmut.
Was, der Prediger?
Bertmann hob die kaum vorhandenen Augenbrauen, nickte dann und suchte, noch immer gegen die halb geöffnete Tür gelehnt, nach einer stabilen Körperhaltung. Er wusste, wie wenig ich es schätzte, wenn er unaufgefordert in mein Büro lief.
Und? Hat er auch gleich ein Thema für seinen Vortrag angeboten?
Bertmann nickte wieder, was seinen Balanceakt zu erschweren schien, er also ganz ins Zimmer trat.
Sakko, Sandalen, grüne Socken. Ich seufzte.
Freiheit und Verantwortung!
Dazu gab es allerdings einiges zu sagen. Oder eben nichts. Ich winkte Bertmann mit einem dezenten Wippen der Feuilletonseiten aus dem Raum und ließ das Käseblatt dann ganz sinken.
Schon kurz vor fünf. Das fahl gewordene Ruhrgebietslicht kündigte von der anstehenden Dämmerung. Herbst. Ich machte mich auf, in die Universitätsbibliothek zu gehen. Recherche.
Dreizehntes Jahrhundert. Eines meiner gelegentlichen Steckenpferde. Schließlich lehrte ich Philosophiegeschichte, mal abgesehen davon, dass es im Spätmittelalter so was wie Philosophieeigentlich gar nicht gab. Den Aufschrei der Fundamentalkatholiken hinsichtlich des heiligen Thomas kann man da getrost überhören. Der kam schließlich immer nur zu dem schon vorher beabsichtigten Ergebnis mit seinen Gedankengängen. Kein Risiko, keine Philosophie.
Im Gang zwischen unseren Denkkammern und Sekretärinnen-depots kam mir dann Almuth entgegen. Almuth Richard-Meyer. Ich kannte sie schon aus der Studienzeit. Der Doppelname war später dazu gekommen. Den Herrn Meyer hatte ich dann auch kennengelernt. Germanistikprofessor, aber andere Universität und, soweit ich wusste (von ihr), praktizierender Hypochonder.
Hübscher blauer Rock, dachte ich, als sie näher kam.
Schwarze Stiefel, hellgraue Strickjacke. Sie drehte den Kopf demonstrativ von mir weg.
Das war wegen der Haarfarbe. Ihre war eigentlich braun. Sie trug das Haar lang und meist offen, das Stirnhaar als Pony geschnitten. Aber seit zwei Monaten war sie blond. Ich wusste nicht recht, was in sie gefahren war und hatte ihr das auch mitgeteilt.
Ihre Ehe mit Dozent Meyer war doch schon länger defekt, das konnte es nicht sein.