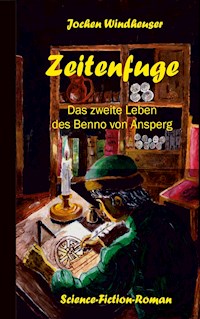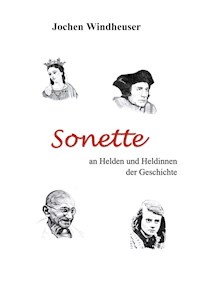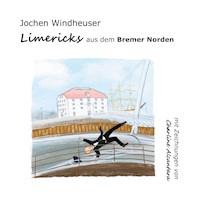6,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: BoD - Books on Demand
- Kategorie: Poesie und Drama
- Sprache: Deutsch
Lyrik ist Sprache in mehr oder weniger strenger Formgebung. Sie hat viel mit der Musik gemein: Sie hat Rhythmus, sie hat Melodiebögen, sie ist geprägt von den Zyklen der menschlichen Atmung. Dieser Band spielt mit höchst unterschiedlichen Formen der Lyrik. Beginnend mit einer sehr freien Form, greift er auf das klassische Maß des Hexameters zurück wie auch die kantige Gestalt des altnordischen Königsgedichts. Ein Kapitel bietet die immer wieder lebendige Form des Sonetts. Eine eigenwillige, ausbaufähige Idee eng symmetrisch aufgebauter Gedichte über Tierbewegungen blitzt auf, gefolgt von Kapiteln mit beliebten Kurzformen: Limericks, Xenien. Im Schlusskapitel entfaltet sich ein bunter Strauß von Einzelgedichten mit je eigenem Charakter.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 33
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Cover:
Laura Windheuser
Prosa sind nur Worte, Verse aber eine Perlenschnur.
aus Tausendundeiner Nacht, 35. Nacht: Ali Nur ed-Din
Inhaltsverzeichnis
Vorwort
I Tritonus – Sieben Gedichte über die verminderte Quinte
II Das Wort und das Land
III Tiere in der Bewegung
IV Versuche in der Fornyrðislag
V Sonette
VI Limericks aus Bremen und umzu
VII Xenien
VIII Einzelgedichte
Zum Autor
Vorwort
Wenn wir uns etwas erzählen, sei es mündlich oder schriftlich, geschieht dies normalerweise in Prosa. Das heißt: Die Sprache selbst mit ihren Regeln und Gewohnheiten gibt die Form vor. Wir können einfach erzählen oder kompliziert, mit vielen Nebensätzen und anderen Konstruktionselementen des Satzbaus. Aber wir gehen nicht auf die Suche nach der besonderen Form, um ihr die Sprache anzupassen, sie ihr unterzuordnen, um der Schönheit dieser Form willen.
Das aber tun wir in der Lyrik. Gedichte brauchen eine Form, die sie von der Prosa abhebt. Viele Formen haben sich in den Sprachen der Welt herausgebildet. Oft sind sie mit musikalischen Formen verwandt. Wahrscheinlich sind alte lyrische Formen untrennbar zusammen mit musikalischen Elementen entstanden. Schon das Wort „Lyrik“ kommt ja von der Lyra, der Leier, einem altgriechischen Instrument.
In vielen Kulturen, so scheint es, wurden vor einer Verschriftlichung die Erzählungen der Barden, der Alten, der Künstler in musikalischer Form überliefert und vorgetragen. Sie enthielten Rhythmen, Melodien, wiederholte Phrasen, genau wie die Musik, die etwa zu Tänzen aufgespielt wurde. Oft waren es Lieder, traditionelle Gesänge, deren Gestalt jeder kannte und deren Form man erwartete, wenn der Sänger oder Erzähler kam und am Feuer seine Geschichten vortrug.
Ich habe mich bisweilen gern an sehr verschiedenen lyrischen Formen versucht. Warum? Wenn ich ehrlich bin: einfach aus Freude an der Form. Vielleicht hat mich meine Nähe zur Musik dazu angesteckt. Manche dieser Formen sind sehr streng. Will man sie wirklich ausfüllen, kommt man um eng gesetzte Grenzen nicht herum. Wenn man ungenau ist mit den Hebungen, den Zeilenlängen oder den Reimen, geht es zwar schneller von der Hand, verletzt aber das Formgefühl. Treue zu den lyrischen Regeln, gerade das ist die Herausforderung!
Das Buch gliedert sich in acht Kapitel, und jedes enthält sieben Gedichte oder thematische Teile. Die Gedichte in Kapitel I sind Grenzgänger. Sie bewegen sich nahe an Prosaformen. Sie handeln jedoch von Musik, von der Musik der Schwarzen in Amerika und im Kontrast dazu von der Musik der dominierenden Weißen, und diese Musik findet sich in den Rhythmen und Versformen bestimmter Teile der Gedichte wieder.
Kapitel II greift dagegen eher streng auf die klassische, im Ursprung griechisch-antike Form der homerischen Hexameter zurück.
Die Form der Gedichte im Kapitel III entspringt einem besonderen Einfall. Alle Gedichte haben einen verwandten Inhalt und sind hinsichtlich Reimverteilung, Zeilenlängen und Hebungen gleichartig gebaut. Eine kleine, gediegene Spielerei!
Das Kapitel IV bildet dazu einen extremen Kontrast. Hier wird die Form der nordischen Hofgedichte aus dem frühen Mittelalter nachempfunden: Stabreime nach bestimmten Regeln, zwei Strophen zu jeweils acht kurzen, substantivischen Zeilen.
Im Kapitel V huldige ich dem Sonett, einer Gedichtform, die im Laufe der Literaturgeschichte (z.B. von Petrarca, Shakespeare, Rilke) immer wieder, mit leichten Abwandlungen, neu belebt wurde. Dieser Form fühle ich mich besonders verbunden.
Die beiden folgenden Kapitel betreten eine heitere literarische Welt. Sie behandeln kleine, aber ebenso strenge Gedichtformen, die zumeist einfach spaßig sein wollen, gern gewürzt mit „höherem Blödsinn“ und „schwarzem Humor“ (Limericks), oder die – wie schon seit der Antike (Martial) und der deutschen Klassik (Schiller, Goethe) – Ausdruck eines knapp gefassten, aber hoffentlich treffsicheren Spottes sind: Xenien.
Den Abschluss bildet ein Kapitel mit formal sehr unterschiedlichen Einzelgedichten, die sich zum Teil wieder deutlich an musikalische Formen anlehnen.
Zu Beginn der jeweiligen Kapitel gebe ich noch kurze Hinweise auf bestimmte Aspekte der darin enthaltenen Gedichte: Formale Regeln, Ideen beim Aufbau, Herkunft der Einfälle.
Bremen, im Februar 2025
Jochen Windheuser