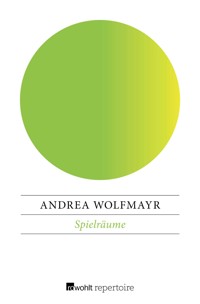
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Rowohlt Repertoire
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Der Kampf einer jungen Frau um jene notwendigen Spielräume, die keinem Menschen von vornherein offenstehen: Über die Trennung von ihrem ersten und das Zusammenleben mit einem zweiten Mann, als Schwangere und dann als Mutter eines kleinen Kindes kommt sie zu dem Bewußtsein, daß sie ihr Leben nicht durch andere Menschen rechtfertigen kann und darf.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 251
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
rowohlt repertoire macht Bücher wieder zugänglich, die bislang vergriffen waren.
Freuen Sie sich auf besondere Entdeckungen und das Wiedersehen mit Lieblingsbüchern. Rechtschreibung und Redaktionsstand dieses E-Books entsprechen einer früher lieferbaren Ausgabe.
Alle rowohlt repertoire Titel finden Sie auf www.rowohlt.de/repertoire
Andrea Wolfmayr
Spielräume
Ihr Verlagsname
Über dieses Buch
Über Andrea Wolfmayr
Andrea Wolfmayr ist 1953 in Gleisdorf bei Graz geboren. Nach dem Abitur studierte sie zunächst Musik, dann Germanistik und Kunstgeschichte. Sie wurde Buchhändlerin, begann zu schreiben und erhielt 1980 für das Manuskript ihres ersten Romans «Spielräume» den Steinhausen-Literaturpreis für Buchhändler.
Inhaltsübersicht
Für Joe, Franz, Ingrid und Mama
Erster Teil Die Trennung
Hörst du noch irgendwas
es ist so still
mein Ohr ist taub
mein Aug ist trüb
es ist fast nichts mehr da
das mich bewegt
ich sah mein Nachtgesicht
im Fenster vis-à-vis
ich bin mir selber fremd
vielleicht bin ich schon tot
nur wenn im Wind hangauf
die Rebe rauscht
der rosa Wind
mit vielen Bändern fliegt
der rosa Wind –
da wach ich auf
und fühl
wie trocken meine Lippen sind
Friederike Mayröcker
Ich les einen Roman von Knut Hamsun, einen Roman über die Ehe einer jungen Frau, die nicht zu Haus bei den Kindern bleiben will, die sich selbstverständlich alle Freiheit nimmt, die sie braucht, die einen Mann hat, der still und stark und Geschäftsmann ist und ihr alle Freiheit läßt, weil er sie liebt und weil er hofft, daß sie einmal zu ihm zurückkehren wird.
Aber die Ehe zerbricht, und ihr hilft ihre Freiheit nicht mehr, weil der andere Mann, den sie liebt, sie verläßt, und sie hat alle Sicherheit verloren und will zurück zu ihrem Mann, aber der will sie nun auch nicht mehr.
Doch sie finden einander wieder, und ihre Beziehung wird zu einer «richtigen» Ehe, sie will nichts mehr von ihren früheren Künstlerfreunden wissen, sie lebt nur mehr für ihren Mann und ihre Kinder, und alle sind sie glücklich.
Und ich les das und weiß: Es geht nicht, es stimmt nicht, so kann ich nicht leben, ich kann nicht nur für Mann und Kinder dasein.
Aber etwas wird spürbar von so großer Liebe und starker Zuneigung, daß ich weiß, er hat recht, der Hamsun, er hat ja so recht, ich brauch das, jeder braucht das, und ich bekomm solche Sehnsucht, daß ich gleich nach Hause laufen möchte zu meinem Mann, daß ich bei ihm sein und ihn festhalten möchte und ihm sagen, daß ich nie wieder weggehen will.
Er ist doch mein Mann, denk ich, wir sind verheiratet, ich möcht mein Leben lang immer nur mit ihm zusammen sein, ich hab nie etwas anderes erwartet; wir werden immer zusammen sein, das glaub ich auch jetzt noch, aber ich denk, daß es unmöglich geworden ist, durch meine Schuld ist es unmöglich geworden. Ich hab doch gewußt, was ich tu, ich hab doch gewußt, daß ich alles aufs Spiel setz. Ich hab ihn geheiratet, und ich hab gewußt, was ich tu, ein Leben lang, hab ich gedacht, mein Mann, ich bin seine Frau, nur seine Frau, hab ich gedacht.
Ich wein bei jeder Gelegenheit, ich kann nicht anders. Ich hab geträumt, daß meine Tante aufgetreten ist in einem Flamencorock und mit gestepptem Chinesenjackerl, in einem deprimierenden Rotlilaviolett und großblumig, alles weit und häßlich und faltig, und etwas ist da wie von schwarzen Vögeln und dunklen Wolken, und dann wach ich auf …
Im Hintergrund meines Traums andauernd Werbung, der Ö 3-Wecker ist eingeschaltet, wie immer, wenn ich bei Hans schlaf. Ich hör ihn telefonieren, er redet über die Sitzung, an der wir gestern teilgenommen haben, über die weiter zu unternehmenden Schritte; es macht mich müde, ich will nichts hören, ich verkriech mich in die Decke.
Er hatte versprochen, wir würden um halb neun aufstehen und Zeit haben für einen gemeinsamen Kaffee, aber als ich aufwach, ist es dreiviertel elf, und er zieht sich grad an.
Vor Überdruß mach ich die Augen wieder zu, und ich muß noch einmal eingeschlafen sein, denn als ich ihn das nächste Mal im Blickfeld hab, steht er an der Tür und bindet seine Schuhbänder.
Er muß gleich gehen, er hat so viel zu tun, er ist viel zu spät dran. Er erzählt mir schnell noch, was vorhin am Telefon besprochen wurde, es interessiert mich überhaupt nicht. Ich will nicht, daß er schon weggeht, ich will mit ihm in Ruhe frühstücken. Ich bin furchtbar traurig und nehm mich zusammen, um nicht gleich loszuheulen.
Er macht auf fröhlich und will mich nicht verstehen. Er geht in die Küche, kommt mit einer Kaffeetasse, Milch und Zucker zurück, stellt alles neben mich hin.
Ich bemüh mich, aus der trostlosen Stimmung rauszukommen. Er setzt sich an die äußerste Bettkante, er sollte längst weg sein, aber er traut sich nicht wegzugehen, weil er Angst hat, daß ich gleich schrei oder wein oder sonstwas Unsinniges mach, doch ich reiß mich zusammen, ich schick ihn weg. Er geht und schaut von der Tür her noch einmal zurück, und dann heul ich ein bißchen in den Polster.
Später ruf ich Manfred an, und der sagt, er wolle am Nachmittag nicht mit mir nach Hause fahren zu den Eltern, und auf einmal hab ich schon wieder alles im Hals heroben, ich kann nichts dagegen tun, ich komm mir nur so schrecklich alleingelassen vor, ich will, daß jemand bei mir ist und mich ein bissel anfaßt, ich will ja sonst nichts.
Da dreh ich den Plattenspieler ganz laut, und Elvis Presley singt «You’re nothing but a hounddog» und weiß nichts davon, wie schlecht es mir geht, der singt ganz einfach wild vor sich hin, der tröstet mich ein bissel.
Was soll ich sagen. Grad war ich noch voll von allen möglichen Gefühlen, von den intensivsten und stärksten Gefühlen, jetzt ist alles fort, so leer, ich weiß gar nicht, wohin ich mich wenden soll, alles sieht so verlassen aus, ich muß meine Arme verschränken und zum Fenster hinunterschauen.
Es sind kaum Leute unterwegs, die Sonne scheint. Sonntagvormittag. Ich hab noch mein Nachthemd an. Unten steht ein Mann von der Wach- und Schließgesellschaft und bewacht die Baustelle von diesem Schuhsupermarkt, es ist ihm sichtlich langweilig, und auch ich möchte gähnen vor lauter Nicht-wissen-was-Tun und Verlassenheit. Dabei hatte ich gedacht, das wird gut, wenn Manfred einmal wegfährt, da hab ich die Wohnung endlich für mich allein, da kann ich machen, was ich will, kann mir meine Zeit allein einteilen, brauch mich nicht anzuziehen, nicht zusammenräumen, kann überlaut Rolling Stones spielen, kann schreiben, trinken, mit dem Vogel spielen.
Aber jetzt ist er weg. Der Abschied war wie früher, seine langen dünnen Haare, wie Federn, sein Gesicht mit scharfen Kanten und blaß, diese Backenknochen und das Kinn voll eintägiger Bartstoppeln, sein Blick aus den Höhlen und dunkle Ringe unter den Augen, der Mund eigenartig lächelnd, und beide hatten wir Angst vor dem Wegfahren, vor dem Alleinsein.
In der Nacht bin ich fast jede Stunde aufgewacht vor Unruhe, den ganzen Abend war ich bleischwer und so müde, daß ich nicht einmal mehr mit ihm schlafen, sondern nur mich anschmiegen wollte, und ich bin auch sofort eingeschlafen. Ich weiß nicht, woher diese bleierne Müdigkeit kommt, ich hab das früher nicht gekannt, aber jetzt könnt ich oft im Stehen einschlafen, ich darf mich nicht hinsetzen, weil mir sofort die Augen zufallen, ich darf kein Buch in die Hand nehmen, nach ein paar Seiten bin ich weg.
Vor ein paar Tagen war ich so müde, obwohl ich vorher nicht sonderlich viel getan hatte, ich hab mich aufs Bett gelegt und «Pardon» gelesen, das heißt, ich wollte lesen, ich weiß nicht einmal mehr, worum sich’s drehte, denn kaum hatte ich zu lesen begonnen, kam es wie eine Welle über mich, so, als läg ich im Operationssaal und kriegte eine Narkose, und ich hab gedacht, jetzt kommt es, gleich bist du weg, aber ich hab mich gewehrt dagegen und doch gewußt, gleich kommt die nächste Welle, und ich hab gewartet und gedacht, siehst du, dieses Mal ist es noch viel stärker, wahrscheinlich überstehst du’s nicht, aber ich hab’s überstanden und noch ein paar Worte gelesen, und da ist schon die dritte Welle gekommen, und ich hab gedacht, was ist, wenn ich mich einfach hineinfallen laß, wenn sie mich mitnimmt, und ich bin hinein in die Welle, ich hab mich tragen lassen, und oben und unten waren nicht mehr zu unterscheiden, es hat mich gewirbelt, und ich bin von einem hohen Turm heruntergefallen. Ich bin in den Schlaf gefallen und war wie ein Stein und ganz bewußtlos.
Und als ich wieder zu mir kam, ist da laute Musik im Zimmer, Vince Weber «I’m the boogie man», und ich frag mich, ob ich denn das Radio so laut gedreht hab, da kommt Manfred neben das Bett und lächelt mich freundlich und milde an, und ich denk, ich bin tot, er ist so unwirklich, diese Musik ist so fremd, und als nächstes denk ich, wieso ist er angezogen, es kann doch erst sechs Uhr früh sein, bei diesem Dämmerlicht, und ich komm langsam und unter Kopfschmerzen zu mir. Ich kann nicht lächeln, mir tut alles weh. Ich war weit weg, ich bin steif von dem anderen Leben und quäl mich mühselig in meine alte Haut zurück und wachs wieder hinein in das alte Kleid und begreif allmählich: ich bin hier eingeschlafen, in meinem, unserem Bett, Manfred ist inzwischen heimgekommen. Ich streng mich sehr an und denk über jedes Detail nach, und langsam find ich den Faden wieder, und ich denk, ach ja, ich bin hier, und Manfred ist hier, und Hans ist hier, und nichts ist geklärt, und alles sieht aus, als wär es in Ordnung, und ich war so schwindlig und unglücklich, und ich bin aufgestanden, um mit ihm zu essen.
Ich hatte schon vorher alles auf den Tisch gestellt, guten Käse, roten Wein. Ich hatte mich gefreut auf dieses Essen, und nun brachte ich kaum einen Bissen hinunter, alles schmeckte farblos, nicht einmal der Wein war gut, dabei hatte ich solchen Appetit darauf gehabt, am Nachmittag hätte ich die Flasche bald allein ausgetrunken.
Es geht mir oft so in letzter Zeit: Ich streng mich an, so zu sein wie immer, aber die Dinge, die mir sonst leicht und selbstverständlich von der Hand gehen, mach ich nun mit Nachdruck und Überlegung, mach sie ausdrücklich und umständlich. Ich beobachte die Leute, ob denen keine Veränderung an mir auffällt, aber denen fällt nichts auf. Ich streng mich gewaltig an, aber anscheinend ist alles wie immer.
Ich werd aber müde davon und unwillig.
Gestern bei den Schwiegereltern dürfte Mama mich das erste Mal so erlebt haben. Sie hat es vermieden, mich anzusprechen, mich nur forschend angeschaut, ich weiß genau, was sie gedacht hat, daß sie fragen wollte, was los ist, daß sie sagen wollte: «Was verstellst du dich, leg die Karten auf den Tisch, du spielst falsch.» Und ich hab das gespürt und hab mich schrecklich angestrengt und hab weitergespielt und auf fröhlich gemacht und erzählt und mich abgequält, und die Zunge ist mir manchmal fast hängengeblieben. Ich hab langsam gesprochen und wie in Trance. Ich mußte mich manchmal schütteln, um das flaue Gefühl loszuwerden, ich hätte mitten im Wort abbrechen können. Ich tu mir furchtbar schwer, ich spiel mich, aber ich spiel mich schlecht.
Alles wird grau und kalt und häßlich und eng. Ich fühl mich allein. Ich hab gekocht: grüne Nudeln mit eine Sauce aus Sardellen und Knoblauch, aber es hat nicht gut geschmeckt, Manfred hat mehr als die Hälfte übriggelassen. Dabei hatte ich gehofft, er würde beim Essen ein wenig auftauen, aber nein, alles blieb kühl, wir haben einander nur mit Mühe ansehen können, unser Gespräch war eine nur von mir geförderte Konversation.
Er schaut an mir vorbei, er macht sein Puzzle, er raucht. Wieso kann er nicht einmal aufstehn und mich küssen oder umarmen? Wieso kann er mich nicht einmal fragen, wie’s mir geht, wie ich mich fühl? Wieso kann er mir nicht einmal was von sich erzählen? Er tut das fast nie mehr, es wird immer schlimmer. Ich hatte zwischendurch manchmal das Gefühl, es würde besser, aber das war ein Irrtum. Alles ist finster, und nichts wird in Ordnung gehn.
Mir ist schwindlig, alles dreht sich, ich glaub, das kommt vom Kreislauf und von den Tabletten, aber diesmal ist es besonders arg. Ich trink grad das zweite Achtel, es geht mir gut, aber alles bewegt sich, und etwas Dickes ist in meinem Kopf. Die Augen stehen nebeneinander, und ich tu mir schwer beim Lesen, ich werd immer kurzsichtiger, die Augen tun mir weh und davon auch der Kopf.
Der Vogel ist ganz still. Wenn ich mit ihm rede, plustert er sich auf und macht die Augen zu. Wenn draußen Vögel zwitschern, reckt er hoffnungsvoll den Kopf und sagt was, wird aber immer stiller, weil er merkt, die hören ihn nicht, die lassen ihn allein, und er kann nicht heraus. Er ist mit mir eingesperrt und wird nie wieder hinauskommen, er wird immer mit mir zusammen sein müssen, sein Leben lang an mich gekettet, von mir und meinen Launen abhängig, gräßlich, am liebsten würd ich ihn gleich freilassen.
Ich kann das einfach nicht mehr: Der Überschwang und die leidenschaftliche und ausschließliche Hingabe sind weg. Bis vor kurzem noch dachte ich, es wäre schön, immer nur für ihn dazusein, und die Zeit war mir zu kurz, nur sechzig Jahre, dachte ich, ich wollte jeden Augenblick mit ihm zusammen sein. Eine lange Zeit waren wir fast pausenlos glücklich miteinander, wir klebten aufeinander, wir wollten nichts anderes, wir haben einander fasziniert, wir haben einander erforscht, wir haben uns bloß mit Blicken verständigen können, wir sind einander immer ähnlicher geworden, auch äußerlich.
Und jetzt: Es ist alles leer und verbraucht. Ich will Zeit für mich allein, ich kann nicht mehr nur mit ihm zusammen sein, ich will andere Leute kennenlernen; ich will mit ihm reden und nicht aus seinen Blicken ablesen müssen, wie er sich fühlt und ob er mich mag. Es ist da noch Liebe und Zuneigung, aber ich will das nicht mehr: dieses Miteinanderleben, Aufeinanderkleben und Einander-nicht-aus-den-Augen-Lassen, es beengt mich. Ich will ich selber sein, ich will hinaus, ich will nicht jeden Abend mit dem Essen warten müssen, ich will …
Es ist kühl jetzt zwischen uns, und manchmal kann man unsere Gespräche nur mehr als Redereien bezeichnen; es hat Nächte gegeben, da haben wir miteinander geschlafen nur aus Gewohnheit und um es loszuwerden. Ich hab mich dabei so unfrei, so gefangen gefühlt, daß es mich würgte. Es ist da manchmal noch eine Leidenschaft und eine Sehnsucht und ein Brennen und sein Gesicht vor mir, und ich träum noch von ihm, und ich glaub, es könnte noch alles gut werden, diese ganzen «Unruhen» würden sich legen, wir würden noch ein Ehepaar wie manches andere. Manchmal wurde ich erregt, wenn ich nur seine Stimme hörte, seine Hand spürte. So etwas ist auch jetzt noch da, es lebt manchmal auf, ist wie eine Blase aus Fallschirmseide, weich und leicht und schimmernd vor Licht bläht sie sich plötzlich, wird gewaltig groß, organisch schön und leuchtet in der Sonne. Ich bin dann glücklich, ich möchte zerspringen und vergehn, ich bekomm keine Luft mehr, ich ersticke vor Freude, so ein Überschwang, daß ich die Stiegen hinunterrennen will und auf die Straße und alle umarmen will und schreien und lachen und rennen und rennen …
Wenn ich mit Hans zusammenleben könnte: Ich hab da so ein Bild, wie wir heiter und beschwingt einkaufen oder im Wald spazierengehn, wie wir in der Mensa sitzen, alles mögliche unternehmen, wegfahren; unsere gemeinsame Arbeit, unsere gemeinsamen Interessen – ich seh mehr Freiheit für mich; ich müßte nicht zu einer bestimmten Zeit daheim sein, müßte meinen Tagesablauf, meine Freizeit nicht auf ihn abstimmen. Aber wie weit verrenn ich mich da wieder in ein Ideal? Ich hab solche Angst, daß ich wieder hereinfallen könnte – aber nein, ich glaub, ich mach mir nichts vor, ich weiß, daß nicht auf der einen Seite das Glück und auf der andern das Unglück wartet, ich glaub nicht daran, daß da hinter einer bestimmten Tür ein Paket für mich steht, ich brauch es nur noch zu öffnen.
Es liegt an mir selbst, ich weiß es ja, ich darf mich nicht von jemand abhängig machen, nur das, was ich allein mach und seh und tu, das bin ich. Ich werde nicht erst durch jemand andern glücklich, nicht durch Manfred, nicht durch Hans, nicht durch sonstwen. Ich muß erst mit meiner eigenen Art zu leben einverstanden sein, ich muß die eigene Art zu leben finden, denn ich hab sie noch nicht, ich kenn sie nicht, ich war noch nie allein. Ich werd es lernen.
Gestern war ich mit Hans daheim bei den Eltern, es war schön und fröhlich und intensiv und stark, und als wir uns dann verabschiedeten, war alles traurig und melancholisch.
Obwohl ich es mir nicht eingestehen mag, wird er immer wichtiger und braucht immer mehr Platz bei mir. Es ist so selbstverständlich und einfach mit ihm, ohne Angst, ohne dieses ewige Abwarten und Stillsein.
Ich denk mir, wenn Manfred ein bißchen mehr Lust zeigte, wenn er mir nur manchmal zu erkennen gäbe, daß er mich noch gern hat, dann wär alles einfacher, es könnte noch Verständnis zwischen uns geben. Ich will ja nicht von ihm weg, ich will nur leben, wie ich leben muß, ohne Angst und ohne Beklemmung, ohne diese Fesseln. Wenn er mit mir leben will, darf das nicht sein, ich geh sonst, ich geh weg von ihm, ich mag mich nicht unter diesem Druck fühlen. Es macht mich fertig, mich derartig beschränken zu müssen, warten zu müssen, immer nur zu warten.
Ich war grad in der Stadt. Dieselbe Stimmung wie in mir: Regen und Grau und Leute und Stille, nur manchmal gelbe Mäntel, darunter meiner, häßlich war ich und allein und überflüssig. Ich bin in eine Eisenhandlung gegangen und hab Schrauben gekauft, «Achthunderter, bitte», und sie hat sie mir eingepackt, zwanzig Stück mit Dübeln, und ich bin Semmeln kaufen gegangen, «bitte runde, vier Stück», und einen halben Liter Milch, falls wir in Graz bleiben übers Wochenende. Aber ich hab schon gewußt, daß wir zu den Eltern fahren, wie immer an diesen Wochenenden, daß ich Hans nur kurz besuchen und nicht zu seinem Fondueessen kommen werde. Ich bin also auf einen Sprung zu Hans gegangen, er hatte Suppe gekocht, die Küche dampfte und war gemütlich. Ich wollt mir nicht einmal den Mantel ausziehen, weil ich doch gleich wieder gehen mußte, aber ich hab ihn dann doch ausgezogen. Er redete mich mit Kosenamen an und lächelte, er ist meine Depressionen schon gewohnt; und ich bin bei ihm in der Küche gesessen und hab erzählt, wie das jetzt so läuft zwischen Manfred und mir, ich hab erzählt von unseren Gesprächen und daß das keine Gespräche mehr sind, sondern Konversationen oder Quälereien oder Verzweiflungsausbrüche, daß wir es aber ohne einander nicht aushalten können, weil wir doch noch aufeinander stehn. Ich hab den Schnaps getrunken, den er mir angeboten hat, und nach drei Schnäpsen hab ich fast zu weinen begonnen und hab mich sehr angestrengt, aber schließlich mußte ich doch weinen, und dann wollt ich gehen. Es war höchste Zeit, ich hatte Manfred nicht gesagt, daß ich zu Hans geh, ich hatte nur vom Einkaufen geredet und daß ich nicht länger als eine halbe Stunde aus sein würde.
Ich bin gegangen, draußen noch Nieselregen, unendlich lange Tage ohne Hans vor mir, es war alles so öd, so tot, so sinnlos.
Ich arbeite langsam dahin, ein bissel Fensterputzen, ein bissel Türrahmenabwaschen, ein bissel mit dem Vogel spielen, der ist traurig. Wie krank sitzt er da und rührt sich nicht. Nur wenn man ihn angreift, hebt er langsam einen Fuß nach dem andern, und sein Gesicht wird dünn, er bleibt sitzen, wo man ihn hinsetzt, er sagt kein Wort, sein Blick ist stumpf und ratlos, er wünscht sich die andern Vögel her, er hat verstopfte Nasenlöcher, er springt in seiner Verzweiflung immer wieder ins Wasser, er hat nasse und verklebte Federn und Durchfall und frißt nichts und sieht krank aus. Ich fühl mich genauso.
Mir ist richtig die rechte Gesichtshälfte tot vor Alkohol. Der Mick Jagger sitzt rechts oben in meinem Hirn und singt, der Brian Jones spielt ein wunderbares Tamburin dazu, mich hebt es bei jedem Schlag.
Ich bin so empfindlich, es geht so schnell, ich bin so schnell draußen, es ist furchtbar mit mir, ich kann nicht allein sein, ich kann es einfach nicht. Hans hat angerufen. Er wollte, daß ich mit ihm essen geh, aber ich hatte mich schon mit Heike verabredet. Er hat sich sehr schnell darauf eingestellt und gesagt, gut, sehen wir uns halt morgen, aber das war mir auch nicht recht; er hat nämlich gesagt, daß er sich morgen ausschlafen wird, endlich einmal wird er lang schlafen können, weil ich nicht da bin.
«On a raindrop», ich spiel sie grad, Manfreds Platte, ich spiel sie jetzt recht oft, Julie Driscoll, Melancholie total. Ja, und ich war recht verwirrt und verzweifelt, ich bin hin- und hergerannt in der Wohnung, ich war so allein, ich wußte nicht, was tun. Ich hab alle möglichen Sachen in die Hand genommen und gleich wieder weggelegt, ich hatte allen Mut verloren, und getröstet hat mich nur der Cherry Brandy; denn ich vergeß ganz sicher, daß es mir schlecht geht, wenn ich Alkohol trink, ich krieg schon beim ersten Schluck eine warme Haut am Kopf und im Gesicht, und später wird alles dickflüssig warm und rot und leuchtend, ich denk nicht mehr dran, daß ich allein bin, daß es mir schlecht geht, daß ich mir leid tu und daß ich verwirrt bin, sondern ich wundere mich zum Beispiel über Julies Stimme, wie sie da groß und stark im Raum steht, und ich sitz mittendrin in ihrer Stimme, ich hab den Strahler eingeschaltet, Manfreds Zimmer, der Strahler, er strahlt genau den Tisch an, genau die Tischmitte, ich sitz in dem Lichtkegel, ganz allein sitz ich in dem Lichtkegel und beschreibe eine Einsamkeit, und langsam fühl ich mich wohl und daheim und zufrieden, und ich genüg mir vollkommen und bin sehr froh, daß mich keiner stört. Das erste Glas Cherry war das.
Mir geht es gut, mir geht es sehr gut, ich gefall mir auch schon besser; vorher war mein Gesicht zu breit, meine Haare fett, ich sah geschmacklos aus und banal, jetzt bin ich interessant, mein Haar ist strähnig vor lauter Beschäftigung; vor lauter Denken und Arbeiten komm ich nicht einmal zum Durchbürsten; mein Gesicht wird eigenartig und neu. Ich trink ja auch nicht, es ist nur, weil es dann leichter wird, erklär ich Heike.
Es ist mir wurscht, vollkommen wurscht, wie es hier auf dem Tisch ausschaut; wenn Mama kommt, wird sie es schrecklich finden, und mir gefällt es auch nicht, aber ich kann nicht immer alles zusammenräumen, wieso soll ich auch; ich würd am liebsten alles liegenlassen wie es hingefallen ist. Ich würd am liebsten gar nichts mehr tun.
Ich hab es Christine erklärt und es Heike gesagt und mit Manfred und Hans darüber geredet, aber es ist immer dasselbe: sie helfen mir nicht, sie nehmen mich nicht ernst, sie verkennen die Lage. Dabei seh ich wirklich keinen Ausweg mehr. Aus meiner Situation gibt es keinen Ausweg. Ich kann immer nur denken, daß man eigentlich tot sein sollte; aber nur Mama hat es bemerkt und aufgeschrien, «um Gottes willen, bis du wahnsinnig», dabei hat doch sie davon angefangen, sie hat erzählt vom Hochobenstehen und Runterschauen, vom Schwindligwerden und der Anziehungskraft des Balkongeländers, aber als ich sagte, daß es mir dreckig geht, ganz ernsthaft, und daß ich schon einmal gedacht hatte, ich müßte wirklich runterspringen, da hat sie gesagt «bitte nicht!» – sie war der erste Mensch, der gemerkt hat, daß ich es ernst mein. Die andern haben mich eher bestärkt, haben mich grotesk-witzig gefunden, haben gelacht, haben es auf die Art gemeint: gut, beweis mir’s.
Das war das zweite Glas.
Das Dumme beim Alkohol ist, daß man immer Nachschub braucht, daß man sich nicht einmal aufpumpen kann für einen Nachmittag oder Abend. Vielleicht, wenn ich Haschisch rauch oder Mescalin nehm? Ich hab keine Angst mehr, ich will nur, daß es schön ist und leicht und einfach.
Ich wollte es ja schon so stark, ich wollte, daß es endlich vorbei ist. Ich wollte, daß wir beide wissen, wie es weitergehen soll, ich wollte, daß es aus ist; vielleicht will ich es jetzt nicht mehr?
Die ersten Nächte nachher: Zuerst die Erleichterung. Wir waren beide befreit, gar nicht traurig; ich bin erfrischt und gestärkt wach geworden. Später dann verworrene Träume: Viel von Manfred, daß es ihm furchtbar schlecht geht, daß er am Boden und zerstört ist, aber ich bemerk es immer erst zu spät, und als ich es endlich bemerk, Reue und Schuldgefühle, wahnsinnige Schuldgefühle!
«Ich war nicht mehr lieb zu dir», hat er gesagt, «ich war schon so lang nicht mehr lieb zu dir.» Er hat viel geredet, abgekämpft und leise, wie von Vergangenheit, so, als wären wir schon weit und für immer auseinander. «Ich hätt mich mehr um dich kümmern sollen», hat er gesagt, «ich hab dir nichts mehr geschenkt, ich war nicht mehr zärtlich zu dir, ich bin auf deine Zärtlichkeiten nicht mehr eingegangen, ich hab deine Worte, deine Verzweiflung nicht beachtet, ich hab nichts mehr bemerkt, ich hab mich für nichts mehr interessiert, ich war allein mit mir beschäftigt und mit dem, wie weh du mir tust, dabei hätte ich etwas unternehmen, hätte kämpfen sollen» – und er gibt sich die Schuld, und ich bin verzweifelt, ich hab doch schuld! Und dann der plötzliche Wechsel, das Lächeln, auf einmal gute Laune und das einander Anfassen, wie viel wir einander berührt haben! Auf einmal war alles leicht und wie früher, wir haben miteinander geschlafen, und es war wie ein Nachholen und für die nächste Zeit Auftanken zugleich. Wir haben geweint, weil es so furchtbar und endgültig und traurig und befreiend war. Wir wußten nicht, was tun, nachdem wir es ausgeredet hatten, nachdem wir gesagt hatten, geben wir’s also auf – was sagt man denn noch, nachdem beschlossen ist, aus, aus und vorbei? Wir sind nebeneinander gelegen, alles war grau, naß und tot, so leicht wie Watte, nichts mehr hat weh getan; ich war wie entrückt, und dann sagte ich, daß ich gern mit ihm ein bissel schmusen würde, und er ist dagelegen, und seine Stimme hat gezittert, «wirklich», hat er gesagt, «wirklich?» Und ich habe gesagt, «ja», und ich bin ihm um den Hals gefallen, und wir haben uns endlos geküßt und gestreichelt, es war soviel Liebe und Zuneigung da, dieses Weinen aneinander, so verzweifelt und aufgegeben, wir haben uns festgehalten, leidenschaftlich wie lange nicht mehr; es muß mehr als ein Jahr her sein, daß es das letzte Mal so war. Ich will ja weiter mit ihm schmusen, mit ihm schlafen, es ist schön mit ihm, ich hab ihn gern, und doch weiß ich, daß ich mit ihm nicht leben kann.
Aber kann ich ohne ihn leben? Er fehlt mir schrecklich, ich fehl ihm auch. Solche Sehnsucht! Aber zurück können und wollen wir beide nicht; es war so schwer, diese Entscheidung zu treffen. Vielleicht war es gar keine richtige Entscheidung, so schnell hört es nicht auf mit uns, es geht noch weiter, es geht immer noch weiter.
Ich hab mir schon oft gedacht, daß es ein Fehler war, ein großer, entscheidender Fehler, den wir gemacht haben, ich hab gedacht, daß ich vielleicht noch zurück kann, doch das stimmt nicht.
Es tut mir so leid um das alles. Was wird seine Mutter sagen? Sie hat es schon lange vorausgespürt. Ihr merkwürdiger Blick immer! Und sein Vater wird sich bestätigt fühlen in seiner vorgefaßten Meinung: «Siehst du, ich hab es dir schon immer gesagt, sie läßt dich sitzen!» Und sein Bruder: «War ja klar, sie ist nicht die richtige Frau für dich, wirst schon eine bessere finden!» Aber seine Schwester, vor der hab ich am meisten Angst, sie hat mich gern gehabt und viel von mir erwartet, ich hab sie enttäuscht, sie wird mich nicht verstehen, wie kann sie auch verstehen, daß man den Menschen, den sie am liebsten hat, nicht mehr am liebsten hat. Ich möcht schreien, ich möcht sagen, daß es nicht stimmt, daß es nicht wahr ist, daß ich ihn ja am liebsten hab, daß es entsetzlich weh tut, unvorstellbar weh, aber es geht einfach nicht, es geht nicht mit uns, ich will etwas andres als er, ich will und kann nicht weiter, und auf keinen Fall will ich zurück.
Sicher, es hätte anders kommen können, ich hätte Hans nicht kennenzulernen brauchen, aber es wäre um nichts besser geworden; wir waren vorher schon auf dem Weg in die Einöde, wir hatten einander schon vorher wenig zu sagen, es war nur ruhiger; vielleicht wär es bald um so sicherer tot gewesen.
Gut, es hätte anders kommen können, die Beziehung zu Hans nur ein kurzes, aber leidenschaftliches Aufflammen; vielleicht wäre dann unsere alte Liebe wieder aufgetaucht, wir hätten neu begonnen. Wir hätten wieder gewußt, was wir einander wert sind, für eine kurze Zeit, vielleicht hätte sich alles anders entwickelt, wir hätten die Chance zu einer «guten» Ehe gehabt, über viele Prüfungen und Opfer, aber hätte das etwas daran geändert, daß unser Zusammenleben schwierig ist, einfach weil wir zu verschieden sind? Gut, wir hätten uns aneinander anpassen, Kompromisse schließen können, jede Ehe braucht Opfer, Verzicht, Entsagung; vielleicht liegt alles, alles nur daran, daß ich zu egoistisch bin, daß ich Angst hab, zu kurz zu kommen in meinem Leben, aber ich will so nicht leben, ich will fühlen, daß ich lebe, ich will mir nichts vormachen müssen, ich will lieber eine oder mehrere schwierige Beziehungen haben als eine lahme, halbtote.





























