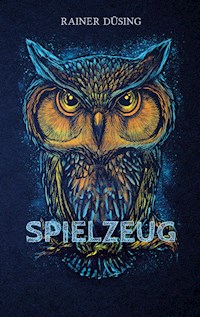
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Bei einer Kölner Firma stehen Batterien für einen asiatischen Spielzeughersteller zur Lieferung bereit. Überraschend werden diese zum Gegenstand wiederholter Diebstahlversuche, während im Umfeld der Firma Gewalt mit Mord und Entführungsversuchen explodiert. Im Durcheinander der Ereignisse sind es Auge und Jo, zwei junge Angestellte der Firma und Freunde mit unterschiedlichen Begabungen und Behinderungen, die sich durch die beunruhigenden Ereignisse herausgefordert fühlen. Globaler Konflikt mischt sich mit menschlichen Eigenarten, Ängsten und Bedürfnissen, Fragen nach Gott, dem Sinn des Lebens, Tod, Ewigkeit, Wiedergeburt und Zeitreisen. Die Ereignisse steigern sich schließlich zu einem märchenhaften Finale in und um den Kölner Dom.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 316
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Prolog
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Epilog
Prolog
Region Peschawar, Nord Pakistan, 16. April 1986
Es war kein schöner Tag in dieser so weit entfernten, abgelegenen Region. Während die Menschen in Europa überwiegend einen sonnigen Frühlingstag erwarten durften, zeigte sich das Wetter etwa siebentausend Kilometer südöstlich von Deutschland von seiner herben Seite. Heftige Schauer des für die Jahreszeit typischen Monsunregens begleiteten den kleinen Fahrzeugkonvoi, der sich vom Flughafen Peschawar kommend auf der pakistanischen Nationalstraße 5 langsam in Richtung auf die afghanische Grenze bewegte. Die vier älteren, zum Teil bunt bemalten Lkw aus japanischer Produktion lagen tief auf den Hinterachsen. Begleitet wurden sie von zwei kleineren Pick-Up Trucks, einer am Anfang und ein weiterer am Ende des kleinen Konvois. Die tiefe Bewölkung bedingte eine sternlose, pechschwarze Nacht, aus der die unruhigen Scheinwerfer der Autos scharfe Kegel herausschnitten. Auf der holprigen und kurvenreichen Straße bewegte sich die Kolonne nur langsam. Die widrigen Umstände, die selbst bei höchster Stufe der Scheibenwischer durch den starken Regen eingeschränkte Sicht der Fahrer und die schwere Beladung der Lkw erlaubten keine höhere Geschwindigkeit.
Die pakistanische Nationalstraße 5 wendet sich von Peschawar kommend Richtung Westen zum Khyber Pass und führt dann zur Grenze nach Afghanistan. Ab hier führt sie als Nationalstraße 1 über Jalalabad, der größeren Stadt auf der afghanischen Seite der Grenze, bis zur afghanischen Hauptstadt Kabul. Als eine der wenigen Verbindungen zwischen Zentralasien und dem indischen Subkontinent diente der Khyber Pass bereits in der Antike Alexander dem Großen bei seiner militärischen Expansion Richtung Indien und später als südlicher Arm der sogenannten Seidenstraße dem Handel zwischen Asien und Europa. Die Passstraße durchkreuzt dabei das Stammesgebiet der Paschtunen, das sich beidseits der Grenze zwischen Pakistan und Afghanistan ausbreitet.
Der direkte Weg zur afghanischen Grenze war offensichtlich jedoch nicht das Ziel der Fahrzeugkolonne. Nach etwa einer Stunde langsamer Fahrt auf der von Peschawar an stetig ansteigenden Straße näherte sich der Konvoi, immer noch in strömendem Regen, dem auf über tausend Meter gelegenen höchsten Ort des Passes, Landi Kotal. Einige hundert Meter vor den ersten Häusern des Ortes verlangsamte das führende Fahrzeug seine Fahrt auf Schritttempo und bog dann nach rechts in eine Umgehungsstraße ein. Nach nur kurzer Wegstrecke gab der vorn fahrende Pick-up Truck den nachfolgenden Fahrzeugen erneut einen Richtungswechsel von Landi Kotal wegführend in nordwestliche Richtung vor.
Die über die ersten Kilometer leidlich ausgebaute Straße war mittlerweile in einen unbefestigten Weg mit zum Teil tiefen Löchern übergegangen, dessen seitliche Begrenzungen man bestenfalls noch ahnen konnte. Riesige Pfützen spritzten meterweit auf, wenn die schwer beladenen Wagen sie durchkreuzten. Gelegentlich machte das grelle Licht der Scheinwerfer Ausschnitte der kargen Bergkulisse sichtbar. Dann, vor einer langen, breiten Ausbuchtung des Weges, verlangsamte das Führungsfahrzeug sein Tempo und hielt mit eingeschalteter Warnblinkanlage und laufendem Motor an. Hinter ihm kamen die vier Lkw und das Schlussfahrzeug ebenfalls am linken Straßenrand zum Stehen.
An dem vorausgefahrenen Pick-up öffnete sich die Beifahrertür und ein großer Mann in dunklem Mantel und einem tief ins unrasierte Gesicht gezogenen breitkrempigen Hut stieg aus. In wenigen Momenten war er vom prasselnden Regen völlig durchnässt. Wasser lief ihm von der Hutkrempe auf die Schultern und Ärmel seines Mantels. Gegen die Lärmkulisse der laufenden Dieselmotoren mit ihren defekten Auspuffanlagen und des peitschenden Regens rief er den aus den anderen Fahrzeugen aussteigenden Männern, die ausnahmslos in lokaler Art mit einem um den Kopf gebundenen Tuch, einem langen hellen Umhang und einer westenartigen dunklen Jacke gekleidet waren, in Paschtu einige wenige befehlsartige Sätze zu. Dabei gestikulierte er weit ausholend mit beiden Armen. Zustimmend nickend stiegen die Männer zurück in ihre Fahrzeuge. Offensichtlich waren die meisten von ihnen froh, sich wieder ins Trockene des Wageninnern zurückziehen zu können. Dem Führungsfahrzeug folgend vollzogen alle Lkw eine scharfe, durch die Breite des Weges ermöglichte Kehrtwendung. Der Fahrzeugkonvoi kam nun auf der gegenüberliegenden Seite der unbefestigten Straße zum Stehen, sodass die gesamte Kolonne jetzt rückfahrbereit in Richtung Landi Kotal geparkt war. Erst jetzt wurden die Motoren und Außenlichter aller Fahrzeuge und das bis dahin immer noch blinkende Warnlicht des Führungsfahrzeugs ausgeschaltet. Der westlich gekleidete Mann aus dem den Konvoi anführenden Wagen war bereits wieder ausgestiegen. Auf seinen Zuruf hin wurde nun auch die Wagentür auf der Fahrerseite geöffnet. Suchend griff er in die tiefen Ablagen der Innenverkleidung. Schließlich, nach einigen wenigen ungeduldigen Gesten, zog er eine großkalibrige Signalpistole hervor. Mit dieser in der Hand schritt er laut gestikulierend einige Schritte vom Fahrzeugkonvoi weg. Dem Knall der in den Himmel gerichteten Pistole folgte ein weißes Signallicht, das in etwa zweihundert Meter Höhe seine maximale Leuchtkraft erreichte und dann langsam verdämmerte.
Ohne weitere Diskussionen zogen sich einige der mittlerweile wieder ausgestiegenen Männer in ihre Fahrzeuge zurück. Offensichtlich wusste jeder, was nun passieren würde. Der völlig durchnässte Beifahrer des Führungswagens hatte sich ebenfalls wieder zu seinem Pick-up begeben. Neben dem Fahrzeug stehend wanderten seine Blicke suchend in Richtung der afghanischen Berge. Er war sich unsicher, ob sein Signal in den dichten Wolken den richtigen Adressaten gefunden hatte.
Die nur durch den prasselnden Regen gestörte Stille der tiefschwarzen Nacht wurde durch einen weiteren Schuss, gefolgt von dem gleißenden Licht der in den Himmel abgefeuerten Signalmunition, erneut unterbrochen. In einigen Fahrzeugen wurden die Seitenfenster heruntergekurbelt und neugierige Blicke richteten sich auf den Mann mit dem breitkrempigen Hut, der nach seiner erneuten Aktion nun wieder Schutz vor dem Regen in seinem Wagen suchte.
Etwa fünfzehn Minuten später, der Regen hatte sich ein wenig abgeschwächt, konnte man in den Bergen Richtung Westen vereinzelt fahl schimmernde Lichter erkennen, die sich der wartenden Gruppe in den sechs Fahrzeugen langsam näherten. Es dauerte weitere zehn Minuten, bis man die Umrisse der Gruppe zuerst erahnen und dann immer besser erkennen konnte. Etwa hundert Menschen und eine größere Zahl Esel bewegten sich langsam über einen engen Pfad den Berg hinunter auf den Fahrzeugkonvoi zu. Die Tiere trugen Seile und andere Vorrichtungen, mit deren Hilfe man Lasten an ihnen befestigen konnte. Die ankommenden Männer waren ebenfalls in paschtunischer Art gekleidet, aber im Unterschied zu den Fahrern und Begleitpersonen des Lastwagenkonvois mit Pistolen, Schnellfeuergewehren und Munitionsgürteln bewaffnet. Kurze Zeit später standen alle neu eingetroffenen Männer mit den Besatzungen der Lkw und der beiden Pick-ups zusammen. Man umarmte sich und redete aufeinander ein. Es wirkte, als ob die Männer sich kannten oder in anderer Weise eng miteinander vertraut waren.
Der Anführer des kleinen Konvois hatte sich der Begrüßungszeremonie entzogen und es sich auf dem Beifahrersitz des Führungsfahrzeugs bequem gemacht. Soweit es dem großen Mann möglich war, streckte er sich auf dem engen Sitz und nahm einen tiefen Zug aus seiner Zigarette. Um sich herum nahm er die sich wiederholenden und nicht enden wollenden Begrüßungsrituale wahr. Ganz offensichtlich herrschte da draußen eine freundliche, ja ausgelassene Stimmung. Gelegentlich wurden Schüsse in den dunklen Nachthimmel gefeuert, Zeichen der Freude und Zufriedenheit.
1. Kapitel
Köln, Dienstag, 3. Mai 2011
Jo Schneider schreckte auf, als er für einen kurzen Moment den grellen Ton der Alarmanlage vernahm, der sofort wieder verstummte. Von einer Sekunde zur anderen beschlich ihn ein ungutes Gefühl. Jetzt war es wieder still. Eigenartig, ja ein wenig unheimlich. Hatte er sich geirrt? War es wirklich der Firmenalarm gewesen oder hatten Polizei oder Feuerwehr oder vielleicht Kinder in der Nachbarschaft …? Gerade wollte er sich beruhigen und von einem technischen Fehler der Alarmanlage ausgehen, als plötzlich das Licht erlosch. Die Dunkelheit nicht nur auf seiner Etage, sondern auch in den Treppenhäusern konnte nur bedeuten, dass die Stromversorgung im gesamten Gebäude unterbrochen war. Auch solche Situationen hatte Jo schon erlebt, aber dann war doch immer sofort das Notstromaggregat angesprungen. Das war diesmal anders, es blieb dunkel und Jo wurde das unheimliche Gefühl nicht los, dass etwas Ungewöhnliches passierte. Kurzer Alarm, Stromausfall, auch das konnte ja irgendwie zu erklären sein. Jo versuchte mit aller Kraft, sich gegen die aufkommende Panik zu stemmen. Aber was war das? Jo hielt den Atem an. Im Erdgeschoss, eine Etage unter ihm, waren eindeutig Schritte und leise gesprochene Worte zu hören, die durch das dunkle Treppenhaus vage herauf hallten. Jo hatte die Luft so lange angehalten, dass er dem Erstickungsgefühl nun mit einigen wenigen tiefen Atemzügen nachgeben musste. Seine Hände zitterten, für einen Moment war er völlig planlos, sein Verstand wie ausgeschaltet.
Johannes, wie sein eigentlicher Name lautete, war ein wenig speziell. Das Chromosom 21 in seinem Erbgut war statt zwei gleich dreimal vorhanden. Was das bedeutete, wusste er mit seinen dreißig Jahren genau. Die bei ihm vorliegende Abweichung des Erbguts vom Durchschnittsmenschen mit üblicher Chromosomenzahl bescherte Betroffenen mehr oder weniger stark ausgeprägte Besonderheiten bezüglich Gesundheit, Aussehen, Persönlichkeit und Intelligenz. Wer mit den Dingen vertraut war, konnte Jo seine drei Chromosomen anmerken, aber man musste sich schon gut auskennen. Auf den ersten Blick imponierten seine Körpergröße von etwa 1,70 Meter, eine kräftige Figur, kurz geschnittenes dunkelblondes Haar, ein freundliches, rundliches, etwas flaches Gesicht und seine immer mehr oder weniger erstaunt wirkenden, großen, etwas auseinanderliegenden Augen mit den leicht schräg gestellten Augenlidfalten. Ein wenig speziell sein Gang, die ausladenden Schritte mit nur angedeuteten Bewegungen der Arme. In Unterhaltungen und Diskussionen kamen seine Einlassungen oft mit einer kleinen Verzögerung, einer kurzen Pause. Die Sätze waren meist kurz mit einer bunten, manchmal skurrilen Wortwahl.
Von seiner inneren Einstellung her war Jo eher nachdenklich, besonnen, seine gesamte Lebenserfahrung hatte ihn in diese Richtung geprägt. Am liebsten hätte er Medizin studiert. Es konnte doch nicht so schwer sein, ein einzelnes Chromosom aus dem Zellkern herauszubekommen. Oder vielleicht wenigstens ruhigzustellen, zu blockieren, funktionsunfähig zu machen. Aber daraus war nichts geworden. Nach Sonderschulabschluss und Schreinerlehre in einer öffentlich geförderten Lehrwerkstatt war er seinerzeit durch das Arbeitsamt auf diese Stelle in der Weiss GmbH vermittelt worden. Seine genaue Funktion war nicht wirklich definiert und bewegte sich irgendwo zwischen Laufjunge, Bürohilfe, Hausmeister und Nachtwächter. In der Firma kannte Jo jeden. Die meisten duzten ihn und wurden von Jo zurück geduzt. Eine seiner vielen Aufgaben war, abends nach dem Reinigungspersonal nochmals durch die Entwicklungslabore und Büros der Firma zu gehen und nach dem Rechten zu sehen. Nach ihm würde dann der reguläre Wachdienst übernehmen. Heute war er mit seinem Rundgang nahezu fertig gewesen und bereits wieder in der ersten Etage des dreistöckigen Gebäudes angekommen, als ihn der kurze Alarm kurz nach neun Uhr aus seinen Gedanken gerissen hatte.
Das Gebäude kannte er bestens. Im Dämmerlicht des frühen Maiabends ging er wie ferngesteuert im Gang einige Meter zurück an die Stelle, wo ein zentraler Alarmknopf angebracht war. Er hatte sich immer gefragt, wozu dieser überhaupt gut sei. Mit einem lauten Klirren ging die dünne Schutzscheibe unter dem leichten Schlag mit dem Schlüsselbund in Scherben. Jo drückte den dicken Knopf so fest er konnte. Aus einem unguten Gefühl, aus Unsicherheit und Angst wurde Panik. Keine blinkenden Lichter, keine Sirenen. Der Alarm funktionierte nicht und auch das erneute Drücken des Alarmknopfs löste nicht die erwarteten akustischen und optischen Signale im Innen- und Außenbereich des Gebäudes aus. Andererseits musste er nun davon ausgehen, dass, wer immer sich im Gebäude herumtrieb, das Splittern der Schutzscheibe gehört hatte und nun von seiner Anwesenheit wusste.
Auf Zehenspitzen bewegte er sich so leise wie möglich über den Gang zurück zu dem Zimmer, das er gerade abgeschlossen hatte und jetzt wieder öffnete. Der Raum war durch die teilweise herabgelassenen Rollläden noch dunkler als der Flur. Jo tastete sich zum Schreibtisch und griff zum Telefon. Obwohl er kein Freizeichen vernehmen konnte, drückte er die Sterntaste und dann die 9, die Nummer des Wachdienstes der Firma. Er wusste sofort, dass dies eher eine Verzweiflungstat war, die Leitung war tot. Ohne weiter zu überlegen, nahm Jo sein Handy aus der Jackentasche und klappte es auf. Wen zur Hilfe rufen? 110, die Polizei? Was, wenn alles nur ein technischer Defekt war? Da war die Nummer des Hausanschlusses von Robert Jansen, dem Geschäftsführer der Firma. Obwohl sie wenig direkten Kontakt pflegten, hatte Jo über die Jahre zunehmend das Gefühl entwickelt, dass der Firmenchef auf eine diskrete Art und Weise seine schützende Hand über ihn hielt. Irgendwie war er sich sicher, Robert Jansen sollte Bescheid wissen, dass in der Firma irgendetwas nicht in Ordnung war. Er drückte die Nummer und wartete, dass sein Telefon die gewünschte Verbindung herstellte. Erleichtert nahm er den mit kurzer Verzögerung einsetzenden Klingelton wahr. Nach mehrmaligem Läuten kam allerdings erneut das Gefühl von Panik auf. Robert Jansen war offensichtlich nicht zu Hause. Da war die Mobiltelefonnummer, vielleicht würde er damit erfolgreich sein. Er wusste, dass Jansen viel unterwegs war und deshalb oft über sein Handy kontaktiert wurde. Erneut wartete er, dass Robert Jansen am anderen Ende der Leitung das Gespräch annehmen würde. Nach mehrmaligem Anläuten der Nummer meldete sich eine freundliche Frauenstimme, die ihm mitteilte, dass der Teilnehmer zurzeit nicht erreichbar sei.
Die nächste Telefonnummer in seinem kleinen Verzeichnis war die Nummer von Auge, seinem Freund. Natürlich, Auge würde wissen, was zu tun war. Ohne weiter zu überlegen, ließ er sein Mobiltelefon die eingegebene Nummer wählen.
2. Kapitel
Das Telefon hatte wahrscheinlich bereits eine Weile geklingelt, als er aus dem Nebenzimmer kommend das Arbeitszimmer erreichte und den Hörer abnahm.
„Jansen!“
Dann etwas ungeduldiger.
„Hallo, Jansen hier!“
Am anderen Ende blieb die Leitung still, nach einigen Sekunden unterbrochen durch ein schwer einzuordnendes Geräusch. Dann wieder Stille.
„Hallo, ist da jemand?“
Jetzt war die Leitung ruhig, keine Geräusche mehr. Was immer das gewesen war, wahrscheinlich verwählt. Vielleicht war er aber auch nur zu spät ans Telefon gekommen? Robert Jansen hatte keinen Hang zum Dramatisieren von Alltäglichkeiten. Wie lange das Telefon bereits geklingelt hatte, bevor er reagierte, er wusste es nicht. Nun klingelte irgendwo im Haus gedämpft ein Mobiltelefon. Es war der ihm bestens bekannte altmodische Klingelton seines Handys. Wo war das verfluchte Telefon? Das Klingeln war weiterhin leise zu vernehmen, als er den Kleiderschrank öffnete, um seine Jackentaschen zu durchsuchen. Während er noch die Kleidungsstücke abklopfte, brach das Klingeln des Telefons ab. Dann eben nicht. Robert war leicht gereizt, dass er nun durch zwei Anrufe aus seiner abendlichen Routine gerissen worden war, ohne den Grund derselben kennenzulernen. Anrufe über das Haustelefon waren zudem ungewöhnlich, da er praktisch alle Telefonate über sein Mobiltelefon erledigte. Aber wo war das Handy nur? Nachdem er alle Taschen seines Sakkos erfolglos gefilzt hatte, beließ er es dabei. Hatte er doch im Auto noch einige Telefonate empfangen. Dort konnte er es aber nicht liegen gelassen haben, er hatte es ja jetzt in der Wohnung wahrgenommen. Es musste also hier irgendwo sein. Nun, heute Abend war ihm das verdammte Handy egal. Morgen früh würde er es suchen und dann wie immer auch irgendwo finden. Jetzt wollte er nur noch kurz seine E-Mails durchsehen, vielleicht noch etwas Fernsehen und dann ins Bett.
Es war ein langer Arbeitstag gewesen. Bereits am frühen Morgen war er gemeinsam mit seiner Mitarbeiterin Mandy Lee mit der frühen Maschine von Köln/Bonn nach Berlin geflogen. Der Tag hatte außer der anstrengenden Sitzung mit dem anspruchsvollen Kunden aus Übersee wenig Freundliches geboten. Jetzt war er froh, dass es Abend war und er seine Wohnung nicht mehr verlassen musste. Eine der digitalen Uhren der Küchenarmaturen zeigte, es war jetzt kurz nach einundzwanzig Uhr. Robert Jansen holte sich die noch fast volle Flasche Lugana aus dem Kühlschrank, schenkte sich ein Glas ein und ließ sich auf der gemütlichen Couch des Wohnzimmers nieder.
Mit seinen neunundfünfzig Jahren wirkte er etwas jünger. Etwa 1,80 Meter groß bei etwa achtzig Kilogramm Körpergewicht, kurzes braunes Haar, von den Schläfen ausgehend ergraut und mit grauen Strähnen durchsetzt. Regelmäßiger Sport seit Jugendzeit hatte ihn in einem fitten Zustand erhalten. Nach einem Tag wie dem heutigen war er aber einfach erschöpft, physisch und mental. Auch war er nicht sonderlich gern allein zu Hause. Er war überhaupt nicht gern allein. In solchen Momenten vermisste er seine Familie, seine Tochter, die bereits das Elternhaus verlassen und ein Psychologiestudium begonnen hatte. Obwohl er oft an Claudia dachte, hatte er nach vielen inneren Kämpfen ihre zunehmende Abnabelung von zu Hause akzeptiert. Was blieb ihm auch anderes übrig? Da ihr Appartement nicht weit entfernt lag, kam sie häufig bei ihren Eltern vorbei und lud sich an den Wochenenden gelegentlich zum Essen ein. Umso mehr genoss er jetzt die Tatsache, dass üblicherweise seine Frau Anna zu Hause war. Anna, das war seine große Liebe gewesen, als er sie vor über 25 Jahren kennengelernt hatte. Sie, Studentin am Biologischen Institut der Universität Köln und dabei, ihre Diplomarbeit fertigzustellen, und er, der für dieses Institut im Rahmen eines internationalen Forschungsprojekts eine Spezialzentrifuge entwickeln sollte. Ihre Ehe hatte die Unruhen der Zeit unbeschadet überstanden.
Die große Wohnung in Köln war ohne die Tochter ohnehin nicht mehr so mit Leben erfüllt wie früher. Dass Anna jetzt für mehrere Tage ihren kranken Vater in Hamburg besuchte, er konnte es nicht ändern.
Er nahm einen großen Schluck aus dem Weinglas. Der kühle italienische Weißwein stimmte ihn etwas milder. Genussvoll ließ er ihn für einige Momente im Mund kreisen. Eindrücke und Gerüche italienischer Regionen, die er so oft bereist hatte, kamen ihm in den Sinn, Erinnerungen an glückliche Tage der Vergangenheit.
Dann drängten sich ihm Bilder und Gedanken zu den Ereignissen des Tages auf. Als Diplomingenieur mit Schwerpunkt Elektrotechnik/Elektronik und langjähriger Geschäftsführer der Weiss GmbH, einem mittelständischen Unternehmen der Elektroindustrie mit Standort in Köln, hatte er die Firma bisher mit Geschick und Glück durch die zuletzt harten wirtschaftlichen Zeiten manövrieren können. Vor Jahren bereits hatte er den Betrieb aus einer Art Tante-Emma-Laden mit breitem Sortiment und niedrigem Ertrag in eine kleine, forschungsintensive und hoch spezialisierte Firma verwandelt. Der Entwicklungsschwerpunkt der Firma, Batterie- und Akku-Technologien, hatte sich über viele Jahre als lukrative Nische erwiesen. Mittlerweile spürte die Weiss GmbH aber zunehmend den Druck der internationalen Konkurrenz. Von Nische keine Spur mehr. So hatten sich die wirtschaftlichen Kennzahlen der Firma nach langjährigen Erfolgen in den letzten Jahren wieder verschlechtert. Als Konsequenz daraus stand die Weiss GmbH vor notwendigen strategischen Korrekturen. Robert Jansen ahnte, dass er die hier notwendigen Entscheidungen nicht mehr, zumindest nicht mehr allein, treffen würde. Nach einem weiteren Schluck Wein entsprach die Gefühlswelt solcher Gedanken aber eher Erleichterung denn gekränkter Eitelkeit.
Details der heutigen Sitzung in Berlin kamen nochmals hoch. Der Auftrag war gut dotiert und damit eine wichtige Chance zur Wiedererlangung wirtschaftlicher Spielräume seiner Firma. Die hauseigene Entwicklungsabteilung hatte den Zeitplan nur mit großen Anstrengungen einhalten können. Einige technische Details des Projektes hatten sich erst im Nachhinein als aufwendig herausgestellt. In weiser Voraussicht hatte er beim Abschluss des Auftrags die Liefertermine vorsichtig kalkuliert, obwohl oder gerade, weil der Kunde von Anfang an viel Druck gemacht hatte. Das Produkt sei bis auf die Energieversorgung bereits fertig produziert und je früher die Spezialbatterien zum Einbau zur Verfügung ständen, desto besser. Die in Singapur ansässige Spielzeugfirma Hathays hatte aus diesem Grunde viele Einzelheiten, Größe und technische Details betreffend, vorab bis ins kleinste Detail vorgegeben. Um die Entwicklung und Produktion zu beschleunigen, waren im Vertrag finanzielle Anreize festgelegt worden, in Form hoher Prämien in Abhängigkeit vom Liefertermin.
Heute hatte er die Erwartungen des Kunden insofern übertreffen können, als er nicht, wie erwartet, einen Prototyp, sondern das fertige Produkt der zu produzierenden Spezialbatterie den Vertretern des Unternehmens aus Singapur erstmals vorzeigen konnte. Außerdem konnte er der in Berlin versammelten Repräsentanz von Hathays verkünden, dass nach erfolgreichen Tests einiger Prototypen alle fünftausend Batterien fertig produziert waren und bereits zum Versand vorbereitet wurden. Obwohl er dies dem Auftraggeber zuvor bereits telefonisch mitgeteilt hatte, konnte er an dieser Stelle seiner Ausführungen zumindest bei einigen seiner Zuhörer freudige Überraschung wahrnehmen, die sich in einem längeren Beifall äußerte.
Das von ihm nach Berlin mitgeführte Vorzeigeobjekt einer der fertig produzierten Batterien hatte er den Firmenvertretern von Hathays in einer freundschaftlichen Geste als Symbol des erfolgreichen Geschäfts überlassen. Tatsächlich hatte Mandy Lee diese Geste vorgeschlagen. Diese mit vielen Kulturen vertraute Frau hatte ein sicheres Gefühl für den erfolgreichen Umgang mit Firmenkunden aus unterschiedlichen Regionen und Kulturkreisen und Robert Jansen wusste dies zu schätzen.
Überhaupt Mandy Lee, Tochter chinesischer Emigranten, in England geboren und ausgebildet und jetzt seit Jahren seine wichtigste Mitarbeiterin. Als Absolventin der London School of Economics war sie zuvor Mitarbeiterin eines Schweizer Investment-Unternehmens gewesen. Irgendwann hatten ihre beruflichen Aktivitäten sie dann nach Deutschland geführt, wo sie sich anfangs nicht wohlfühlte. In einer Phase privaten und beruflichen Durcheinanders war sie seinerzeit in die Weiss GmbH in Köln eingetreten und hatte dort mit großem Erfolg die Leitung der internationalen Geschäftsabteilung übernommen. Mandy hatte durch Abstammung und Erziehung großen Anteil an den internationalen Aktivitäten der Firma und insbesondere auch an diesem letzten erfolgreichen Projekt. In der Großstadt Köln mit ihrer liberalen und multikulturellen Tradition hatte sie ihre neue Heimat gefunden, für die Weiss GmbH war sie bei allen internationalen Geschäften mittlerweile unentbehrlich. Robert Jansen war sich bewusst, dass Mandy auch bei diesem für die Firma extrem wichtigen Geschäft die Schlüsselfigur gewesen war.
Für den Auftrag hätte es seiner Einschätzung nach eine ganze Reihe von Konkurrenten in den USA, in Europa und insbesondere in Ostasien gegeben. Wie so oft konnte er die Überlegungen des Auftraggebers, die zum Vertragsabschluss geführt hatten, nicht komplett nachvollziehen. Grundsätzlich unterschied sich der jetzige Auftrag sowohl die technischen Details betreffend als auch bezüglich des finanziellen Volumens nicht von den üblichen Geschäftsabschlüssen seiner Firma. Nur der enorme Druck zur schnellstmöglichen Lieferung war ihm immer wieder als ungewöhnlich aufgestoßen. Vereinbart war, die Batterien in Stückzahlen von fünfmal jeweils tausend per Luftfracht nach Karatschi in Pakistan zu liefern. Eine dortige Fabrik war vom international operierenden Hathays Konzern offensichtlich für die Endmontage des Produkts verpflichtet worden. Auch dieses Detail der Versandvereinbarung illustrierte, unter welchem zeitlichen Druck der ganze Auftrag stand. Es sollte nicht die Produktion der insgesamt fünftausend Batterien abgewartet werden, sondern nach Fertigstellung von jeweils tausend sollte sofort der Versand erfolgen. An dieser Stelle hatte er eigenmächtig den Ablauf der Dinge insofern geändert, als er doch die Gesamtproduktion abgewartet hatte, die jetzt zum Transport nach Karatschi bereitstand. Den Vertretern von Hathays hatte er das so begründet, dass nach der langwierigen Entwicklungsarbeit die Produktion selbst keine wesentliche Verzögerung mehr mit sich gebracht hatte. Eine Option für die Herstellung weiterer Batterien über die vereinbarte Stückzahl von fünftausend hinaus war ebenfalls vertraglich fixiert worden. Robert Jansen vermutete allerdings, dass seine Firma nur für die komplexe Entwicklungsarbeit in Anspruch genommen worden war. Eine eventuelle Produktion größerer Stückzahlen würde bei Bedarf an einem billigeren Produktions-Standort irgendwo in Asien erfolgen. Er hatte an diesem, dem Auftraggeber unterstellten Szenario, nichts zu bemängeln. Mandy und er hatten solche Aspekte bei den Kostenverhandlungen bereits berücksichtigt.
Robert Jansen griff zur Fernbedienung, um den Fernseher einzuschalten. Die bereits fortgeschrittenen Abendnachrichten zeigten unscharfe Bilder des bis dato als erfolgreich beschriebenen Vormarschs amerikanischer und alliierter Truppen in der afghanischen Provinz Helmand. Mehrere amerikanische Militärhubschrauber waren zu erkennen, einer davon setzte mit kreisenden Rotorblättern Infanteriesoldaten im Kampfgebiet ab. Nach für sie verlustreichen Gefechten, so der Kommentar, waren die Taliban nun auf dem Rückzug aus dieser von Ihnen seit Jahren kontrollierten Region.
Dies war nicht die Art Abendunterhaltung, die sich Robert Jansen gewünscht hatte. So griff er nochmals zur Fernbedienung, um das Programm zu wechseln, als erneut das Telefon im Arbeitszimmer zu klingeln begann.
3. Kapitel
Anna Jansen hatte für ihre Reise von Köln nach Hamburg den Wagen ihres Mannes ausgeliehen. Grundsätzlich bevorzugte sie für solche Reisen den Zug. Diesmal hatte sie sich jedoch aus verschiedenen Gründen für die komfortable Limousine entschieden, insbesondere auch, weil ihre Tochter Claudia angeboten hatte, sie zu begleiten. Der Gesundheitszustand ihres über achtzig Jahre alten, verwitweten und allein lebenden Vaters hatte sich durch eine Reihe aufeinander folgender Erkrankungen in den letzten Monaten ständig verschlechtert. Er hatte jetzt offensichtlich einen pflegebedürftigen Zustand erreicht. Nach langen Diskussionen hatte er nun, seit Wochen in der geriatrischen Abteilung eines Hamburger Krankenhauses untergebracht, der Aufgabe des eigenen Haushalts und der dauerhaften Aufnahme in ein Pflegeheim in seiner vertrauten Umgebung in Hamburg zugestimmt. Anna hatte die Entscheidung akzeptiert, allerdings in der stillen Hoffnung, diese später nochmals anpassen zu können und den Vater in ihrer Nähe unterzubringen.
Die beiden Frauen hatten verabredet, den Umzug des Vaters bzw. Großvaters ins Pflegeheim gemeinsam zu organisieren. Claudia, die ihren Opa gern mochte, hatte darüber hinaus wahrgenommen, wie schwer ihrer Mutter diese Aufgabe fiel und hatte daher ihre Begleitung und Hilfe angeboten. Vom Charakter her war sie eher der weiche, mitfühlende Typ Mensch und ihr Lebensgefühl fand sich auch ein wenig in ihren äußeren Merkmalen wieder. Während ihre mit 1,77 Meter Größe hoch aufgeschossene Mutter eher kühle Eleganz ausstrahlte, mit markanten Gesichtszügen und einer sehr schlanken Figur, wirkte Claudia mit ihrer etwas kleineren Statur und ihren weiblichen Rundungen eher sinnlich aufregend. Dieser Kontrast spiegelte sich auch in der Garderobe der zwei Frauen wider. Anna Jansen bevorzugte Designermode, klassische Pumps und teure Taschen und trug bei sich bietender Gelegenheit auch gern einmal einen Hut. Für die Fahrt nach Hamburg am Steuer des schon etwas betagten, aber gut erhaltenen Mercedes Coupe hatte sie ein geschmackvolles dunkles Kostüm gewählt. Neben ihr saß Claudia in einem bequemen, hell-beigen, weichen Kaschmirpullover und einer ausgewaschenen dunkelblauen Jeans.
„Schade, dass Papa Dich nicht begleiten konnte.“
„Du kennst ihn doch, im Moment ist er ganz absorbiert von irgendeinem wichtigen Auftrag dieses Spielzeugherstellers aus Asien. Ich habe den Eindruck, dass er da sehr unter Druck steht. Er war seit Tagen angespannt wegen des Treffens heute in Berlin.“
„Aber ich finde es irgendwie auch schön, dass wir beide in den nächsten Tagen viel voneinander haben.“
Claudias Stimme klang besorgt und liebevoll.
„Schau mal, der dunkle Lieferwagen hinter uns. Was ein Wahnsinn, wie der da gerade überholt.“
„Ich sehe keinen Lieferwagen.“
„Du hast recht, es ist auch kein Lieferwagen, sondern ein schwarzer Mercedes Kombi. Es ist der zweite Wagen hinter uns. Ich beobachte den schon eine ganze Weile. Jetzt hatte ich den Eindruck, als der kleine VW ihn überholte, wollte er das sofort rückgängig machen, und zwar ohne Rücksicht auf den übrigen Verkehr.“
„Solange er uns nicht bedrängt, stören mich solche Schwachköpfe eigentlich wenig. Außerdem, wir sind bald da, noch zwei Ausfahrten und wir haben es geschafft.“
Anna war sich bewusst, dass der ernste Teil ihrer Reise unerbittlich näherkam. Das kleine Krankenhaus, in dem ihr Vater untergebracht war, lag ziemlich zentral in der Stadt ganz in der Nähe des Universitätsklinikums in Eppendorf. Sie hatte die letzten Tage mehrfach mit dem Stationsarzt Dr. Brender und einem Sozialarbeiter telefoniert, um die Details der geplanten Verlegung des Vaters vorzubereiten. Anna wurde von Minute zu Minute angespannter.
„Lass uns direkt ins Krankenhaus fahren, um einmal einen ersten Eindruck zu bekommen, ins Hotel einchecken können wir später noch.“
4. Kapitel
Dr. Brender sah die beiden Frauen in den Gang der geriatrischen Station einbiegen. Ohne sie zu kennen, ahnte er, wer da auf ihn zukam. Von weitem hatte man den Eindruck von zwei Freundinnen oder Schwestern. Erst als sie näherkamen, wurde klar, dass es sich um Mutter und Tochter handeln musste. Mit ihren einundfünfzig Jahren machte Anna Jansen auch in den Augen des jungen Stationsarztes noch eine gute Figur. Die fast fünfundzwanzig Jahre jüngere Tochter Claudia stand dabei allerdings keineswegs im Schatten ihrer Mutter. Die beiden auf unterschiedliche Weise attraktiven Frauen waren ein echtes Kontrastprogramm zu den hier stationär versorgten, alten, kranken, behinderten und häufig dementen Patienten.
„Guten Tag, ich bin Anna Jansen, die Tochter von Herrn Gertens. Meine Tochter Claudia.“
„Das passt ja gut. Schön, dass Sie da sind. Herzlich willkommen. Wir haben ja ein paarmal miteinander telefoniert. Ich bin Philip Brender, der Stationsarzt. Im Laufe des heutigen Tages habe ich bereits mehrmals vergeblich versucht, Sie telefonisch zu erreichen. Es gibt schlechte Nachrichten, Ihr Vater hat in der letzten Nacht leider eine schwere Komplikation erlebt.“
„Was ist denn passiert?“
Claudia übernahm das Gespräch. Sie kannte ihre Mutter gut und hatte sofort wahrgenommen, was diese wenigen Worte des Arztes bei ihrer Mutter ausgelöst hatten.
„Er hat irgendwann in der Nacht einen Schlaganfall erlitten. Etwa gegen Mitternacht war die diensthabende Nachtschwester das letzte Mal in seinem Zimmer. Sie hat nichts Auffälliges berichtet. Zumindest lag er ruhig im Bett und hat wohl auch noch eine kurzes ‚gute Nacht‘ in Richtung der Schwester vermerkt. Heute Morgen war er dann gegen sieben Uhr nicht mehr ansprechbar und seine komplette rechte Körperhälfte zeigte sich gelähmt. Wann genau das passiert ist, lässt sich nicht eindeutig festlegen. Sicher ist nur, dass diese Symptomatik gestern und wahrscheinlich auch in der Nacht noch nicht vorlag. Wir haben dann heute Morgen schnell ein MRT des Schädels …“
„MRT?“
Claudia war der Begriff unbekannt.
„Ein modernes und sehr präzises Bildgebungsverfahren, eine Art Röntgenuntersuchung des Kopfes, durchgeführt, das unseren klinischen Verdacht leider bestätigt hat. Ein großer Hirninfarkt, wie gesagt ein Schlaganfall.“
„Was, was bedeutet das jetzt … für ihn, für uns?“
„Nun, bei einem alten Mann mit vielen Vor- und Begleiterkrankungen und der großen Ausdehnung des Infarkts in unserer Bildgebung ist die Frage der Therapieoptionen kompliziert. Wir haben uns heute Morgen bereits mit der entsprechenden Fachabteilung am Universitätsklinikum in Verbindung gesetzt. Von dort wurde uns bestätigt, dass akute Interventionen in Würdigung der Gesamtsituation keinen Sinn ergeben. Um ehrlich zu sein und auf den Punkt zu kommen, ich glaube nicht, dass er diese Situation überstehen wird.“
„Nicht überstehen wird? ... Sie meinen, er wird sterben?“
„So ist es.“
Dr. Brender war klar, dass er mit seinen kurzen, klaren Worten die zwei Frauen maßlos überforderte. Als Stationsarzt einer geriatrischen, also alte Menschen versorgenden Abteilung waren Gespräche wie diese für ihn jedoch Routine. Seine Erfahrung sagte ihm, dass man in solchen Situationen nicht herumreden, auf keinen Fall unberechtigte Hoffnung machen sollte.
„Was können wir denn jetzt machen, was ist mit seinem Platz im Pflegeheim? Wir haben ihn dort doch schon angemeldet.“
Claudia Jansen hatte die katastrophalen Nachrichten als Erste verarbeitet.
„Nun, der Platz im Pflegeheim, der mithilfe unserer Sozialabteilung organisiert wurde, den haben wir heute Morgen bereits abgesagt, zumindest für die nächsten ein bis zwei Wochen. Ich meine, Ihr Vater bzw. Großvater bleibt jetzt erst einmal zur Akutversorgung bei uns. In den nächsten ein bis zwei Tagen sieht man dann genauer, wie sich die Dinge entwickeln.“
„Wir haben uns darauf eingerichtet, einige wenige Tage hier in Hamburg zu bleiben, wir wohnen in unmittelbarer Nähe der Klinik im Bristol.“
„Das Bristol ist ideal, wenn Besucher nahe bei der Klinik wohnen wollen. Ein kleines, komfortables Hotel, ich kenne es ganz gut, wohne selbst nur ein paar Straßen weiter.“
„Dürfen wir jetzt einmal zu ihm?“
Die Frage klang ängstlich.
„Natürlich. Aber nicht erschrecken, er wird Sie nicht erkennen. Ich gehe einmal vor.“
5. Kapitel
Peter Hansmann ging normalerweise spät, meist erst nach Mitternacht, ins Bett. Üblicherweise verbrachte er seine Abende mit einem Buch oder im Internet surfend und einigen Flaschen Bier. Mit seinen fünfunddreißig Jahren hatte er sein Leben ziemlich zurückgezogen eingerichtet. Wer seinen Lebensstil verstehen wollte, musste seine Erscheinung sehen: 1,65 Meter groß und untergewichtig, er war ein kleiner, zarter Mann. Wenn man ihm nahe gegenüberstand, blickte man in ein schmales Gesicht, das von Locken seines dünnen, dunkelblonden Haares eingerahmt war. Eine weitere Auffälligkeit an ihm war seine auf beiden Augen stark eingeschränkte Sehkraft. Zur Korrektur seiner Sehfähigkeit benötigte er seit seiner frühen Kindheit außergewöhnlich dicke Brillengläser, die seine Augen sehr stark vergrößerten. Die massigen Brillengläser in der hellbraunen Kunststofffassung gaben den Anschein, als ob seine Augen etwas vorstehen würden. Neben den Proportionen seiner kleinen, untergewichtigen Figur waren die Augen also sein äußerlich dominierendes Merkmal. Es war deshalb, dass ihn viele Bekannte und Freunde nicht Peter, sondern Auge nannten. Trotz der vordergründigen Respektlosigkeit dieser Namensgebung war es doch eine liebevolle, freundschaftliche Nennung. Auge hatte nichts dagegen, war ein Auge nicht auch Symbol des Sehens, des Weitblicks, ja von Wahrnehmung generell.
Seit fast einem Jahrzehnt war Auge nun in der Entwicklungsabteilung der Weiss GmbH beschäftigt. Robert Jansen hatte ihn seinerzeit direkt nach seinem Ingenieurstudium verpflichtet. Er schätzte die intellektuelle Unabhängigkeit und Kreativität dieses kleinen, ungewöhnlichen Mitarbeiters und pflegte zunehmend auch einen persönlichen Kontakt insbesondere dadurch, dass er Auge regelmäßig zu familiären Festen oder auch einfach einmal zum Abendessen zu sich nach Hause einlud. Sowohl seine Frau Anna als auch Tochter Claudia liebten die oft überraschenden, provokativen Standpunkte, die Auge in Diskussionen vertrat, und seinen schwarzen, sarkastischen Humor. Während beide Frauen mit Auge bereits seit Jahren ‚per Du‘ verkehrten und ihn mit seinem Spitznamen anredeten, war der Ton zwischen den beiden Männern offiziell. Dabei hatte Auge durchaus zur Kenntnis genommen, dass insbesondere bei privaten Anlässen von Robert Jansen ihm gegenüber immer häufiger auch das ‚Du‘ einfloss. Auge wusste, dass dies häufig einer grundsätzlichen Anpassung des persönlichen Umgangs vorausging.
Das auf den ersten Blick Verborgene an ihm war jedoch noch etwas Anderes. Auge war auch jenseits seiner beruflichen Qualifikation ein kluger Mensch, der seine Situation oft reflektierte und der vielleicht gerade wegen seines kritischen Verstandes mit der Diskrepanz von Anspruch und Realität in seinem Leben haderte. Es war auch deshalb, dass er gern regelmäßig und viel Bier trank. Der Alkohol gab ihm, zumindest für einige Zeit, die innere Ruhe, Zufriedenheit und Selbstsicherheit, mit der er auch sonst gern Menschen und Dinge gesehen hätte. Damit einhergehend rauchte er seit seiner Jugendzeit ‚schwarze‘ Zigaretten aus französischer oder deutscher Produktion, zwanzig bis vierzig Stück pro Tag. Er liebte es, wenn er die Verwunderung von Menschen spürte, die ihn nicht kannten. Diese Verblüffung war begründet in dem grellen Kontrast einer offensichtlich schwächlichen Konstitution zusammen mit den überdimensionierten Brillengläsern und seinem eher herben Lebensstil mit Bier zu allen Tageszeiten und diesen Zigaretten, die auch starke Raucher mit Respekt ablehnten, wenn er ihnen eine anbot.
Die Routine der langen Abende mit Trinken, Rauchen und Grübeln hatten seinem kleinen, schwachen Körper weiter zugesetzt. Seine körperlichen Möglichkeiten waren entsprechend eingeschränkt. Ärztlichen Rat hatte er in seinem Leben selten in Anspruch genommen, zuletzt vor vielen Jahren, als er sich alkoholisiert bei einem Sturz auf der Treppe den Unterarm gebrochen hatte. Ansonsten versuchte er, bis dato erfolgreich, Arztpraxen oder Kliniken mit ihrer speziellen Atmosphäre und Stimmung, dem hellen Neonlicht und diesem eigenartigen Geruch fernzubleiben. Auge war sich seines körperlichen Zustands und gesundheitlichen Gefährdungen vollkommen im Klaren, aber er wollte, und vielleicht konnte er mittlerweile auch nicht mehr, die Dinge ändern, warum auch? Beziehungen mit Frauen waren selten, meist kompliziert und immer kurz. Gern hätte er Partnerschaft und Intimität mit einer Frau genossen, aber irgendwie war er bei seinen Versuchen bisher nicht erfolgreich gewesen. Vielleicht auch, weil er irgendwann aufgegeben hatte, da er die häufig erlebten Enttäuschungen nicht wiederholen wollte.
Seine Lebenserfahrung hatte in Auge Solidarität und Sympathie mit denen wachsen lassen, die im täglichen Kampf um Macht, Geld, Ansehen, Liebe und Sex ihre Ziele nicht oder nur sehr eingeschränkt erreicht hatten. Seine Lebensphilosophie, seine politische Gesinnung waren offensichtlich links. Obwohl irgendwie auch christliches Gedankengut dazugehörte, Auge hatte mit dem organisierten Christentum, der Kirche, nichts im Sinn. Am besten gefiel er sich, wenn er mit seinem in Abhängigkeit vom Alkoholpegel mehr oder weniger glasklaren Verstand seine politischen Vorstellungen oder seine Lebensphilosophie vortragen konnte, am liebsten als Gegenrede auf irgendein ‚dummes Geschwätz‘.
Er ging zum Kühlschrank und machte sich eine weitere Flasche Bier auf. Zu Hause trank er sein Bier grundsätzlich aus der Flasche. Im Fernsehen plätscherte eine politische Diskussionsrunde. Das Programm war zurzeit voll damit. Standen nicht in einigen Wochen wieder irgendwelche Wahlen an? Nach den wenigen Wortfetzen, die er mitbekommen hatte, waren wieder einmal die kriegerischen Auseinandersetzungen in Afghanistan das Thema. Was wollen die Alliierten dort? Ist der Krieg zu gewinnen? Auge hatte keine Eile, in die Diskussion einzusteigen. Eher gleichgültig warf er sich, nachdem er seine Flasche Bier auf den Tisch gestellt hatte, auf die Couch und zündete sich eine Zigarette an. Eigentlich langweilten ihn diese Diskussionen. Das lag insbesondere daran, dass er keinen Diskussionsbedarf hatte, allzu sehr war er sich seiner Meinung zu vielen Themen bereits sicher. Bezüglich der aktuellen Fernsehdebatte bedeutete das: ‚Raus aus dem Krieg, und zwar sofort, egal, was da fernab passierte. Man konnte den Menschen, die dort nach unseren Kriterien in mittelalterlichen oder vielleicht sogar frühzeitlichen Bedingungen leben, nicht von heute auf morgen unseren Lebensstil aufdrücken. Wir haben in Europa durch all die fürchterlichen Geschehnisse in unserer Geschichte bis in die erste Hälfte des zwanzigsten Jahrhunderts hinein doch auch den Weg nach vorn gefunden, zumindest bisher. Barbarische Unterdrückung von Minderheiten oder von Frauen war in Europa früher doch auch an der Tagesordnung gewesen, und an Grausamkeiten generell kann wahrscheinlich kaum eine Kultur der europäischen Geschichte das Wasser reichen. War es nicht einfach eine weitere Folge der Globalisierung, dass solche fernen Probleme jetzt an der eigenen Haustür ankamen? Wen hätten ein paar Taliban in Afghanistan oder Pakistan vor hundert Jahren interessiert?‘
Die Diskussion im Fernsehen verlief diesmal eher heftig und Auge begann, an dem Programm Gefallen zu finden, als das Telefon seine Gedanken unterbrach.
„Hallo.“
Er hatte es sich abgewöhnt, sich mit seinem Namen zu melden.
„Hallo Auge, Jo hier, Du musst mir helfen.“
„Was ist los Jo, warum sprichst Du so leise?“
Mit wenigen Sätzen schilderte Jo Schneider in leisen, aufgeregten Worten seinem Freund Auge die Situation auf dem Firmengelände der Weiss GmbH und seine eigene, ihn zunehmend beängstigende Lage.
„Bleib, wo Du bist, ich rufe die Polizei und auch Jansen an und komme dann selbst gleich rüber zur Firma. Schließ Dich doch sicherheitshalber in dem Zimmer, von dem Du jetzt telefonierst, ein. Ich lege jetzt auf, bleib‘ auf jeden Fall da, wo Du bist und… schließ Dich ein!“
Die letzten Worte waren im Befehlston gefallen. Am anderen Ende der Leitung war Jo beeindruckt und beruhigt zugleich ob der kühlen Entscheidungen und Anordnungen seines Freundes. Vorsichtig stellte er sein Handy aus und ging dann, wieder auf Zehenspitzen, leise im Halbdunkel des Raums zurück zur Tür.





























