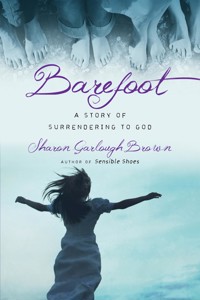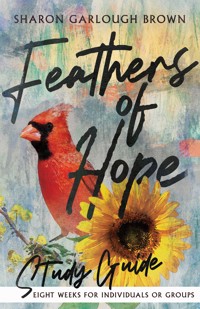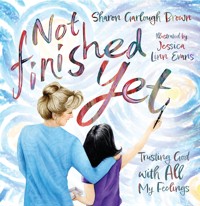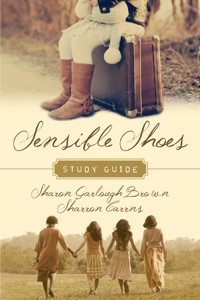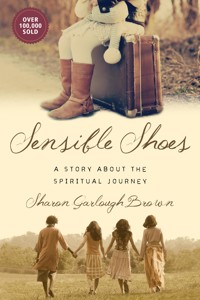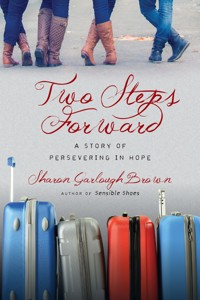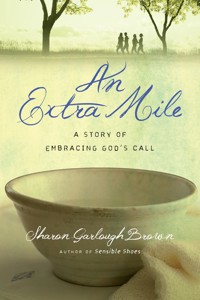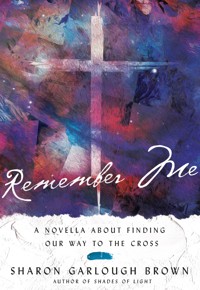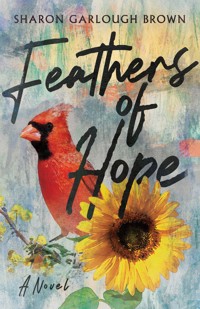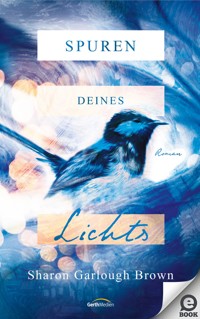
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Gerth Medien
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Die Sozialarbeiterin Wren Crawford hat seit ihrer Jugend mit Depressionen und einer Angststörung zu kämpfen. Nach einem erneuten Zusammenbruch findet sie Trost und Halt in den Bildern von Vincent van Gogh, mithilfe von geistlichen Übungen, Seelsorge und tiefen Gesprächen. Doch dann droht eine schwierige Freundschaft aus der Vergangenheit ihre Fortschritte zunichte zu machen ... Sharon Garlough Brown lädt ihre Leser mit diesem Roman dazu ein, sich gemeinsam mit Wren auf eine heilsame Reise zu begeben. Eine Reise weg von der Angst, hin zu Hoffnung und in die Gegenwart des einen, der uns selbst in unserer dunkelsten Stunde zur Seite steht.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 544
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das Hörbuch können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Über die Autorin
Sharon Garlough Brown ist Pastorin und Autorin der erfolgreichen Unterwegs mit dir-Romanreihe. Gemeinsam mit ihrem Mann Jack leitet sie eine Gemeinde in West Michigan. Ihren reichen Erfahrungsschatz aus vielen Jahren geistlicher Retraiten und Kursen über geistliche Übungen webt sie meisterhaft in ihre Bücher ein.
Für David, meinen geliebten Sohn.Du inspirierst mich mit deinem Mut, deinem Mitgefühl und deiner Weisheit. Worte können nicht ausdrücken, wie sehr ich dich liebe und wie stolz ich auf dich bin.Es leuchtet in der Finsternis, und die Finsternis hat es nicht auslöschen können. Johannes 1,5
Inhalt
Teil 1: Auch dort
Teil 2: Ausgelaugt
Teil 3: Wachsam sein
Teil 4: Auch das Dunkel
Anmerkungen, Hinweise und Anlaufstellen für Betroffene
Vorwort
Wenn man einen Roman schreibt, ist ein wesentlicher Schritt dabei der, Namen für die Figuren zu finden. Und manchmal bieten sich Namen auf eine Weise an, die man als Autorin nicht vorhersehen kann. Der Name „Wren“ ist ungewöhnlich – in Amerika ebenso wie in Deutschland. Deshalb möchte ich Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, kurz berichten, wie es zu diesem Namen kam.
Im Frühling 2016, ein paar Monate, bevor ich mit dem ersten Entwurf von Wohin du mich auch führst begann, kam mir ein Name für eine Romanfigur in den Sinn. Da mir klar war, dass diese Figur nicht in die Unterwegs mit dir-Reihe gehören würde, notierte ich mir ihn nicht. Als ich einige Zeit später versuchte, mich daran zu erinnern, fiel er mir nicht mehr ein. Und ich merkte, dass ich das sehr bedauerte. Der Name, der mir zunächst so wichtig zu sein schien, war verloren. Das dachte ich jedenfalls.
Ein paar Wochen später saß ich auf unserer Veranda, den Laptop vor mir, als ein Stück vor mir auf dem Geländer ein kleiner Vogel landete. Ich beobachtete ihn und dachte: Du hast ja Mut, so nah heranzukommen. Und dann kam er noch dichter heran. Er hüpfte direkt auf mich zu und blieb ein paar Zentimeter vor meinem linken Fuß sitzen. Ich wagte nicht, mich zu regen. Das Vögelchen flog hoch auf meinen Stuhl und hüpfte auf der Armlehne entlang, dann auf meinen Laptop, wo er auf den Tasten herumhopste. Irgendwann landete er auf meinem rechten Knie, dann auf dem linken, bevor er sich wieder dem Laptop widmete und nach den Tasten pickte. Mittlerweile wagte ich kaum noch zu atmen. Schließlich flog der Kleine wieder auf das Verandageländer rechts von mir, streifte noch kurz das Windspiel, das darüberhing, und flog davon.
Einen Moment lang saß ich wie erstarrt da mit dem Gefühl, dass ich soeben „himmlischen Besuch“ erhalten hatte. Das war ganz sicher kein typisches Verhalten für einen Vogel! Ich ging ins Haus, holte mir mein Vogelbestimmungsbuch und sah mir die Bilder an. Ich wusste drei Dinge: Er war sehr klein, er war braun, und die Schwanzfedern standen in einem 45-Grad-Winkel nach oben. Mein Buch identifizierte ihn als „Wren“ – ein Zaunkönig. Mir kamen die Tränen. Denn das war der Name der Figur gewesen, den ich mir nicht notiert hatte.
Als ich dann schließlich an Spuren deines Lichts schrieb, schenkte ich Wrens Mutter Jamie eine Variation dieses heiligen Moments. Aus dem gewöhnlichen amerikanischen Zaunkönig machte ich einen australischen „Fairywren“, einen Prachtstaffelschwanz – ein sehr kleiner Vogel mit leuchtend blauem Brustgefieder.
Wie der Vogel, der mich an jenem Tag besuchte, beweist auch Wren großen Mut. Ich hoffe, dass sie für Sie zu einer Botin der Gnade, des Trostes und der Inspiration wird. Und ich wünsche Ihnen, dass Sie beim Lesen dieses Buches dem Herzen Gottes ganz nahekommen.
Mit Segenswünschen
Sharon Garlough Brown
Wünschte ich mir: „Völlige Dunkelheit soll mich umhüllen, das Licht um mich her soll zur Nacht werden!“ – für dich ist auch das Dunkel nicht finster; die Nacht scheint so hell wie der Tag und die Finsternis so strahlend wie das Licht. Psalm 139,11–12
Prolog
Februar
* * *
Es war das Seufzen gewesen, so stand es in dem Zeitungsartikel, dieses schreckliche Seufzen, das in der Morgendämmerung die Aufmerksamkeit der Frau erregte und sie an den Strand hinunterführte. Sie sagte, die Schreie der jungen Wale seien am schlimmsten gewesen. Sie hätten aufgeregt mit den Flossen geschlagen und ihr Stöhnen habe besonders gequält geklungen.
Wren Crawford klappte ihren Laptop zu und schob ihr Sandwich auf dem Schreibtisch zur Seite. Sie hatte wirklich Besseres zu tun, als in ihrer Mittagspause Artikel über Wale zu lesen, die am anderen Ende der Welt zu Hunderten gestrandet waren. Im Augenblick schaffte sie es doch kaum, das Leid zu verkraften, mit dem sie bei ihrer Arbeit mit traumatisierten Frauen und Kindern im Bethel-Haus konfrontiert wurde. Da brauchte sie sich nicht auch noch mit Informationen über eine möglicherweise aussichtslose Rettungsaktion zu belasten. Ihr Therapeut Dr. Emerson würde ihr zustimmen. Lassen Sie Tragödien, die sich nicht in Ihrer unmittelbaren Nähe abspielen, möglichst nicht an sich herankommen. Bei ihrer Arbeit hatte sie Tag für Tag mit genug Tragödien zu tun.
Sie konzentrierte sich auf die Kinderzeichnungen an den Aktenschränken und versuchte mit aller Kraft, das Bild abzuschütteln. Aber es gelang ihr nicht. Immerzu sah sie die ehrenamtlichen Helfer vor sich, wie sie mit ihren Eimern unentwegt Wasser schöpften und die überlebenden Wale damit übergossen, um sie kühl und feucht zu halten, und wie sie bei Flut mit aller Kraft versuchten, die Tiere ins Wasser zurückzudrängen. Wenn ihnen das gelungen war, bildeten sie eine Menschenkette, um zu verhindern, dass die geretteten Wale wieder an Land zurückkehrten. Hunderte Kadaver lagen bereits an den Stränden Neuseelands. Erst nach mehreren Tagen würde sich zeigen, ob ihre Bemühungen erfolgreich gewesen waren.
Wren nahm ihr Telefon zur Hand und schrieb Casey, ihrem besten Freund seit Schultagen, eine SMS. Bestimmt würde er sie wegen ihrer Überempfindlichkeit necken, aber wenn einer Verständnis für sie hatte, dann er.
Brauche eine kleine Ablenkung, schrieb sie.
Wovon?
Gestrandete Wale in Neuseeland.
Wie wäre es mit kleinen Kätzchen, die irgendjemand ausgesetzt hat?
Wren wählte seine Nummer. „Wie viele?“
„Drei.“
„Wo?“
„Im Müllcontainer. Ich habe ihr klägliches Maunzen gehört, als ich den Müll rausbrachte.“
Für solche Grausamkeiten konnte Wren einfach kein Verständnis aufbringen. Weder gegenüber Tieren noch Kindern noch irgendwelchen anderen Lebewesen, die schwach und verletzlich waren. „Wo sind sie jetzt?“
„Sie spielen gerade mit meinen Schnürsenkeln. Und – aua! – sie beißen mich. Hey, Theo, nimm das als Spielzeug.“
„Du hast ihnen bereits Namen gegeben?“
„Nur einem.“
„Hast du mit Brooke darüber gesprochen?“
Er lachte. „Noch nicht. Ich weiß nicht so genau, wie sie zu Katzen steht.“
Wren hoffte nur, dass Caseys Verlobte, die in einem anderen Bundesstaat lebte, damit einverstanden war. „Du hast ein gutes Herz, Casey.“
„Oder ich bin einfach nicht in der Lage, niedlichen kleinen Lebewesen zu widerstehen.“
„Wie auch immer …“ Eine Kollegin erschien im Türrahmen. In ihrem Gesichtsausdruck konnte Wren lesen, dass es wieder einmal einen Notfall gab. Wren hielt einen Finger in die Höhe, um ihr zu bedeuten, dass sie gleich für sie da wäre. „Ich muss Schluss machen. Aber vielleicht könntest du dich erkundigen, ob es irgendwo in der Nähe eine Katzenauffangstation gibt? Und vermutlich müssen sie von einem Tierarzt untersucht werden. Wie sieht dein Terminplan aus? Ich muss heute lange arbeiten.“
„Das geht schon. Ich übernehme das. Heute sind keine Aufnahmen geplant.“ Casey, der freiberuflich Videofilme drehte, hatte in den vergangenen Monaten an einem Film über Menschenhandel in West Michigan gearbeitet. „Aber komm doch nach der Arbeit vorbei, Wrinkle, okay? Ich muss mit dir reden.“
„Okay.“ Sie biss ein letztes Mal in ihr Sandwich. „Und falls du keinen Platz für sie findest …“
„Ich weiß, keine Sorge. Dann behalte ich sie hier, bis wir eine Lösung gefunden haben. Ich kann nur hoffen, dass sie in der Zwischenzeit nicht meine Couch anknabbern.“
„Danke, Casey. Du bist der Beste.“
„Jeder von uns bringt Licht in seine eigene kleine Ecke der Welt, nicht?“
Ja, dachte sie, während sie durch den Flur eilte. Leuchte in alles hinein, was dunkel und zum Verzweifeln ist.
B
Es gab eine Zeichnung von ihrem Lieblingsmaler Vincent van Gogh, eine Bleistift-, Kreide- und Tuschezeichnung von einem knorrigen Baum mit freigelegten Wurzeln – halb ausgerissen von einem Sturm, und trotzdem krallte er sich in die Erde. Vincent hatte in diesen Wurzeln ein Bild gesehen für den Kampf ums Überleben, das Ringen um Hoffnung. Er kannte das.
An dieses Bild musste Wren denken, als ihre Kollegin von ihrem neuesten Notfall berichtete: Eine Mutter war von ihrem Lebensgefährten zusammengeschlagen worden, der seinen Freunden ihre vierjährige Tochter zur Verfügung gestellt hatte, damit sie sich mit ihr vergnügten. Die Frau war früher von der Arbeit nach Hause gekommen und hatte ihn auf frischer Tat ertappt.
Wren hatte das Gefühl, sich jeden Moment übergeben zu müssen oder in Ohnmacht zu fallen. Sie brauchte einen festen Halt. Genau wie Vincents Baumwurzeln. Sie umklammerte die Kante des Tisches, an dem sie mit Allie saß.
„Brauchst du eine Minute?“, fragte Allie.
Wren nickte.
Allie legte den Polizeibericht zur Seite. „Wenn wir in Chicago oder Detroit leben würden, dann würde mich so etwas vielleicht nicht überraschen, aber in Kingsbury …“
Genau. Im College war Wren fassungslos gewesen über die Statistiken zum Thema „Missbrauch und Menschenhandel in West Michigan“. Damals hatte sie den Entschluss gefasst, für die Opfer da zu sein und ihnen wenn möglich zu helfen. Aber die Dunkelheit war nicht aufzuhalten.
Sie biss sich auf die Lippe. Nein, sie würde ihren Tränen nicht nachgeben. Denn wenn sie jetzt anfing zu weinen, würde sie nicht mehr aufhören können. Passiert das häufiger?, hatte Dr. Emerson sie vor einigen Wochen gefragt. Dass Sie weinen und nicht mehr aufhören können?
Nicht oft. Aber manchmal.
Auf der Arbeit? Nein. Auf der Arbeit gelang es ihr, sich zusammenzureißen. Aber es fiel ihr zunehmend schwer, ständig unter Hochspannung zu stehen, immer auf die nächste Krise zu warten, immer befürchten zu müssen, dass sie die Kontrolle verlor und zusammenklappte.
Wren senkte den Blick auf ihre Hände und dachte an Vincents schiefen Baum, der so stark zur Seite hing, dass er jeden Augenblick umkippen konnte.
Wären Sie bereit, intensivere Hilfe in Anspruch zu nehmen?, hatte Dr. Emerson gefragt. Oder vielleicht eine Auszeit von der Arbeit?
Das ging nicht. Die Personaldecke war auch so schon dünn genug, und ständig kamen neue Kinder mit ihren Müttern ins Bethel-Haus. Sie schaute durch das Fenster hinaus in den trüben Februartag. „Bei den kleinen Walen ist es besonders schlimm.“
„Wie bitte?“
Sie hatte nicht gemerkt, dass sie laut gesprochen hatte. „Nichts.“
Allie hielt inne und fragte schließlich: „Alles in Ordnung? Ich meine, nicht nur im Augenblick, sondern ganz allgemein. In letzter Zeit scheinst du irgendwie neben dir zu stehen.“
Wren bemühte sich, diese Beobachtung als Sorge zu werten und nicht als Kritik. „Ich schätze, meine Arbeit fordert langsam ihren Tribut.“
Allie nickte. „Lass nicht zu, dass der Feind dich runterzieht. Wir stehen hier an vorderster Front, richtig? Du musst mit deinem Schild des Glaubens die Dunkelheit zurückdrängen. Das müssen wir alle tun.“
Wren seufzte. „An manchen Tagen habe ich nicht viel Kraft zum Kämpfen.“
„Das verstehe ich. Mir geht es genauso. Darum müssen wir immer wieder unseren Geist erneuern. Wir müssen unsere Gedanken in die richtigen Bahnen lenken, weil uns das alles“, Allie deutete zum Flur, „runterziehen will.“
Und an den Tagen, an denen Wren nicht die Kraft hatte, ihre Gedanken in die richtigen Bahnen zu lenken und ihren Geist zu erneuern? An den Tagen, an denen der Sog von Traurigkeit und Angst so stark war, dass sie ihm nichts entgegenzusetzen hatte? Was dann?
Allie schien ihre Gedanken lesen zu können. „Was wir fühlen, ist zweitrangig. Wir müssen in Gottes Wort gegründet bleiben. Nur so können wir überleben. Der einzige Weg durch die Dunkelheit hindurch ist das Gebet. Das unablässige Gebet.“
Aber wenn es um sie herum nur Dunkelheit gab, konnte Wren nicht beten. Sie hatte dann nicht die Kraft, in der Bibel zu lesen oder mit Gott zu reden. Aber das würde sie Allie nicht sagen, denn das Letzte, was sie zusätzlich zu ihrer Niedergeschlagenheit gebrauchen konnte, waren Schuldgefühle und die Angst vor Verurteilung. Entschlossen schob sie ihren Stuhl zurück. „Ich gehe jetzt mal rüber und begrüße Evelyn und ihre Mutter.“
Mitfühlend blickte Allie sie an. Oder war da eher Mitleid in ihrem Blick? „Pass auf: Wie wäre es, wenn wir heute mal tauschen und ich das Aufnahmegespräch führe?“
Wren wollte widersprechen. Sie wollte Allie versichern, dass sie durchaus in der Lage war, diesen Fall zu übernehmen, und ihr beweisen, dass sie emotional und geistlich gerüstet war, den guten Kampf zu kämpfen und die Dunkelheit zu besiegen. Aber ihr fehlte die Kraft zum Tapfersein. Und außerdem: In Anbetracht der rechtlichen und medizinischen Konsequenzen, die in Fällen wie diesen drohten, durfte sie nicht riskieren, etwas zu übersehen. Oder vor anderen zusammenzubrechen. Darum erwiderte sie: „Okay. Danke, Allie.“
„Das würdest du doch auch für mich tun.“ Allie nahm die Akte zur Hand. „Deine Mittagspause ist noch nicht zu Ende. Geh doch in den Kunstraum. Atme tief durch und komm zur Ruhe.“
Gute Idee. Wren nahm ihr Handy aus der Schreibtischschublade, machte sich auf den Weg zum Kunstraum und schloss die Tür hinter sich. Sie würde malen und dabei Musik hören. Das würde sie beruhigen. Sie nahm einige Tuben Acrylfarbe aus dem Vorratsschrank, stellte eine Staffelei und eine kleine Leinwand auf und wählte ihr Lieblingslied „Vincent“1 aus. Das inspirierte sie immer.
Starry, starry night, sang Don McLean, während Wren das Himmelblau auf ihre Palette drückte. Wie Vincent würde auch sie heute in Blau- und Grautönen malen.
Du schaust hinaus in einen Sommertag mit Augen, die die Dunkelheit in meiner Seele kennen. Vincent kannte es. Er verstand es. Er war ein Gefährte in der Dunkelheit.
Wren mischte das Blau mit einem Klecks Violett, bis es beinahe Schwarz war. Mit energischen Pinselstrichen trug sie die Farbe dick auf, formte das Dunkle zu düsteren Bergen und Höhlen. Einige Pinselstriche Gelb würden den Himmel aufhellen, aber eigentlich wollte sie den Himmel gar nicht aufhellen. Die violette Dunkelheit beruhigte sie.
Sie trat von der Staffelei zurück und vertiefte sich in die Szene. Das Violett würde sie mit Grau mischen und ein bedrohliches Wolkengebilde daraus entstehen lassen. Ohne eine Spur von Licht. Nicht wie bei Vincents Dunkelheit, durch die immer ein Licht hindurchschimmerte.
Lassen Sie es, wie es ist, würde Dr. Emerson vermutlich sagen. Wenigstens malen Sie.
Sie musste sich wirklich Zeit nehmen, wieder häufiger zu malen, besonders wenn sie sich gestresst fühlte. Sich mit Kunst zu beschäftigen, hatte ihr immer gutgetan – nicht nur, indem sie selber malte, sondern vor allem, indem sie Vincents Kunst betrachtete.
Als Kind hatte sich Wren in seine Gemälde verliebt und über Jahre hinweg die aufrichtige Poesie seiner Briefe studiert und sich daran erfreut. Ihre Abschlussarbeit im College hatte die ausgeprägte Spiritualität seiner Kunst und die Helldunkelmalerei seines leidvollen, von fröhlichen Augenblicken durchsetzten Lebens zum Thema gehabt. Sie hatte sich mit den von einem „Lichtstrahl von oben“ durchzogenen Schatten der Verzweiflung, wie er es nannte, beschäftigt. In seinen Briefen, seinen Skizzen, seinen Gemälden – sogar in den besonders düsteren – leuchtete immer eine Andeutung von Hoffnung auf.
Mit Augen, die die Welt gesehen haben und nicht vergessen können …
Wie sehr sie sich wünschte, sie könnte sehen und vergessen! Wren legte ihr Palettenmesser aus der Hand und strich eine Strähne ihrer kurzen dunklen Haare aus den Augen. Sie beneidete Menschen, denen das gelang. Aber sie hatte es noch nie gekonnt und würde es vermutlich auch nie können. Sozialarbeiter, Künstler, Pflegekräfte, Menschen des Glaubens und des Mitgefühls – ihre Aufgabe war es zu sehen, ohne sich das Leid anderer zu sehr zu Herzen zu nehmen.
Am Waschbecken drückte sie die Borsten ihrer Pinsel zusammen, um die Überreste der dunklen Farbe auszuwaschen. Vielleicht würde sie die Kinder heute lieber malen statt zeichnen lassen. Dann konnte sie die verwendeten Farben analysieren, die Bilder auf Hinweise auf ein Trauma prüfen und ihre Beobachtungen in die jeweilige Akte eintragen.
Mit lauwarmem Wasser wusch Wren sich die Hände, während sie über die Schulter hinweg ihr Werk betrachtete. Welche Schlussfolgerungen würde ein Betrachter ziehen, wenn er das Bild anschaute? Was würde Dr. Emerson in ihrer Akte notieren? Sie drehte den Wasserhahn zu, nahm ihre Palette wieder zur Hand und tauchte ihren breitesten Pinsel in graue Farbe. Damit übermalte sie die ganze Leinwand und löschte jeden kleinsten Hinweis auf ihr Werk aus.
Sie durfte der Melancholie keinen Raum geben. Für die Kinder musste sie stark sein. Für die Frauen musste sie Hoffnung verbreiten. Sie musste sich zusammenreißen und Widerstandskraft zeigen. Das hatte sie schon mehrmals geschafft. Und sie würde es auch heute schaffen. In all dem Chaos und dem Aufruhr konnte sie sich festklammern wie Vincents Wurzeln. Und weitermachen.
1
Oktober
* * *
Zeit für Ihre Medikamente, Wren.“ Kelly, eine der freundlicheren Krankenschwestern, betrat das Zimmer mit einem kleinen Plastikbecher mit Tabletten und einem Glas Wasser.
Wren legte ihren Bleistift zur Seite. Sie war so in ihre Zeichnung vertieft gewesen, dass sie die Aufforderung der Schwestern, zum Schwesternzimmer zu kommen, um die Medikamente abzuholen, glatt überhört hatte. Kelly schimpfte zum Glück nicht.
„Das ist wirklich gut“, bemerkte sie, als sie Wrens Skizze einer Frau, die einen Eimer trug, betrachtete. „Ich wusste gar nicht, dass Sie malen können.“
„Ist nur so ein Hobby.“
„Na ja, ich kann nicht viel mehr als Strichmännchen zeichnen.“ Kelly reichte ihr den Becher. „Ich bin froh, dass Sie malen.“
Es gab nicht viel anderes zu tun. Schlafen, malen, an den Gruppenstunden teilnehmen. Nachdem die lähmende Lethargie endlich gewichen und die rasenden, beängstigenden Gedanken in Wrens Kopf langsam zur Ruhe gekommen waren, drängten ihre kreativen Impulse wieder nach oben. Pflichtbewusst schluckte sie ihre Tabletten.
„Die anderen sind gerade zum Frühstück nach unten gegangen“, erklärte Kelly. „Ich würde Ihnen ja gern ein Tablett ins Zimmer bringen, aber das sieht Dominic nicht gern.“
Nein, allerdings nicht. Ihr neuer Fallmanager hatte Wren klare Anweisungen gegeben. Er fand es wichtig, dass sie so oft wie möglich Gemeinschaft suchte. „Ich komme gleich.“
„Ich begleite Sie nach unten. Kommen Sie doch zum Schwesternzimmer, wenn Sie so weit sind.“
Wren wartete, bis Kelly den Raum verlassen hatte, bevor sie sich wieder ihrer Zeichnung zuwandte. Wenn sie das Bild der gestrandeten Wale nach all den Monaten, die vergangen waren, seit sie den Artikel gelesen hatte, immer noch nicht aus ihren Gedanken vertreiben konnte, dann musste sie eben damit arbeiten.
Das hatte Dr. Emerson ihr bei ihrer letzten Sitzung empfohlen, kurz bevor er im Juni in den Ruhestand gegangen war. Seien Sie offen für das, was das Bild Ihnen offenbaren möchte. Und machen Sie einen Termin bei einem meiner Kollegen.
Aber Wren hatte keinen Termin bei einem anderen Therapeuten gemacht. Sie hatte die Veränderung satt, und es kostete sie zu viel Energie, mit jemand anderem noch einmal ganz von vorn anzufangen. Falls sie überhaupt einen Therapeuten fand, mit dem sie zurechtkam. Das war immer eine Herausforderung. Und wenn man dann endlich einen guten gefunden hatte, zog er weg. Oder die Therapeutin ging in Mutterschutz und kam nicht zurück. Oder die Therapie wurde von der neuen Krankenkasse nicht übernommen. Oder der Therapeut ging in den Ruhestand.
Mit der Spitze ihres Bleistifts schattierte Wren die Haare der Frau. Vielleicht war das ja gar keine Rettungsmission. Vielleicht wollte die Frau mit dem Eimer mit einem Kind eine Sandburg bauen, und dieser Eimer war wie der rote Plastikeimer, den Wren und ihre Mutter früher immer an den Strand in der Nähe ihres Elternhauses in Australien mitgenommen hatten, wenn sie Muscheln suchen wollten. Die dunkelroten mochte Wren am liebsten.
Aber ihr Großvater hatte sie immer gewarnt, dass blau geringelte Kraken in den Gezeitentümpeln lauerten, sich in Muschelschalen oder unter Steinen versteckten. Sie müsse gut aufpassen, weil diese Lebewesen ein kleines Mädchen mit einem Biss lähmen und bewusstlos machen könnten. Am Ende würde ihr Gift sogar zu Atemstillstand führen. Opa kannte ein Mädchen, das –
Sie musste atmen.
– mit seinem Großvater auf der Suche nach Seesternen gewesen war, als –
Atme.
Wren legte eine Hand auf ihre Brust, die andere unter ihren Brustkorb und atmete langsam durch die Nase, damit sich ihr Zwerchfell mit Luft füllte, genau wie ein Therapeut es ihr vor Jahren beigebracht hatte. Beim Ausatmen mit gekräuselten Lippen spannte sie ihre Bauchmuskeln an. Den Oberkörper still halten, ganz still. Einmal. Zweimal. Ein drittes Mal.
Siehst du? Alles in Ordnung. Atme nur weiter, schön langsam.
Nach ihrer Morgengruppe würde sie einen entspannten Tag am Strand des nahe gelegenen Lake Michigan verbringen, wo keine Wale strandeten, keine giftigen Kraken im Schatten lauerten und wo Kinder hüpfen und spielen und Sandburgen bauen konnten – zufriedene, glückliche und sorgenfreie Kinder, nicht verängstigte oder traumatisierte oder missbrauchte wie die, die ins Bethel-Haus kamen, sondern Kinder, die lachten und im Wasser tollten, unschuldig, beschützt und in Sicherheit.
Sie versteckte ihren Skizzenblock unter dem Kopfkissen, damit ihre Bettnachbarin ihn nicht fand. Dann band sie ihre Schuhe mit einer Plastikklemme – als Ersatz für die konfiszierten Schnürsenkel – zu und ging zum Schwesternzimmer.
Auf dem Weg zum Speisesaal waren das gequälte Stöhnen und die Protestschreie hinter den geschlossenen Türen deutlich zu hören. Das gleiche Stöhnen und die gleichen Protestschreie, die in den vergangenen Tagen wie eine Dauerschleife in Wrens Kopf abgelaufen waren. Ich sollte gar nicht hier sein. Ich gehöre nicht hierher. Bitte helft mir!
Während der letzten Monate hatte sie sich eingeredet, dass sie nach mehr als zehn Jahren Therapie und sechs unterschiedlichen Therapeuten – und natürlich im Rahmen ihrer Ausbildung zur Sozialarbeiterin – alle Hilfsmittel zusammengetragen hatte, die sie brauchte, um den guten Kampf zu kämpfen, wann immer ihr Angstgegner wieder den Kopf in die Höhe reckte. Aber sie hatte sich geirrt. Naiv und voller Hoffnung hatte sie gedacht, sie könnte ihre Medikamente absetzen, ohne dies mit ihrem Arzt abzusprechen. Sicher, man konnte ihr vorwerfen, dass sie selbst schuld daran war, weil sie nicht proaktiv um Hilfe gebeten hatte, als sie dringend Hilfe brauchte. Aber sie hatte gehofft, sie käme allein zurecht.
Und das war ihr auch gelungen. Zumindest eine Zeit lang. Fast vier Monate hatte sie sich ohne Dr. Emerson durchgeschlagen, und ganze acht Monate ohne Casey. Man könnte sagen, sie hätte ein wenig Anerkennung dafür verdient, dass sie so lange durchgehalten hatte, ohne zusammenzubrechen, zumal ihr Job ihr einiges abverlangte. So viele Wale. So viele Mutter- und Babywale.
In den Fluren des Glenwood Psychiatric Hospital und an zahllosen fernen Küsten lagen Gott weiß wie viele hilflose Wesen, die seufzten und stöhnten, schlapp und desorientiert, die auf eine Gnadenmission hofften, auf einen Becher kaltes Wasser, die Rettung vor der Zerstörung, die Auferstehung vom Tod.
In den vergangenen drei Jahren hatte Wren zu den Rettern gehört. Jetzt, mit siebenundzwanzig, gehörte sie zu den Gestrandeten, die es satthatten, gegen die reißende Strömung der Angst, Verzweiflung und Empfindsamkeit anzukämpfen, die sie ohne Vorwarnung und von einem Augenblick zum nächsten unter Wasser ziehen konnte. Wenn andere wüssten, welche inneren Kämpfe nötig waren, um nicht unter der täglichen Last des Kummers und Stresses zusammenzubrechen, wären sie vermutlich nicht erstaunt, dass Wren im Glenwood gelandet war. Vielleicht würden sie sogar Mitgefühl mit ihr haben. Aber sie hatte es ihnen nicht gesagt. Ihre Freunde und Kolleginnen wähnten sie in einem dringend benötigten Urlaub.
Casey hätte sie die Wahrheit gesagt, und er hätte sie verstanden. Er hatte selbst Hilfe gebraucht. Mehrmals. Oft war sie es gewesen, die ihm beigestanden und ihn aus der Krise herausgeholt hatte. Aber jetzt nicht mehr. Das war nun die Aufgabe seiner Frau. Sie hoffte nur, dass Brooke aufmerksam war.
Wren häufte Rührei auf ihren Teller, goss sich ein kleines Glas Orangensaft ein und nahm an einem kleinen Tisch in der Ecke Platz. Ganz bewusst wandte sie den anderen Patienten, die gemeinsam an größeren Tischen in der Mitte des Raumes saßen, den Rücken zu. Während sie langsam kaute, glitt ihr Blick über die gerahmten Kunstdrucke an der Wand. Sie sollten wahrscheinlich die triste Stimmung im Speisesaal und den nicht gerade erbaulichen Fensterblick auf eine Mauer kompensieren. Sie fragte sich, ob diejenigen, die die Drucke ausgewählt hatten, sich bewusst für Vincents Sonnenblumen und Schwertlilien und Weizenfelder und Gärten als Schmuck für eine psychiatrische Klinik entschieden hatten. Vielleicht wussten sie ja nicht, dass er einige dieser Gemälde während seines Aufenthalts in einer Nervenheilanstalt gemalt hatte. Vielleicht hatten sie die Gemälde ausgesucht, ohne den Hintergrund seiner künstlerischen Tätigkeit zu kennen, ohne sich bewusst zu machen, wie er seinen Schmerz angegangen war und sein Leiden in die Schaffung von etwas Schimmerndem und Transzendentem hatte fließen lassen, indem er das wirbelnde Licht der Sterne oder das verwitterte Gesicht und die erschöpfte Haltung eines Feldarbeiters einfing.
Egal, wie die Kunst an die Wände gekommen war, Wren war dankbar für die Schönheit inmitten der Verzweiflung. Hier an dem Ort, an dem sie seit fünf Tagen keinen Grashalm und keinen Baum gesehen hatte, zeigte Vincent ihr die Strahlkraft der Natur und erinnerte sie daran, dass es noch Orte gab, an denen sie atmen konnte. Zum Beispiel der von Mauern umschlossene Hof, in dem sie sich zweimal am Tag aufhalten durfte und wo ein Stück blauen oder grauen Himmels über den Betonmauern einen kleinen Ausschnitt jener Unendlichkeit offenbarte, die sie lockte und ihre Hoffnung beflügelte, dass sie eines Tages frei wäre von der bedrückenden Dunkelheit, die auf ihr lastete wie ein Felsbrocken auf einer Libelle.
Vincent zumindest hatte auf dem Gelände der Anstalt begleitete Spaziergänge machen und im Freien malen dürfen, wenn er gesundheitlich dazu in der Lage gewesen war. Wren fragte sich, wer entschieden hatte, dass Strenge und Kargheit für die Patienten einer psychiatrischen Klinik wie Glenwood besser waren als Schönheit und üppige Vegetation. Wenn es nur einen Garten gäbe, in dem man sich an blühenden Pflanzen erfreuen könnte. Wenn es nur Blumen oder Vögel oder einen Teich gäbe. Irgendetwas Lebendiges und Belebendes.
Sie legte ihre Plastikgabel mit den abgerundeten Zinken aus der Hand und konzentrierte sich auf Vincents goldene Weizenfelder unter einem aufgewühlten Himmel. Das weite Blau erinnerte sie an den australischen Himmel, den sie als Kind so sehr geliebt hatte. In ihrer Erinnerung und Fantasie konnte sie dorthin reisen – zum Haus ihrer Großeltern, in dem sie mit ihrer Mutter zehn Jahre gelebt hatte. Ein Haus, das immer größer geworden war, wenn Opa hier eine Veranda anbaute, dort ein Schlafzimmer. Es stand auf einem Stück Land, das er dem Busch abgerungen hatte. Die Weide, auf der die Pferde grasten, war von Eukalyptusbäumen gesäumt.
Wren stellte sich vor, wie sie als kleines Mädchen mit einem Buch unter den Weidenbäumen am Teich saß und las. Wie Opa Weihnachtsbaumschmuck aus stacheligen Banksia-Zapfen schnitzte. Wie sie unter dem Kreuz des Südens lag und den Himmel nach Sternschnuppen absuchte. Wenn sie eine entdeckte, wünschte sie sich etwas. Hier war sie glücklich und zufrieden.
Aber schon damals hatten sich Schatten auf sie gelegt und das Bild der Freude und Zufriedenheit verdüstert. Die unheilvolle Dunkelheit rückte unaufhaltsam näher, so, wie es auch Vincent erlebt hatte. Die Sturmwolken ballten sich zusammen, die Krähen hockten in den Bäumen, der Zerstörer pirschte sich am helllichten Tag an sie heran und stieß furchterregende Drohungen aus, immer auf der Lauer, immer näher rückend, immer mehr den Lichthof der Sonne verdunkelnd. Damals hatte sie keine Worte für die Dunkelheit gehabt. Erst später lernte sie einen Namen dafür kennen. Depression. Angststörung.
„Die Gruppenstunden beginnen“, rief eine Stimme von der Tür aus. Obwohl die Teilnahme an den verschiedenen Gruppen keine Pflicht war, hatte man dennoch keine Wahl, wollte man die Therapeuten von seinen Fortschritten überzeugen. Bisher hatte Wren nicht eine Stunde versäumt.
Mit einem letzten Blick auf Vincents Himmel schob sie die Rühreierreste in den Mülleimer, goss ihren Saft aus und folgte den anderen Patienten durch den Flur.
B
„Wren? Was für ein Name ist das denn?“
Jeden Tag die gleiche Frage von der Frau, die ständig auf ihrem Stuhl vor und zurück wippte und die Hände rang.
„Lass sie in Ruhe, Sylvia“, murmelte der Mann neben ihr. „Das ist ein sehr schöner Name.“
„Das ist ein Vogelname. Der Name eines Vogels. Wie ein kleines Vögelchen. Sie ist ein kleines Zirpvögelchen. Zirp, zirp.“
Wren hielt den Blick gesenkt und rang um Fassung, versuchte aber gleichzeitig, Mitgefühl für diese Frau aufzubringen. Wann würde Christie, die Sozialarbeiterin, endlich eingreifen? Im Bethel-Haus hatte Wren selbst viele Gruppen wie diese geleitet, mit ambulanten Patienten und Bewohnern, die traumatisiert und zutiefst verstört zu ihnen gekommen waren und für einige Zeit dort lebten. Manche von ihnen kämpften gegen die Dämonen der Abhängigkeit, andere waren auf der Flucht vor häuslicher Gewalt, und einige waren eine Gefahr für sich selbst und, ganz selten, auch für andere.
Sie gehörte nicht hierher. Beim Aufnahmegespräch hatte man Wren versprochen, dass sie nur ein paar Tage bleiben müsse, bis sie stabilisiert und medikamentös eingestellt sei. In dieser Zeit könne sie einige neue Strategien erlernen, um mit Stress umzugehen. Dann könne sie wieder nach Hause.
Sie sei erschöpft, hatte sie erklärt, geistig, körperlich, emotional und geistlich, und sie brauche nur eine kurze Atempause von ihrem Leben, einen Ort, wo sie kein Handy habe, wo sie nicht ständig mit den Bedürfnissen und dem Schmerz anderer Menschen konfrontiert werde, wo sie nicht an jeder Straßenecke mit dem Chaos und dem Leid der Welt in Berührung komme.
„Zirp, zirp, kleiner Vogel.“
Wren rieb sich die Nase.
„Kleiner Vogel, zirp, zirp.“ Sylvia lachte, laut und lange. „Hast du einen alten Bubukater gesehen? Kapiert? Kapiert, kleines Zwitschervögelchen?“
Hör auf!, forderte Wren still für sich. Hör sofort auf damit!
Sylvia beugte sich vor, sodass ihr Gesicht Wrens beinahe berührte. Ihr Atem roch sauer. „Zirrrrrrp, zirrrrrrp!“
Wren sprang mit geballten Fäusten und bebenden Nasenflügeln auf. Jemand packte sie und bog ihr die Arme nach hinten. Sie wehrte sich gegen die Umklammerung, konnte sich aber nicht aus dem festen Griff befreien.
Zirp, zirrrrrrp! Der spöttische Schrei durchbohrte sie wie eine gezackte Klinge, und sie sank auf die Knie und flehte und schrie, das alles möge doch endlich aufhören.
B
Eine Stunde später erschien Dominic mit seinem Klemmbrett in der Hand im Türrahmen ihres Zimmers. „Ist es in Ordnung, wenn wir kurz reden?“, fragte er und betrat das Zimmer, ohne ihre Zustimmung abzuwarten. Mit dem Fuß angelte er sich den Schreibtischstuhl und setzte sich neben ihr Bett.
Wren zog die Knie an die Brust und die Kapuze ihres grauen Sweatshirts über den Kopf. Ihre Finger tasteten nach der Kordel – eine Rettungsleine, eine Nabelschnur, um sie zu erden. Aber die Kordel war zusammen mit den Schnürsenkeln konfisziert worden. „Ich wollte sie nicht schlagen.“ Ihre Stimme klang dünn, als käme sie von einem viel jüngeren Mädchen.
Er notierte etwas, ohne sie anzusehen. „Dr. Browerly wird Sie sehen wollen, wenn er nach dem Mittagessen wieder da ist.“
Wren wusste, worum es bei diesem Gespräch gehen würde: Bemerkte sie zunehmende Stimmungsschwankungen bei sich? Aggressive Gedanken? Hatte sie schon einmal mit gewalttätigem Verhalten zu kämpfen gehabt? Sie kannte die Checklisten.
„Ich schlafe nicht“, erwiderte sie, und zu spät wurde ihr bewusst, dass das in ihrer Akte vermerkt werden und dass man ihr daraufhin noch ein weiteres Medikament verschreiben würde. Aber wie sollte sie schlafen, wenn alle fünfzehn Minuten die Schwester in ihr Zimmer kam und mit der Taschenlampe kontrollierte, ob alles in Ordnung war? Wie sollte sie schlafen, wenn ihre Bettnachbarin schnarchte, wenn Patienten nachts über den Flur geisterten, manchmal sogar ungesehen an dem Schwesternzimmer vorbeischlichen und stumm im Türrahmen ihres Zimmers standen und sie anstarrten? Wie konnte sie hoffen, ihre Ängste in den Griff zu bekommen, wenn alles um sie herum das Gefühl von Hilflosigkeit und Verletzlichkeit in ihr verstärkte?
Sie sehnte sich nach Ruhe. Sie wollte schlafen und schlafen und nicht aufwachen. „Bitte schicken Sie mich nicht wieder in den Südflügel.“ Im Südflügel lagen die Patienten, die geistig schwer gestört waren. Wren hatte drei mörderische Tage dort verbracht, nicht weil ihr Zustand eine solche Unterbringung erforderlich gemacht hätte, sondern weil nur dort ein Bett frei gewesen war. „Bitte, Dominic.“ Ihre Bettnachbarin hatte Wren frisch genähte Wunden an ihren Armen präsentiert und nachts manchmal vor Angst aufgeschrien. Tag für Tag hatte Wren gebettelt, in den Nordflügel verlegt zu werden, und Tag für Tag war ihr gesagt worden: „Vielleicht morgen.“
Sie starrte auf ihr Armband. Darauf standen ihr Name und ihr Geburtsdatum. Aber das war nicht ihr Leben. Das konnte nicht ihr Leben sein.
„Christie deutete mir gegenüber an, dass Sie von jemandem aus der Gruppe provoziert wurden und dass Ihre Reaktion Züge einer posttrauma–“
„Nein.“ Wren kannte sich aus mit posttraumatischen Belastungsstörungen. Die hatte sie nicht. Obwohl sie eine entwickeln könnte, wenn man sie erneut in den Südflügel verlegte. „Ich bin müde. Das ist alles.“ Nicht verrückt, fügte sie still für sich hinzu.
Er blickte sie an. „Wurden Sie durch den anderen Patienten verletzt, der Sie festgehalten hat?“
„Nein, nicht schlimm. Ich meine, nein.“ Wren hatte sich und anderen gegenüber immer wieder beteuert, dass sie Sylvia bestimmt nicht geschlagen hätte, dass sie die Kontrolle behalten hätte, dass sie nur von ihrem Stuhl aufgesprungen war, um dem Spott zu entgehen und der Gruppe zu entfliehen. Aber vielleicht hatte der andere Patient sie davor bewahrt, etwas zu tun, was sie niemals von sich erwartet hätte. Sie wusste nicht mehr, wozu sie fähig war, sie war so müde. „Bitte schicken Sie mich nicht wieder in den Südflügel zurück. Ich will einfach nur schlafen.“
Dominic machte sich ein paar weitere Notizen und erhob sich schließlich. „Alle anderen sind im Augenblick in den Gruppen. Vielleicht können Sie vor dem Mittagessen noch ein wenig Ruhe finden.“
Sie wartete, bis er den Raum verlassen hatte, dann drehte sie sich auf die Seite. Sie wollte nicht weinen. Denn wenn sie anfing zu weinen, konnte sie bestimmt nicht mehr aufhören.
B
„Dominic sagte, ich darf Ihnen Ihr Mittagessen ins Zimmer bringen.“
Wren schob ihre Kapuze zurück und richtete sich im Bett auf.
Kelly reichte ihr ein Tablett mit Hühnersalat, einer Schale Melone und einem Körnerbrötchen. Dann ließ sie sich auf Wrens Bettkante nieder. „Wie geht es Ihnen? Haben Sie ein wenig geschlafen?“
Wren rieb ihre Augen. „Ich glaube, schon.“ Ihr Blick wanderte zum leeren Bett ihrer Zimmergenossin. Die Laken waren zerwühlt. Bisher hatten sie noch nicht viel miteinander gesprochen. Je normaler jemand wirkte, desto weniger war er bereit, über die Gründe seines Aufenthalts in dieser Klinik zu reden. „Wenn ich ein paar Nächte gut schlafen könnte, würde es mir sehr viel besser gehen, denke ich.“
„Das ist hier kaum möglich, ich weiß.“
Wenn Wren gewusst hätte, wie schwierig das werden würde, dann wäre sie vielleicht nicht hergekommen. Aber ihre sonst so verlässlichen Bewältigungsstrategien hatten einfach nicht mehr funktioniert. Und sie hatte Angst. Sie wusste nicht, wozu sie fähig war. Sie war so müde. Deine Schuld, mahnte die Stimme in ihrem Kopf. Wenn du nicht die Therapie abgebrochen und deine Medikamente weitergenommen hättest …
Der Gedanke, dass sie ihr Leben nur mithilfe von Medikamenten meistern konnte, war ihr zuwider.
Nur Casey und ihre Eltern wussten über den Cocktail aus Antidepressiva und Medikamenten gegen ihre Ängste Bescheid, die sie seit der Highschool regelmäßig einnahm. Auch Casey nahm verschiedene Medikamente gegen seine bipolare Störung. Das Stigma, das psychischen Erkrankungen anhaftet, hatten sie miteinander geteilt. Es hatte die Last leichter gemacht. Und sie gleichzeitig auch vergrößert.
„Dr. Browerly möchte Sie vor Ihrer nächsten Gruppenstunde sehen“, erklärte Kelly. „Und ich dachte, Sie könnten nach dem Essen noch ein wenig in den Hof gehen. Es ist so schön draußen. Kühl, aber sonnig.“
„Okay. Danke.“ Wolken, Regen, Hagel – es war Wren egal. Ein bisschen frische Herbstluft und ein Ort, wo sie sich ohne die Berieselung von Musikvideos oder Nachrichten aus dem Gemeinschaftsraum auf der anderen Seite des Flurs aufhalten konnte, waren echte Geschenke. Falls sie eine Auffrischung in Sachen „Dankbarkeit für die kleinen Dinge im Leben empfinden“ nötig gehabt hatte, dann hatte der Aufenthalt im Glenwood Hospital dies bereits bewirkt.
B
Immergrün. Kornblume. Aquamarin. Türkis. Azur. Himmelblau. Blau, oh, welch ein Wunder war dieses Blau! Wren legte den Kopf in den Nacken und schaute nach oben. Die weißen Wolken hingen wie von Vincent mit dicken Pinselstrichen aufgetragen am Himmel. Sie schloss ihr linkes Auge und strich mit zwei Fingern über den Bogen einer Wolke. Sie stellte sich vor, wie sich ihr Palettenmesser in der Hand anfühlte, während sie Weiß mit Violett und einer Spur von Zitronengelb mischte und die Farbe verteilte wie Glasur auf einem Kuchen. Im Kunstraum der Klinik gab es keine Palettenmesser oder Ölfarben oder Leinwände, sondern nur Wasserfarben, weiche Pinsel und weißes Kopierpapier. Aber wenigstens gab es Farbe. Zum ersten Mal seit Monaten empfand Wren den Wunsch, sich an eine Staffelei zu stellen und etwas Schönes zu schaffen. Das war schon ein Fortschritt, würde ihr Therapeut vermutlich sagen.
„Hören Sie das?“, fragte eine Stimme von hinten. Sie drehte sich zu einem grauhaarigen Mann um, der zum Himmel deutete. „Warten Sie einen Moment“, flüsterte er. „Warten Sie … da! Haben Sie es gehört?“
Wren hörte nur das Rascheln des sanften Windes in unsichtbaren Bäumen, die sich mittlerweile vermutlich in lodernde Fackeln von Bernstein, Zinnoberrot und Kupfer verwandelt hatten. „Nein. Tut mir leid. Ich glaube nicht.“
„Sie müssen genau hinhören. Schließen Sie die Augen.“
Da sie nicht wusste, ob es nicht vielleicht gefährlich war, sich so nah bei einem ihr fremden Mitpatienten aufzuhalten, blinzelte sie.
„Hören Sie jetzt genau hin, okay? Wie ein Husten. Cha-cha. Cha-cha-cha.“
Und auf einmal hörte sie den Ruf, genau wie er ihn beschrieben hatte. Sie öffnete die Augen. „Ja! Diesmal habe ich es gehört.“
Er nickte zustimmend. „Ein Carolinaspecht. Zu dieser Jahreszeit gibt er einen anderen Ruf von sich. Normalerweise ist es ein Quiierr-quiierr.“ Er schloss die Augen. „Kardinal … Blauhäher … Meise. Wieder Specht.“ Während sie sich an den Wolken erfreut hatte, hatte er sich an den Vogelrufen ergötzt. „Kennen Sie das wichtigste Hilfsmittel für die Vogelbeobachtung?“
Wren überlegte kurz. „Ein Fernglas?“
Er schnaubte. „Ihre Ohren. So erkennen Sie, welche Arten in Ihrer Umgebung sind, selbst wenn Sie sie nicht sehen können. Sie müssen nur richtig hinhören.“
Hoffentlich fragte er sie nicht nach ihrem Namen. Sie wollte nicht verraten, dass eine Frau, die den Namen eines Vogels trug, so wenig über diese Gattung wusste.
„Michigan“, fuhr er fort, „ist ein optimaler Ort. Liegt genau auf ihrer Wanderroute. Man sieht sie kommen und gehen.“ Er suchte den Himmel ab. „Bald werden sie wegziehen, zumindest einige von ihnen. Nach Süden, sobald das Wetter umschlägt. Haben Sie mal beobachtet, wie die Gänse sich beim Anführen der V-Formation abwechseln?“
Wren nickte.
„Wissen Sie auch, warum die eine Seite des V länger ist als die andere?“
„Nein.“
„Weil auf dieser Seite mehr Vögel fliegen.“ Er lachte und machte einem Pfleger ein Zeichen, dass er wieder hineingehen wollte.
Wren setzte sich auf eine Bank, den Blick noch immer gen Himmel gerichtet, die Ohren nun auf das Vogelgezwitscher eingestellt, das sie den einzelnen Vögeln aber nicht zuordnen konnte. Ihre Mutter kannte bestimmt einige der Rufe. Sie liebte Vögel. Immer wieder hatte sie Wren erzählt, wie ein Vogel sie gerettet hatte. Oder vielmehr, wie Gott sie gerettet hatte, indem er ihr einen Vogel schickte.
Vielleicht sollte sie ihre Mutter anrufen und sie bitten, ihr die Geschichte noch einmal zu erzählen, um sie daran zu erinnern, dass sie nicht allein war, dass Gott bei ihr war. Auch wenn es im Augenblick nicht so schien.
2
Oh, ihr süßes kleines Vögelchen.
Jamie Crawford drückte das Telefon an ihre Brust und lehnte sich ans Geländer. Es kostete sie alle Kraft, nicht sofort ins nächste Flugzeug von North Carolina nach Michigan zu steigen und ihre älteste Tochter in die Arme zu schließen. Aber Wren hatte wieder einmal darauf beharrt, dass dies eine Reise war, die sie allein machen musste. Sie wollte nicht, dass ihre Familie sie so erlebte. Nicht hier, Mama. Nicht jetzt. Vielleicht wenn ich wieder zu Hause bin.
„Ist alles in Ordnung, Mami?“ Die fünfjährige Zoe, das Nesthäkchen der Familie, das Jamie ganz unerwartet mit zweiundvierzig bekommen hatte, hielt beim Malen inne und schaute sie mit gerunzelter Stirn vom Tisch aus an. Obwohl Jamie vom Nachbarzimmer aus telefoniert hatte und sehr vorsichtig mit dem gewesen war, was sie sagte, spürte das Mädchen den Schmerz und die Sorge seiner Mutter.
„Alles gut, Schätzchen.“ Jamie legte das Telefon auf die Küchentheke und zog sich einen Stuhl heran. „Erzähl mir was über dein hübsches Bild.“
„Ich mache eine Karte für Wren.“
„Wirklich?“ Dieses Kind war wirklich einmalig.
„Weil sie so traurig ist.“
„Das ist wirklich sehr lieb, Zoe. Über eine Karte von dir freut sie sich bestimmt.“
Konzentriert zog Zoe die Nase kraus und wählte mit Bedacht einen Buntstift aus ihrem Kästchen aus. „Sie ist so traurig, weil ihr Freund weggezogen ist.“
Jamie nahm ein Blatt Papier von dem Stapel, der vor Zoe lag. Sie musste unbedingt vorsichtiger sein mit dem, was sie mit Dylan besprach, wenn die Kinder in der Nähe waren. „Dein hübscher Regenbogen wird sie bestimmt wieder fröhlich machen.“
„Und ich male eine Fee. Wie die, die auf deinem Bauch gelandet ist.“
Jamie nahm den blauen Buntstift aus dem Kästchen. „Zoe, wenn Mami telefoniert, geht es oft um Erwachsenendinge, um die du dir keine Gedanken zu machen brauchst, okay?“
„Ich weiß. Das sagt Papa auch immer.“
So gern Jamie das Thema gewechselt und von dem Missverständnis mit der Fee abgelenkt hätte – wenn sie das nicht richtigstellte, würde Zoe am Sonntag den Leuten im Gottesdienst vermutlich von der Fee erzählen, die Gott Jamie geschickt hatte, als Wren noch im Bauch ihrer Mami gewesen war.
Jamie skizzierte die Umrisse eines Vogels, bevor sie den Körper und den hoch stehenden Schwanz ausmalte. „Es war keine Fee, die sich auf Mamis Bauch gesetzt hat. Es war ein Vogel, der Fairywren heißt. Ein Staffelschwanz, ein winzig kleiner Vogel, der so strahlend blau ist wie der hier, siehst du?“
Zoe stützte sich auf der Tischplatte ab und beugte sich vor. „Das sieht aber nicht aus wie ein Vogel.“
„Stimmt. Ich kann nicht so gut malen wie du oder Wren. Aber das ist jedenfalls der kleine Vogel, der sich eines Tages, als ich gebetet habe, auf meinen Bauch gesetzt hat. In Australien gibt es ganz viele von diesen Vögeln. Ich zeige dir später mal ein Foto von einem echten.“
Zoe ließ den Kopf sinken und seufzte dramatisch. „Ich bin nur so traurig.“
Dylan betrat die Küche mit seinem Lieblingsbecher in der Hand, aus dem er immer trank, wenn er eine Predigt schrieb. „Warum ist mein Mädchen so traurig?“
„Weil ich vermutlich niemals einen echten Staffelschwanz oder Koalabären sehen werde.“
Er warf Jamie einen Blick zu, der fragte: Wo kommt das jetzt her?
Jamie formulierte mit den Lippen die Worte große Ohren und Wren.
Dylan strich Zoe über den Kopf. „Wenn du älter bist, machen wir vielleicht alle zusammen eine Reise nach Australien, dann kannst du sehen, wo deine Mami geboren wurde und wo ich sie getroffen und mich in sie verliebt habe. Und du wirst ganz viele Wallabys, Kängurus und Koalas sehen.“
„Und auch viele Kasuare, die dir mit ihren spitzen Krallen die Augen auskratzen“, rief der zwölfjährige Joel aus dem Wohnzimmer.
„Iiiiih!“, rief Zoe.
„Nicht, wenn ich aufpasse“, widersprach Dylan. „Meinem Mädchen wird nichts passieren.“
Joel tauchte mit seinem Biologiebuch im Türrahmen auf. Seine Kopfhörer hingen um seinen Hals. „Du findest sie vielleicht süß, aber Koalas haben auch spitze Krallen.“
Dylan hob die Hand. „Joel, das reicht.“
„Ich meine ja nur.“
„Es reicht!“
Ohne ein weiteres Wort ließ Joel sich wieder auf die Couch sinken.
„Zoe, pack deine Buntstifte zusammen und geh zum Spielen nach oben, okay? Ich muss mit Mami reden.“
„Aber ich will –“
„Jetzt sofort. Bitte.“
„Wir malen später weiter“, tröstete Jamie. „Und wenn du magst, hänge ich deinen Regenbogen an den Kühlschrank, dann können wir alle uns daran erfreuen, bevor wir ihn deiner Schwester schicken.“
„Ich muss noch die Fee malen.“
„Na gut, dann nimm ihn mit. Aber mal bitte auf deinem Schreibtisch, nicht auf dem Bett, okay?“
„Du auch, Joel“, sagte Dylan. „Geh für einen Augenblick nach oben. Ich möchte gern ungestört mit deiner Mutter reden.“
Sie warteten, bis sie zwei Türen im Obergeschoss hörten. Eine wurde etwas wütender zugeschlagen als die andere. „Sie hasst es, wenn sie ein Gespräch nicht mitbekommt“, bemerkte Jamie.
„Und mir gefällt es nicht, dass sie so gern lauscht. Wir müssen vermutlich anfangen, alle wichtigen Gespräche in meinem Büro zu führen. Entweder das, oder ich sage der Gemeinde, dass wir ein größeres Haus brauchen.“ Diese Drohung sprach Dylan aus, seit die heute sechzehnjährige Olivia die Grundschule besucht hatte. Das Haus war nicht für eine wachsende Familie geeignet. Aber der Blick über das Tal war unbezahlbar, vor allem wenn Glühwürmchen wie tausend funkelnde Lichter herumschwirrten oder Heißluftballons vom Talboden aufstiegen und über die bronzefarbenen und roten Bäume dahinglitten oder der Morgendunst wie ein hauchdünner Schleier über den immergrünen Bäumen hing. Wren liebte den Ausblick genauso sehr wie Jamie. Während ihrer Besuche hatte sie ihn häufig gemalt.
Dylan goss den Rest seines Kaffees ins Spülbecken. „Also, klär mich auf. Was gibt es Neues?“
„Sie will immer noch nicht, dass ich komme.“
„Ich weiß, das sagt sie, aber …“
„Sie meint, das würde mich zu sehr aufregen.“ Sosehr Jamie auch versuchte, Wren vom Gegenteil zu überzeugen – sie ließ nicht mit sich reden. „Ich habe ihr gesagt, dass es nicht um mich geht, sondern um sie. Darum, ihr unsere Liebe und Unterstützung zu zeigen. Und sie meint, das könnte ich am besten tun, indem ich wegbleibe. Ich möchte ihren Wunsch respektieren, aber …“
„Hat Kit sie schon besucht?“
„Wren hat nichts erwähnt. Und ich habe nicht gefragt.“
„Ich rufe sie an und frage sie, ob sie mal bei ihr vorbeischaut.“
Jamie schüttelte langsam den Kopf. „Nein. Warte.“ Auch wenn Kit, Dylans Lieblingstante, Wren bestimmt guttun würde, hatte Wren Jamie nicht die Erlaubnis gegeben, anderen von ihrem Klinikaufenthalt zu erzählen. „Ich möchte sie nicht hintergehen, zumal sie niemandem verraten hat, wo sie ist.“
„Aber Kit hat Erfahrung auf diesem Gebiet. Ginge es dir nicht auch besser, wenn du wüsstest, dass sie sich kümmert?“
„Natürlich, aber …“ Dylan nahm sein Telefon zur Hand. „Ich übernehme die Verantwortung. Wir rufen sie an.“
B
Nein, sagte Kit, Wren habe sich nicht bei ihr gemeldet. Zuletzt habe sie sie beim Kunstfestival gesehen, wo Wren eines ihrer Gemälde ausgestellt habe. „Ihre Seenlandschaft war wundervoll“, erklärte Kit, „aber sehr düster. Ich bin keine Malerin, aber es war sehr aufwühlend. Es waren viele Leute auf der Ausstellung, und ich hatte keine Gelegenheit, mit Wren darüber zu reden. Jetzt wünschte ich natürlich, ich hätte das Gespräch mit ihr gesucht. Das tut mir sehr leid.“
Jamie hatte ein Foto des Gemäldes gesehen. Die wogenden Wellen und der stürmische Himmel waren mit dicken, van-Gogh-artigen Pinselstrichen gemalt, doch es fehlte die Lebendigkeit der Farbe, wie sie sonst in Wrens Bildern zu finden war. Auch wenn Wren beteuert hatte, es sei eine gute Erfahrung gewesen, an dem Wettbewerb teilzunehmen, hatte sie trotzdem eingeräumt, wie schwierig es für sie gewesen sei, neben ihrem Werk zu sitzen, während die Leute Interesse heuchelten oder es mit einem abschätzigen Blick oder oberflächlichen Kompliment bedachten. Jamie bedauerte, nicht dabei gewesen zu sein. Aber Olivia hatte sich auf ihre Führerscheinprüfung vorbereitet, Zoe war krank gewesen, und Dylan hatte an einer Konferenz teilgenommen. Und Joel – irgendetwas war auch bei Joel gewesen, aber sie konnte sich nicht mehr daran erinnern, was es war.
„Ich würde sie sehr gern besuchen“, sagte Kit gerade, „wenn sie das möchte.“
Ein Physikprojekt. Joel hatte ein wichtiges Physikprojekt fertigstellen müssen, und da Dylan nicht in der Stadt gewesen war …
„Willst du mal bei ihr nachhören?“, fragte Kit. „Ich weiß, dass die Besuchszeiten ziemlich streng geregelt sind, aber ich würde meinen Terminplan entsprechend anpassen, wenn sie Besuch haben darf.“
„Ich frage sie“, erwiderte Jamie. „Aber, ganz ehrlich, vermutlich wird sie gar nicht glücklich darüber sein, dass wir dir davon erzählt haben. Nichts gegen dich, ich meine …“
„Nein, ich verstehe das. Solche Dinge sind sehr heikel. Und das Gefühl der Scham macht alles noch schlimmer. Das arme Mädchen!“ Kit hielt inne. „Ich bin sehr froh, dass ihr mich informiert habt. Ich werde für sie beten. Kann ich sonst noch etwas tun?“
Jamie fiel nichts ein, darum bedankte sie sich bei Kit und versicherte ihr, sie werde sie auf dem Laufenden halten. Schließlich gab sie das Telefon an Dylan zurück.
Wie viele Stunden hatte sie im Laufe der Jahre damit verbracht zu versuchen, Wrens Depression zu begreifen, einen Grund dafür zu finden, ein auslösendes Ereignis, ein Versagen ihrerseits oder irgendetwas, was sie vielleicht übersehen und was ihre geliebte Tochter dazu gebracht haben könnte, daran zu zweifeln, dass sie dem Leben, das ihr geschenkt worden war, gewachsen war. Wäre es leichter, die Krankheit ihrer Tochter zu akzeptieren, wenn sie eine Erklärung dafür hätte? Aber selbst wenn Jamie sie verstehen oder erklären könnte, hätte sie immer noch keine Kontrolle darüber und könnte sie nicht heilen. Obwohl sie alles versucht hatte. Gott war ihr Zeuge.
Und wieso jetzt dieser neueste Zusammenbruch? Über Jahre hinweg hatte Wren immer wieder beteuert, sie brauche keinen Klinikaufenthalt, sie könne die Depression und ihre Ängste mit ambulanten Therapiestunden und Medikamenten in den Griff bekommen. Es war nicht leicht gewesen, aber in den letzten Jahren war es ihr tatsächlich gelungen. Trotz ihres anstrengenden Jobs als Sozialarbeiterin – eine Berufswahl, von der Jamie immer befürchtet hatte, sie könnte die falsche gewesen sein – war es Wren gelungen, und manchmal ging es ihr sogar sehr gut damit. Anderen zu helfen, gab ihr ein Gefühl der Sinnhaftigkeit.
Sie ist traurig, weil ihr Freund weggezogen ist, hatte Zoe gesagt.
Es bestand kein Zweifel daran, dass Caseys plötzlicher Umzug und seine Heirat Wren hart getroffen hatten, nicht weil es jemals eine Liebesbeziehung zwischen den beiden gegeben hätte, sondern weil sie wie Geschwister waren. Nachdem sie so viel Zeit miteinander verbracht hatten, war es verständlich, dass Wren seinen Wegzug betrauerte. Aber erklärte das ihre lähmende Angst und ihr Abrutschen in eine massive melancholische Phase?
Auf der anderen Seite, so rief sich Jamie in Erinnerung: Wer war sie, dass sie sich ein Urteil darüber erlaubte, wie groß der Kummer eines anderen Menschen war?
Falls Wren wusste, was ihre letzte Krise ausgelöst hatte, so hatte sie ihrer Familie diese Information vorenthalten. Sie hatte nur gesagt, sie sei zu müde gewesen, um weiter gegen die Dunkelheit anzukämpfen. Sie habe Angst gehabt, so große Angst, dass sie Hilfe in einer psychiatrischen Klinik gesucht habe.
Durch das Fenster beobachtete Jamie die Wolkenfetzen, die sich wie Ranken über den Himmel wanden.
Ihre Tochter befand sich in einer psychiatrischen Klinik. Ihre Tochter litt an einer psychischen Erkrankung. Sie konnte nichts tun, um das in Ordnung zu bringen, nichts, um den Schmerz zu lindern. Sie konnte nichts tun.
Du kannst beten, würde mancher erwidern. Du kannst Gott vertrauen.
Das tat sie. Aber das hieß noch lange nicht, dass Gott auch alles gut machen würde.
3
Egal, wie alt sie war, Wren wurde nie müde, sich die Geschichte von dem „himmlischen Besucher“, wie ihre Mutter den kleinen Vogel nannte, anzuhören.
Sie stopfte ein Kissen hinter ihren Kopf, klappte ihren Notizblock auf und malte die Umrisse ihres geflügelten Namensvetters.
Als sie klein gewesen war, hatte Wren häufig im Schneidersitz auf der Weide gesessen und gehofft, einer von diesen kleinen Staffelschwänzen, die in dem die Weide eingrenzenden Gebüsch herumflatterten, käme zu dem Schluss, dass sie ein gutes Mädchen war, und würde sich ebenfalls auf ihrem Schoß niederlassen. Aber leider klappte das nicht, obwohl sie ganz still saß, und das machte das, was ihre Mutter erlebt hatte, umso besonderer und geheimnisvoller.
Mit der Bleistiftspitze schattierte sie den Schwanz.
Abends hatte Wren dann an ihre Mutter gekuschelt in dem kleinen Dachzimmer gesessen. Beide machten es sich unter der von ihrer Großmutter handgefertigten Steppdecke gemütlich, und Wren lauschte der Stimme ihrer Mutter. Wie keine andere vermochte diese es, ihre Ängste zur Ruhe zu bringen, indem sie Wren versicherte, dass sie in Sicherheit war, dass Gott über sie wachte und dass er selbst sie zusammengeknüpft hatte, nicht mit Nadeln, wie ihre Oma sie zum Nähen benutzte, sondern mit Liebe. Wren verstand nicht, was es bedeutete, dass Gott etwas mit Liebe zusammenknüpfte, aber sie hatte das Gefühl, etwas ganz Besonderes zu sein. Sie wusste, dass sie erwählt war und dass Gott sie bereits gekannt hatte, bevor sie zur Welt gekommen war.
„Aber was hat der Vogel gemacht, nachdem er auf deinen Schoß gehüpft war?“, fragte sie dann.
Und ihre Mutter antwortete: „Für mich sah es so aus, als wollte er sagen: ‚Ich wurde gesandt, um dir eine Nachricht von Gott zu überbringen.‘“
„Welche Nachricht?“
„‚Hab keine Angst.‘“
Und so legte Wren den Kopf auf ihr Kissen und versuchte, ihre eigene Angst zu vertreiben. Denn wenn Gott zu ihrer Mutter „Hab keine Angst“ gesagt hatte, dann brauchte auch sie keine Angst zu haben. Vor nichts.
Trotzdem war sie immer froh, dass Opa seinen Schlangenstock mitnahm, wenn sie gemeinsam in den Busch gingen. Er hatte ihr nämlich erzählt, dass einer seiner Hunde von einer Östlichen Braunschlange gebissen und getötet worden war. Nun hatte Wren Angst, dass Tangara, ihr liebster Hütehund, eines Tages auch gebissen und getötet werden würde. Diese Östlichen Braunschlangen waren schnell und aggressiv, und Opi sagte, sie seien bösartig und könnten sich aufrichten wie ein Hengst, und ihr Gift sei so gefährlich, dass es ein kleines Mädchen lähmen könne. Ihre Mutter gab ihm dann immer ein Zeichen, er solle ihr solche Dinge nicht erzählen, aber Opa erwiderte darauf: „Sie muss Bescheid wissen, damit sie aufpasst, wenn sie draußen spielt.“
Und wenn ihre Mutter abends dann die Leiter mit einem letzten „Ich hab dich lieb. Schlaf gut!“ hinuntergestiegen und ihr Kopf unterhalb der Dachbodenklappe verschwunden war, hatte sich Wren hinter einer Mauer aus Plüschtieren verbarrikadiert, war unter die Bettdecke gekrochen und hatte durch die Dachluke hindurch das Kreuz des Südens angeschaut, denn wenn sie das sehen konnte, wusste sie, dass Gott auch sie sehen konnte.
Als ihre Bettnachbarin hereinkam, schob Wren den Block unter die Decke. Sobald Monica eingeschlafen war, würde Wren eine schwangere Frau mit einem Vogel auf dem Schoß zeichnen. Sie wünschte, sie hätte ihre feinen Grafitstifte mitgebracht, aber vermutlich wären die zusammen mit den Schnürsenkeln und der Kordel ebenfalls konfisziert worden. Sie sollte dankbar sein, dass sie einen Bleistift behalten durfte.
Der arme Vincent. In der Anstalt hatte man ihm seinen Stift weggenommen. Ebenso wie seine Malutensilien, nachdem er während einer seiner Anfälle Ölfarbe und Terpentin geschluckt hatte. Er leide an einer Schläfenlappenepilepsie, hatten seine Ärzte gesagt. Damit einher gingen schlimme Anfälle und Halluzinationen, die Wochen anhalten konnten und ihm große Angst einjagten. Der arme, gequälte Vincent, verletzt und gestrandet und verängstigt, sehnte sich nach einem Becher Trost, nach Rettung, nach Frieden.
Wren räusperte sich und grüßte, als sie bemerkte, dass Monica zu ihr herübersah.
Leise erwiderte Monica ihren Gruß. Dann schlurfte sie zu ihrem Bett, holte ihren Schlafanzug unter dem Kissen hervor und verschwand hinter dem Vorhang, um sich umzuziehen.
Wren hoffte nur, dass sie schlafen konnte, ohne alle halbe Stunde von Monicas Schnarchen geweckt zu werden – trotz der Ohrstöpsel, die Kelly ihr gebracht hatte. Eigentlich sollte sie Mitgefühl für ihre Leidensgenossin empfinden – was immer deren Leiden war –, doch stattdessen empfand sie nur verzweifelte Erschöpfung.
So hatte sie ihrer Mutter ihren Kampf geschildert, als sie ein zweites Mal telefoniert hatten. Ja, sie habe häufige Panikattacken gehabt und leide unter Depressionen, aber wenn sie nur etwas Schlaf bekomme und medikamentös wieder richtig eingestellt sei, dann wäre alles gut. Und nein, es sei nicht nötig, dass Kit sie besuchen komme. Sie wolle sich ausschließlich auf ihre Gruppenstunden konzentrieren und darauf, dass sie so weit wiederhergestellt werde, dass sie nach Hause zurückkehren könne. Morgen wolle sie ihr schriftliches Entlassungsgesuch vorlegen, und dann müsse sie maximal noch drei Tage bleiben, was, wie sie ihrer Mutter versichert hatte, ausreichend Zeit sei. Zumal die Behandlung in der Klinik manchmal genauso schwer zu ertragen sei wie die Krankheit selbst.
Psychische Erkrankung.
Sie litt an einer „psychischen Erkrankung“. Wren hatte versucht, sich mit dieser Bezeichnung abzufinden, seit im Teenageralter eine Angststörung und eine Depression bei ihr diagnostiziert worden waren. „Das ist keine Schande“, hatte der Arzt gesagt, als er ihr das erste von vielen Rezepten ausstellte. „Wenn du Diabetikerin wärst, bräuchtest du Insulin.“
Aber diese Logik schien sich einigen Christen aus ihrem Bekanntenkreis nicht zu erschließen, die, obwohl sie ganz bestimmt keinen Diabetiker dafür verurteilen würden, dass er Medikamente nahm, darauf beharrten, dass man von Depressionen und Angststörungen geheilt werden könne, wenn man „nur genug dafür beten“ oder „die richtigen Bibelstellen auswendig lernen“ würde. Das hatte ihr ein Kleingruppenleiter gesagt, als Wren im ersten Collegejahr mit ihm über ihre Probleme gesprochen hatte. „Angststörungen und Depressionen sind ein Zeichen dafür, dass dir der Glaube fehlt“, hatte der Gruppenleiter gesagt. Wenn sie nur Buße tun und Jesus vertrauen würde, dann komme alles wieder in Ordnung.
„Und da fragst du dich, warum ich nicht in die Kirche gehe?“, hatte Casey gesagt, als sie ihm davon erzählt hatte. Dann hatte er darüber geschimpft, dass Hiobs Freunde gesund und munter waren und ihre frommen Plattitüden über diejenigen ergossen, die in Staub und Asche saßen.
Wren bereute, ihm überhaupt davon erzählt zu haben. Er brauchte nicht noch mehr Nahrung für seinen Zorn auf die Kirche.
Kurz darauf hatte Wren die Kleingruppe verlassen und die Gemeinde gewechselt. Und sie hatte den Entschluss gefasst, mit niemandem mehr außer Casey, ihren Eltern und ihrem Therapeuten über ihre Erkrankung zu sprechen. Sie wollte keine weiteren Vorhaltungen riskieren. Wenn sie „nur an Jesus zu glauben“ brauchte, um aus der Dunkelheit herauszukommen, dann wäre ihr das mittlerweile gelungen. Über Jahre hinweg hatte sie das versucht. Aber die Erklärung, ihre Ängste und Depression hätten ihre Ursache in der Sünde oder in mangelndem Glauben oder einem geistlichen Krieg, verstärkte diese nur noch.
Der Vorhang wurde zurückgeschoben und Monica erschien in einem gestreiften Flanellschlafanzug. Ihre Jeans und ihr Sweatshirt drückte sie wie eine Rettungsweste an ihre Brust.
„Deine Socken“, sagte Wren und deutete auf den Boden. „Du hast deine –“
„Oh. Danke.“ Als sie sich bückte, um sie aufzuheben, verlor sie beinahe das Gleichgewicht.
„Alles in Ordnung?“
Monica blickte auf, und ihr Mund verzog sich zu einem trockenen Grinsen. „Ist überhaupt jemand von uns in Ordnung?“
Unsicher, ob dies die Eröffnung eines Gesprächs war – oder ob sie selbst überhaupt ein Gespräch führen wollte –, versuchte Wren, die Spitze ihres kleinen Fingers in das Loch ihres Sweatshirts zu zwängen, durch das normalerweise die Kordel gezogen wurde.
„All das hier“, Monica gestikulierte wild mit der Hand vor ihrem Gesicht, „diese vielen Masken, dieses ganze ‚Mir geht es gut, alles ist in Ordnung‘ fällt in sich zusammen, ob wir es wollen oder nicht. Es fällt an einem Ort wie diesem in sich zusammen. Und die da draußen behaupten, ich bin tapfer. Tapfer? Dass meine Mutter meine Kinder versorgen muss, damit ich eine Pause vom Muttersein bekomme – das ist tapfer? Das macht mich einfach nur krank!“ Voller Abscheu spuckte sie dieses letzte Wort aus. „Und dieser Psychiater, Breyer, Bauer –“
„Browerly?“
„Ja, Browerly. Der ist doch einfach nur überflüssig. Sitzt da an seinem Computer und schaut dich nicht einmal an, während er ununterbrochen tippt. Das ist alles so … so …“
Wren wartete darauf, dass sie das richtige Wort fand.
„Entwürdigend. Eine Nummer. Ich bin eine Nummer. Seine ‚Zwei-fünfzehn‘ oder ‚Zehn-dreißig‘ oder ‚Eins-fünfundvierzig‘. Ich bin ein Termin in seinem Kalender, mehr nicht.“ Sie streifte ihre Pantoffel ab. „Er sitzt die Stunde ab, damit er die Gebühren kassieren und seine Hütte am See oder seine Kreuzfahrt oder was auch immer finanzieren kann.“
Wren räusperte sich erneut. „Kelly ist nett.“
„Ja, Kelly ist in Ordnung. Aber Kelly ist nicht diejenige, die über meinen Aufenthalt hier entscheidet. Das ist Browerly. Und wenn du ihn wirklich mal sprechen möchtest, dann geht er dir aus dem Weg. Ist dir das schon aufgefallen? Was passiert, wenn du mit ihm über deine Entlassung sprechen möchtest oder eine Beschwerde wegen irgendetwas hast? Dann ist er gerade“, sie machte mit den Fingern Anführungsstriche in die Luft, „nicht zu sprechen. Ist dir das aufgefallen?“
Das war ihr tatsächlich aufgefallen. Aber Dr. McKendrick, der andere Psychiater, den alle hier bevorzugten, war ausgebucht. Wren hatte sich erkundigt.
„Das ist ein einziger großer Schwindel“, sagte Monica. „Ich hätte mich nie bereit erklären dürfen hierherzukommen. Und wie heißt es so schön? Neunzig Prozent von uns werden wieder hier landen? Nein, ich nicht!“ Ihre Augen funkelten vor Entschlossenheit, als sie die Decke zurückriss und in ihr Bett stieg. „Ich nicht!“
Nein, dachte Wren. Ich auch nicht. Bitte nicht!