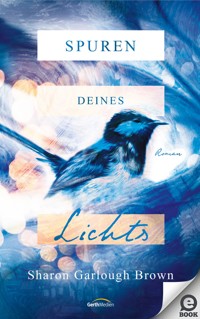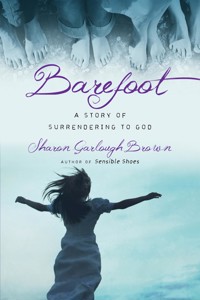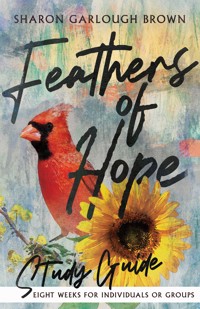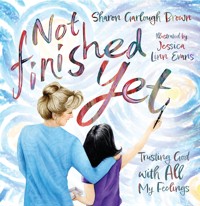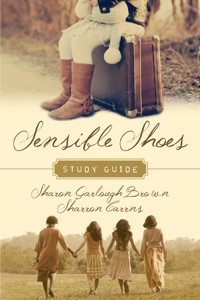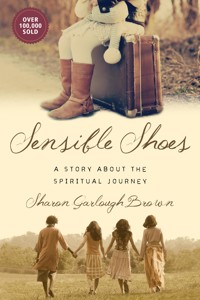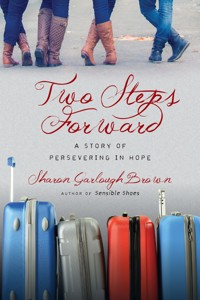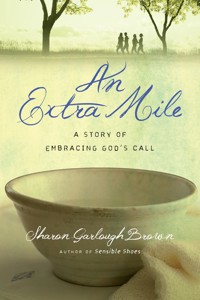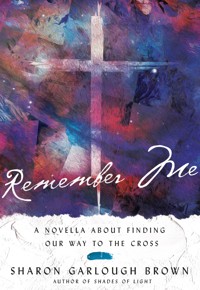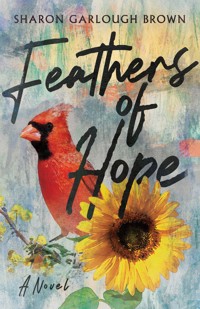Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Gerth Medien
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Vier Frauen auf einer Glaubensreise
- Sprache: Deutsch
Die drei Freundinnen Hannah, Mara und Charissa gehen gemeinsam mit Megs Tochter Becca durch eine Zeit tiefer Trauer und gleichzeitig auch großer Freude. Während Mara mitten im Scheidungsprozess steckt und ihr Zuhause im Chaos zu versinken droht, verspürt sie gleichzeitig auch den Ruf, anderen Menschen mit ihren Begabungen zu dienen. Hannah trauert um ihre Freundin Meg und muss sich endgültig von ihrem "alten Leben" verabschieden - und in ihre neue Rolle als Ehefrau hineinwachsen. Charissa versucht händeringend, ihre Schwangerschaft und ihr Studium unter einen Hut zu bringen. Dabei stellt sie fest, dass sie sich selbst und anderen gegenüber gnädiger sein muss. Becca hat nach dem Tod ihrer Mutter mit Schuldgefühlen zu kämpfen. Wird es ihr dennoch gelingen, neue Hoffnung zu schöpfen? Begleiten Sie in diesem vierten und gleichzeitig letzten Band der Reihe die Freundinnen auf ihrem Weg - mit all seinen Höhen und Tiefen - auf dem ihr ganzes Gottvertrauen gefordert ist. Die praktischen geistlichen Übungen im Anhang bieten Gelegenheit zur persönlichen Reflexion.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 582
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Über die Autorin
Sharon Garlough Brown ist Pastorin. Gemeinsam mit ihrem Mann leitet sie eine Gemeinde in West Michigan. Ihren reichen Erfahrungsschatz aus vielen Jahren geistlicher Retraiten und Kursen über geistliche Übungen hat sie in diesem Buch meisterhaft eingewoben.
Nehmt also Gott zum Vorbild! Ihr seid doch seine geliebten Kinder! Euer ganzes Leben soll von der Liebe bestimmt sein. Denkt daran, wie Christus uns geliebt und sein Leben für uns gegeben hat, als eine Opfergabe, an der Gott Gefallen hatte.
Epheser 5,1–2
* * *
Für Mama, Papa und Beth, die mir vorgelebt haben, was Liebe bedeutet. Und für Jack und David, die mir täglich zeigen, was Liebe ist. Ich liebe euch und danke Gott für euch.
Inhalt
Teil 1: Im Schatten
Meditation zu Johannes 11,17–44: Auferstehung und Leben
Teil 2: Zerbrochen und ausgegossen
Meditation zu Markus 14,1–11: Eine gute Tat
Teil 3: Steine wegrollen
Einkehrtag: Warten auf den Morgen
Teil 4: Alles wird neu
Meditation zu Johannes 21,9–22: Dem Ruf folgen
Leitfaden für Gebets- und Gesprächsrunden
Anmerkungen
Wege
Sinnlos zu fragen, welcher See in dem anderen Tal liegt,
von Fischreihern belagert,
oder zu bedauern, dass ich die Lieder in dem Wald
nicht hören werde,
den zu umgehen ich beschlossen hatte.
Sinnlos zu fragen, wo andere Wege hinführen würden,
da sie irgendwohin führen;
denn nichts als das Hier und Jetzt
ist mein eigentliches Ziel.
Der Fluss fließt sanft im lauen Abend,
und alle Schritte meines Lebens führen mich nach Hause.
Ruth Bidgood
Teil 1
Im Schatten
* * *
Erbarm dich, Gott, hab Erbarmen mit mir! Bei dir suche ich Zuflucht, im Schutz deiner Flügel will ich mich bergen, bis das Unglück vorüber ist.
Psalm 57,2
1
Becca
In Bezug auf die Trauer hatte Becca Crane in den drei Wochen seit dem Tod ihrer Mutter eines gelernt: Die Emotionen überfielen sie ohne Vorwarnung. Die einfachsten Dinge konnten sie aus der Fassung bringen – ein amerikanischer Akzent in der Londoner U-Bahn, eine Packung Cheerios (die Lieblingscornflakes ihrer Mutter) im Supermarkt, die traurigen Klänge einer Violine, gespielt von einem Straßenmusiker auf der Südseite der Themse. Und aus irgendeinem Grund lösten abendliche Spaziergänge am Flussufer mit Blick auf das House of Parliament einen so tiefen Schmerz in ihrer Brust aus, dass sie kaum noch Luft bekam.
Sie zog ihre Wollmütze über die Ohren und lehnte sich an das kalte Metallgeländer. Die schmiedeeisernen Laternen warfen ihr warmes Licht auf Paare, die Hand in Hand am Südufer entlangspazierten, und das Lachen von Kindern auf einem Karussell drang zu ihr herüber.
Warum sie diese Abendspaziergänge überhaupt unternahm, wusste sie nicht. Vielleicht war der bohrende Schmerz des Verlustes besser zu ertragen als die Gefühllosigkeit, die sich unmittelbar nach dem Tod ihrer Mutter in ihr ausgebreitet hatte. In ihrer Heimatstadt Kingsbury waren die Tage wie im Nebel an ihr vorbeigezogen. Sie war wie betäubt gewesen, als würde sie neben sich stehen und sich selbst in einem Film zusehen; eine kleine, dunkelhaarige Waise, die sich und alle anderen davon überzeugen wollte, dass sie schon „zurechtkommen“ würde.
„Ruf mich an, wenn du etwas brauchst“, hatte ihre Tante am Telefon zu ihr gesagt, kurz nachdem Becca nach London zurückgekehrt war, um ihr Auslandsjahr zu Ende zu bringen. Doch Becca gab nicht viel auf ihre Worte, denn Rachel hatte sich nicht einmal die Mühe gemacht, zur Beerdigung zu kommen, und dabei eine Auslandsreise, die sie unbedingt antreten müsse, als Grund vorgeschoben. Außerdem hatte sie von ihrem Angebot Abstand genommen, Becca während des Sommers einen Teilzeitjob zu geben, damit sie – auch ohne die finanzielle Unterstützung und Billigung ihrer Mutter – mit Simon nach Paris fahren konnte. Becca sei durch das „bescheidene Vermögen“ ihrer Mutter nun ja versorgt, hatte Rachel sarkastisch angemerkt. „Was um alles in der Welt willst du mit dem Haus machen?“
Becca wusste es nicht. Sie wusste gar nichts. Nur, dass sie ihre Mutter vermisste. Ganz schrecklich sogar!
Ein hell erleuchtetes Ausflugsschiff fuhr an ihr vorbei. Becca stellte sich die Gespräche der jungen Frauen vor, die bei Kanapees und Champagner mit ihrem Gegenüber flirteten und an nichts anderes zu denken brauchten als an die Männer, die sie für sich gewinnen wollten. Ihre Freundin Pippa war genau so. Sie hatte sich bemüht, ihr verständnisvoll und mitfühlend zu begegnen, aber Pippa hatte noch keinen geliebten Menschen verloren, abgesehen von ihren wechselnden Freunden und dem Schmerz, der damit verbunden war, wenn eine Beziehung zu Ende ging. Ihr Rat war gut gemeint gewesen, doch nicht wirklich hilfreich. Becca solle sich ablenken. Mit Alkohol, Spaß, Sex – es sei ganz egal, hatte Pippa gemeint, Hauptsache, es lenke sie von dem Schmerz ab. Das allein sei wichtig.
Jeder hatte einen guten Rat für sie. Vielleicht fühlten sich ihre Freundinnen dadurch einfach besser und glaubten, ihr geholfen zu haben, bevor sie sich anschließend von der Verantwortung freisprachen, sich weiter um sie kümmern zu müssen. Becca hatte schon alles gehört, was ihre besten Freundinnen auf beiden Seiten des großen Teichs zu bieten hatten:
Deine Mutter würde wollen, dass du glücklich bist. Sie würde wollen, dass du dein Leben weiterlebst.
Du solltest reisen, dir die Welt ansehen. Das Leben ist kurz. Mach das Beste draus!
Erinnere dich einfach an die schönen Zeiten, die du mit deiner Mutter gehabt hast. Versuch, glücklich zu sein.
Schau auf das, wofür du dankbar sein kannst.
Doch keine dieser Plattitüden half ihr weiter. Und immer wenn jemand sagte: „Ich weiß genau, was du empfindest. Als mein –“, es folgte der Name eines Familienmitglieds oder geliebten Haustieres, „– starb …“, dann hätte Becca am liebsten geschrien: „Du weißt überhaupt nicht, was ich empfinde! Du hast keine Ahnung davon, wie es mir gerade geht!“
Sie holte ein Taschentuch aus ihrer Manteltasche und putzte sich die Nase. Wie sollte irgendjemand anderes wissen, was sie empfand, wo sie es doch nicht einmal selbst wusste? Die einzige Person, mit der sie darüber reden wollte – die einzige Person, der sie in ihrem Leben vertraut hatte –, war tot. Für immer. Sie lebt in deinen Erinnerungen weiter, hörte sie Simons Stimme in ihrem Kopf wiederholen.
Doch das reichte nicht. Nicht einmal annähernd!
Sie trat von dem Geländer zurück und machte sich auf den Weg zum London Eye, das in hellem Blau angestrahlt war. Dort, am Fuß des Riesenrads, wo sich gerade fröhlich lachende Menschen für eine halbstündige Fahrt in den großen Kabinen anstellten, hatte ihre Mutter im Dezember auf sie gewartet. Becca hatte sie bereits von Weitem entdeckt und Simon auf sie aufmerksam gemacht. Aber dieser lachte nur und sagte, wie klein und ängstlich sie doch wirken würde, wie sie so dastand, den Kopf in den Nacken gelegt, und zum Riesenrad hinaufblickte. „Sie scheint ziemlich nervös zu sein, nicht?“, fragte er, und Becca nickte. Als sich ihre Blicke trafen, zwang ihre Mutter ein angestrengtes, aber entschlossenes Lächeln auf ihr Gesicht. „Ah, sieh nur“, sagte Simon, „sie wird mich lieben.“ Und Becca hatte gelacht und sich noch enger an ihn gedrückt.
Sie lebt in deinen Erinnerungen weiter, wiederholte Simons Stimme.
Das reichte nicht.
Während sie beobachtete, wie Familien in die Kabinen einstiegen, wurde Becca eines bewusst: Sie würde alles dafür geben, um diese Fahrt noch einmal mit ihrer Mutter machen zu können. Nur sie beide.
Ihr Telefon vibrierte und zeigte eine SMS von Simon an: Warte auf dich.
Mit ihrem Jackenärmel fuhr sie sich über das Gesicht und antwortete: Bin gleich da.
Hannah
Einen Monat nachdem sie ihre Kündigung an die Gemeinde abgeschickt hatte, in der sie 15 Jahre als Pastorin gedient hatte, wusste Hannah Shepley Allen eines: Entbehrlich zu sein war in der Theorie leichter zu ertragen als in der Praxis.
„Für mich bist du unersetzlich“, versicherte ihr ihr Ehemann Nathan, mit dem sie seit zwölf Tagen verheiratet war. Er beugte sich vor und drückte ihr einen Kuss auf die gerunzelte Stirn. „Und für Jake auch. Er ist total vernarrt in dich. Genau wie ich!“
Hannah schob ihren Stuhl vom Küchentisch zurück, den Blick noch immer fest auf den Bildschirm ihres Laptops gerichtet. Vielleicht wäre ihr Ego weniger angekratzt, wenn sie nicht so leicht zu ersetzen gewesen wäre. Aber die neueste E-Mail von ihrem Hauptpastor Steve Hernandez legte den Schluss nahe, dass die Westminster-Gemeinde bereits eine geeignete Nachfolgerin für sie gefunden hatte. Wärst du eventuell dazu bereit, eine Mietkauf-Lösung für Heather in Erwägung zu ziehen? Dann müsste sie nicht umziehen.
Sie deutete mit der Hand auf den Bildschirm. „Nur zu, lies.“ Nathan schob seine Brille hoch und beugte sich vor, um die E-Mail zu überfliegen, die Hannah inzwischen schon dreimal gelesen hatte. Sie wartete, bis er sich wieder aufrichtete, bevor sie fragte: „Und? Was meinst du?“
„Nun, das würde uns ganz gewiss den Stress eines Hausverkaufs ersparen. Für mich klingt das nach einer Gebetserhörung.“
„Nein, ich meine, was hältst du davon, dass sie Heather einstellen wollen?“
„Er schreibt doch gar nichts davon, dass Heather deine Nachfolgerin wird.“
„Das ist doch offensichtlich.“ Hannah schob das Kinn vor und las die E-Mail noch einmal. Wenn du dich für diese Möglichkeit erwärmen kannst, dann setz dich doch bitte mit Heather in Verbindung, um die Details zu klären. „Und warum fragt mich eigentlich Steve danach? Warum hat Heather nicht einfach selbst zum Hörer gegriffen, mich angerufen und gesagt: ‚Hallo, ich übernehme deine Stelle und dein Büro, und ich würde auch gern dein Haus übernehmen!‘“
Nathan klappte Hannahs Laptop zu und drehte sie sanft zu sich herum. „Vielleicht wollte er einen Testballon steigen lassen und sehen, wie du reagierst.“
Wie dem auch sei – es war auf jeden Fall seltsam. Die ganze Sache war seltsam. Und nicht einmal Nate konnte sie von diesem Gedanken abbringen. Seit der Rückkehr von ihrer Hochzeitsreise hatte sie in ihrem Alltag als Hausfrau jede Menge Zeit, um über ihren Umzug nach West Michigan nachzudenken. Obwohl Steve ihr gegenüber die Freistellung aus dem Amt als Geschenk dargestellt und gesagt hatte, sie solle frei sein, um sich auf ihre Ehe zu konzentrieren, und nicht aus Pflichtgefühl nach Chicago zurückkehren, fragte sie sich dennoch, ob es nicht eher ein Versuch war, Kontrolle über sie auszuüben. „Und du findest wirklich nicht, dass die ganze Sache seltsam ist?“, fragte sie mit einem zweifelnden Unterton in der Stimme.
„Möchtest du denn, dass ich es seltsam finde?“ Seine braunen Augen lächelten sie an, doch sein Mund verzog sich nicht. „Denn ich kann es ‚seltsam‘ finden, wenn du willst. Ich kann hier und jetzt mit dir zusammen Verschwörungstheorien entwickeln. Vielleicht hat die Gemeinde das Ganze ja von Anfang an geplant und diese Sabbatzeit als Vorwand genutzt, um dich loszuwerden, um diese Heather einstellen zu können, die vielleicht sogar ein Verhältnis mit dem –“
„Ach, hör doch auf!“ Hannah boxte ihn sanft in den Magen. „Das meine ich gar nicht. Ich sage doch nur, dass diese ganze Angelegenheit sehr …“
Er wartete darauf, dass sie das richtige Adjektiv fand.
„… seltsam ist.“ Ein besseres Wort fiel ihr nicht ein. Irgendetwas stimmte da nicht.
„Nun, ich möchte deiner Intuition nicht widersprechen, Shep. Aber vielleicht hat Heather ja einfach einen guten Job gemacht und dich würdig vertreten, und jetzt, da feststeht, dass du nicht zurückkommen wirst, wollen sie ihr eine feste Stelle anbieten. Das erspart der Gemeinde die Suche nach einer neuen Mitarbeiterin. Und dein Haus gefällt ihr offenbar so gut, dass sie darin wohnen bleiben möchte. Also, warum nicht? Ich habe den Eindruck, dass sie dir, nein, uns einen Gefallen tun, indem sie uns den Stress ersparen, den ein Hausverkauf mit sich bringen würde.“
Und den Stress einer doppelten Hypothek, die am ersten April fällig werden würde. Obwohl Nate diese Doppelbelastung mit keinem Wort erwähnt hatte, lag die Last schwer auf Hannah. Ohne regelmäßiges Einkommen und angesichts der begrenzten finanziellen Mittel, die sie in ihre Ehe einbrachte, hätte sie eigentlich vor Freude über diese schnelle Lösung in die Luft springen sollen. Stattdessen empfand sie nur Zorn und Ärger.
„Lass dir nicht von deinem Stolz den Blick auf dieses wunderbare Geschenk versperren, Hannah.“
„Ich weiß.“ Auf keinen Fall brauchte sie jetzt eine Belehrung. Sie brauchte Zeit, um die ganze Angelegenheit zu verarbeiten.
Nate warf einen Blick auf seine Uhr. „Ich muss los. Jakes Bandprobe ist gleich zu Ende.“ Er schnappte sich seine Autoschlüssel, die auf der Küchentheke lagen und nicht am Haken neben der Garderobe hingen. Gestern hatte sie den Fehler gemacht, sie dort hinzuhängen, und er hatte das ganze Haus danach abgesucht und war außer sich gewesen, als sie seinen Anruf auf ihrem Handy beim Einkaufen nicht gehört hatte. Am Ende war er deshalb zu spät zum Unterricht gekommen.
„Soll ich ihn abholen?“, bot Hannah an.
„Nein, kein Problem. Ich mache das schon.“
„Dann kümmere ich mich schon mal um das Abendessen. Pasta Primavera, okay?“ Sie öffnete gleich beim ersten Versuch den richtigen Schrank und nahm einen Edelstahltopf heraus, der schon bessere Tage gesehen hatte. Wenn sie erst einmal ihr Haus ausgeräumt hatte, würde sie einige seiner Küchenutensilien gegen ihre austauschen.
„Äh … es ist Donnerstag“, bemerkte er.
Sie hielt inne. Offenbar hatte sie die Bedeutung des Donnerstags vergessen.
„Pizza-Abend“, erklärte er. „Eine Tradition der Allen-Jungs. Aber wenn du schon etwas anderes geplant hast, dann hat Jake bestimmt nichts dagegen.“
„Nein, schon gut.“ Falls Nathan ihr schon von dieser Tradition erzählt hatte, dann hatte sie es wieder vergessen. Es gab einige besondere Aktivitäten der Allen-Jungs, die sie sich merken musste. Vielleicht sollte sie sich eine Liste machen.
„Jake und ich essen gern eine Pizza mit Fleisch, aber ich kann für dich auch eine vegetarische mitbringen, wenn du möchtest.“
„Nein, hol nur, was ihr immer esst. Das ist in Ordnung.“ Sie stellte den Topf in den Schrank zurück. „Dann mache ich noch einen Salat dazu, okay?“
„Ja, prima. Ich bin gleich wieder da.“ Er gab ihr einen Kuss auf die Wange und verschwand durch die Tür.
Chaucer, Nates Golden Retriever, kam in die Küche getrottet und ließ sich schwanzwedelnd auf der Fußmatte nieder. „Willst du raus?“, fragte Hannah. Er rührte sich nicht. „Raus?“ Ein kurzes Bellen. Sie ging zur Terrassentür. „Rausgehen?“, fragte sie und versuchte, Nathans Tonfall nachzuahmen. Chaucer hielt ihr eine Pfote hin. Hannah ergriff sie mit einer Hand und streichelte mit der anderen sein seidenweiches Fell. Er bellte erneut. „Oh, verstanden! Du willst ein Leckerli?“ Er sprang auf und drehte sich im Kreis. „Okay. Ein Leckerli. Dein Herrchen hat vergessen, dir eins zu geben, nicht?“ Sie griff in die Dose auf der Arbeitsplatte und warf zwei Hundekekse auf den Boden. „Aber verrate ihm nicht, dass ich dir einen mehr gegeben habe.“
Sie wusch ihre Hände und suchte dann in den Schränken nach einer Salatschüssel. In den fünf Tagen, die sie nun in Nathans Haus zusammenlebten, hatte sie noch nicht mehr geschafft, als ihre Kleidung in eine Hälfte seines Kleiderschranks zu hängen. Er hatte versprochen, einige Regale in seinem Arbeitszimmer für sie freizuräumen, aber sie scheute sich, in seinen Bereich einzudringen. Darum standen die Kartons mit Büchern und Tagebüchern, die sie in ihre Sabbatzeit mitgenommen hatte, noch unangetastet im Keller. Ihre restlichen Besitztümer waren in Chicago. Nate hatte erklärt, dass er keinerlei emotionale Bindung an seine Möbel habe und dass sie gern einige von ihren Möbeln aufstellen könne. Das sei ihm nur recht. Du kannst das Haus ruhig umgestalten, hatte er gesagt. Es ist schon viel zu lange eine Junggesellenbude.
Eine düstere Junggesellenbude. Während der Wintermonate war ihr gar nicht aufgefallen, wie wenig Tageslicht ins Haus fiel. Aber nachdem die Märztage nun länger wurden, kam ihr das Haus mit seinen schweren Brokatvorhängen und den überwiegend braungrauen Wänden vor wie eine Höhle. Hannah war zwar nie ein Fan von grellen Farben gewesen, aber vielleicht sollten sie seine düsteren und ihre eher unscheinbaren Möbel gegen etwas Fröhliches eintauschen.
Sie hätte mehr Fotos vom Ferienhaus der Johnsons machen sollen, als sie noch dort gewohnt hatte. Nancy hatte einen ausgezeichneten Geschmack, und auch wenn Hannahs Budget begrenzt war, würde sie mit leichten Baumwollstoffen in Pastelltönen vielleicht schon viel bewirken können. Wenn es nicht zum Zerwürfnis zwischen ihr und Nancy gekommen wäre, hätte sie ihr bestimmt gern beim Dekorieren geholfen.
Nach ihrer Rückkehr aus den Flitterwochen hatte Hannah im Ferienhaus ihre Sachen gepackt und Nancy eine Topfpflanze und einen Dankesbrief auf dem Küchentisch zurückgelassen. 15 Jahre Freundschaft, und mittlerweile kommunizierten sie nur noch schriftlich miteinander, denn Hannahs Bemühungen um eine persönliche Aussprache waren auf kühle Zurückhaltung gestoßen: Nancy und Doug freuten sich, dass sie die Zeit in ihrem Haus genossen habe und wünschten Hannah und ihrem Mann alles Gute für ihre gemeinsame Zukunft. Als Hannah vorgeschlagen hatte, sie am Haus zu treffen, um ihnen den Schlüssel persönlich zu übergeben, hatte Nancy zurückgeschrieben, dass sie eine Freundin ins Ferienhaus begleiten werde und sie noch nicht genau sagen könne, wann sie dort eintreffen würden. Hannah könne den Schlüssel einfach unter die Fußmatte legen.
Chaucer, der beide Kekse bereits verschlungen hatte, ließ sich mit einem Seufzer auf dem Boden nieder. „Du sprichst mir aus der Seele“, sagte Hannah. Vielleicht würde Nancy ihr eines Tages verzeihen, dass sie sie getäuscht und manipuliert hatte. Sie hoffte es jedenfalls. Entschlossen riss sie eine Packung Salat auf und gab ihn in die Salatschüssel.
Aus den Fugen geraten. So ließ sich ihr Zustand im Augenblick am besten beschreiben. Irgendwann würde sie sich an ihr neues Leben gewöhnen, mit all seinen Freuden und Herausforderungen. Doch die Eingewöhnung würde einige Zeit dauern. Das wusste sie. Jeder Trauertherapeut würde sich die größeren Veränderungen in den vergangenen sechs Monaten ihres Lebens anschauen und ihr raten, diese Umbrüche sehr bewusst zu verarbeiten. Sie wusste, dass selbst positive Umbrüche mit Stress verbunden waren. Im Rahmen ihrer Pastorentätigkeit hatte sie genügend trauernde Menschen begleitet, um die komplizierte Dynamik von Verlust und Neuanfang zu erkennen.
Mit ihrem blanken Fuß kraulte sie Chaucers Rücken, während sie die Croutons über den Salat streute.
Eine berufliche Veränderung? Ja. Zuerst eine verordnete Sabbatzeit und dann eine Kündigung. Also: Ja.
Ein größerer Umzug? Ja. Zweimal sogar. Aus ihrem geregelten Leben in Chicago ins Haus der Johnsons am Lake Michigan, und dann in Nathans Haus in Kingsbury.
Eine Ehe? Ja. Ihre erste Ehe, und zwar im Alter von 40 Jahren.
Mutterschaft? Ja. Sie war nun die Stiefmutter eines 13-jährigen Jungen.
Eine Veränderung im gesellschaftlichen Umfeld? Ja. Sie war aus dem Kreis ihrer Kollegen und ihrer Gemeinde in Chicago herausgerissen worden und hatte neue Beziehungen in Kingsbury aufbauen müssen, vor allem zu ihren Gefährtinnen auf ihrer geistlichen Reise.
Tod eines geliebten Menschen?
Hannah stellte die Salatschüssel zur Seite, und ihr schossen die Tränen in die Augen, als ihr bewusst wurde, dass sie fast den ganzen Tag nicht ein einziges Mal an ihre geliebte Freundin Meg gedacht hatte.
Mara
Man sollte niemals die Wirkung eines Vergrößerungsspiegels unterschätzen, dachte Mara Garrison, oder die Bedeutung einer guten Pinzette. Sie hob ihr Kinn an und versuchte erneut, ein dickes widerspenstiges Haar auszuzupfen. Seit sie 50 geworden war, schienen ihre Erzfeinde über Nacht zu sprießen.
„Hab’ dich!“, rief sie, als sie zufrieden feststellte, dass sie das Haar mit der Wurzel herausgezogen hatte. Sie strich über ihr Kinn, um sich ihres Erfolgs zu versichern; eine Geste, die sie an ihre Großmutter erinnerte. Nana hatte oft mit einer Pinzette vor dem Spiegel ihrer alten Frisierkommode gesessen und ihr Spiegelbild in dem angelaufenen Glas begutachtet. Wenn ihre Verschönerungsmaßnahmen abgeschlossen waren, klopfte Nana auf das bestickte Polster des Stuhls, und Mara setzte sich vor den Spiegel und schnitt Grimassen. Während Nana ihre kastanienbraunen Haare mit festen, aber liebevollen Strichen auskämmte, erzählte Mara ihr von den Mädchen in der Schule, die ihr den Spottnamen „Der Wal“ gegeben hatten. „Mach dir nichts draus, Sweet Pea“, sagte Nana dann. „Stöcke und Steine brechen meine Beine …“
Schniefend, aber tapfer hatte Mara den Satz dann immer zu Ende gebracht: „… aber Spottnamen tun mir nichts.“
Wer immer diesen Spruch erfunden hatte, war ein riesengroßer Lügner!
Falls sie jemals erfuhr, dass irgendjemand ihrer Enkelin Madeleine Spottnamen nachrief, würde derjenige oder diejenige den Zorn ihrer Großmutter zu spüren bekommen. Und auch den Zorn ihres Papas. Ihr Sohn Jeremy würde so etwas nicht dulden, so viel war sicher. Und außerdem gab es heutzutage viele Anti-Mobbing-Maßnahmen, und die Öffentlichkeit war sensibilisiert für dieses Thema, sodass man Kindern solche Dinge nicht mehr so leicht durchgehen ließ. So sollte es zumindest sein. Wegen Brians Verhalten hatte sie genügend Beschwerden von Lehrern, Schülern und Verwaltungsmitarbeitern bekommen. Sie wusste also, dass sie in dieser Beziehung die Augen und Ohren offen hielten.
Sie warf sich ihren roten XL-Kimono über, schlurfte durch den Flur und ging hinunter in die Küche. „Bist du wach, Brian?“, rief sie in Richtung seiner geschlossenen Zimmertür im Keller. Keine Antwort. Bailey, Brians Hund, stand auf den Hinterbeinen davor und kratzte am Holz. Mara stieg die Kellertreppe hinunter. „Platz, Bailey.“ Sie stieß ihn sanft mit ihrem Pantoffel an. „Brian?“ Immer noch keine Antwort. Vorsichtig öffnete sie die Tür einen Spalt, und ein beißender Gestank nach Schweiß und gammeliger Pizza schlug ihr entgegen. Wie oft musste sie den Jungen noch sagen, dass sie ihr Essen nicht herumliegen lassen sollten? Bailey rannte ins Zimmer. „Bist du wach?“ Sie bückte sich, um ein Paar Sportsocken aufzuheben. Mit finsterem Blick musterte sie die zusammengeknüllte Decke auf Brians Bett. Sie verließ das Zimmer wieder und stieg die Kellertreppe hinauf, während Bailey um ihre Füße herumtänzelte.
„Wo ist dein Bruder?“, fragte sie den 15-jährigen Kevin, der gerade in die Küche trottete.
„Keine Ahnung.“
„Brian?“, rief sie in Richtung Obergeschoss. Keine Antwort. Sie stieg ein paar Treppenstufen hinauf, um sich davon zu überzeugen, dass er nicht schon im Badezimmer zugange war.
Mara war sich sicher, dass ihr Jüngster in seinem Zimmer gewesen war, als sie zu Bett ging. Sie hatte seine Musik gehört – seine neueste Lieblingsmetalband, die den Soundtrack für seinen eigensinnigen Trotz und seine Auflehnung gegen ihre Autorität lieferte –, und beinahe hätte sie an seine Tür geklopft, um ihm zu sagen, er solle die Musik leiser drehen. Aber vor einigen Wochen hatte sie auf den Rat ihrer Therapeutin Dawn hin beschlossen, sorgfältiger darüber nachzudenken, welche Kämpfe sie mit ihm austragen wollte. Bisher hatte sich diese Strategie allerdings nicht ausgezahlt. Überhaupt nicht.
Kevin griff nach einer Schachtel Cornflakes, die er direkt aus der Verpackung in seinen Mund kippte.
„Hey! Wie wäre es mit einer Schale?“ Mara öffnete den Schrank und stellte eine Müslischale auf den Tisch. Er füllte sie wortlos und futterte die trockenen Cornflakes mit den Fingern, wobei er sich die Marshmallow-Stücke zuerst herauspickte. Sie beschloss, nicht auf einen Löffel zu bestehen. „Lauf doch mal schnell in den Keller und sieh nach, ob Brian irgendwo dort unten ist. Machst du das, Kevin?“ Vielleicht hatte Brian ihr Rufen nicht gehört. Oder er hatte sie mal wieder ignoriert.
„Ich esse gerade.“
Wähle deine Kämpfe sorgfältig aus, erklang Dawns Stimme in ihrem Kopf.
In Ordnung.
Sie war gerade auf halber Treppe in den Keller, als Brian in Boxershorts und einem verknitterten T-Shirt aus dem Waschkeller kam. „Was machst du da? Hast du nicht gehört, dass ich dich gerufen habe?“
Die Panik in seinem Gesicht wich in Sekundenschnelle der üblichen Verachtung. Ohne eine Antwort zu geben, versuchte er, sich auf der Treppe an ihr vorbeizudrücken.
„Hey!“ Sie streckte den Arm aus, und bevor er sich ihr widersetzen konnte, schnüffelte sie an seinen Haaren – ein schnelles Manöver, das sie sich vor Jahren angeeignet hatte, als Jeremy als Jugendlicher mit Marihuana experimentiert hatte.
Seine Nasenflügel blähten sich. „Was tust du da, du Freak?“
„Nichts. Ich habe mich nur gefragt, wo du gesteckt hast, das ist alles.“
„Lass mich in Ruhe!“, knurrte er und murmelte dann noch etwas anderes vor sich hin.
„Entschuldige?“
„Ich sagte: ‚Lass mich in Ruhe!‘“ Er stürmte die Treppe hoch und schrie zornig auf, als Bailey ihn oben auf der letzten Treppenstufe zum Stolpern brachte.
„Du warst derjenige, der einen Hund haben wollte“, murmelte Mara. Sie schnippte mit den Fingern und rief Bailey zu sich. Vor einigen Monaten hatte ihr Mann, der bald ihr Ex-Mann sein würde, Brian den Hund gekauft, um sie zu ärgern. Doch inzwischen hatte Mara Zuneigung zu dem kleinen Tier entwickelt. Sie streichelte sein Gesicht und gab ihm einen Klaps auf sein Hinterteil, bevor er davonrannte.
Als die Badezimmertür im oberen Stockwerk ins Schloss fiel, stieg sie die Treppe zum Waschkeller hinunter, um nachzusehen, was Brian dort getrieben hatte. Vor Jahren, als Jeremy kaum älter gewesen war als Kevin, hatte sie dort alle mögliche Schmuggelware gefunden. Während sie den Mülleimer durchsuchte, rief sie sich in Erinnerung, dass sie Jeremys Rebellion überlebt hatte. Heute war er ein liebevoller Sohn, Ehemann und Vater. Vielleicht gab es auch für Brian Hoffnung. Wenn er nicht noch mehr nach seinem Vater kam.
Im Mülleimer fand sie nur Flusen und zusammengeknüllte Taschentücher. Keine Zigarettenstummel und keine Tüten mit verdächtigen Substanzen. Doch Brian hatte noch nie die Waschmaschine bedient und auch nie seine saubere Wäsche gefaltet oder selbst weggeräumt. Was also hatte er hier gemacht? Mit dem Fuß verteilte sie die Schmutzwäsche auf dem Betonfußboden, ohne zu wissen, wonach sie eigentlich suchte. Bingo! Sie hatte es gefunden. Vergraben unter Jeans, Boxershorts und Sweatshirts fand sie ein zusammengeknülltes Bettlaken. Er hatte versucht, sein Malheur zu vertuschen.
Und sie hatte ihm sofort ungute Absichten unterstellt.
Doch sie würde auf keinen Fall mit ihm darüber reden. Tom war derjenige, der die Pubertätsgespräche mit den Jungen führte, und sie würde ihm ganz bestimmt keine SMS schicken und ihn bitten, Brian zu versichern, dass er sich keine Sorgen zu machen brauchte. Sie stopfte das Laken und einige Handtücher in die Waschmaschine und startete das Waschprogramm. Wenn er in der Schule war, würde sie sein Bett frisch beziehen, und er würde wissen, dass sie Bescheid wusste. Doch Dankbarkeit darüber, dass sie ihn nicht darauf ansprach, konnte sie nicht erwarten. Vermutlich würde er sich nur noch mehr ärgern, dass sie es herausgefunden und sich darum gekümmert hatte. Denn er wollte sie nicht brauchen, hatte Dawn ihr einmal erklärt. Er wollte lieber bei seinem Vater in Cleveland leben.
Das würde Tom jedoch nicht zulassen. Über seinen Anwalt hatte er deutlich gemacht, dass er nur ein Besuchsrecht haben wollte, keine Alltagsverpflichtungen. So kam es Mara jedenfalls vor. Sie sollte das Sorgerecht für beide Jungen behalten, egal, was Brian wollte. Tom würde alle 14 Tage am Wochenende in die Stadt kommen und die Jungen abholen. Alle zwei Jahre sollten sie die kompletten Osterferien mit ihm verbringen und abwechselnd die wichtigen Feiertage. In den Sommerferien würde er kostspielige Reisen mit den Jungen unternehmen und damit seine Rolle als „Spaß-Papa“, der sie verwöhnte, festigen. Den langweiligen Alltag, die Konflikte, den Stress der Erziehung zweier Teenager, das alles würde an Mara hängen bleiben.
Vor einer Woche hatte Tom ihr eine Unterhaltsregelung vorgeschlagen, die es ihr ermöglichen würde, mit den Jungen im Haus wohnen zu bleiben, bis Brian die Highschool abgeschlossen hatte. Danach sollte das Haus verkauft und der Gewinn geteilt werden. Nachdem ihr Anwalt alles peinlich genau durchgerechnet hatte, riet er ihr, sich auf die Regelung einzulassen. Es sei eine gute Regelung, meinte er, und der Unterhalt für die Jungen sei angemessen. Sie wären gut versorgt. Wenn sie das Angebot annähme, könnten sie sich eine Gerichtsverhandlung sparen und wären nach der vorgeschriebenen Wartezeit von einem halben Jahr geschiedene Leute.
Eigentlich sollte sich Mara freuen. Sie sollte erleichtert und dankbar sein. Und das war sie auch. Trotzdem wurde sie das Gefühl nicht los, dass Tom sie über den Tisch gezogen hatte. Beide Jungen würden immer wieder zu hören bekommen, dass allein seine „Großzügigkeit“ es ihnen ermöglichte, so weiterzuleben wie bisher. Ihr heldenhafter Vater. So sah es das Drehbuch vor. Und wenn Mara sich nicht daran hielt, würden die Jungen sauer auf sie sein.
Aber sie wollte sich Tom nicht verpflichtet fühlen. Was sie sich wünschte, war ein klarer Schlussstrich, damit sie die Sache endgültig abhaken konnte. Vielleicht hatte sie unterschwellig gehofft, sein Unterhaltsvorschlag würde ihn als den tyrannischen Mistkerl offenbaren, den sie in den vergangenen 15 Jahren hatte ertragen müssen. Stattdessen mimte er jetzt den großherzigen Familienvater. Doch am Ende übte er durch sein „Geschenk“, das sie von jedem finanziellen Druck befreien würde, wieder einmal Kontrolle über sie aus. Sie war nicht naiv. Alles, was auf den ersten Blick für sie und die Jungen von Vorteil war, diente in erster Linie zu seinem Besten. Vermutlich wollte er sein Hab und Gut schützen; das Haus so lange behalten, bis sich der Markt erholt hatte und er in vier Jahren einen besseren Preis dafür erzielen würde.
Vielleicht sollte seine Unterhaltsregelung sie auch davon abhalten, sich in seine persönlichen Angelegenheiten einzumischen, indem sie sich beispielsweise die Frage stellte, was es mit dieser schwangeren Freundin auf sich hatte, von der Kevin ihr erzählt hatte, und welche Vereinbarung er mit ihr getroffen hatte. Vielleicht hatte sein Anwalt ihm vorgeschlagen, sich großzügig zu zeigen, um seine „Indiskretion“ zu vertuschen. Seine Firma sah es wahrscheinlich nicht so gern, dass er eine andere Frau schwängerte und sich dann von der Mutter seiner Söhne scheiden ließ. Falls es überhaupt sein Kind war. Mara wusste es nicht genau, und keinesfalls würde sie Kevin bitten, es für sie in Erfahrung zu bringen.
Lass los, befahl sie sich. Lass alles los. Die Bitterkeit. Deinen Rachedurst. An dem Abend, an dem sie sich mit ihren Freundinnen in Megs Haus getroffen hatte, um mit der Geschichte, wie Jesus den Jüngern die Füße wusch, zu beten, hatte sie alles an Gott abgegeben. Aber Mara wurde täglich daran erinnert, dass sie immer wieder neu loslassen musste, vor allem, wenn bestimmte Knöpfe bei ihr gedrückt wurden.
Sie sortierte die dunklen Sachen aus der restlichen Schmutzwäsche. Diese Vereinbarung würde ihr auf jeden Fall Zeit verschaffen, wieder auf die Füße zu kommen. Vielleicht konnte sie aus ihrem Teilzeitjob im Crossroads-Haus einen Vollzeitjob machen. Miss Jada hatte angedeutet, dass der Vorstand dieser Möglichkeit gegenüber nicht abgeneigt war. Das wäre wirklich eine wundervolle Gebetserhörung! Ihr gefiel die Aufgabe, die Mahlzeiten zu koordinieren und sich um die obdachlosen Gäste, die bei ihnen Zuflucht suchten, zu kümmern. Schließlich waren auch sie und ihr kleiner Sohn Jeremy vor fast 30 Jahren in der gleichen Situation gewesen und hatten damals im Crossroads-Haus Hilfe bekommen.
Als Mara die Treppe hochkam, hockte Brian zusammengesunken an der Küchentheke und starrte in seine Müslischale. Sie ignorierte die Jungen, schnappte sich ihr Handy und überprüfte ihre Nachrichten: eine von Abby, die schrieb, sie brauche an diesem Morgen nicht auf Madeleine aufzupassen; eine von Hannah, die den Termin für ihr Gebetstreffen am heutigen Abend in Charissas Haus bestätigte, und eine von Tom (der die Anweisung erhalten hatte, ihr alle Planänderungen persönlich mitzuteilen und nicht über die Jungen). Er informierte sie darüber, dass er die beiden eine Stunde später als vereinbart abholen werde. „Papa holt euch erst um sieben ab“, erklärte sie, „aber dann bin ich nicht mehr da. Ich treffe mich heute Abend mit meiner Gebetsgruppe.“
Keiner von ihnen nahm ihre Mitteilung zur Kenntnis. Sie antwortete Abby, dass sie gern ein anderes Mal kommen werde, und Hannah, dass sie sich auf den Abend freue. Tom antwortete sie nur mit „okay“. Dann bereitete sie schweigend die Schulbrote für die Jungen vor. Wie sollte sie erkennen, welche Kämpfe wichtig waren und wo sie den beiden nur eine Möglichkeit gab, sie auszunutzen? Darüber musste sie noch mal mit Dawn reden.
Ich bin die Frau, die Jesus liebt, sagte sie im Stillen zu ihrem Spiegelbild in der Mikrowelle, während sie die Weißbrotscheiben mit Senf bestrich. Diese geistliche Übung hatte sie in den vergangenen Wochen sträflich vernachlässigt, wie ihr in diesem Moment auffiel. Obwohl sie ständig vor dem Spiegel stand und sich Haare am Kinn auszupfte, war es ihr immer noch nicht zur Gewohnheit geworden, sich Gottes Liebe zuzusprechen. Sie war so konzentriert darauf, die lästigen Haare loszuwerden, dass sie dabei die Gelegenheit verpasste, sich so zu sehen, wie Gott sie sah. Geliebt. Begünstigt. Erwählt.
Das lässt tief blicken, würde Hannah sagen.
Sie durfte nicht vergessen, in der Gruppe von diesem Bild zu erzählen. Seit Hannahs Hochzeit hatten sie sich nicht mehr getroffen, und sicher gab es viel zu besprechen.
Mara wischte sich die Nase an ihrem Ärmel ab und steckte Kevins Käse-Schinken-Sandwich in eine Plastiktüte. Noch immer sah sie Meg bei ihrer ersten Gruppenstunde im New Hope-Einkehrzentrum am Tisch in der hinteren Ecke neben der Tür sitzen, den Hals übersät mit roten Flecken, während sie überlegte, ob sie das Seminar mitmachen oder lieber die Flucht ergreifen sollte. Die Veränderung und Weiterentwicklung, die Meg durchgemacht hatte, war in vielerlei Hinsicht bemerkenswert. Sie war das Band gewesen, das sie alle zusammengehalten hatte. Obwohl Hannah und Charissa es nicht laut aussprachen, fragte sich Mara doch, ob auch sie Zweifel hegten, dass ihre Gruppe ohne Meg Crane fortbestehen würde.
„Hast du wieder Schinken und Käse auf mein Sandwich getan?“, fragte Kevin.
So wollte er es doch. Jeden Tag belegte sie die Weißbrotscheiben mit Schinken und Käse, wobei sie nur eine der Brotscheiben mit Senf bestrich. „Ja.“
„Schinken und Käse hängen mir zum Hals raus!“
Sie blies die Wangen auf und ließ langsam Luft entweichen. „Dann sage ich dir jetzt mal was“, sagte sie und kämpfte gegen die Versuchung an, das Sandwich in den Mülleimer zu werfen. „Wie wäre es, wenn ihr euch eure Brote selbst schmiert? Ich nehme mir den Rest des Tages frei. Und Brian?“ Dieses Mal schaute er sie doch tatsächlich an. „Du musst noch mit deinem Hund rausgehen.“
Charissa
Was haben schwangere Frauen nur an sich?, fragte sich Charissa Sinclair, als sie in der Bibliothek anstand, dass sogar Fremde jeglichen Sinn für Anstand verloren und persönliche Grenzen überschritten? Die nächste Person, die ihren Bauch berührte, würde einen Klaps auf die Finger bekommen. Oder vielleicht würde auch sie ihre Hand austrecken und deren Bauch wie eine Wunderlampe reiben.
„Wann ist es denn so weit?“, hatte die letzte Übeltäterin gefragt.
Um einen weiteren Übergriff zu verhindern, hatte Charissa ihre Gartenbücher fest an ihren gewölbten Bauch gedrückt. „Im Juli.“
„Sie sehen richtig gut aus. Seien Sie froh, dass Sie so groß sind. Ich war einfach nur unförmig wie ein Elefant. Und dann sagte mein Arzt mir, dass ich –“
Und los geht’s! Charissa kämpfte gegen die Versuchung an, ihr ins Wort zu fallen und zu sagen, dass sie an den Geschichten über ihre Schwangerschaftsprobleme oder ihre Angst vor der Geburt nicht interessiert sei. Wenn sie sich noch eine Geschichte über die Freundin einer Freundin oder einer Cousine zweiten Grades anhören musste, bei der während der Geburt Komplikationen aufgetreten waren, würde sie laut schreien. Oder mit irgendetwas um sich werfen.
„Die Nächste, bitte.“ Die Bibliothekshelferin rief die Frau an den Schalter und unterbrach ihren Redefluss, als sie gerade zum besten Teil kommen wollte. Charissa bemerkte, wie sie in sich zusammensackte.
„Nun, dann wünsche ich Ihnen alles Gute“, sagte sie mit einem letzten taxierenden Blick über die Schulter.
Charissa lächelte gezwungen.
Die Schwangerschaft war schon schwierig genug, auch ohne dass Fremde noch zusätzlich Stress machten. Es gab Frauen, die vollständig in ihrer Schwangerschaft aufgingen. Die Fotos und ihre Posts auf Facebook, mit denen sie ihre „Reise“ dokumentierten, verursachten Übelkeit bei Charissa. Sie gehörte auf jeden Fall nicht dazu, und sie hatte endlich damit begonnen, diese Tatsache zu akzeptieren, ohne sich mit Schuldgefühlen zu bombardieren. „Weißt du, ich liebe unsere Bethany“, sagte sie zu John, als sie nach Hause kam, „aber ein Teil von mir würde am liebsten sagen: ‚Weck mich auf, wenn sie draußen ist.‘“
„Ich weiß“, erwiderte er. „Wie viele Babys kämen wohl auf die Welt, wenn wir Männer sie austragen müssten?“
„Kein einziges. Ihr Männer seid Weicheier.“ Sie legte ihre Bücher auf die Konsole und hängte den Schlüssel von Megs Auto, das Becca ihr geliehen hatte, an den Haken. Warum soll es in der Einfahrt stehen, während ich in London bin?,hatte Becca gesagt, als sie ihre Brautjungfernkleider für Hannahs Hochzeit angezogen hatten. Charissa musste ihr dringend mal schreiben und sie fragen, wie sie mit allem fertigwurde.
„Jeremy und ich werden heute Abend zusammen etwas essen gehen und anschließend in den Baumarkt fahren. Du hast ja dein Gebetstreffen“, sagte John. „Er möchte mir zeigen, was er sich für unser Bad vorstellt.“
„Aber vergiss bitte nicht, dass deine Frau schwanger ist, okay? Und das Haus hat nur eine Toilette.“
„Ich weiß. Es geht ja nur um ein paar kosmetische Verschönerungen. Keine großen Sachen.“
„Und behalte unser Budget im Blick, okay?“ Sie schaute durch das Fenster, als Jeremy mit lautem Getöse in die Einfahrt abbog. „Wir müssen uns an unseren Budgetplan halten, John.“
„Ich weiß. Und Jeremy weiß es auch, und er ist gut in solchen Dingen. Denk doch nur mal daran, was er uns bereits an Kosten gespart hat! Wir haben bisher viel weniger ausgegeben als befürchtet.“
Das stimmte. Maras Sohn war ein Gottesgeschenk für sie. In den fünf Wochen seit der Vertragsunterzeichnung hatte Jeremy die Holzböden und die Küchenschränke aufgearbeitet und ihnen beim Anstrich der Wände geholfen, und auch das Zimmer ihrer Tochter hatten sie bereits in einem hellen Rosaton gestrichen. Jeremy betonte immer wieder, wie dankbar er für die Arbeit sei. Da in seiner Firma Kurzarbeit angesagt war und er und seine Frau Abby vor Kurzem Eltern geworden waren, standen sie unter großem finanziellem Druck. Er hoffte nur, dass die Kurzarbeit im Frühling wieder aufgehoben werden würde. Eigentlich rechnete er sogar fest damit. In der Zwischenzeit bot er sich für alle möglichen Aushilfsjobs an.
John öffnete die Haustür und begrüßte seinen neuen Freund. „Komm rein!“
Jeremy putzte sich die Arbeitsschuhe auf der Fußmatte ab und ergriff Johns ausgestreckte Hand. Sein schüchternes Lächeln entblößte die Lücke zwischen seinen Schneidezähnen. Mara hatte Charissa einmal anvertraut, dass sie es bedauere, nie das Geld für eine Zahnspange gehabt zu haben. Früher wurde er wegen seiner Zähne aufgezogen, hatte Mara gesagt. Kinder können so grausam sein, nicht?
Ja. Das stimmte. Obwohl sie es sich nur ungern eingestand, musste Charissa zugeben, dass sie früher selbst zu diesen Kindern gehört hatte. Doch in letzter Zeit war sie sensibler geworden für ihre kritischen und verurteilenden Kommentare, obwohl es ihr schwerfiel, sich dies ehrlich einzugestehen. Fortschritt, keine Perfektion. Das war ihr neues Motto – und an den meisten Tagen war es viel leichter mit dem Mund zu propagieren, als es in die Tat umzusetzen.
Sie begrüßte Jeremy und fragte anschließend: „Hat Abby heute Abend keinen Dienst?“
„Nein.“
„Wie geht es ihr damit, dass sie wieder arbeiten muss? Und wie geht es Madeleine?“
„Gut. Beiden geht es gut, danke.“ Er ließ seine Fingergelenke knacken und wandte sich John zu. „Können wir?“
„Gib mir noch eine Sekunde.“ John eilte durch den Flur zum Schlafzimmer.
Charissa legte ihre Hand an ihren Rücken. Sie kannte Jeremy und Abby noch nicht so gut, dass sie ein Gespräch über Geld oder Stress mit ihm führen wollte. „Deine Mutter kommt heute Abend her. Wir haben unsere Gruppenstunde.“
„Ja, das hat sie mir erzählt. Sie freut sich immer sehr darauf.“
„Ja, diese Zeit für Gebet und Reflexion tut uns allen gut. Ich meine, es ist keine ‚gute Zeit‘ in dem Sinne, wie die meisten Menschen es interpretieren würden.“
Er lachte. „Nein, da hast du wohl recht. Für Abby und mich bedeutet eine ‚gute Zeit‘ im Augenblick, dass wir mal ein paar Stunden am Stück durchschlafen können.“
„In ein paar Monaten wird das auch bei uns so sein.“ Darauf freute sich Charissa ganz und gar nicht. Wenn sie nicht ihre sechs bis acht Stunden Schlaf bekam, war sie reizbar wie ein Stier. Es hatte schon seinen Grund, warum Schlafentzug als Foltermethode galt.
Jeremy deutete mit dem Kinn auf die Gartenbücher. „Wollt ihr den Garten umgestalten?“
„Nein, eigentlich nicht. Der Garten ist ganz schön angelegt. Aber momentan stecken so viele Pflanzen ihre Köpfe aus der Erde, und ich habe keine Ahnung, was das alles ist.“ Sie fragte sich, wie viele der Pflanzen noch von Meg und Jim gesetzt worden waren, als sie vor 20 Jahren in dem Haus gelebt hatten. Eigentlich hatte sie Meg im Frühling und Sommer nach den Pflanzen fragen wollen, aber …
„Ein eigener Blumengarten ist Abbys Traum“, sagte Jeremy. „Sie hat viele Topfpflanzen auf den Balkon unserer Wohnung gestellt. Sie sind wirklich sehr schön, aber ich kenne mich mit Blumen nicht aus. Ich kann sie nur nach Farben unterscheiden, mehr nicht.“
„Meine Pflanzenkenntnisse sind auch nicht viel besser, aber ich hoffe, dass Johns Mutter weiß, welche Blumen in den Beeten blühen, und dass sie mir, wenn sie zu Besuch kommt, einige Pflegetipps gibt.“
„Was ist mit Mama?“, fragte John, als er mit seinem Portemonnaie und Mobiltelefon wieder auftauchte.
„Ich habe gerade gesagt, dass sie einen grünen Daumen hat.“
„Das stimmt. Mama kann alles zum Blühen bringen. Aber was mich betrifft: Ich brauche die Pflanzen nur anzuschauen und sie sterben.“
„Aber bitte fang nicht an, unsere Pflanzen zu töten, bevor sie die Gelegenheit haben zu wachsen“, bat Charissa. „Wir werden den schönsten Garten im Viertel haben, wart’s nur ab.“
„Und das sagt die Frau, die bisher immer behauptet hat, sie könne nicht mal die Verantwortung für eine Zimmerpflanze übernehmen.“
„Na los“, sagte sie und boxte ihn liebevoll gegen die Schulter, während er sie frech angrinste. „Ihr könnt jetzt fahren. Aber behalte ihn im Auge, Jeremy. Lass dir nicht einreden, ich hätte meine Erlaubnis gegeben, irgendetwas anderes zu kaufen als das, was du für unser Bad empfiehlst. Und du, John, denk an das Budget.“ Das sagte sie nicht nur zu ihm, sondern auch zu sich selbst.
John salutierte gespielt, Jeremy nickte ihr leicht zu und beide verschwanden durch die Haustür.
Charissa streifte die Schuhe von den Füßen, ließ sich in einen Sessel vor dem Kamin fallen und legte ihre Füße auf einen Hocker. Eigentlich wollte sie noch die Teppiche saugen, bevor Hannah und Mara kamen, aber sie hatte einfach keine Kraft dazu. Wenigstens das Bad war sauber. Das musste für heute genügen.
Obwohl sie noch nie die Tage bis zum Semesterende gezählt hatte, konnte sie es diesmal kaum erwarten. Noch sieben Wochen. Ihre Doktorandenkurse und der Schreibkurs, den sie für Studienanfänger gab, waren eine echte Herausforderung für sie – und zusätzlich zu alldem wuchs auch noch ein Kind in ihrem Bauch heran. Doch Charissa beklagte sich nicht. Oder versuchte es zumindest. Seit einiger Zeit beschäftigte sie sich mit dem Gedanken, dass ihr Körper ein „heiliger Ort“ war; ein Ort, an dem neues Leben heranwuchs und Gestalt annahm. Sie konnte sich noch nicht vorstellen, wie dieses Leben aussehen würde, aber sie vertraute darauf, dass alles gut gehen würde. Oder besser gesagt, sie vertraute Gott, dass er alles gut machen würde. Zumindest versuchte sie es.
Vielleicht fühlte sie sich deshalb so stark zur Gartenarbeit hingezogen. Angesichts der Todesfälle, die sie in den vergangenen Monaten erlebt hatte – geistliche und emotionale, aber auch der Tod einer neu gewonnenen Freundin –, berührte es sie umso mehr, zu beobachten, wie die grünen Triebe nach dem harten Winter aus der Erde hervorschossen.
Mit ihren 26 Jahren war sie noch nicht oft mit dem Tod in Berührung gekommen. Ihre Großmutter väterlicherseits war gestorben, als sie in der ersten Klasse war, und der Vater einer Freundin sowie eine Klassenkameradin – ein Mädchen, das sie nur vom Namen her kannte –, als sie die Highschool besuchte. Da sie in ihrem Leben bisher noch keine größeren Tragödien oder Verluste erlebt hatte, hatte sich Charissa auch noch nicht mit der Auferstehung auseinandergesetzt. Sie war für sie nichts weiter als eine Glaubensdoktrin, der sie bisher immer und ohne zu zögern zugestimmt hatte, seit sie als Drittklässlerin das Apostolische Glaubensbekenntnis auswendig gelernt hatte: Am dritten Tage auferstanden von den Toten. Punkt. Oder besser: Ausrufezeichen!
Worte von Megs Beerdigung klangen noch in ihr nach. Lieder, Bibelverse, die Ansprache des Pastors – das alles hatte ihre Aufmerksamkeit auf ein Versprechen gelenkt, das bisher noch keine Bedeutung für sie gehabt hatte. Wir sind das Ostervolk, hatte Megs Pastor gesagt, und leben in der Hoffnung. Inmitten von Tod. Inmitten von Veränderung. Inmitten von Trauer. Inmitten von Unsicherheit.
Am dritten Tage auferstanden von den Toten.
In wenigen Wochen würden sie am Ostermorgen wieder von der Auferstehung singen. Für Charissa war das Osterfest bisher nicht viel mehr gewesen als Freudengesang, Tulpen und mit Schokoladeneiern gefüllte Osternester. Doch nun hatte Ostern eine neue Bedeutung für sie gewonnen, nicht als ein historisches Ereignis, dessen man einmal im Jahr gedachte, sondern als eine fortdauernde Realität, die im Alltag gelebt werden wollte.
Am dritten Tage auferstanden von den Toten.
Megs Tod hatte ihr ihre Verletzlichkeit bewusst gemacht. Meg war jünger gewesen als Charissa, als sie ihren Mann zu Grabe getragen hatte, jünger als Charissa, als sie ihr einziges Kind zur Welt gebracht hatte; das Kind, das eigentlich zwei Elternteile hätten nach Hause holen und in dem Zimmer unterbringen sollen, das sie so liebevoll für es vorbereitet hatten.
Charissas Blick wanderte zu dem Zimmer, das jetzt auf Bethany wartete.
Sie war nicht abergläubisch. Aber egal, wie sehr sie auch versuchte, die Wolke der Sterblichkeit zu vertreiben, die sich seit Megs Krebsdiagnose über ihr Haus gelegt hatte, es gelang ihr nicht. Trotz Jeremys Renovierungsarbeiten musste Charissa ständig über die Träume nachdenken, die hier geboren und gehegt worden und schließlich in tausend Scherben zerbrochen waren.
Für den heutigen Abend hatte Charissa den anderen vorgeschlagen, sich zu treffen, um einfach nur füreinander zu beten, und keine der Gebetsübungen aus ihren Notizbüchern zu machen. Aber vielleicht brauchten sie doch ein wenig Orientierung.
Ich bin die Auferstehung und das Leben. Dieser Vers von Megs Beerdigung ließ sie nicht los und es schien ein guter Text zur Meditation zu sein. Charissa warf einen Blick auf ihre Uhr: Noch 45 Minuten, bis Hannah und Mara kamen. Zeit genug, um einen kurzen Leitfaden zusammenzustellen. Oder besser, eine Einladung zum Gespräch und zum Gebet.
Meditation zu Johannes 11,17–44
Auferstehung und Leben
Als Jesus nach Betanien kam, lag Lazarus schon vier Tage im Grab. Das Dorf war keine drei Kilometer von Jerusalem entfernt, und viele Leute aus der Stadt hatten Marta und Maria aufgesucht, um sie zu trösten. Als Marta hörte, dass Jesus kam, ging sie ihm entgegen vor das Dorf, aber Maria blieb im Haus. Marta sagte zu Jesus: „Herr, wenn du hier gewesen wärst, hätte mein Bruder nicht sterben müssen. Aber ich weiß, dass Gott dir auch jetzt keine Bitte abschlägt. „Dein Bruder wird auferstehen“, sagte Jesus zu Marta. „Ich weiß“, erwiderte sie, „er wird auferstehen, wenn alle Toten lebendig werden, am letzten Tag.“ Jesus sagte zu ihr: „Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer mich annimmt, wird leben, auch wenn er stirbt, und wer lebt und sich auf mich verlässt, wird niemals sterben, in Ewigkeit nicht. Glaubst du mir das?“ Sie antwortete: „Ja, Herr, ich glaube, dass du der versprochene Retter bist, der Sohn Gottes, der in die Welt kommen soll.“ Nach diesen Worten ging Marta zu ihrer Schwester zurück, nahm sie beiseite und sagte zu ihr: „Unser Lehrer ist hier und will dich sehen!“ Als Maria das hörte, stand sie schnell auf und lief zu ihm hinaus. Jesus selbst war noch nicht in das Dorf hineingegangen. Er war immer noch an der Stelle, wo Marta ihn getroffen hatte. Die Leute aus Jerusalem, die bei Maria im Haus waren, um sie zu trösten, sahen, wie sie aufsprang und hinauseilte. Sie meinten, Maria wolle zum Grab gehen, um dort zu weinen, und folgten ihr. Als Maria zu Jesus kam und ihn sah, warf sie sich vor ihm nieder. „Herr, wenn du hier gewesen wärst, hätte mein Bruder nicht sterben müssen“, sagte sie zu ihm. Jesus sah sie weinen; auch die Leute, die mit ihr gekommen waren, weinten. Da wurde er zornig und war sehr erregt. „Wo habt ihr ihn hingelegt?“, fragte er. „Komm und sieh es selbst, Herr!“, sagten sie. Jesus fing an zu weinen. Da sagten die Leute: „Er muss ihn sehr geliebt haben!“ Aber einige meinten: „Den Blinden hat er sehend gemacht. Hätte er nicht verhindern können, dass Lazarus stirbt?“ Aufs Neue wurde Jesus zornig. Er ging zum Grab. Es bestand aus einer Höhle, deren Zugang mit einem Stein verschlossen war. „Nehmt den Stein weg!“, befahl er. Marta, die Schwester des Toten, wandte ein: „Herr, der Geruch! Er liegt doch schon vier Tage im Grab.“ Jesus sagte zu ihr: „Ich habe dir doch gesagt, dass du die Herrlichkeit Gottes sehen wirst, wenn du nur Glauben hast.“ Da nahmen sie den Stein weg. Jesus blickte zum Himmel auf und sagte: „Vater, ich danke dir, dass du meine Bitte erfüllst. Ich weiß, dass du mich immer erhörst. Aber wegen der Menschenmenge, die hier steht, spreche ich es aus – damit sie glauben, dass du mich gesandt hast.“ Nach diesen Worten rief er laut: „Lazarus, komm heraus!“ Der Tote kam heraus; seine Hände und Füße waren mit Binden umwickelt und sein Gesicht war mit einem Tuch verhüllt. Jesus sagte: „Nehmt ihm das alles ab und lasst ihn nach Hause gehen!“
Für das Gebet und Gespräch
1. Mit welcher Schwester identifizierst du dich? Warum?
2. Versuche, so zu tun, als würdest du das Ende der Geschichte nicht kennen, während du dir vorstellst, du wärst diese Schwester. Was empfindest du, als Jesus endlich eintrifft?
3. Was erstaunt dich an Jesus?
4. Was bedeutet es für dich jetzt, in diesem Moment, Jesus als die Auferstehung und das Leben zu kennen?
2
Hannah
Die Hochzeitsfotos, die nicht gestellt waren, erzählten eine viel intimere und zärtlichere Geschichte als die gestellten. Hannah schaute über Maras Schulter auf ein Foto von sich und Nathan, wie sie gerade mit Katherine Rhodes sprachen, die sie im New Hope-Einkehrzentrum getraut hatte. „Oh, das gefällt mir!“, rief Mara. „Sieh nur, wie Nathan dich anschaut. So voller Bewunderung.“ Ja, sein Gesichtsausdruck war weich und sehnsüchtig. Hoffnungsvoll. Und sogar ein wenig stolz.
Charissa stimmte zu. „Das hier ist auch sehr schön“, sagte sie und deutete auf das letzte Bild im Stapel.
Ja, dieses Foto gehörte auch zu Hannahs Lieblingsfotos. Darauf war zu sehen, wie ihr Vater ihre Hand in Nathans legte. Alle drei hatten Tränen in den Augen.
„Es war wirklich eine schöne Hochzeit.“ Mara schob die Fotos zusammen und gab sie Hannah zurück, die sie wieder in den Briefumschlag steckte. Irgendwann würde sie die Bilder in ein Album einkleben. Meg hätte ihr bestimmt gern dabei geholfen.
Charissa stand vom Sofa auf, auf dem sie zusammen gesessen hatten, und band ihre langen schwarzen Haare zu einem Pferdeschwanz zusammen. „Ich hatte zwar vorgeschlagen, heute Abend einfach nur miteinander zu plaudern und zu beten“, sagte sie, „aber ich habe noch einmal darüber nachgedacht, und mir ist klar geworden, dass ich Hilfe brauche, inmitten all der Veränderungen meinen Blick in die richtige Richtung zu lenken. Darum habe ich eine kleine Reflexionsübung zusammengestellt. Sie ist längst nicht so ausführlich, wie es die von Katherine sind, aber sie soll uns dabei helfen, über Ostern und die Auferstehung nachzudenken. Anschließend können wir füreinander beten. Ich hoffe, das ist okay für euch.“
Mara nickte. „Ich habe nichts dagegen.“
„Ich auch nicht“, stimmte Hannah zu. Der Gedanke, den ganzen Abend nur über Meg und ihren Tod zu reden, hatte ihr ohnehin nicht behagt. So sehr sie Maras und Charissas Freundschaft auch schätzte, zog sie es dennoch vor, ihre Trauer still für sich zu verarbeiten.
Charissa reichte ihnen ein Blatt. Über das elfte Kapitel des Johannesevangeliums hatte Hannah schon einige Male meditiert, aber sie würde Charissas Idee auf keinen Fall schlechtmachen. Während sich Charissa in ihrem Sessel niederließ, schaute Hannah gedankenverloren in die tanzenden Flammen im Kamin. Vor drei Wochen hatten sie noch vor einem flackernden Feuer in Megs Wohnzimmer gesessen, über die Tiefe der Liebe Jesu nachgedacht und sich gegenseitig die Füße gewaschen. Als Meg vor Hannah niederkniete, ehrfürchtig ihre Füße ins Wasser tauchte und sie anschließend abtrocknete, konnten beide die Tränen nicht zurückhalten. Und dann drückte Meg auf jeden ihrer Füße einen Kuss, und ihr Gesicht wurde vom Kaminfeuer erhellt – und von etwas anderem. Von jemand anderem. Es war, als hätte Jesus selbst vor Hannah gekniet und ihr die Füße gewaschen.
Sie hatte ganz vergessen, Meg davon zu erzählen.
Sie kniff die Augen zusammen und versuchte, den plötzlichen Anfall von Trauer abzuwehren.
„O Liebes“, murmelte Mara, als sich Hannahs Brust zu heben begann. Es hatte keinen Zweck. Hannah legte den Kopf an die Schulter ihrer Freundin und ließ ihren Tränen freien Lauf.
* * *
Freitag, 13. März, 19:30 Uhr
Nachdem ich in Tränen ausgebrochen bin, haben Mara und Charissa vorgeschlagen, einfach nur zu reden und miteinander zu beten und den Text außer Acht zu lassen. Ich glaube, auf meine Tränenflut waren sie nicht vorbereitet. Aber ich brauche etwas Zeit für stille Reflexion. Ich brauche Raum zum Hören und Atmen, bevor ich darüber rede.
Bisher habe ich mich immer als Marta gesehen, die vor Jesus tritt und ihm Vorwürfe macht, dass er nichts unternommen hat. Deshalb sehe ich mich heute Abend als Maria, die sich weigert, das Haus zu verlassen und Jesus gegenüberzutreten, weil sie zutiefst enttäuscht darüber ist, dass er nicht gekommen ist, als sie ihn gerufen haben. Ich stelle mir vor, wie ich am Tisch sitze, als sich die Nachricht verbreitet, dass er endlich eingetroffen ist – vier Tage zu spät. Er hatte sich nicht einmal die Mühe gemacht, an der Beerdigung teilzunehmen, und jetzt ist er auf einmal da? Nein, das ist nicht in Ordnung.
„Kommst du?“, fragt Marta und schnappt sich ihren Umhang. Nein. Ich komme nicht. Was für eine Art von Liebe ist es, die nichts unternimmt, obwohl es in ihrer Macht gestanden hätte einzugreifen?
Ich verspüre den inneren Drang, die richtige Antwort zu geben. Die theologische Antwort. Die Antwort, die ich kenne und der zu vertrauen ich gelernt habe. Aber ich denke, dass ich noch länger bei Maria verweilen und die Last ihres Schmerzes und ihrer Enttäuschung tragen muss. Denn wenn ich wirklich ehrlich bin und mir die Zeit nehme, auf meine trauernde Seele zu hören, dann stelle ich fest, dass ich immer noch Zorn empfinde, weil er meine Gebete – unsere Gebete – nicht so erhört hat, wie ich es mir gewünscht hätte.
Den ganzen Tag habe ich mich wieder mit dem „Wenn ich doch nur“ auseinandergesetzt. Wenn ich nur viel früher bemerkt hätte, dass mit Meg etwas nicht in Ordnung war. Wenn ich nur früher erkannt hätte, dass es keine Bronchitis war. Wenn ich sie nur mehr gedrängt hätte, zum Arzt zu gehen. Wäre die Prognose eine andere gewesen, wenn sie einen Monat früher zum Arzt gegangen wäre?
Und was, wenn ich sie dazu ermutigt hätte, doch eine Chemotherapie zu machen, obwohl der Arzt gesagt hatte, der Krebs sei bereits zu weit fortgeschritten, und eine Therapie habe keinen Sinn mehr? Was, wenn ich sie dazu ermutigt hätte, mit aller Kraft dagegen anzukämpfen? Zu kämpfen, um zu leben?
Ich schreibe die Wörter „zu leben“ und erkenne augenblicklich die Ironie darin. Was ist meine Definition von „leben“?
Jesus sagte zu Marta: „Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer mich annimmt, wird leben, auch wenn er stirbt, und wer lebt und sich auf mich verlässt, wird niemals sterben, in Ewigkeit nicht. Glaubst du mir das alles?“
Ja, ich glaube es, Herr. Hilf meinem Unglauben.
Glaube ich auch nur für einen Augenblick, dass Meg hierher zurückkommen würde, nachdem sie deine Herrlichkeit gesehen hat? Vergesse ich, dass sie lebt? Dass sie jetzt viel mehr aus der Fülle lebt, als sie es hier auf Erden jemals getan hat? Vergesse ich das?
Es tut mir leid, Herr. Aber es tut weh.
Ich weiß, dass sie mit einem traurigen Herzen wegen Becca gestorben ist. Ich weiß, dass sie sich Sorgen gemacht hat wegen allem, was ungesagt und ungetan geblieben ist. Indem sie mir die Verwaltung ihres Vermögens übertrug, hat sie mir gleichzeitig auch ihre Tochter anvertraut. Sie hoffte, dass ich sie im Gebet vor Gott bringen und nicht nur die Regelung der finanziellen Angelegenheiten übernehmen werde. Sie hoffte, dass Becca sich an mich wenden wird, wenn sie irgendetwas braucht. Sie hoffte, dass Becca eine Beziehung zu mir aufbauen wird. Ich weiß nicht, ob es tatsächlich so kommen wird. Wie kann ich Megs Wünschen gerecht werden und gleichzeitig Becca die Freiheit lassen, ihren eigenen Weg zu wählen?
Ich bete für sie. Ich biete ihr Hilfe und Ermutigung an. Ein offenes Ohr, wenn sie es braucht. Doch bisher hat sie auf keine meiner E-Mails geantwortet. Ich fürchte, ich darf sie nicht zu sehr drängen. Ich muss ihr Zeit lassen.
„Wenn du einfach nur für sie da sein könntest“, hatte Meg gesagt, „falls sie etwas braucht.“ Sie hat mich nicht gebeten, ein Mutterersatz für Becca zu werden. Sie hat mich nicht gebeten, zu versuchen, sie zu Jesus zu führen oder sie zu überreden, ihre Beziehung mit Simon zu beenden. Sie hat mich nur gebeten, für ihre Tochter da zu sein.
Ich sehe Megs Gesicht vor mir und höre ihre Stimme sagen: „Ich bin so dankbar für dich, Hannah.“ Nicht für meine Hilfe. Nicht für meine Gebete. Nicht einmal für meine Zeit. Sondern für mich. Ich hätte gern so viel mehr für sie getan. Als wir im Februar in ihrem alten Haus gebetet und sie mit Öl gesalbt haben, wollte ich sie zur Heilung salben, nicht zum Tod. Und ich höre deine Stimme, die mich wieder einmal daran erinnert, dass ich sie zum Leben gesalbt habe.
Warum verwechsle ich immer lebendig mit tot? Bring Becca vom Tod zum Leben, Herr. Und danke, dass du Meg vom Leben ins Leben geholt hast. Danke, dass du mir das Vorrecht geschenkt hast, bei ihr zu sein, als sie in deine Gegenwart eingetreten ist. Bitte lass die Erinnerung an diesen Augenblick für Becca eine Quelle des Trostes werden und nicht der Trauer. Bring sie zum Leben. Bitte!
Ich lese mir den Text noch einmal durch und erinnere mich daran, wie unterschiedlich die beiden Schwestern getrauert haben. Marta, die Frau, die ausspricht, was sie bewegt. Maria, die einer Konfrontation aus dem Weg geht. Ich bin schon jede der beiden Frauen gewesen. Es gab Augenblicke, da habe ich dir vorgeworfen, dass du dich nicht kümmerst, und es gab Zeiten, da habe ich meinen Schmerz für mich behalten und im Stillen meine Enttäuschung genährt.
Ich sehe Maria, die im Haus sitzt, umgeben von Menschen, die vermutlich Jesu Macht infrage stellen. „Den Blinden hat er sehend gemacht. Hätte er nicht verhindern können, dass Lazarus stirbt?“, werden sie später fragen. Keines ihrer Worte tröstet oder beruhigt Maria. Im Gegenteil: Sie verschlimmern ihren Schmerz. Und dann taucht Marta in der Tür auf. Ihr Gesichtsausdruck ist weicher geworden und sie sagt sanft: „Unser Lehrer ist hier und will dich sehen!“
Ihre Worte beenden den Aufruhr. Sie zähmen Marias Groll, setzen ihrer Verwirrung und ihrem Schmerz ein Ende. „Jesus ist hier und er möchte dich sehen. Er ruft nach dir.“ Diese Worte verändern alles, und langsam, aber sicher geht Maria in ihrer Trauer einen Schritt weiter.
Dies sind die Worte, die ich höre, Herr, wenn ich im Angesicht der Verluste und der Gewinne in meinem Leben weitergehe. Da gibt es so viel Schönes, das ich feiern kann, und gleichzeitig gibt es so viele Tode zu betrauern. Du rufst mich zu dir. Ich rufe dich zu mir. Komm und sieh die Dinge, die ich begraben habe. Komm und sieh meine Enttäuschungen und meine Hoffnungen. Begegne mir mit deiner Auferstehungskraft. Und nicht nur mir, sondern uns allen. Bitte!
Mara
Während die anderen ihre Gedanken niederschrieben, starrte Mara auf das Blatt und versuchte, sich zu konzentrieren. Es wäre leichter für sie gewesen, einfach nur über die Fragen zu reden und anschließend zu beten. Sie war wirklich nicht gut darin, ihre Gedanken schriftlich festzuhalten. In den vergangenen Monaten hatte sie es mehrmals probiert, aber es war ihr nicht gelungen. Sie würde nie eine Tagebuchschreiberin werden wie Hannah. Damit musste sie sich abfinden.
Sie las den Text erneut. Mit welcher Schwester identifizierte sie sich? Mit der großmäuligen. Mit der, die keine Scheu hatte, Jesus zu sagen, was sie empfand. Sie hatte ihm eine Nachricht geschickt und ihn um Hilfe gebeten, doch er war nicht gekommen. Mara hätte ihn zur Rede gestellt, genau wie Marta – wobei sie sich nicht sicher war, ob sie dabei so höflich geblieben wäre.
Worin sie sich auch nicht sicher war, war die Frage, ob sie diesen Glauben gehabt hätte. Marta vertraute darauf, dass Jesus allmächtig war, obwohl er ihrer Bitte nicht nachgekommen war. Was für ein großer Glaube!
Aber Marta hatte auch Zweifel. Zuerst behauptete sie, sie würde glauben, dass Jesus alles tun könne, dass er die Auferstehung und das Leben sei, dass er der Messias sei, der Sohn Gottes. Und als Jesus dann darum bat, den Stein wegzurollen, hatte sie Einwände, weil es zu sehr stinken würde.