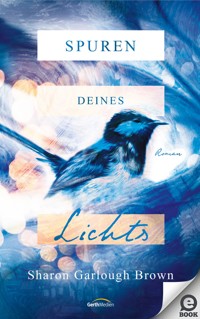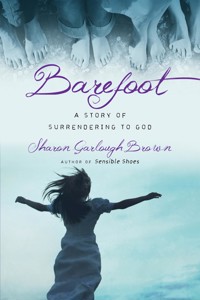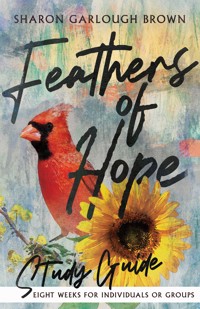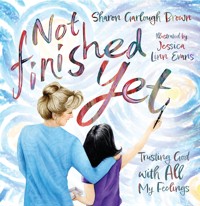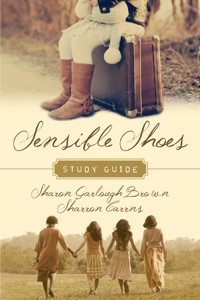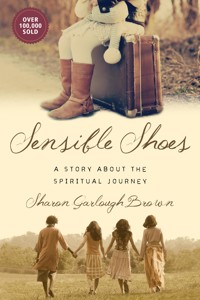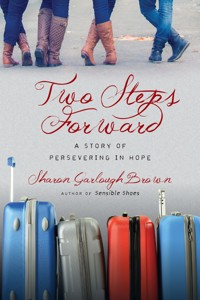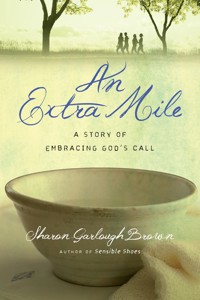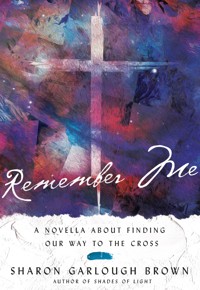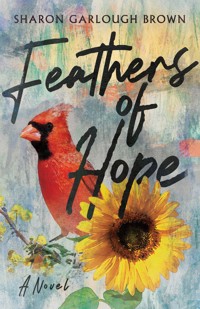Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Gerth Medien
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
In einer Zeit großer Veränderung stehen sich Wren Crawford und ihre Großtante Katherine Rhodes, die Leiterin des "New Hope"-Einkehrzentrums, zur Seite, um einander zu weiteren Schritten im Glauben zu ermutigen. Während sich Katherine auf den Ruhestand vorbereitet und dabei mit einigen Unzulänglichkeiten ihrerseits konfrontiert wird, gelingt es Wren zunehmend, den Weg innerer Heilung zu beschreiten. Dieser Roman bietet jede Menge geistliche Einsichten, thematisiert das Loslassen und ermutigt dazu, Glaubensschritte zu wagen. Außerdem dürfen sich alle Leser der erfolgreichen "Unterwegs mit dir"-Reihe von Sharon Garlough Brown freuen: Sie erleben nicht nur ein letztes Seminar von und mit Katherine Rhodes, sondern treffen auf dem Weg dorthin auch einige lieb gewonnene Freundinnen wieder.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 592
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Über die Autorin
Sharon Garlough Brown ist Pastorin und Autorin der erfolgreichen Unterwegs mit dir-Romanreihe. Gemeinsam mit ihrem Mann Jack leitet sie eine Gemeinde im schottischen Dundee. Ihren reichen Erfahrungsschatz aus vielen Jahren geistlicher Retraiten und Kurse über geistliche Übungen webt sie meisterhaft in ihre Bücher ein.
Für meinen geliebten Sohn, mit dem ich dieses Buch gemeinsam geschrieben habe.Deine Weisheit, deine Einsichten und deine Kreativitätsind auf jeder Seite dieses Buches zu finden.David, du inspirierst mich mit deinem Mut, deiner Freundlichkeit und deiner Güte. Ich bin unglaublich froh und stolz, deine Mutter zu sein!Der Herr segne dich und beschütze dich.Der Herr wende sich dir freundlich zu und sei dir gnädig.Der Herr sei dir besonders nahe und gebe dir seinen Frieden.
4. Mose 6,24–26
Inhalt
Teil 1: Das Unsichtbare
Teil 2: Aus der Dunkelheit
Teil 3: Ins Licht
Anmerkungen
Liste der Werke von Vincent van Gogh
Hilfen für Menschen mit psychischen Problemen und deren Angehörige
Teil 1
Das Unsichtbare
Darum verliere ich nicht den Mut.Die Lebenskräfte, die ich von Natur aus habe, werden aufgerieben;aber das Leben, das Gott mir schenkt, erneuert sich jeden Tag.Die Leiden, die ich jetzt ertragen muss, wiegen nicht schwer und gehen vorüber.Sie werden mir eine Herrlichkeit bringen, die alle Vorstellungen übersteigt und kein Ende hat.Ich baue nicht auf das Sichtbare, sondern auf das, was jetzt noch niemand sehen kann.Denn was wir jetzt sehen, besteht nur eine gewisse Zeit.Das Unsichtbare aber bleibt ewig bestehen.
2. Korinther 4,16–18 (GNB)
1
Der Kardinalsvogel, der früh am Morgen mit vorquellenden Augen und seiner roten Kopffedern beraubt in ihrem Futterhäuschen landete, war entweder krank oder verletzt. Wren Crawford stellte ihre Kaffeetasse auf den Küchentisch und beobachtete ihn durch die Glastür zur Veranda. Wenn er nicht jetzt gleich tot zu Boden fiel, würde sie ihn vermutlich später im Garten finden. Sie hoffte nur, sie würde schneller sein als die Katze der Nachbarn.
Schnell suchte sie im Schrank unter dem Spülbecken nach Gummihandschuhen. Sie würde auch eine Gartenschaufel holen. Vielleicht könnte sie ihn im Wald begraben.
Sie stellte sich die Szene gerade bildlich vor, als ihre Großtante Katherine Rhodes im Bademantel neben ihr auftauchte, eine Zeitschrift in der Hand. „Er ist in der Mauser“, erklärte Kit. „Dieser kleine Kerl hat gerade alle seine Federn verloren.“
Wren spürte, wie ihre Anspannung nachließ. „Dann ist er also nicht krank?“
„Nein, es geht ihm gut. Nur sieht er im Augenblick nicht besonders hübsch aus.“ Kits verständnisvolles Lächeln ließ erkennen, dass sie nicht nur erraten hatte, in welche Richtung Wrens Gedanken gewandert waren, sondern auch begriffen hatte, wie es dazu gekommen war. „Bei den meisten Vögeln geht die Mauser allmählich vonstatten“, erklärte sie, „aber manchmal kommt es auch vor, dass ein Exemplar das Alte auf einmal und ziemlich unvermittelt abwirft.“
Wren lebte nun schon seit neun Monaten mit Kit unter einem Dach, und mittlerweile hatte sie sich daran gewöhnt, dass ihre Großtante häufig in Metaphern sprach. Doch dieses Mal hielt Kit sich mit Erklärungen zurück und beließ es dabei. „Das wäre doch ein interessantes Motiv für ein Bild, meinst du nicht?“, fragte sie und tippte Wren auffordernd auf den Unterarm.
Ja. Irgendwann vielleicht. Wenn sie wieder Energie für kreative Arbeit hätte. Schnell griff Wren nach ihrem Handy auf dem Küchentisch und machte ein Foto, bevor der Vogel davonflatterte.
Vincent hätte ihn ganz bestimmt gemalt, dachte sie später am Vormittag, während sie ihren Wagen mit den Putzmitteln aus dem Lagerraum des Pflegeheimes belud. Der Mann, dessen Motive Bauern und Sternennächte, Sonnenblumen und Eisvögel gewesen waren, hätte diesen Vogel in der Mauser mit einer solchen Einfühlsamkeit gemalt, dass es sie bestimmt zu Tränen gerührt hätte.
Weil sie mittlerweile wusste, wie es sich anfühlte, in der Mauser zu sein.
Sie schob ihren Wagen durch den ersten der drei Flure, für deren Reinigung sie zuständig war. An der Wand vor jeder Zimmertür gab es kleine Vitrinen mit ausgewählten Gegenständen, die das Personal und die Besucher an das Leben erinnern sollten, das die Bewohner des jeweiligen Zimmers geführt hatten, bevor sie ihre Arbeit, ihre Hobbys, ihre Gesundheit oder einen geliebten Menschen verloren hatten.
Bevor Wren Mr Kennedys Vitrine abstaubte, sprach sie ein kurzes Gebet für ihn. In dem Kasten lagen ein hochwertiger Markengolfball, eine Tüte mit altem Tomatensamen und ein Foto von ihm als stämmigem jungen Mann in einer Militäruniform. Die Mauser war eine gute Metapher, nicht nur für sie, sondern auch für die Menschen, um die sie sich hier kümmerte. Und nicht nur für die Bewohner, sondern auch für deren Angehörige, für die Menschen, die sie liebten. Die Ehepartner. Die Kinder. Die Enkel. Die Freunde. Sie alle verloren etwas Wesentliches. Jeder auf seine Weise, aber es geschah bei allen. Bei manchen etwas dramatischer als bei anderen.
„Guten Morgen, Mr Kennedy“, grüßte Wren, während sie ihre Hände unter den Spender mit Desinfektionsmittel an der Wand hielt.
Mr Kennedy saß in einem zerschlissenen Sessel neben dem Bett. Sein dünnes Haar war noch nicht gekämmt, ein weißes Handtuch war wie ein Lätzchen in sein grau kariertes Schlafanzugoberteil gesteckt. Als er ihre Stimme wahrnahm, schaute er von seinem Frühstückstablett hoch, wo er gerade erfolglos versuchte, mit der Gabel ein Würstchen aufzuspießen. Heute Morgen zitterte seine Hand stärker als sonst.
Wren warf einen Blick durch die Tür in den Flur. Keine Schwester und keine Hilfskraft in Sicht. „Wie wäre es, wenn ich Ihnen ein wenig helfe?“ Sie trat zum Sessel, nahm seine Hand und führte ihm die Gabel zum Mund. Er nahm den Bissen und kaute langsam. „Schmeckt das gut?“
Er schluckte, dann öffnete er den Mund wie ein kleiner Vogel. Sanft lockerte sie seine Hände, nahm die Gabel selbst in die Hand, schob einen weiteren Bissen darauf und hielt diesen an seine Lippen. Er nahm ihn, kaute und schluckte. Dann musste er husten. Die Essensreste aus seinem Mund spritzten in alle Richtungen.
„Alles in Ordnung?“
Er hustete erneut. Sie griff nach der Plastiktasse mit den beiden Henkeln auf seinem Tablett. „Das scheint Apfelsaft zu sein. Ist das in Ordnung? Oder soll ich Ihnen lieber etwas Wasser holen?“
„Saft ist in Ordnung“, erwiderte er leise und mit rauer Stimme.
Sie legte seine Finger um die beiden Henkel. „Haben Sie sie?“
„Ja.“ Seine Hände zitterten so stark, dass ihm der Saft ins Gesicht spritzte, als er die Tasse an die Lippen führte. Sie wartete, bis er getrunken hatte, dann half sie ihm, die Tasse wieder aufs Tablett zu stellen. Gerade als sie ihm Kinn und Wangen mit einer Serviette abtupfen wollte, betrat eine der Krankenschwestern das Zimmer, eine kleine Schale mit Apfelmus, ein Glas Wasser und einen Plastikbecher mit Tabletten in den Händen. Greta warf Wren einen Blick zu, sagte aber nichts. „Ich habe hier Ihre Morgenmedizin, Pete.“
Wren trat zur Seite.
„Hoppla“, bemerkte Greta, „das sieht so aus, als hätten Sie geduscht.“ Sie wischte ihm mit einem Zipfel des Handtuchs die Speisereste ab.
Während Wren noch einmal ihre Hände desinfizierte, musterte sie die kleine Erinnerungssammlung vor dem Zimmer: die Figur eines Golfspielers mit Mr Kennedys eingraviertem Namen, ein Foto von ihm, wie er strahlend vor Glück neben seiner Frau auf einem Segelboot stand, und ein paar gerahmte Fotos von seinem Sohn und seinen Enkeln, die in Kalifornien lebten. Mr Kennedy sagte, sie kämen manchmal zu Besuch. Aber er sagte auch, seine Frau käme ihn von Zeit zu Zeit besuchen, doch sie war bereits vor sieben Jahren gestorben.
Greta gab ein wenig Apfelmus auf einen Löffel und legte eine Tablette darauf. „Okay, die erste, Pete. Mund auf. Etwas weiter. Alles drin? Gut.“ Sie beobachtete ihn beim Schlucken. „Brauchen Sie Wasser zum Runterspülen?“ Als er nicht antwortete, stemmte sie eine Hand in die Hüfte. „Heißt das ‚Nein danke‘ oder ‚Ja bitte‘?“
Er schluckte erneut und sagte: „Nein, danke.“
Sie legte eine weitere Tablette auf den Löffel. „Also gut, jetzt die nächste. Sie kennen das ja. Gut gemacht. Noch eine, in Ordnung? Fast fertig.“
Mr Kennedy verschluckte sich und hustete. Greta reichte ihm einen Becher. „Für heute ist ein Bad geplant. Wir sorgen dafür, dass Sie wieder schön frisch riechen.“
Er murmelte etwas, das Wren nicht verstehen konnte.
„Brauchen Sie Hilfe, um auf die Toilette zu gehen?“, fragte Greta.
„Das schaffe ich schon“, erwiderte er.
„Aber nicht, dass Sie klingeln, wenn ich gerade gegangen bin. Ich bin jetzt hier. Sind Sie sicher, dass Sie jetzt nicht zur Toilette müssen?“
„Ja, bin ich.“
„Na gut. Chelsea kommt gleich und hilft Ihnen beim Baden und Anziehen.“ Sie wandte sich an Wren. „Vielleicht sollten Sie mit dem Saubermachen bis nach dem Bad warten.“
„In Ordnung“, erwiderte Wren. Nachdem Greta das Zimmer verlassen hatte, trat sie an seinen Sessel. „Soll ich den Sportkanal für Sie einschalten, Mr Kennedy? Es ist Donnerstag. Ich wette, da läuft irgendwo ein Golfturnier.“
Er nickte. Wren nahm die Fernbedienung vom Tisch und schaltete den Fernseher ein. Der richtige Sender war bereits eingestellt.
„Wollen Sie es gemeinsam mit mir ansehen?“, fragte er. Seine Stimme war kaum lauter als ein Flüstern.
„Das würde ich gern tun, aber ich muss leider weitermachen. Wenn ich fertig bin, komme ich zu Ihnen. Wäre das in Ordnung?“
Er räusperte sich und schwieg einen Moment, als wäre er nicht sicher, ob er es schaffen würde, so laut zu sprechen, dass sie ihn verstehen könnte. „Sicher.“
Wren lächelte ihn an. Manchmal war das Sprechen eine Heldentat für ihn, und wenn es nur zwei Silben waren. „Ich komme wieder, wenn Sie gebadet haben, und putze das Zimmer, okay?“
„Okay.“
Sie legte die Fernbedienung auf den Tisch, sodass er sie erreichen konnte. „Brauchen Sie jetzt noch etwas?“
Er sah sie an. „Meine Brieftasche.“
Wren schob eine Strähne ihrer dunklen Haare hinters Ohr. Dieses Gespräch hatte sie schon mehrmals mit ihm geführt. „Ihre Brieftasche ist sicher verwahrt. Die brauchen Sie heute nicht.“
„Sie müssen doch ein Trinkgeld bekommen, wenn Sie mein Zimmer putzen.“
Sie tätschelte ihm die Schulter. „Das ist schon in Ordnung, Mr Kennedy. Es ist alles bereits geregelt.“
„Ich habe Ihnen schon was gegeben?“
„Ja.“ Das war die einfachste Antwort. „Wollen Sie jetzt weiterfrühstücken?“
„Sicher.“ In den drei Monaten, die sie ihn bereits kannte, hatte Wren nicht einmal mitbekommen, dass er darüber geklagt hätte, dass seine Würstchen oder Spiegeleier kalt geworden waren.
„In Ordnung, dann bis später.“ Von der Tür aus feuerte sie ihn im Stillen an, als er versuchte, einen Bissen auf die Gabel zu bekommen. Vermutlich war er früher genauso fest entschlossen gewesen, einen langen Putt ins Loch zu schlagen. Sie ordnete ein paar Flaschen auf ihrem Wagen und wartete, bis er sich erfolgreich die Gabel in den Mund gesteckt hatte, bevor sie zum nächsten Zimmer weiterging, innerlich voll Jubel über einen riesengroßen Sieg.
B
„Wren, könntest du mir mal kurz helfen?“
Wren hockte auf dem Teppich und sammelte heruntergefallene Heftklammern auf. Peyton war für das Unterhaltungsprogramm im Heim zuständig und gestaltete gerade die Infotafel neu. Sie hatte Onkel Sam, die Freiheitsglocke und Bilder von Feuerwerken abgenommen. Peyton war ein paar Jahre jünger als Wren. Dies war ihre erste Arbeitsstelle nach dem Collegeabschluss. Jetzt gestaltete sie die Infotafel mit Ankündigungen für eine tropische Strandparty.
Wren trat zu ihr an den Tisch, auf dem ausgeschnittene Bilder von Ananas, Palmen und Surfbrettern lagen.
„Kannst du die bitte mal halten?“ Peyton reichte ihr zwei Rollen mit Luftschlangen, dann begann sie, die roten und gelben Luftschlangen miteinander zu verflechten. „Ich hoffe, dass es dieses Mal gut angenommen wird“, bemerkte sie. „Die Party soll am Sonntagnachmittag stattfinden. Bestimmt sind dann mehr Enkelkinder mit dabei.“
Wren nickte. Beim Grillfest am vierten Juli waren nur wenige Kinder da gewesen. Aber Mitte August würden sicher wieder mehr Familien in der Stadt sein. „Hast du dieses Thema schon mal angeboten?“
„Ja, kurz nachdem ich letzten Sommer hier angefangen habe. Aber die meisten werden sich nicht mehr daran erinnern. Und wir haben seitdem sehr viele neue Bewohner bekommen.“
Wren zuckte innerlich zusammen. Peyton hatte das so beiläufig gesagt. Vermutlich hatte sie noch nie darüber nachgedacht, warum es so viel Wechsel im Heim gab. Dem Tod oder dem Verfall gegenüber gleichgültig zu werden, schien ein berufsbezogenes Phänomen im Willow Springs-Pflegeheim zu sein.
Peyton beendete ihre Arbeit, klebte ihr Ende der Luftschlangen zusammen und bedeutete Wren, ihre Seite abzureißen. „Danke“, sagte sie, als Wren ihr das Ende reichte. „Könntest du mir beim Infobrett helfen oder hast du noch mit der Reinigung der Zimmer zu tun?“
Wren legte den Rest des Krepppapiers auf den Tisch. „Mit den Zimmern bin ich fertig. Ich muss jetzt nur noch die Flure saugen.“ Da es nicht sinnvoll war, die Flure zu saugen, bevor Peytons Dekoration fertig war, griff sie nach den Pappbuchstaben. „Was willst du damit schreiben?“
„Ich habe alles hier aufgeschrieben.“ Sie deutete auf ein Blatt Papier.
Während Wren die Buchstaben für „Aloha, Freunde“ und „Schön, dass Sie da sind“ zusammensetzte, beschrieb Peyton ihre Pläne für die themenbezogene Dekoration, das Essen und die Bastelaktivitäten. Kayla, eine der Pflegehelferinnen, war in Hawaii aufgewachsen und bereit, einen Hula-Tanz vorzuführen. „Das wird den Leuten gefallen“, schwärmte Peyton. „Sie kann uns einfache Bewegungen beibringen.“ Wren fragte sich, wie sich Mr Kennedy wohl dabei fühlen würde, der kaum die Bewegung seiner Arme und Hände kontrollieren konnte.
Die Aufzugtüren glitten auf, und Wren warf einen Blick über die Schulter. Mrs Whitlocks Tochter Teri, die fast jeden Tag zu Besuch kam, nahm einen Besucherausweis aus dem Korb, straffte die Schultern und atmete tief durch, bevor sie merkte, dass sie beobachtet wurde. Als Wren ihr zuwinkte, lächelte sie, und ihr Blick wanderte zur Infotafel. „Ihr Mädels sorgt immer dafür, dass es hier drin so festlich aussieht.“
Peyton warf ihren langen blonden Pferdeschwanz zurück und deutete einen Knicks an. „Danke. Ich tue mein Bestes.“
Wren betrachtete die Infotafel.
„Ich unterbreche nur ungern“, sagte Kayla, die gerade in den Aufenthaltsraum kam, „aber in Miss Daisys Bad gibt es ein kleines Missgeschick zu beseitigen.“
„Ich komme sofort“, sagte Wren und holte ihren Putzwagen aus dem Flur.
2
Katherine Rhodes las ihre Notizen für das Seminar am Samstag noch einmal durch, als ihr Handy auf dem Schreibtisch eine Nachricht von Wren anzeigte: Hallo, Kit! Bleibe länger, um mit Mr Kennedy Golf zu schauen. Iss ruhig schon ohne mich zu Abend.
In dem Fall, dachte Kit, könnte sie ruhig auch noch etwas länger bleiben. Klingt gut. Viel Spaß!, tippte sie. Dann lehnte sie sich in ihrem Stuhl zurück und reckte sich. Ihre Amtszeit als Leiterin des New Hope-Einkehrzentrums in Kingsbury ging in wenigen Wochen zu Ende, und bis dahin blieb noch viel zu tun.
Fast vier Monate waren vergangen, seit sie ihre Kündigung eingereicht hatte, und das Kuratorium hatte die Suche nach einem Nachfolger oder einer Nachfolgerin für sie eigentlich bis Ende Juli abgeschlossen haben wollen. Aber jetzt stand der August vor der Tür, und bisher war noch niemand gefunden worden.
Na ja, vielleicht hatten sie ja schon jemanden im Blick, und sie wusste nichts davon. Der Auswahlprozess war sehr viel vertraulicher vonstattengegangen, als sie erwartet hatte – was ja das Vorrecht des Kuratoriums war, wie sie sich immer wieder selbst in Erinnerung rufen musste. Einige Namen von Personen, die ihrer Meinung nach für die Nachfolge geeignet waren, hatte sie ihnen genannt, doch die Stellenbeschreibung, die das Kuratorium am Ende entwickelt hatte, ließ erkennen, dass eine Richtungsänderung der Arbeit gewünscht war.
Von ihrem Schreibtisch nahm sie den Aktenordner mit der Aufschrift „Übergabe“ und zog das einzelne Blatt heraus, das sie von der Webseite ausgedruckt hatte. Ihre Kündigung hatte dem Kuratorium die Möglichkeit gegeben, seine Vision der Arbeit neu zu definieren. Gesucht wurde eine Person mit ausgeprägten Führungseigenschaften, Unternehmergeist und Erfahrungen im digitalen Marketing und in der Beschaffung von Spendengeldern. Das Kuratorium suchte jemanden, der den Kreis der Geldgeber erweitern, die geplante Renovierung des Gebäudes managen und eine aktive Präsenz in den sozialen Medien entwickeln würde und somit den Wirkungskreis des New Hope-Zentrums in West Michigan und darüber hinaus ausweiten könnte.
Kit hatte es immer wieder erlebt, dass bei der Suche nach einem Nachfolger oder einer Nachfolgerin für eine bestimmte Position auf Begabungen und Stärken Wert gelegt wurde, die bei der Vorgängerin vermeintlich oder tatsächlich nicht vorhanden waren. Sie bemühte sich, das nicht persönlich zu nehmen. In all den Jahren ihrer Arbeit im New Hope-Zentrum hatte sie nie so getan, als wäre sie etwas anderes als eine geistliche Begleiterin und Leiterin von Retraiten.
Ihr Blick glitt über den abgetretenen Teppich in ihrem Büro. Das Gebäude war müde. Genau wie sie. Seit sie erkannt hatte, dass sie loslassen und zum nächsten Abschnitt in ihrem Leben Ja sagen musste, wie immer der sich gestalten mochte, hatte sich ihre Erschöpfung verstärkt und beschleunigt. Obwohl das Kuratorium ihr zugestanden hatte, nach ihrem Ausscheiden noch ein letztes Mal den „Glaubensreise“-Kurs zu leiten, war ihr klar geworden, dass es besser war, ganz zurückzutreten. Sollte der neue Leiter oder die neue Leiterin doch den Freiraum haben, eine Vision und Präsenz zu entwickeln, die anders war als ihre.
„Klopf, klopf!“, rief eine bekannte Stimme von der Tür her.
„Mara!“, rief Katherine. Hatte sie einen Termin mit ihr vergessen? Sie überflog ihren aufgeschlagenen Terminkalender. Kein Begleitgespräch für sechzehn Uhr. „Komm doch rein. Wie schön, dass du da bist!“ Sie ließ die Stellenausschreibung wieder in ihrem Aktenordner verschwinden und stand vom Schreibtisch auf. Jetzt war es nötig, schnell umzuschalten, um betend präsent sein zu können.
Mara umarmte sie fest, bevor sie ihre perlenbesetzte Tasche auf den Boden stellte. Wie üblich trug sie leuchtende Farben – eine türkisfarbene Tunika, orange Armreifen und eine passende Halskette dazu – und ihre elfenbeinfarbene Haut unter ihren kastanienbraunen Haaren zeigte ein wenig Bräune um Nase und Stirn.
Kit wollte gerade die Christuskerze und eine Schachtel Streichhölzer holen, als Mara sagte: „Entschuldige, wenn ich störe, aber ich war gerade bei Gayle, um mit ihr über das Essen für deine Abschiedsfeier zu sprechen. Deine Bürotür stand offen, und ich wollte nur kurz Hallo sagen. Ich hoffe, das ist in Ordnung.“
„Aber natürlich!“ Es kam ihr sogar ganz gelegen. Ein normales Gespräch verlangte ihr sehr viel weniger an geistiger und emotionaler Energie ab als ein geistliches Begleitgespräch. „Ich wollte mir gerade eine Tasse Tee machen. Trinkst du eine mit?“
„Aber gern! Ingwer-Pfirsich, wenn du hast.“
„Die Sorte habe ich extra für dich besorgt.“ Sie nahm die beiden Becher mit Motiven von Vincent van Gogh, die Wren ihr geschenkt hatte, vom Regal und hängte in jeden einen Teebeutel. „Ich gehe schnell in die Küche und stelle Wasser auf. Bin gleich wieder da.“
„Ich komme mit“, erklärte Mara. „Lass mal, die nehme ich schon.“
Gemeinsam gingen sie durch den Flur zu der kleinen Küche. Maras Armreifen klapperten gegen das Porzellan. „Ich glaube, ich bin schon ein paar Monate nicht mehr hier gewesen.“ Sie deutete auf die Wände. „Mir gefallen die vielen Kunstdrucke. Ist das alles von van Gogh?“
„Ja. Wren hat die Bilder ausgewählt. Sind sie nicht beeindruckend?“ An den Wänden im Flur hingen Bilder vom Säen und Ernten, von Weizenfeldern, Olivenhainen und ansprechenden Sonnenblumen in unterschiedlichen Phasen der Blüte und des Verfalls. Wenn die neue Leitung die Kunstwerke nicht behalten wollte, dann müssten alle Drucke heruntergenommen und die Wände frisch gestrichen werden.
„Was ist das hier?“ Mara deutete mit dem Kinn auf die Skizze von einem kahlköpfigen älteren Mann, der vornübergebeugt auf einem Stuhl saß, die Ellbogen auf seine Oberschenkel stützte und die Finger zur Faust geballt an sein Gesicht drückte.
„Worn Out, heißt es“, erklärte Kit. Mit diesem Bild hatte sie häufig meditiert. In der Küche goss sie das abgestandene Wasser aus dem Wasserkocher in den Ausguss und füllte ihn mit frischem Wasser.
„Der arme Mann“, sagte Mara. „Man möchte ihn geradezu einfach auf die Stirn küssen und ihm sagen, er solle durchhalten, nicht?“
Oder mir einen Stuhl zu ihm heranziehen, dachte Kit, und einfach mit ihm schweigen.
Mara stellte die Becher auf die Arbeitsplatte und lehnte sich ans Spülbecken. „Arbeitet Wren heute hier?“
„Nein, sie ist im Pflegeheim.“
„Hat sie ihre Stunden dort jetzt aufgestockt? Ich habe schon länger nicht mit ihr gesprochen.“
„Nein, ihre Stundenzahl ist gleich geblieben. Aber sie verbringt einen großen Teil ihrer Freizeit dort und leistet den Bewohnern Gesellschaft.“
„Gut für sie“, erwiderte Mara. „Ich könnte das nicht. Viel zu traurig. Seltsam, dass sie damit kein Problem hat, ich meine wegen ihrer Depressionen und so.“ Sobald sie die Worte ausgesprochen hatte, schlug sie die Hand vor den Mund. „Entschuldigung, das kam nicht so, wie ich es gemeint hatte. Ich wollte sagen, ich bin überrascht, dass es sie nicht deprimiert, wenn sie ständig von Krankheit und Tod umgeben ist.“
Diesen Gedanken hatte auch Kit schon gehabt. Ja, es war erstaunlich, dass Wren sich von der Traurigkeit dieses Ortes nicht herunterziehen ließ, sondern ihn eher tröstlich fand. Er schien ihr sogar etwas zu geben. Gefährten im Leid, sagte sie häufig. Eine große Gemeinschaft.
„Ich bin froh, dass sie ganz gut zurechtkommt“, fuhr Mara fort. „Aber ich sage ihr immer wieder, dass sie ihr Talent vergeudet, wenn sie Toiletten putzt und Böden schrubbt. Sie sollte irgendwo Kunsttherapie anbieten. Nicht mit misshandelten Frauen und Kindern wie früher. Ich verstehe, dass ihr das zu viel geworden ist. Aber irgendwo, wo sie mit anderen malen und zeichnen kann. Wenn im Budget bei Crossroads genügend Geld wäre, würde ich sie sofort einstellen, damit sie mit unseren Leuten arbeitet. Sie könnten wahrhaftig ein wenig Kunst gebrauchen, die ihre Welt heller macht.“
Sie redete wie Wrens Mutter Jamie, die häufig ähnliche Sorgen und Wünsche für ihre Tochter äußerte. Wren würde es sicher leichter fallen, das von Mara zu hören als von ihrer Mutter.
Das Wasser kochte, und Kit hielt die beiden Becher hoch. „Sternennacht oder Iris?“
„Sternennacht.“
Sie goss das Wasser zuerst in Maras Becher, dann reichte sie ihr einen Löffel. „Du kannst selbst entscheiden, wie stark du ihn haben möchtest.“
„Ach, heute kann der Beutel ruhig drinbleiben. Je stärker, desto besser.“
„So ein Tag also, ja?“
„So eine Jahreszeit“, erwiderte Mara. „Ich erspare dir die Details, bis wir uns zum Begleitgespräch treffen. Jetzt möchte ich mit dir lieber über deine Verabschiedung reden.“
Kit rührte in ihrer Tasse. „Ich fürchte, diese Feier entwickelt sich ein wenig zäh.“ Sie drückte den Teebeutel aus und warf ihn in den Mülleimer, der dringend geleert werden musste. Sie musste Wren unbedingt daran erinnern, stärker auf diese Dinge zu achten. Die neue Leitung würde vielleicht nicht so nachsichtig sein.
„Wren hat mir gesagt, dass du deinen Abschied lieber sang- und klanglos nehmen würdest. Kommt nicht infrage, Katherine! Wir werden eine Feier für dich organisieren, ob es dir nun gefällt oder nicht. In all diesen Jahren hast du so vielen Menschen geholfen zu erkennen, wie sehr Gott sie liebt und wie sehr sie ihm am Herzen liegen – du wirst nicht von hier fortgehen, ohne dass wir dich gebührend feiern. Direkte Anweisung von Jesus. Du kannst ja mal mit deiner eigenen geistlichen Begleitung über deinen inneren Widerstand sprechen.“
Kit lachte. „Ich habe dich zu gut ausgebildet, Mara.“
„Ha! Jetzt mit sechzig bin ich froh, dass ich unterwegs doch ein paar Dinge gelernt habe.“ Sie hakte sich bei Kit ein. „Und jetzt sprechen wir über diese Abschiedsfeier, ja?“
B
Sie hätte keine besonderen Wünsche in Bezug auf das Essen, meinte Kit, als sie in ihrem Büro saßen, und ein richtiges Abendessen sei doch nicht nötig. Appetithäppchen und Kuchen, hätte sie gedacht.
„Wir werden hier nicht einfach Chips und Dips aus dem Supermarkt auftischen, Katherine. Wenn du ein Problem damit hast, dann sprich mit deiner Tochter. Ich bekomme meine Anweisungen von ihr.“
„Aha“, erwiderte Kit und hob in gespielter Ergebenheit die Hände, „dann ist es also beschlossene Sache. Wer bin ich, dass ich Sarah widersprechen würde – oder Jesus?“
Mara grinste. „Jetzt sind wir auf dem richtigen Weg.“
Kit trank einen Schluck Tee. Das New Hope-Zentrum hatte kein Geld für eine derart große Feier. Wenn Sarah auf einem großen Abendessen bestanden hatte, dann würden sie und Zach vermutlich die Rechnung bezahlen. Nimm es doch einfach an, Mama, würde Sarah sagen. Und freu dich über die Liebe und Wertschätzung, die dieses Geschenk ausdrückt.
Nachdenklich schaute sich Mara im Büro um. „Ich kann nicht glauben, dass du in den Ruhestand gehst. Wir werden dich hier vermissen.“
„Ich bleibe ja in der Nähe“, erwiderte Kit.
„Das will ich doch hoffen. Mich wirst du auf jeden Fall nicht los. Ich werde ständig bei dir auf der Matte stehen.“
„Und ich werde mich freuen, dich zu sehen.“
Mara legte die Hand auf ihr Herz. „Das hast du immer. Und ich werde dir immer dankbar sein, dass du mir nachgegangen bist, als ich beim ersten Kurs alles hinschmeißen wollte.“ Sie klopfte auf das Sofakissen. „Seither bin ich einen ziemlich weiten Weg mit dir gegangen. Und es tut mir so leid, dass ich an deinem letzten Seminar nicht teilnehmen kann. Ich wäre so gern dabei, aber samstagvormittags bin ich für die Ausbildung der Ehrenamtlichen zuständig, und im Augenblick kann niemand für mich einspringen.“
„Mach dir keine Gedanken“, beruhigte Kit sie. „Deine Arbeit ist wichtig für das Reich Gottes.“ Sie erinnerte sich nicht mehr, wie lange Mara nun schon zusammen mit anderen die Obdachlosenunterkunft leitete, aber in dieser Aufgabe war sie mit ihrer Leidenschaft und ihren Talenten eine gute Besetzung. Hinzu kam noch ihre persönliche Erfahrung, weil sie und ihr Sohn früher selbst einmal in diesem Heim gelebt hatten. Sie konnte glaubwürdig eine der vielen wunderbaren Geschichten davon erzählen, wie ein Leben neu wurde, und Katherine hatte das Vorrecht gehabt, diese Geschichte zum Teil mitzuerleben.
Sie umschloss ihren Teebecher mit beiden Händen.
Dieser Teil ihrer Arbeit war noch nicht vorbei, sagte sie sich. Sie konnte sich auch weiterhin mit Menschen treffen, die sich sie als Begleiterin für ihren Glaubensweg wünschten, um tiefer in Gottes Liebe und Gnade hineinzuwachsen – falls Gott sie auch weiterhin für diese Arbeit befähigte. In den vergangenen Monaten hatte sie verstärkt erleben können, wie Gottes Kraft gerade durch ihre Schwachheit gewirkt hatte. Und das war an sich schon ein Geschenk der Gnade.
„Bitte erinnere mich immer wieder daran, dass ich das, was ich tue, für Gott und sein Reich tue“, bat Mara, „denn ich muss dir was sagen: Vielleicht werde ich jetzt im Alter ein wenig unleidlich. Aber ich habe neuerdings einfach keine Geduld mit Menschen, die sich nicht weiterentwickeln wollen.“
„Das hört sich so an, als gäbe es eine Geschichte dahinter“, erwiderte Kit.
„Hast du ein paar Minuten Zeit?“
„Natürlich.“
Mara stellte ihren Becher auf den Couchtisch. „Gott weiß, dass ich nicht mit dem Finger auf Menschen zeige, die dummes Zeug reden. Ich bin selbst eine, die bei jeder Gelegenheit ins Fettnäpfchen tritt. Aber wenn man etwas Unüberlegtes sagt, das einen anderen verletzt … und dann wütend wird, wenn einem gesagt wird, dass das wehgetan hat, wenn man sich dann auch noch verteidigt und dem anderen vorwirft, überempfindlich zu sein, anstatt die Möglichkeit in Betracht zu ziehen, dass man selbst blind oder unwissend ist …“ Sie atmete tief und lange aus und blies ihren Pony zurück. „Ich kenne dieses Verhalten. Ich habe es in meiner Ehe viel zu lange ertragen. Darum sind meine Antennen vermutlich ganz besonders sensibel, wenn ich mitbekomme, dass jemand sich einem anderen gegenüber so verhält. Und das geschieht neuerdings häufiger bei Crossroads. Ich habe das so satt. Darum habe ich das angesprochen und einige der Ehrenamtlichen damit ziemlich auf die Palme gebracht. Wenn das so weitergeht, dann haben wir bald vermutlich nicht mehr viele Leute, die mithelfen.“
„Das tut mir leid zu hören“, erwiderte Kit und stellte ihren Becher ebenfalls ab. „Gibt es ein bestimmtes Thema oder Muster? Oder herrscht einfach eher eine allgemeine Gereiztheit?“
Mara legte ihre Füße, die in Sandalen steckten, auf die Tischkante. „Ich habe den Eindruck, dass die Leute unglaublich reizbar sind, egal, wo du hinschaust. Es gibt so viel Rechthaberei. Aber das meine ich gar nicht. Ich spreche davon, wie einige von den weißen Ehrenamtlichen den afroamerikanischen Bewohnern und ehrenamtlichen Helfern begegnen, und über die Bemerkungen, die sie gemacht haben. Nicht nur über sie, sondern auch direkt ihnen gegenüber.“
Kit spürte, wie sich ihre Schultern verspannten. Mit so etwas hatte sie nicht gerechnet, und sie fühlte sich ganz und gar nicht imstande, ein solches Gespräch zu führen. Hilf mir, Herr.
„Offener Rassismus ist leicht aufzuzeigen und zu benennen“, fuhr Mara fort. „Wir haben versucht, unsere Mitarbeiter und Ehrenamtlichen für die etwas unterschwelligeren Formen zu sensibilisieren. Aber wenn man erklärt, warum etwas, das jemand gesagt oder getan hat, problematisch ist, dann kommt sofort die Reaktion: ‚Warum legst du eigentlich alles sofort rassistisch aus?‘ Und dann ist kein Gespräch mehr möglich.“
Kit hoffte sehr, dass dies nicht die Einleitung zu einer politischen Diskussion wäre. Sie hatte die Spaltungen so satt und war nicht dazu aufgelegt, ihre üblichen Fragen zu stellen, die ihr Gegenüber in eine andere Richtung lenken sollten: „Wozu, glaubst du, lädt dich Gott in einer solchen Situation ein?“ Oder: „Was sagt dir dein innerer Aufruhr in Bezug darauf, was du von Gott brauchst?“ Diese Fragen gehörten in ein seelsorgerliches Gespräch. Im Augenblick brauchte sie die Gnade, gut zuzuhören und nicht zu reagieren, egal, was Mara sagte. Sie legte die geöffneten Hände in den Schoß. Lass los. Empfange.
Mara beugte sich vor und polierte einen angekratzten orange lackierten Zehnagel, bevor sie ihre Füße wieder auf den Boden stellte. „Ich nenne dir mal ein Beispiel: Letzte Woche kam einer von unseren langjährigen Ehrenamtlichen – Larry, er ist schon lange Christ –, um bei der Essensausgabe zu helfen. Die Kinder lieben ihn sehr. Er ist wie ein Großvater zu ihnen, er spielt mit ihnen und gibt ihnen immer was zu lachen. Aber ich musste Larry in der Vergangenheit schon häufiger auf Bemerkungen ansprechen, die er gemacht hat – zum Beispiel hat er einigen der afroamerikanischen Jungen gesagt, sie müssten sich in der Schule anstrengen und hart arbeiten, wenn sie nicht in Gangs landen oder drogenabhängig werden wollen.“
Kit runzelte die Stirn.
„Ja, genau“, fuhr Mara fort. „Letzte Woche ist er in die Küche gekommen, während wir noch Sandwiches machten und alles vorbereiteten. Wir haben eine neue Ehrenamtliche, die bei der Vorbereitung hilft – Ruth, eine ältere schwarze Frau. Er ist freundlich zu ihr, er möchte, dass sie sich willkommen fühlt, als Teil der Familie. Das ist alles okay. Aber nachdem er sich ein wenig mit ihr unterhalten hat, schaut er sie an, als sei sie von einem anderen Planeten, und sagt: ‚Wow! Sie sind ja erstaunlich wortgewandt.‘ Ruth legt den Kopf schief, mustert ihn von oben bis unten und wirft ihm einen Blick zu, der besagt: ‚Es lohnt sich nicht, darauf zu antworten.‘ Dann wendet sie sich zu Debra um, die neben ihr steht und Möhren schneidet. Larry schnappt sich einen Keks und schlendert in den Speisesaal, um auf die Kinder zu warten. Und ich denke mir, das kann ich nicht durchgehen lassen. Das ist zu wichtig. Weil das genau das ist, wofür wir unsere Ehrenamtlichen sensibilisieren wollen, verstehst du? Für genau solche Bemerkungen und Einstellungen, die uns gar nicht bewusst sind, die aber andere verletzen und Schaden anrichten. Wir bemühen uns doch, so miteinander umzugehen, wie Jesus mit den Menschen umging. Das ist unser Wunsch. Das ist unser Auftrag.“
Kit nickte zustimmend.
„Ich stand also da neben dem Herd und hörte zu, wie Ruth und Debra miteinander plauderten. Ich wollte sie nicht unterbrechen und Ruth fragen, wie sie sich fühlt. Das würde ich lieber in einem Gespräch unter vier Augen machen. Darum folgte ich Larry in den Speisesaal. Es war sonst niemand da, darum setzte ich mich zu ihm an einen Tisch und erklärte ihm, so entschlossen und ruhig ich konnte, dass seine Bemerkung Ruth gegenüber vielleicht ein Kompliment sein sollte, doch dass er damit eigentlich ein rassistisches Klischee bedient hätte. Es sei eine dieser Mikroaggressionen gewesen, über die wir bereits häufiger gesprochen hätten. Er explodierte, hob die Hände und erklärte mir, er hätte es so satt, ständig vorgeworfen zu bekommen, er sei ein Rassist. Dabei wollte er doch nichts anderes, als – und ich zitiere jetzt – ‚diesen Menschen zu helfen, etwas aus ihrem Leben zu machen‘.“
Kit schaute sie nur an und wusste nicht genau, was sie antworten sollte. Sie war noch nie im Crossroads-Haus gewesen, und sie hatte sich nie Gedanken darüber gemacht, wie rassistische Vorurteile sich auf die Gemeinschaft auswirken würden, für die Mara tätig war. Sie könnte ihre Unwissenheit auf diesem Gebiet eingestehen. Aber die Wahrheit war, dass sie sich immer bemüht hatte, Menschen nicht nach ihrer ethnischen Zugehörigkeit wahrzunehmen oder das irgendeine Rolle spielen zu lassen. Und dass Mara jetzt so offen über Hautfarbe sprach, war ihr unangenehm. Zum Glück hatte sie sehr viel Übung darin, ihre Gedanken und Reaktionen zu kontrollieren, sodass Mara das vermutlich nicht merkte – selbst wenn sie sie aufmerksam beobachtete.
„Ich habe mich bemüht, vernünftig mit ihm zu reden. Ich habe ihm versichert, dass er im Crossroads-Haus herzlich willkommen ist und wie wichtig er für die Kinder sei. Aber ich habe ihm auch gesagt, es wäre auch für alle wichtig, dass er seine blinden Flecken anerkennt. Und dass ich mir wünschte, dass wir alle miteinander lernen würden. Ich sagte, wir alle bräuchten noch mehr Schulungen zum Thema Gerechtigkeit zwischen ethnischen Gruppen. Da ist er gegangen. Er sagte, er hätte diesen ganzen Mist mit der politischen Korrektheit so satt, und stürmte aus dem Gebäude, gerade als die Kinder kamen. Die Mails, die ich ihm daraufhin schickte, hat er nicht beantwortet. Ich musste ihn also gehen lassen. Und ein paar andere, bei denen er offenbar seinen Unmut rausgelassen hat, hat er mitgenommen. Sie waren so empört darüber, was ich zu ihm gesagt hätte und wie ich ihn – sie malte Anführungszeichen in die Luft – ‚verurteilt‘ hätte, dass sie auch gegangen sind.“
„Oh, das tut mir leid“, sagte Kit nach einer Weile. „Das scheint ja wirklich eine schwierige Situation zu sein.“
„Ja“, erwiderte Mara, „aber hier geht es ja nicht nur um mich. Das mache ich mir immer wieder bewusst.“ Sie faltete die Hände im Schoß. „Später habe ich mit Ruth darüber gesprochen – sie und Debra haben beide gesehen, wie er rausgestürmt ist –, und sie meinte, sie mache sich mehr Sorgen darum, wie die Kinder reagieren, wenn sie erfahren, dass Larry vermutlich nicht zurückkommt und sich nicht mal von ihnen verabschiedet hat. Sie haben schon so viele Brüche erlebt, und jetzt verlieren sie noch einen Menschen, der ihnen etwas bedeutet. Sie hat recht, und das macht mir sehr zu schaffen. Wenn er nur offen gewesen wäre für die Möglichkeit, etwas Neues zu erkennen, dann hätten wir gemeinsam weitergehen können, so chaotisch und schwierig und frustrierend das vielleicht auch gewesen wäre. Wir hätten gemeinsam einen Weg suchen können.“
„Ja, ich weiß, das hättest du getan“, sagte Kit. „Ich habe wirklich Hochachtung davor, wie du dich für all diese Menschen einsetzt – auch für die, die deine Arbeit schwierig machen. Du weißt, Mara, dass sich darin sehr viel Liebe zeigt, oder? Ganz besonders in Zeiten wie diesen.“
Mara legte den Kopf in den Nacken und schloss die Augen. „Es ist im Augenblick so laut, verstehst du? Alles ist so laut. Wir hören einander nicht. Da sind ständig Auseinandersetzungen, ständig werden Etiketten aufgeklebt und Urteile gefällt. Und seit wann ist ‚Gerechtigkeit‘ ein Schimpfwort? Wann sind einige Christen zu dem Schluss gekommen, dass es ein Politikum ist, sich für Gerechtigkeit und für Menschen einzusetzen, die am Rande der Gesellschaft stehen, und nicht vielmehr ein Auftrag im Reich Gottes? Ich verstehe es nicht.“
„Ich auch nicht. Aber ich bin froh, dass du vor Ort bist und tust, was du tust. Damit nutzt du deine eigenen Erfahrungen treu und verantwortungsbewusst.“
Mara schaute sie wieder an. „Manchmal frage ich mich allerdings, ob mir diese Themen so wichtig wären, wenn sie für mich nicht so persönlich wären. Würde ich so allergisch auf Rassismus reagieren, wenn nicht eines meiner Kinder Rassismus bereits am eigenen Leib erfahren hätte? Ich sage nicht, dass Jeremys Probleme allein auf seine Hautfarbe zurückzuführen sind, aber als Kind einer weißen Mutter und eines schwarzen Vaters einen rassistischen Tyrannen als Stiefvater zu haben war nicht gerade hilfreich gewesen. Und ich schätze, ein Teil von mir bereut noch immer, dass ich mich manches Mal nicht gegen Tom gestellt und ihm Einhalt geboten habe. Auch wenn ich verstehe, warum ich es nicht getan habe, warum ich das Gefühl hatte, ich könnte es nicht. Aber wenn ich jetzt aufstehen und für diese Kinder eintreten kann, die nicht mal meine eigenen sind, dann tue ich das mit meiner ganzen Kraft. Wenn es eine Möglichkeit gibt, Menschen, die das Gefühl haben, vergessen oder geschlagen worden zu sein, oder das Gefühl vermittelt bekommen haben, weniger wert zu sein wegen ihrer Hautfarbe oder Armut oder mangelnder Bildungsmöglichkeiten oder was auch immer, den Rücken zu stärken, dann suche ich danach. Selbst wenn andere sich darüber aufregen.“
Kit wünschte, sie könnte Mara ein Video zeigen, wie sie selbst vor Jahren auf dieser Couch gesessen hatte, tief verstrickt in Scham und Schuldgefühle, in Angst und Selbstverurteilung und fest davon überzeugt, dass es ihr nie gelingen würde, zu erfassen, wie groß die Liebe Gottes zu ihr war, oder diese Liebe anzunehmen. Welch großartiges Zeugnis für die Gnade und Macht Gottes. Und was für eine Ehre, dachte sie, nachdem Mara ihr Büro verlassen hatte, weil sie zu einer Sitzung musste, was für eine Freude, Gottes Wirken aus erster Hand miterleben zu dürfen und zu sehen, wie er Fesseln löste und befreite Menschen hinaussandte in die Welt.
B
Das Knarren der Haustür ließ Kit später am Abend hochfahren. Sie war auf der Couch eingeschlafen. Die Bibel, die aufgeschlagen auf ihrem Schoß lag, fiel zu Boden. „Hallo“, grüßte sie, als Wren mit dem Rucksack über der Schulter das Zimmer betrat.
„Hallo. Ach, entschuldige, habe ich dich aufgeweckt?“
„Ja, aber das macht nichts. Ich bin wohl kurz eingenickt.“ Sie schob ihre Brille zurecht. „Wie spät ist es?“
„Kurz vor neun.“ Wren streifte ihre Sneakers ab.
„War es ein guter Tag?“
„Ja, ganz in Ordnung. Es war ziemlich ruhig, abgesehen von Miss Daisy.“
Kit hob ihre Bibel vom Boden auf und legte sie auf den Couchtisch. In den vergangenen Monaten hatte sie viel von der armen Frau gehört, die ihre Puppe nicht aus der Hand gab und flehte, ihre Eltern sollten kommen und sie nach Hause holen.
„Fast den ganzen Morgen hat sie verschlafen, doch heute Nachmittag war sie sehr unruhig. Mr Kennedy fragte ständig, ob jemand ihr wehtäte. Ich weiß nicht, ob er sich daran erinnert, dass sie fast jeden Tag schlechte Phasen hat.“ Wren zog den Reißverschluss ihres Rucksacks auf und nahm ihre Uniform heraus. „Eine Pflegehelferin hat ihr dieses Lied ‚Daisy, Daisy‘ vorgesungen, und dann haben sie ihr anscheinend ein Sedativum gegeben, denn als ich ging, schlief sie tief und fest.“
„Das ist ein altes Lied“, bemerkte Kit. „Meine Großmutter hat mir das immer vorgesungen. ‚Daisy, Daisy, gib mir doch deine Antwort.‘ Es geht dabei um irgendeine Kutsche und ein Fahrrad für zwei.“ Sie sah vor sich, wie sich ihre Großmutter über sie beugte und mit strahlendem Gesicht leise dieses Lied sang und sich dazu ganz leicht im Rhythmus bewegte. Ihr Atem hatte nach Lakritz gerochen. „Ich habe immer gewollt, dass sie ,Kitty, Kitty‘ sang. Funktionierte nicht ganz so gut. Aber wegen dieses Liedes habe ich mir immer ein Tandem gewünscht – ein Fahrrad für zwei.“
Ihre Arbeitskleidung noch immer im Arm, setzte sich Wren auf die Armlehne der Couch. „Hast du eins bekommen?“
„Nein. Nie. Robert hatte nicht viel übrig fürs Fahrradfahren, und wozu braucht man ein Tandem, wenn man niemanden hat, der mitfährt.“
„Wir sollten dir eins besorgen.“
Kit lachte. „Jetzt bin ich ein wenig zu alt für so etwas.“
„Aber du bist doch noch nicht alt, Kit.“
Sie lachte erneut. „Vielen Dank.“ Da war der Anflug eines Funkelns in Wrens sanften braunen Augen. In letzter Zeit war das häufiger bei ihr zu beobachten. Trotzdem durfte man das nicht als selbstverständlich hinnehmen. Nicht, wo es sie so viel Mühe kostete und sie sich so anstrengen musste, damit es ihr gut ging. Kit wünschte, es wäre nicht so.
„Ich meine, du bist eine jugendliche, gesunde Mittsiebzigerin. Nicht wie einige der Bewohner in Willow Springs.“
Auch das war für Kit nicht selbstverständlich.
„Welche Farbe hätte dein Fahrrad haben sollen?“, fragte Wren.
„Ach, keine Ahnung. Das wäre, glaube ich, egal gewesen.“
„Aber wenn du wählen könntest.“
„Komm nicht auf dumme Ideen, Wren.“
„Tue ich nicht. Ich frage nur.“
Kit strich mit den Fingern über ein Sofakissen. „Blau, denke ich.“
„Hell oder dunkel?“
„Hell. Wie die Farbe deiner Uniform.“
Wren schaute auf das Kleiderbündel in ihren Armen herunter. „Da wir gerade davon sprechen, ich muss heute noch waschen. Meine drei Outfits sind jetzt offiziell schmutzig.“ Sie deutete auf einen großen Fleck auf der Bluse. „Tomatensoße. Ich habe mir Pasta aus der Cafeteria geholt und wollte beim Golfschauen mit Mr Kennedy essen. Ich hoffe nur, dass etwas davon bis morgen trocken ist.“
„Musst du morgen denn wieder arbeiten?“
„Eine Kollegin ist krank, und ich werde vormittags gebraucht. Nach dem Mittagessen komme ich ins New Hope-Zentrum und putze dort.“ Sie hielt inne. „Falls das in Ordnung ist. Entschuldige, ich hätte das erst mit dir absprechen sollen.“
„Nein, das ist in Ordnung. Du weißt ja, dass du dir deine Arbeitszeit flexibel einteilen kannst. Aber natürlich muss alles sauber sein, bevor die Gruppe am Samstag kommt.“
„Gut, danke.“ Wren ging zur Terrassentür und sah hinaus in die Dämmerung. „Keine toten Kardinalsvögel?“
„Nein, ich glaube nicht.“
„Das ist gut. Ich musste den ganzen Tag daran denken.“
„Was meinst du?“
Wren drehte sich zu Kit um. „Was du gesagt hast über den kahlen Kardinalsvogel und die Mauser. Ich habe über dieses Bild nachgedacht.“
„Ach ja? Erzähl mir mehr darüber.“
„Gut, gern. Ich stelle erst mal rasch die Waschmaschine an. Hast du deine Gebetszeit schon gehabt?“
Wenn es ging, versuchten Kit und Wren abends gemeinsam zu beten – sie betrachteten eine Bibelstelle, lasen liturgische Gebete oder beteten mit einem Kunstwerk oder einer Collage, oder sie ließen im Gebet der liebenden Aufmerksamkeit den Tag noch einmal an sich vorbeiziehen. „Ich warte auf dich“, versprach Kit und unterdrückte ein Gähnen.
B
Wren kam zurück und war mit ihrem Handy beschäftigt. „Beim Nachdenken über das Bild der Mauser fiel mir ein, dass Vincent es auch gebraucht hat. Er hat damit die Verluste in seinem Leben beschrieben.“ Sie ließ sich neben Kit auf der Couch nieder und reichte ihr das Handy. „Hier. Du kannst es selbst lesen. Das ist aus einem seiner Briefe an Theo.“
Kit schob ihre Brille hoch, um zu lesen, was Vincent an seinen Bruder geschrieben hatte: „Was die Mauser für die Vögel ist, die Zeit, da sie das Gefieder wechseln, das sind Missgeschick und Unglück und schwierige Zeiten für uns Menschen. Man kann in dieser Mauserzeit verharren, man kann auch wie neugeboren daraus hervorgehen, aber jedenfalls geschieht das nicht in der Öffentlichkeit; es ist durchaus kein Spaß, und deshalb tut man besser daran, zu verschwinden.“
„Es sind Worte, aus denen ich höre, wie verletzlich er war“, bemerkte Kit. „Vielleicht spricht daraus auch Scham.“
Wren nickte. „Das kann ich nachvollziehen. Ich habe diesen Impuls auch gehabt. Ich wollte mich am liebsten verstecken, um keine Erklärung geben zu müssen. Das macht es leichter.“ Kit gab ihr das Handy zurück, und sie legte es auf den Couchtisch. „Dawn hat mir bei unserem letzten Gespräch gesagt, es wäre schön, wenn ich versuchen würde, neue Freundschaften zu schließen und mehr Zeit mit Leuten meines Alters zu verbringen. Aber ich habe ihr geantwortet, dass mich das viel zu viel Kraft kostet. Als ich heute darüber nachgedacht habe, ist mir klar geworden, wie anstrengend diese Mauserzeit sein kann. Ich habe das Gefühl, ich muss mich auf nichts anderes als meine Arbeit konzentrieren, bis meine Federn wieder nachwachsen.“
Kit konnte ihr nicht widersprechen, aber sie war froh, dass Wrens Therapeutin begonnen hatte, sie sanft aus ihrer Komfortzone zu stupsen. „,Bis‘ ist ein gutes Wort“, erwiderte sie. „Ich höre erwartungsvolle Hoffnung darin, als wärst du um eine Ecke gebogen, auf etwas Neues zu.“ Wren schaute sie verständnislos an. „Ich habe gehört, dass du gesagt hast: ‚Bis meine Federn nachwachsen‘.“
„Oh!“ Wren lächelte flüchtig. „Danke, dass dir das aufgefallen ist. Das ist vermutlich schon ein Fortschritt.“
„Ein großer Fortschritt. Und wenn Dawn denkt, du seist bereit für eine neue Herausforderung, dann nimm auch das als Wort der Hoffnung.“
„Ja, mag sein“, erwiderte Wren, aber es klang nicht sehr überzeugt.
Kit beschloss, sie nicht zu drängen. „Da wir gerade von Vögeln und Mauserzeiten sprechen“, sagte sie, „meine Großmutter – die, die mir ‚Daisy, Daisy‘ vorgesungen hat – hatte einen Wellensittich. Er hieß Sokrates und war ein kleiner Pfiffikus. Sie hat ihn immer aus seinem Käfig genommen, wenn ich zu Besuch kam, und er machte dann Purzelbäume in meiner Hand. Er konnte auch meinen Namen sagen. ‚Kitty-kitty-kitty‘, plapperte er immer, und dann haben wir gelacht.“
Wren zog die Knie hoch, legte das Kinn darauf und sah Kit interessiert an.
„Wenn er in der Mauser war, bekam er immer diese scharfen kleinen Stoppeln. ‚Stoppelfedern‘ werden sie genannt, und sie waren kratzig und sehr unbequem für ihn, wie kleine Stacheln. Stoppelfedern sind sehr empfindlich. Als Schutz für das neue Wachstum haben sie eine Art Ummantelung – so ähnlich wie Zehennägel. Doch irgendwann muss diese Schutzhülle abgeworfen werden, damit sich die Feder entfalten kann. Der kleine Sokrates hat sich deshalb ständig geputzt, um diese Schutzhüllen loszuwerden, aber an die Federn auf seinem Kopf kam er nicht heran. Wenn die Stoppelfedern dort dann stark genug waren, strich meine Großmutter ganz sanft darüber, damit das neue Wachstum sich entfalten konnte.“
Seit Jahren hatte Kit nicht mehr daran gedacht, wie ihre Großmutter dem Sittich vorgesungen und ihn gestreichelt und wie dieser kleine Vogel sich an ihre Hand geschmiegt hatte, als wüsste er, dass sie etwas tat, was gut und wichtig für ihn war.
„Was du über die Mauser gesagt hast, Wren, wie anstrengend sie doch ist, das hat auch meine Großmutter immer gesagt. Sie sagte immer, Sokrates brauche in der Mauserzeit besonders viel liebevolle Zuwendung und Ruhe. Darum habe ich manchmal neben seinem Käfig gesessen und ihm vorgelesen, während er auf seiner Stange saß, und ich habe beobachten können, wie sich diese kleinen Stacheln des Sittichs in Federn verwandelt haben.“ Sie hielt inne. „Und das ist immer passiert.“
Sie schwiegen, und Kit lauschte auf das Summen und Gurgeln der Waschmaschine, während ihre Gedanken zum New Hope-Zentrum, dem Kuratorium und ihrem Ruhestand wanderten. Nach einer Weile beugte sich Wren vor und gab ihr einen Kuss auf die Wange. „Danke, dass du mir einen sicheren Ort gibst, wo meine Stoppelfedern wachsen können. Und dass du so viel Geduld mit mir hast.“
Langsam strich Kit sich durch ihr kurzes weißes Haar. „Ich glaube, ich erlebe im Augenblick auch eine Mauserzeit. Also danke, dass auch du Geduld mit mir hast.“
Während der Wind mit dem Windspiel an der Dachtraufe spielte, sah Kit durch die Verandatür in die Dunkelheit hinaus, und ihre Gedanken wanderten zu dem kahlen Kardinal und zu Wren und den Bewohnern des Willow Springs-Pflegeheims und zu Mara und den Mitarbeitern und Bewohnern und Ehrenamtlichen vom Crossroads-Haus und zu all den stacheligen Orten von Beschwerlichkeit, Verlust und Veränderung, an denen Menschen so verletzlich waren. Nachdenklich strich sie sich noch einmal durchs Haar.
3
Sobald Wren am Freitagnachmittag ihre Schicht in Willow Springs beendet hatte, fuhr sie mit dem Fahrrad zum New Hope-Zentrum. „Es gibt doch Spenden für ein Abschiedsgeschenk für Katherine, nicht?“, fragte sie Gayle, nachdem sie die Teilzeitkraft in ihrem Büro begrüßt hatte.
Gayle nickte und nahm einen Aktenordner aus ihrer Schreibtischschublade. „Ich führe genau Buch. Fast alle haben zugesagt zu kommen. In der Kapelle wird es also voll werden.“
„Fantastisch“, erwiderte Wren. Sie hoffte nur, dass Kit das ebenfalls fantastisch finden würde. „Hat das Kuratorium eigentlich die Absicht, ihr ein Geschenk zu kaufen, oder bekommt sie einen Scheck überreicht?“
„Keine Ahnung. Warum?“
„Ich hätte da eine Idee.“ Wren spähte hinaus in die Lobby, um sicherzugehen, dass Kit nicht in der Nähe war. „Gestern Abend hat sie erzählt, dass sie sich schon immer ein Tandem gewünscht hat.“
„Im Ernst? Gibt es so was überhaupt noch?“
„Ich habe bereits im Netz gesucht und bin auf verschiedene Angebote gestoßen.“ Es gab sogar mehrere in der richtigen Farbe.
„Weiß Sarah davon?“
„Dass Kit sich ein Tandem wünscht?“
„Dass du eins für sie kaufen willst.“
„Nein.“
„Oh.“ Gayle legte eine Hand auf den Aktenordner. „Ich weiß nicht, Wren. Ich meine, wenn sie meine Mutter wäre …“
„Viele ältere Leute fahren Fahrrad. Und wir sprechen ja nicht über ein Mountainbike oder ein Rennrad. Ich bin früher mal Tandem gefahren. Ich könnte vorn sitzen. Das ist nicht schwer, wenn man es erst mal raushat.“
„Aber wenn sie stürzt und sich die Hüfte bricht oder …“
„Schon verstanden.“ Wren hob die Hand. Sie brauchte niemanden, der ihre eigenen Befürchtungen noch verstärkte. „Vergiss es einfach. Vergiss, dass ich es erwähnt habe.“
„Ich mache mir nur Sorgen, dass …“
„Schon gut.“
Gayle verstaute den Aktenordner wieder in der Schublade. „Ich wollte deine Begeisterung nicht dämpfen, Wren.“
„Schon in Ordnung.“ Wren nahm ihren Rucksack. „Ich muss mich jetzt an die Arbeit machen. Aber sag Kit bitte nichts von der Idee mit dem Tandem, okay?“
Gayle zog einen imaginären Reißverschluss zwischen ihren Lippen zu.
Wenn das Tandem kein Gemeinschaftsgeschenk sein konnte, dachte Wren, als sie im Flur um die Ecke bog, dann würde sie es ihr eben allein kaufen. Und niemand außer Kit bräuchte etwas davon zu erfahren.
Richtig so, Wrinkle, stimmte Casey ihr in ihren Gedanken zu.
Wren blieb so abrupt stehen, dass sie beinahe stolperte.
Selbst sieben Monate nach seinem Tod fuhr sie bei dem Gefühl, seine Stimme zu hören, zusammen. Sie klang so unglaublich lebensecht, und sie hätte schwören können, dass er unmittelbar neben ihr stand.
Oder hinter ihr.
Denn genau da hatte Casey immer gesessen, wenn sie sich am Samstag manchmal ein Tandem gemietet hatten und um den See geradelt waren. Zwar hatte er Witze darüber gemacht, dass er hinter ihr saß und sie zur Abwechslung einmal ihn chauffieren musste. Aber es war ihm immer gelungen, ihr Mut zu machen, die Führung zu übernehmen. Wenn es ihm gut ging, war Casey ihr Held.
Das war bestimmt ein seltsames Bild gewesen. Er mit seinen knapp zwei Metern und seinem roten Haar, das im Fahrtwind flatterte, und sie zartes Persönchen, die mit aller Kraft in die Pedale trat. Dieser Gedanke zauberte ein Lächeln auf Wrens Lippen. Bei ihrer ersten Fahrt hatten sie erst nach einigen Versuchen und viel Gelächter ihren Rhythmus gefunden, aber nachdem sie gelernt hatten, im Gleichklang zu treten, hatten sie diese Fahrten immer sehr genossen.
Dawn hatte recht, dachte Wren, während sie ihre Putzmittel aus dem Schrank holte. Es gab einen Tag auf dem Weg der Trauer, an dem die Erinnerung an einen geliebten Menschen einem ein Lächeln auf die Lippen zauberte, bevor eine Träne über die Wange rollte. Vielleicht machte sie ja doch Fortschritte.
Sie steckte sich ihre In-Ear-Kopfhörer in die Ohren, suchte Don McLeans „Vincent“ auf ihrem Handy und drückte die Wiederholungstaste. Dann begann sie die Kunstdrucke abzustauben und suchte dabei innerlich nach dem Bild, mit dem sie heute Abend beten wollte.
Leider hing das Gemälde, das ihr dabei in den Sinn kam, nicht an diesen Wänden: Ein Wiegenlied, Vincents Porträt seiner Freundin Augustine Roulin. Das Bild, von dem sich Casey bei ihrer letzten Begegnung provoziert gefühlt hatte. Das war das letzte Mal gewesen, dass sie ihn lebend gesehen hatte.
Ihr Blick wanderte zu der geschlossenen Tür ihres Ateliers, einem Seminarraum, der nicht gebraucht wurde und den sie nutzen durfte. Kit hatte ihr das ausdrücklich gestattet. Letztes Jahr im Dezember hatten sie und Casey an ihrem Arbeitstisch gestanden und die verschiedenen Porträts von Augustine in einem Bildband angeschaut und über Vincents Stil diskutiert, bis Casey brummte, Müttern zu gefallen sei eine Sache der Unmöglichkeit und die Vaterschaft werde „überschätzt“. Damals hatte Wren nicht verstanden, was er meinte. Sie verstand es ja noch jetzt kaum, wo immer noch so viele Geheimnisse über Caseys Leben und seinem Tod hingen. Er hatte seine Geheimnisse mit ins Grab genommen. Und manchmal musste man das eigene Nichtwissen begraben und loslassen, um auf dem Weg der Trauer weitergehen zu können, wie Kit ihr immer wieder in Briefen und Gesprächen klargemacht hatte.
„Warum macht diese Frau dich traurig?“, hatte Zoe sie im letzten Frühling gefragt, als sie in Chicago eines von Vincents Porträts von Augustine angeschaut hatten. Da die anderen aus ihrer Familie auf der Suche nach einem College für Olivia gewesen waren, hatten sie und Zoe ein paar Stunden im Kunstmuseum verbracht.
Wren war so verblüfft gewesen über die Wahrnehmungsgabe ihrer kleinen Schwester, dass sie nicht gewusst hatte, was sie antworten sollte. Darum hatte sie die Frage zurückgegeben. „Macht sie dich denn traurig?“
„Ja.“ Zoe ergriff Wrens Hand. „Weil sie zornig aussieht.“
„Findest du?“
„Ja.“ Zoe stellte sich auf die Zehenspitzen, um besser hinschauen zu können. „Vielleicht schreit das Baby zu viel.“
„Vielleicht“, hatte Wren erwidert. „Babys weinen manchmal sehr viel.“
Sie wischte einen Spritzer vom Rahmen des Druckes Zwei abgeschnittene Sonnenblumen. Casey hätte nicht viel Geduld mit einem schreienden Baby gehabt. Aber nicht einmal ein Neugeborenes mit Koliken hätte der Grund sein können, warum er Brooke und ihre Tochter Estelle verlassen hatte. Casey war oft egoistisch gewesen, aber niemals grausam. Irgendetwas war ihm zu viel geworden. Irgendetwas hatte eine manisch-depressive Phase ausgelöst. Vielleicht war Brooke ja tatsächlich übergriffig geworden, wie er behauptet hatte. Von einem Menschen, dem Wren nie begegnet war – und vermutlich auch nie begegnen würde –, konnte sie viel eher das Schlimmste annehmen als von dem allerersten Freund, den sie gefunden hatte, nachdem sie mit elf Jahren von Australien nach Amerika gezogen war. Von dem besten Freund, der für sie wie ein Bruder gewesen war.
Nur dass ein bester Freund ihr nicht verschwiegen hätte, dass er Vater geworden war.
Ein Anflug von Zorn überrollte sie.
Verraten. Dieses Wort beschrieb am besten, wie sie sich fühlte, selbst nach so vielen Monaten. Im Mai, als sie neben Kit im Garten des New Hope-Zentrums gekniet hatte, um den Brief, in dem sie Casey ausdrücklich ihre Vergebung zusprach, zu begraben und die Samen, die sie bei seinem Begräbnis von den Sonnenblumen gepflückt hatte, in die Erde zu setzen, hatte sie noch gedacht, dass sie doch bestimmt auch in der Lage sein würde, ihren Zorn und ihre Verwirrung zu begraben. Wie naiv sie gewesen war!
„Vergebung ist ein Prozess“, erklärte Dawn ihr immer wieder. Wie Trauer. Und dass sie inzwischen Zorn und Trauer empfinden konnte, ohne davon völlig verschlungen zu werden, war ein Hinweis darauf, dass sie Fortschritte machte.
Aber wenn sie wüsste, was genau sie ihm vergeben musste, wenn sie nur Bescheid wüsste, was er getan hatte und warum, dann könnte sie ihn vielleicht wirklich loslassen.
Mit Lappen und Sprühflasche in der Hand öffnete sie die Tür zu ihrem Atelier und ging ans Fenster, das auf den Garten hinaussah. Sie hoffte, dass die Sonnenblumen bis zu Kits Abschiedsfeier voll aufgeblüht sein würden. Das könnte sogar gelingen.
Sie nahm die Kopfhörer aus ihren Ohren und lauschte dem Gesang eines Kardinalsvogels, der auf der Rosenlaube saß. Vielleicht könnte sie zwei Versionen malen, eine von dem Vogel mit der kahlen Stelle und einen, bei dem alle Federn wieder nachgewachsen waren. Abstoßung und Erneuerung. Verlust und Hoffnung. Eigentlich …
Sie dachte an Vincent und sein Vorhaben, Augustine seine Sonnenblumengemälde an die Seite zu stellen: ein Triptychon – eine ganz normale Heilige zwischen den leuchtenden Blumen, ein krasser Gegensatz. Und alle drei Bilder strahlten etwas aus vom Glanz Gottes.
Sie könnte ein Triptychon von Kardinalsvögeln malen. Das Leben vor der Mauser, das Leben während der Mauser, das Leben nach der Mauser. Der Kardinal nach dem Verlust wäre nicht mehr derselbe wie der davor. Wie auch? Ein solcher Kampf hinterließ Spuren. Selbst falls neue Federn nachwuchsen.
Selbst wenn, ermahnte sie sich. Sie musste es weiter üben, die Hoffnung in den Dingen zu sehen. Die unsichtbaren Dinge nicht aus dem Blick zu verlieren.
„Ach hier bist du!“, rief Kit von der Tür aus.
Erschrocken fuhr Wren herum. „Ja, ich bin hier.“
Kit deutete auf die Sprühflasche. „Vielleicht könntest du dein Atelier später sauber machen. Vor dem Seminar morgen ist noch einiges zu tun.“
Wren errötete. „Ich weiß. Ich hatte auch nicht vor, hier zu putzen. Ich wollte nur mal kurz in den Garten schauen.“
„Ah, gut. Mir ist aufgefallen, dass die Mülleimer noch voll sind, darum ...“
„Ich weiß. Ich werde sie ausleeren.“ Wie ich es immer mache, fügte sie im Stillen hinzu.
„Danke, Wren.“
Wren wartete, bis Kits Schritte im Flur verklungen waren, bevor sie sich wieder dem Abstauben von Vincents Bildern zuwandte.
B
Das muss für heute genügen, ermahnte sich Kit später am Nachmittag. Sie speicherte das Dokument für das Seminar auf dem Computer ab. Ihr Blick wanderte zur aufgeschlagenen Bibel auf ihrem Schreibtisch.
In den vergangenen Tagen hatte sie Gott gebeten, er möge ihr doch gute letzte Worte für die Menschen schenken, die an ihrem letzten Kurs in New Hope teilnehmen würden. Das Thema der Haushalterschaft war ihr in den Sinn gekommen: gut umgehen mit Liebe, mit Schmerz, mit Gnade. So, wie du geliebt wirst, liebe. Wie du getröstet wirst, tröste. Wie dir vergeben wird, vergib. Das sollten die Themen für die nächsten drei Samstagvormittage sein. Es sei denn, Gott zeigte ihr etwas anderes, wofür sie natürlich immer offen wäre.
Liebe ist geduldig, las sie im ersten Korintherbrief, Kapitel 13. Liebe ist freundlich. Sie ist nicht neidisch oder überheblich, stolz oder anstößig. Sie ist nicht selbstsüchtig. Über jede Eigenschaft, die Paulus hier nannte, konnte man ein Leben lang nachdenken. Während der Pausen zur persönlichen Reflexion würde sie die Teilnehmer einladen, über jedes einzelne Wort zu meditieren und zu überlegen, wie Gott gerade ihn oder sie auf diese Weise geliebt hatte. Das könnte ihnen allen helfen, eine Grundhaltung einzuüben, diese Art der großzügigen Liebe von Gott zu empfangen. Anschließend sollten sie darüber nachdenken, wie sie diesen Aspekt der Liebe an andere weitergeben könnten, ganz besonders an Menschen, die ungeduldig und unfreundlich, neidisch und prahlerisch, arrogant und unverschämt, selbstsüchtig, leicht reizbar und missgünstig waren.
Langsam massierte sie ihre Schläfen. Langmütig. Das war die Bedeutung des griechischen Wortes, das Paulus für „geduldig“ verwendete, das Gegenteil von unbeherrschten Zornausbrüchen und ungebändigter Leidenschaft. Langmut und Beharrlichkeit reichten weit, über eine lange Zeit und über eine lange Strecke hinweg. Sie würde besonders herausstellen, dass diese Beharrlichkeit in der Liebe, die wir anderen entgegenbringen, eine Gabe des Geistes war, mit der man beschenkt wird, wenn man in der überreichen Liebe Gottes bleibt. Sie würde daran erinnern, dass Jesus gesagt hat: „Ich habe euch genauso geliebt, wie der Vater mich geliebt hat. Bleibt in meiner Liebe!“ Diese Art der göttlichen Liebe annehmen und genießen zu können, das musste man üben. Und man musste sich Zeit geben.
„Ich gehe jetzt nach Hause, Katherine“, rief Gayle von der Tür aus. „Es sei denn, du hast noch etwas für mich zu tun.“
Katherine schaute von ihrer Bibel hoch und ging im Geist noch einmal die Aufgabenliste durch. „Die Gebetshandzettel sind gedruckt? Die Teilnehmerliste ist vollständig?“
„Liegt alles auf meinem Schreibtisch.“
„Wunderbar, Gayle. Vielen Dank.“ Sie würde jetzt auch für heute Schluss machen.
Nachdem Gayle gegangen war, machte sie sich auf die Suche nach Wren, deren Putzwagen vor der Damentoilette stand. Sie wollte sie nicht erschrecken, darum rief sie bereits im Flur ihren Namen.
Wren tauchte im Türrahmen auf. Ihre Hände steckten in gelben Gummihandschuhen. „Du gehst nach Hause?“
„Ja. Auf dem Heimweg kaufe ich noch kurz ein paar Sachen für das Abendessen ein. Ich mache was Schnelles. Hast du noch viel zu tun?“
„Ein wenig. Wie spät ist es?“
„Kurz nach vier.“
„Ist gut“, erwiderte Wren. „Wir sehen uns dann zu Hause.“
Kits Tasche lag noch in ihrem Büro. Auf dem Weg dorthin blieb sie vor Vincents Sämann stehen. Vielleicht sollte sie sich noch einen Augenblick Zeit nehmen und so beten, wie es in den letzten Monaten so wichtig für sie geworden war.
Mit gefalteten Händen wanderte ihr Blick über das Gemälde, bis er an der großen geöffneten Hand des Mannes hängen blieb. Er verteilte die Samenkörner aus seinem Beutel, jede Menge Samenkörner.
Sie beugte sich vor und schaute genauer hin.