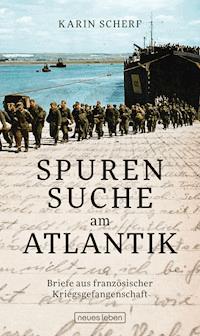
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Neues Leben
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
»MAN FRAGT NICHT: WARST DU NAZI? ICH BIN DEUTSCHER, DAS IST VERBRECHEN GENUG.« Das schreibt der Kriegsgefangene Wolfram Knöchel am 15. September 1946. In Frankreich räumen er und seinesgleichen die Minen, die ihre »Kameraden« am Atlantik einst vergruben. Er überlebt das Himmelfahrtskommando. Auch seine Korrespondenz mit den Eltern in Halle bleibt erhalten. Erst nach seinem Tod entdeckt die Tochter die etwa 150 Briefe. Es sind nicht nur historisch bedeutsame Dokumente, sondern auch berührende persönliche Mitteilungen eines jungen Mannes, der Krieg, Gefangenschaft und Gegenwart selbstkritisch reflektiert. Und später, wieder daheim, nie mehr darüber spricht. Karin Scherf begibt sich auf Spurensuche, reist nach Frankreich. Und registriert erstaunt: Deutsche Kriegsgefangene in Lagern der Westalliierten waren auch dort nie Thema. Erst jetzt beginnt man mit der Aufarbeitung eines umstrittenen Nachkriegskapitels. Jedoch: Es gibt kaum Unterlagen. Knöchels Briefe gehören zu den wenigen authentischen Zeugnissen, die der Wissenschaft zur Verfügung stehen. Dank dieses Buches können nun die Geschichtsforschung und eine breitere Öffentlichkeit davon Kenntnis nehmen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 234
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Bildnachweis: Privatarchiv der Autorin
ISBN eBook 978-3-355-50030-2
ISBN Print 978-3-355-01843-2
© 2016 Verlag Neues Leben, BerlinUmschlaggestaltung: Buchgut, Berlin,unter Verwendung eines Motivs von ullstein bild
Die Bücher des Verlags Neues Lebenerscheinen in der Eulenspiegel Verlagsgruppe.
www.eulenspiegel.com
KARIN SCHERF
SPURENSUCHEamATLANTIK
Briefe aus französischerKriegsgefangenschaft
Inhalt
Vorwort
Die Entdeckung
»War vom 20. März bis 27. Juli 1945 amerikanischer Kriegsgefangener«
»Bin jetzt zu Aufräumungsarbeiten am Atlantik eingesetzt«
Mai 2015: Recherche am Atlantik
In St.-Vivien-sur-Mer bei der blühenden Dattelpalme
Tränen in Bordeaux
Die Pulverfabrik des Sonnenkönigs in St.-Médard
»Das persönliche Elend macht blind, egoistisch und ungerecht«
Vaters Kriegstrauma: ein medizinischer Exkurs in Halle
»Allein in Pin Sec haben wir 50 000 Minen gehoben«
Auf der Suche nach Yvonne
Weihnachten 2015
Vorwort
Von Dr. Arlette Capdepuy, Universität Bourdeaux
Im Mai 2015 bekam ich Besuch aus Halle in Ostdeutschland. Die Journalistin Karin Scherf hatte Briefe ihres verstorbenen Vaters Wolfram Knöchel gefunden, die dieser zwischen 1944 und 1948 an seine Eltern schrieb. Der Krieg hatte ihn mit 18 Jahren vom Gymnasium geholt, er musste in der Wehrmacht dienen. Im Mai 1945 geriet er in amerikanische Gefangenschaft und wurde, wie Zehntausende andere Soldaten, auf den Rheinwiesen interniert. Von dort wurde er nach Frankreich überstellt, um dort bei der Beseitigung der deutschen Hinterlassenschaften und beim Wiederaufbau eingesetzt zu werden.
Allerdings hatte Knöchel im Krieg eine schwere Verletzung davongetragen. Ein Panzer hatte sein Schützenloch überrollt, und es grenzte an ein Wunder, dass er lebend aus diesem Grab kam. In Le Mans wurde er in einem französischen Lazarett gepflegt, und als er genesen war, meldete er sich zum Minenräumen an der Atlantikküste. Vermutlich war die Aussicht auf eine bessere Verpflegung und eine frühere Entlassung aus der Kriegsgefangenschaft nicht ganz schuldlos an seiner Entscheidung. Wolfram Knöchel kam an die Küste, an den von den Besatzern errichteten Atlantikwall zwischen Le Verdon und Arcachon, um dort deutsche Minen zu beseitigen.
Seine Stationen ab Herbst 1945 lauteten: La Roche-sur-Yon, Soulac-sur-mer und St.-Vivien. Vom 3. Juli 1946 bis zum 28. Juli 1947 war er im Hauptlager von Saint-Médard-en-Jalles stationiert. Und von Juni 1946 bis zu seiner Entlassung im Juli 1947 arbeitete und lebte er im Lager von Soulac – »Le Pin Sec«.
Aus Knöchels ersten Briefen ist erkennbar, dass der junge Mann sich als Opfer sah: eingepfercht hinter Stacheldraht, von den Franzosen als »le boche« verhöhnt, als »Nazi« beschimpft. Dabei war er lediglich als unschuldiger Oberschüler zur Wehrmacht eingezogen worden. Ohne eigenes Zutun, ohne Begeisterung, wehrpflichtig eben. Sein Kriegseinsatz war zu kurz, um schuldig zu werden.
In seinen ersten kurzen Briefen wurde zumeist die eigene missliche Lage erwähnt und auf Bemerkungen der Eltern reagiert (und da deren Briefe nicht vorliegen, wirken seine Reaktionen sprunghaft). Im Laufe der Zeit jedoch wurden die Briefe tiefgründiger. Wolfram Knöchel dachte über Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft nach. Er wollte das Abitur nachholen und studieren. Er beschaffte sich Schulbücher, las Zeitungen, schrieb. Als Kriegsgefangener durfte er jede Woche eine Seite schreiben. Und das tat er. Schreiben zwingt zur Konzentration und zum Nachdenken. Er reflektierte seine Lage, seine Berichte gingen nunmehr weit über die Beschreibung seiner Lebensumstände hinaus. Krieg und Nachkrieg hatten den Anfang 20-Jährigen rasch reifen lassen. Er dachte über die Folgen des Krieges für Deutschland nach, sah die sich anbahnenden Konflikte zwischen den Sieger- und nunmehrigen Besatzungsmächten. Manchmal schien er der Verzweiflung nahe. Einmal legte er sogar Hand an sich. Er konnte gerettet werden.
Wolfram Knöchel blieb knapp drei Jahre in Kriegsgefangenschaft, ehe er nach Deutschland zurückkehren durfte. Ein hoher Preis für wenige Monate Soldatsein.
Ich forschte in den Archiven über das Kriegsgefangenlager Saint-Médard, als mir Dr. Karin Scherf die Briefe ihres Vaters zeigte. Schon ein flüchtiger Blick verriet mir, dass es sich dabei nicht nur um Zeitzeugnisse von großem ideellen Wert handelte, sondern auch um außergewöhnliche, für die Wissenschaft bedeutende Dokumente. Aufgrund meiner Forschungen wusste ich, dass die Kriegsgefangenlager seit geraumer Zeit zwar ein sehr dynamisches und vielfältiges Forschungsgebiet geworden waren, aber es gab kaum Unterlagen von und über Kriegsgefangene in den zugänglichen Archiven. In Bordeaux beispielsweise existiert fast nichts aus jener Zeit.
Gemeinsam mit Karin Scherf suchte ich in Bordeaux die Archives départementales de la Gironde auf, wo die Dokumente gescannt und elektronisch archiviert wurden. Die Briefe des »Prisonnier de guerre Wolfram Knochel« erhielten die Achivnummer 1 NUM 142. Nunmehr sind sie der Wissenschaft allgemein zugänglich.
Aus Knöchels Briefen erfahren wir viel über die Arbeits- und Lebensbedingungen deutscher Kriegsgefangener in Frankreich. Sie geben nicht nur Auskunft, was das für Menschen waren, wie sie dachten und handelten, sondern auch, wie sie behandelt wurden.
Was für ein bitterer Sieg – was für eine überwältigende Niederlage, möchte man ausrufen. Der Kriegsgefangene Knöchel schreit sein Leid heraus: Er ist ein Mensch …
Wolfram Knöchel
Geboren am 7. Mai 1926 in Halle/Saale
Gestorben am 9. September 2008 in Torgau
Die Eltern:
Erich Knöchel, Angestellter in den Leuna-Werken
Martha Knöchel, Hausfrau
1932–1936
Volksschule (Lutherschule in Halle/Saale)
1936–1943
Oberschule der Franckeschen Stiftungen zu Halle (Latina)
1943–1944
Luftwaffenhelfer, Flakgruppe Halle-Leuna
1944–1945
Inf. Rgt. 305, Gefreiter
März 1945
Beginn der Kriegsgefangenschaft
ab 1948
Krankenpfleger, Laborarbeiter in den Leuna-Werken, Chemiestudium (abgebrochen aus gesundheitlichen Gründen), Lehrer an der Volkshochschule, Fachschullehrer-Ausbildung, Diplomstudium Philosophie
ab 1959
wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Erwachsenenbildung an der Universität Leipzig
1965
Promotion zum Dr. päd.
1968
Habilitation
ab 1970
Professor für Erwachsenenpädagogik (Universität Leipzig, Universität Rostock)
Die Entdeckung
Ein Schuhkarton ohne Deckel. Im dunklen Winkel eines Bücherregals finden ihn Ende 2014 meine tastenden Finger, die auf der Suche sind nach … Ja, wonach eigentlich? »VEB Schuhfabrik Eppendorf (Sachs.)«, steht auf dem vergilbten Etikett, daneben verweist der Umriss eines flachen Schuhes auf »Damen Schnürslipper Box Kalb Transparent gekl. Grau-Beige, EVP: MDN 40,20«. Statt der Schuhe liegen Briefe im Karton, gebündelt und verschnürt mit gelbem Seidenband, das die Jahre zerknüllt haben.
Den Karton hat man mir nach dem Tod meines Vaters vor sechs Jahren gegeben, zusammen mit alten Dokumenten und Urkunden. Das war geblieben. Er nicht. Ich hatte damals alles in das Bücherregal geräumt. Nichts gelesen. Sechs Jahre lang.
Nun drängt es sich also mit aller Macht wieder nach vorn in die Erinnerung.
Diese Briefe habe ich noch nie gesehen, uralt sind sie, das bräunliche hauchdünne Papier raschelt kaum noch, als ich die komplizierte Faltung öffne. Ein Blick auf das Datum: 1944 – also genau vor 70 Jahren, da war der Vater gerade 18 Jahre alt und eigentlich Abiturient in der Oberprima an den Franckeschen Stiftungen zu Halle. Bereits ein Jahr zuvor hatte eine ganz andere Karriere begonnen – die des Flakhelfers, die amtlich als Luftwaffenhelfer bezeichneten Oberschüler der Jahrgänge 1926 bis 1928. In nur einem Jahr wurde Schule zur Ausnahme. Achtzehn Stunden Unterricht pro Woche waren eigentlich vorgeschrieben, doch Krieg und Schule waren kaum in Einklang zu bringen.
Aus dem Kindersoldaten Wolfram war, als er diesen Brief schrieb, bereits der Wehrmachtgefreite Knöchel geworden, der noch gläubig folgt, doch auch schon zweifelt. Das finde ich in einem seiner Briefe bestätigt, in dem er 1947 schreibt, dass er damals (d.h. bei der Abkommandierung an die Westfront) nur das Allernotwendigste mitnehmen durfte und dass dabei auch »mein Tagebuch mit verloren gegangen ist, und als wir damals hörten, dass unser Tross z. T. verbannt sei; dass man aber einiges gerettet habe und es nach Sichtung verteilen werde, kriegte ich einen Schreck – in dem Buch stand so mancherlei, was damals für den Schreiber noch höchst gefährlich war …« 1948, kurz nach seiner Rückkehr aus französischer Kriegsgefangenschaft, musste er gleich mehrmals seinen Weg vom Abiturienten zum Wehrmachtsoldaten und Kriegsgefangenen in Lebensläufen belegen. Dabei erwähnt der Vater, dass während seiner Zeit als Luftwaffenhelfer gegen ihn ein militärgerichtliches Verfahren wegen Abhörens von »Feindsendern« eingeleitet wurde, was dann wegen fehlender Beweise niedergeschlagen wurde. Doch das Misstrauen blieb, nach dem Attentat auf Hitler vom 20. Juli 1944 wurde er sogar einige Tage verhaftet und verhört. Ein Misstrauen, das umso lächerlicher wirkt, liest man die folgenden Zeilen voller jugendlicher Naivität und immer noch ganz im Sinne nationalsozialistischer Erziehung.
Zeithain, 9. Dezember 1944
Liebe Eltern!
[…] Wie ich Euch ja schon schrieb, beschäftigen wir uns hier mit ganz ernsten Problemen. Mehrere von uns (natürlich nur die dazu fähigen Männer) halten wöchentlich Vorträge, die dann nachher von einem kleineren Kreis diskutiert werden. Solche Themen sind »Deutschland lebt in seinen Kindern«, »Der Kampf als Lebensgesetz«, »Nietzsche«, »Faust« usw. Bloß gut, dass ich mich früher schon damit beschäftigt habe, so bin ich heute wohl der, der am meisten mit dem Uffz. Friedrich diskutiert.
Was Euch noch mehr interessieren wird: In Hinblick auf das nahe Weihnachtsfest wird die Art einer Feier erörtert. Ich musste mit Erstaunen und auch mit Freude feststellen, dass die überwiegende Mehrzahl für ein christliches Fest mit den alten Liedern usw. war, während nur Einzelne für ein Julfest waren.
Es ist das Gute dieser schweren Zeit, dass gerade der raue und harte Soldat in der Gefahr zu Gott betet und mal an den Glauben seiner Kindheit erinnert wird. Auf die Dauer kann sich eben ein glaubensloser Mensch nicht halten: Er braucht ein Seil, an dem er sich immer wieder emporzieht.
[…]
Ich bitte Euch nur, bei einem etwaigen Angriff Euch nicht unnötig in Gefahr zu begeben, denn was habe ich von einigen geretteten Sachen, wenn mir das Liebste, was ich habe, verloren gegangen ist.
[…]
Wir geben uns hier alle Mühe, unsre Stube etwas vorweihnachtlich auszuschmücken. Aber überall sieht das Militär hervor. Tannenzweige stecken in leeren Hülsen, die Kerzen werden bei Alarm angebrannt. […] Wenn man an die schönen Zeiten denkt, an den strahlenden Baum in der Ecke, man muss ja Heimweh kriegen, oder vielmehr Sehnsucht, die durch eine schwarze Wolke verdunkelt wird, die Terror heißt. Ich drängle mich gewiss nicht zur Front, aber erfülle meine Pflicht wie jeder andere, eine Pflicht, die darin besteht, Euch von den Schrecken des Krieges zu befreien, unsere Heimat vor weiteren Verwüstungen zu schützen und uns selbst endlich eine zielbewusste Berufsausbildung zu ermöglichen. Ich kann das mit ruhigem Gewissen sagen, da ich keine Ideale in Hinsicht auf den Krieg mehr habe und da ich schon eine gewisse, wenn auch geringe Ahnung habe.
[…]
Wenn aber die Mutti sich begreifliche Sorgen macht, so sage ich nur »Unkraut verdirbt nicht« oder »Gute Ware hält sich«. Nun sucht Euch das Beste aus! Nun seid vielmals gegrüßt und Kopf hoch!, wenn’s auch mal kracht, denn für uns sorgt einer, der die Macht dazu in den Händen hat.
Viele Küsse
Euer Wolfram
Traditionelle Weihnachtsgebräuche als Zeichen aufkeimenden Ungehorsams gegen das verordnete pseudonordische Julfest der Nazis, die ideologische Saat der »Blut-und-Boden«-Romantik keimt noch in den jungen Köpfen, doch dazwischen regt sich schon das Unkraut des eigenen Denkens. Drei Monate später erlebt der noch 18-Jährige den Schrecken der Westfront, das letzte Aufgebot, er wird vom Panzer überrollt, verschüttet das Loch, in dem er Schutz sucht. Er überlebt, kommt in Gefangenschaft. Die berüchtigten Rheinwiesen – 1 300 000 deutsche Soldaten und Flüchtlinge sollen es gewesen sein, die auf der linken Rheinseite monatelang unter freiem Himmel vegetieren mussten. Er überlebt. Ist einer von Tausenden Kriegsgefangenen, die sich die Franzosen zum Wiederaufbau ihres Landes von den Amerikanern einfordern. Im Südwesten Frankreichs wird er Démineur, entschärft am ehemaligen Atlantikwall die tödlichen Hinterlassenschaften der deutschen Wehrmacht, des Krieges. Bis 1948. Überlebt auch das und schreibt davon in seinen Briefen. Und von seinem Hunger nach Leben.
Ratlos sitze ich vor dem Schuhkarton.
Was soll ich mit dem Stapel dieser in kleine Kuverts gefalteten Weltgeschichte anfangen? Jetzt?
Der Verfasser der Briefe ist nicht mehr da, hat fast nie über diese Zeiten gesprochen, ich kenne nur winzige Fetzen seiner Erinnerungen, Streiflichter, manchmal auftauchend am Rande einer Belanglosigkeit, die das Erinnern wohl initiierte. Es waren kaum Geschichten, und sie gingen auch selten gut aus. Oft besann sich der Vater dann schnell und wandte sich wieder der gegenwärtigen Belanglosigkeit zu, ganz so, als bereute er, dass die Erinnerungen seine Lippen verlassen hatten.
Das kollektive Schweigen einer Generation von deutschen Männern.
Wenn es doch einmal gebrochen wurde, verzog der Vater nur verächtlich das Gesicht …
Guéret, 9. November 1947
[…]
Ich will mich aber nicht etwa beschweren, sondern nur erklären, wieso ich in der letzten Zeit nichtssagende Briefe schreibe. Ich habe aber weder die Zeit, groß Briefe zu schreiben, noch die Langeweile, um mir mehr Gedanken machen zu können. Es ist vielleicht gut so, man kommt so besser über diese Zeit hinweg. […]
Von wegen »Memoiren«, nee, meine Erinnerung genügt mir. Zudem will ich nicht auch noch was zum Völkerhass beitragen (das würde aber in diesem Falle so sein). Übrigens, wer wirklich mal ganz schlechte Zeiten hinter sich gebracht hat, spricht davon nur ganz selten. Die am meisten schreien, haben bestimmt nichts mitgemacht […]
Was hat der Vater erlebt, was entzieht sich der Vorstellungskraft der Nachgeborenen, denen eigenes Erleben aus jener Zeit fehlt? Was hat ihn verstummen lassen, später, als die Wunden geheilt waren? Oder waren sie nie geheilt?
Die Orte, an denen die Briefe geschrieben wurden, klingen melodiös beim Buchstabieren: Saint-Médard-en-Jalles, Guéret, La Roche-sur-Yon, Soulac-sur-mer, St.-Vivien … Die Namen reihen sich aneinander wie die Worte in einem französischen Chanson, man versteht sie kaum, doch es klingt so hübsch: Le Pin Sec – die trockene Pinie. So könnte vielleicht ein altes Gasthaus heißen, eins mit schmalen grauen Fensterläden und einer Holzterrasse, auf der herbeigewehter Dünensand kleine Wellen bildet.
Die Fotos im Internet verraten mir, dass mein in die Jahre gekommenes Gasthaus in Wirklichkeit ein riesiger Campingplatz direkt am Atlantik ist, gesichtslose Feriensiedlungen, Reihen heruntergekommener »Mobilheime«. Die Enttäuschung macht meinen Entschluss endgültig – ich will zu den Orten reisen, will selbst sehen, wo der Vater seine Briefe schrieb: hinter Stacheldraht, im Sand, unweit des Atlantik. Will Jahrzehnte später erfahren, wo sich Wolfram Knöchel wegschrieb von dieser Wirklichkeit. Das waren über 32 Monate Gefängnis. Ich lese die Empörung über diese Freiheitsberaubung. Er besaß ein ausgeprägtes Gerechtigkeitsgefühl und musste machtlos akzeptieren, dass es Gerechtigkeit nicht gab. Nicht für ihn.
Dann wieder Verantwortung: Wir machen hier sauber, heißt es, und vorher können wir schwerlich nach Hause. Schuldgefühle, uneingestanden zwar, spielen mit hinein.
Ich bin nie sicher, was tatsächlich Wirklichkeit war. Ich kenne nur seine Erzählungen, ich lese diese Briefe, kenne seine Wahrheit. Und sein Bemühen, das Furchtbare erträglich zu machen – für sich und die Eltern damals, und später in Lebensläufen, in denen das Jämmerliche in Stärke gewendet wurde. Eine Übung, die Millionen praktizierten, erst um zu überleben und dann um hineinzupassen ins neue System. Die Lebensläufe im Wandel der Zeiten – jene Stacheldrahtzeit darin wurde bei ihm immer kürzer, immer bedeutungsloser. Wurde sie es wirklich?
Damals konnte er noch nicht wissen, dass es einmal ein Bleistiftkreuz in der Kaderakte geben würde aufgrund dieser Gefangenschaft. Aus DDR-Sicht saß er auf der falschen Seite ein, Knöchel war beim Klassenfeind gewesen. Selbst Mitglieder des Politbüros trugen diesen Vermerk. Alliierte Gefangenschaft – davon erholte sich nicht jeder.
Der Vater sprach von dieser Signatur als Stigma erst sehr spät. 1990 hatte ich viele Fragen an ihn, heftige, vorwurfsvolle. Doch sie betrafen die Zeit nach dem Stacheldraht. Jene Jahre in Frankreich blieben unerklärt, obwohl vielleicht dort schon Antworten lagen. Wo das Schweigen begann, warum es begann. Heute treffe ich bei solchen Fragen oft auf verständiges Nicken, alles scheint klar. Ist doch zu verstehen, sie wollten damals nichts mehr davon hören, wollten vergessen, sagt man mir. Haben sie wirklich vergessen, oder war es einfach nur besser so für alle? Oder fragten wir nicht, da wir nichts wissen wollten, weil so die Welt geordnet blieb? Gut und Böse hatten ihren Platz, Schuld war geklärt – wir im Osten lebten auf der richtigen Seite.
Hinter dem französischen Stacheldraht war der Vater nicht auf der richtigen Seite. Im Leben danach wollte er das dann auch nicht mehr sein. Oder vielleicht doch, sogar viel zu sehr? In seinen seltenen Erzählungen erschien die Zeit dort niemals als heldisch, und manchmal tauchte auch normales Leben auf: Frauen, eine schwarze Hure, die ihm die Liebe beibrachte in einem Bordell in Bordeaux, wo der Gefangene Knöchel kellnern musste und die Böden schrubbte.
Als junges Mädchen roch ich das Abenteuer in diesen kleinen Geschichten, beneidete ihn gar. Er hatte die Welt gesehen, die mir verschlossen war. Ich wusste nicht, dass lediglich die Niedrigsten der Niedrigen Erlebnisse teilten – er der Prisonnier de guerre, sie die farbige Hure.
Der Vater erzählte mir von Yvonne, seiner ersten Liebe, hinter Stacheldraht. In meiner Fantasie ist Yvonne hinreißend schön. Ihr kupferfarbenes Haar umrahmt in großen Wellen das Gesicht. Porzellanhaut. Ihr Vater hatte eine Apotheke, der Bruder war gefallen. Alles ist gut. Dann wird das Lager verlegt, niemand weiß etwas. Yvonne versucht sich aus Kummer das Leben zu nehmen.
Zehn Jahre später werde ich geboren und erhalte ihren Namen als zweiten Vornamen: Karin Yvonne.
Doch nichts von Yvonne findet sich in den Briefen. So etwas schrieb der Sohn nicht seinen Eltern. Und so vieles andere auch nicht.
Also werde ich nach Antworten suchen – in Frankreich.
Ich finde Verbündete diesseits und jenseits der Grenze. Ich lerne einen Feuerwerker kennen, der mir die tödlichen Gefahren des Minenräumens erklärt, treffe mich mit einem Psychiater und mit Neurologen, die mir sagen können, was es aus medizinischer Sicht bedeutet, »verschüttet« und »vom Panzer überrollt« zu werden. Stoße auf eine französische Historikerin, die sich diesem schwierigen Kapitel in den Beziehungen zwischen Frankreich und Deutschland widmet. Lerne Franzosen kennen, die mir spontan bei meiner Suche helfen wollen, ungeachtet des Umstandes, dass kaum noch Zeitgenossen meines Vaters leben, die Auskunft geben könnten. Ich mache die Bekanntschaft mit dem deutschen Stammtisch in Aquitainen, 250 Mitglieder zählt er, jüngere und ältere. Einige schreiben mir später, dass sie meine Nachforschungen gut finden, andere bieten Hilfe an. Niemand von ihnen fragt mich, was daran denn interessant sein soll – Jahrzehnte danach.
Das werde ich nur in Deutschland gefragt. Etwa von »s. V.« – schmallippigen Verhinderern, wie ich sie im Laufe meiner Recherchen verächtlich nennen werde. Fast will ich schon vor dieser Ignoranz kapitulieren. »Es ist alles darüber gesagt, man weiß schließlich alles über diese Zeiten«, lässt mich ein Hörfunk-Redakteur wissen. Seine überhebliche Absage ist so repräsentativ, wie seine Annahme falsch ist. Aufgrund meiner eigenen Nachforschungen kann ich seine Behauptung widerlegen.
Bei meinen Literaturrecherchen und später auch vor Ort in Frankreich erfahre ich, dass das Thema »Deutsche Kriegsgefangene in Frankreich nach dem Zweiten Weltkrieg« in der Öffentlichkeit nie eine Rolle spielte. Auch wissenschaftlich ist das Thema bisher so ziemlich unbearbeitet. Erst in jüngster Zeit haben französische Historiker damit begonnen, die Politik gegenüber den deutschen Kriegsgefangenen kritisch zu untersuchen.
Die Ursachen, warum dies erst so spät geschieht, sind vielfältig. Ein wesentlicher Grund besteht darin, dass es so gut wie keine Dokumente in den öffentlichen Archiven der Kommunen oder Départements über die deutschen Kriegsgefangenen gibt. Das vermutlich Wenige, was existiert, wird in den Militärarchiven sicher verwahrt und ist kaum erreichbar. Als amtliches französisches Material liegt lediglich die Historique du Service des Prisonniers de Guerre de l’Axe (1943–1948) vor. Die Untersuchung wurde Ende 1948 von der Direction Générale des Prisonniers de Guerre de l’Axe beim französischen Verteidigungsministerium erstellt. Die Arbeit besorgten Militärangehörige, sie wurden von Général de Corps d’Armée Buisson angeleitet.
Generalleutnant Buisson wertete Verwaltungsunterlagen und statistische Erhebungen aus, die den Geist jener für alle Seiten schweren Nachkriegszeit atmeten. Die deutschen Kriegsgefangenen standen stellvertretend und verantwortlich für die deutschen Besatzer, die Zehntausende Franzosen als Arbeitssklaven deportiert und das Land zerstört hatten. Und so behandelte man sie auch. Auf der anderen Seite brauchte Frankreich jede Hand beim Wiederaufbau. Da waren die ehemaligen Wehrmachtsoldaten ein Wirtschaftsfaktor.
Unter diesen Umständen fanden kritische Stimmen, die auf Menschenrechte und Bestimmungen internationaler Abkommen verwiesen, kaum Gehör. Nicht nur Generalleutnant Buisson sah sich als Vertreter einer Gewahrsams- und Siegermacht, die auf der Basis der geltenden Gesetze nach bestem Wissen handelte und auch moralisch dazu berechtigt war. Die Genfer Konvention für Menschenrechte konnte, sollte es denn im Interesse Frankreichs sein, deshalb auch anders ausgelegt werden. Mit Bezug auf den international umstrittenen Einsatz deutscher Kriegsgefangener beim Minenräumen sei es, so Buisson, »auf jeden Fall wünschenswert, dass in einer neuen Konvention die Minenräumung durch Kriegsgefangene erlaubt werde«.
Mit dieser Initiative konnte sich Frankreich nicht durchsetzen. Artikel 52 des 3. Genfer Abkommens vom 12. August 1949 definierte, was in der Ursprungsfassung von 1929 noch offen geblieben war: »Kein Kriegsgefangener wird für ungesunde oder gefährliche Arbeiten verwendet, es sei denn, er melde sich freiwillig. Kein Kriegsgefangener wird zu Arbeiten herangezogen, die für ein Mitglied der Streitkräfte des Gewahrsamsstaates als erniedrigend angesehen würde. Das Entfernen von Minen oder ähnlichen Vorrichtungen gilt als gefährliche Arbeit.«
Insgesamt scheint es ein wesentliches Merkmal der Nachkriegsjahrzehnte gewesen zu sein, dass von der Mehrheit der Europäer das brisante und schwierige Problem »Kriegsgefangenschaft« gern und schnell ausgeblendet wurde. Frankreich machte da keine Ausnahme. Hinzu kam ein ausgeprägtes Desinteresse an politischen Themen. Darauf machte mich die französische Historikerin Danièle Voldman im Gespräch explizit aufmerksam. Die Mehrheit der Menschen in Europa wollte damals nur leben, den Frieden genießen und nicht mehr zurückschauen. Darum ließen sie die Vergangenheit ruhen.
Auch in (West-)Deutschland war es nicht anders. An die Verbrechen der Nazi-Diktatur nach innen wie außen wollte man nicht erinnert werden; Adenauers Ausruf im Deutschen Bundestag »Ich meine, wir sollten jetzt mit der Naziriecherei Schluss machen« wurde praktische Politik. Viele Protagonisten des Dritten Reiches konnten ihre Kariere fortsetzen. Wenn über Krieg und Kriegsgefangenschaft gesprochen wurde, dann allenfalls im Zusammenhang mit den im Osten verlorenen Territorien und den deutschen Soldaten, die in »russischen« Lagern litten. Denn: Die Bundesrepublik war Teil der westlichen Welt und damit Bundesgenosse im Kalten Krieg gegen die östliche Welt. Und dazu gehörte der Propaganda-Krieg, in welchem der alte Feind auch der neue war: »Der Russe« war an allem schuld.
Im Osten Deutschlands war es ähnlich. Dem Antisowjetismus der Nazis setzte man offiziell die verordnete Freundschaft mit den Befreiern entgegen, was, da überzogen und vom neuen »Großen Bruder« oft ungeschickt konterkariert, zumindest in den ersten Nachkriegsjahren für eine gewisse Ignoranz sorgte. Über die Kriegsheimkehrer aus dem Osten schwieg man wie über die aus dem Westen, und auch die Soldaten erzählten nichts. Entweder weil ihre Berichte sich nicht mit dem positiven Bild deckten, das offiziell über die Sowjetunion verbreitet wurde, oder weil die Scham zu groß war. Bekanntlich hatten die deutschen Kriegsgefangenen dort, wo sie interniert waren, zuvor als Soldaten großes Unheil angerichtet.
In Ost wie West gehörte es alsbald zur Staatsräson, über die Leichen, die man im Keller hatte, besser zu schweigen. Die Verbündeten hätte das Gegenteil wahrscheinlich zur berechtigten Vorhaltung provoziert: Wer im Glashaus sitze, solle besser nicht mit Steinen werfen! Schließlich hatten nicht Franzosen, Briten, Russen oder Amerikaner die Deutschen überfallen, sondern die Deutschen ihre Nachbarn. Die mehr als fünfzig Millionen Weltkriegstoten gingen darum ursächlich auf ihr Konto.
Im Frühjahr 1957 setzte die Bundesregierung eine Wissenschaftliche Kommission für die Dokumentation des Schicksals der deutschen Kriegsgefangenen des 2. Weltkriegs ein. Da die Federführung beim Bundesministerium für Vertriebene, Flüchtlinge und Kriegsgeschädigte lag, scheint die Vermutung nicht ganz abwegig, dass die damit verfolgten Absichten auch bestimmter politischer Natur waren. Zwar hatten beim Londoner Schuldenabkommen die Westmächte auf einen Teil ihrer Vor- und Nachkriegsschulden verzichtet, aber die Sowjetunion, Polen, die Tschechoslowakei und andere Ostblockstaaten – die ebenfalls Anspruch auf Reparationen hatten – waren nicht geladen. Somit bestand unverändert die Gefahr, dass im Falle von Friedensverhandlungen mit Deutschland die okkupierten und ausgeplünderten Staaten die Rechnung aufmachen könnten. Diese hoffte Bonn offenkundig mit einer Gegenrechnung zu unterlaufen, indem nämlich Leid und Leistungen deutscher Kriegsgefangener in den Internierungsstaaten aufgelistet würden.
Mit der Leitung der Kommission wurde der Historiker Prof. Dr. Erich Maschke beauftragt, der selbst von 1945 bis 1953 in der Sowjetunion interniert gewesen war. Aber er saß dort nicht ein, weil er der SA und der NSDAP angehört hatte, sondern weil der studierte Mediziner, Historiker und Geograf ein aktiver Nazipropagandist und zudem wissenschaftlicher Berater des Amtes Rosenberg gewesen war, jener üblen Ideologie-Zentrale des deutschen Faschismus, die den Marsch gen Osten propagandistisch unterfüttert hatte.
Nach seiner Rückkehr aus der Kriegsgefangenschaft übernahm Maschke 1956 in Heidelberg den Lehrstuhl für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte. In dieser Eigenschaft (und mit dieser Vita!) erhielt er eben jenen Auftrag aus Bonn. Einer der Vordenker und akademischen Wegbereiter faschistischer Eroberungspolitik sollte also die Geschichte der deutschen Kriegsgefangenen wissenschaftlich aufarbeiten.
Was für eine Unverfrorenheit.
Dennoch muss man der von eben jenem Manne geleiteten Kommission konzedieren, seriöse wissenschaftliche Arbeit geleistet zu haben. Was auch von unabhängigen Historikern anerkannt wurde und zum großen Problem für die Kommission selbst und die Veröffentlichung ihrer Ergebnisse werden sollte. (Eine Folge zum Beispiel: Bei Wikipedia findet dieses mehrbändige Werk in der Biografie von Maschke keinerlei Erwähnung.)
Die Kommission sah sich einem sozialgeschichtlichen Ansatz verpflichtet und berücksichtigte »objektive« und »subjektive« Aspekte gleichermaßen. Als Quellen benutzte sie zum einen Aussagen und Aufzeichnungen ehemaliger Kriegsgefangener wie etwa Berichte, Tagebücher, Briefe und Kriegsgefangenenzeitungen, zum anderen Akten deutscher Dienststellen, Organisationen und Verbände sowie der westlichen Gewahrsamsmächte. Drittens wertete die Kommission Unterlagen des Internationalen Komitees des Roten Kreuzes (IKRK) und der Young Men’s Christian Association (YMCA) aus. Als humanitäre internationale Organisationen hatten sie Zugang zu den Kriegsgefangenenlagern.
Der »objektive« Bereich betraf alle quantifizierbaren Aspekte wie etwa die Zahl der Kriegsgefangenen, die Lagersystematik, die Verpflegungssätze und -mengen in den Gefangenenlagern, die Arbeitsleistungen und Ähnliches. Die »subjektiven« Aspekte bezogen sich auf das Erlebnis und die Erfahrung der Kriegsgefangenschaft, die man mit sozialpsychologischen Verfahren aufzuklären versuchte.
Aus der Erforschung der »subjektiven« Aspekte leitete die Kommission den Schluss ab, dass die Geschichte der deutschen Kriegsgefangenen keine »Geschichte des Handelns, sondern des Leidens« gewesen sei. Was durchaus im Sinne der Initiatoren dieses Forschungsauftrages war. Das jedoch kollidierte mit dem wissenschaftlichen Anspruch der Kommissionsmitglieder selbst. Um dem kritischen Vorhalt zu entgehen, man habe propagandistische Zuarbeit geleistet, versuchten die Kommissionsmitglieder, analoge Untersuchungen im Ausland anzuregen. Mit einer vergleichenden Forschung wollten sie der Gefahr einer einseitigen Darstellung entgegenwirken.
Ihre diesbezüglichen Kooperationsbemühungen liefen aber ins Leere, wofür es gewiss verschiedene Gründe gab. Lediglich in Frankreich fand das Werben ein Echo. Dort arbeitete eine Kommission zur Erforschung der Geschichte der französischen Kriegsgefangenen in deutschem Gewahrsam unter Leitung von Fernand Braudel. Sie kooperierte zeitweilig mit der Maschke-Kommission.
Die Forschungsarbeit der Kommission war Druck von verschiedenen Seiten ausgesetzt.
Da waren zum einen die ehemaligen deutschen Kriegsgefangenen, die sich und ihre Leidensgeschichten prominent widergespiegelt sehen wollten. Sie hatten einflussreiche Fürsprecher, der mächtigste war der Verband der Heimkehrer, Kriegsgefangenen und Vermisstenangehörigen Deutschlands e.V. (VdH) mit einer halben Million Mitglieder. Da waren zum anderen die Bundesregierung und ihren Ministerien, die die Erkenntnisse zeitgeschichtlicher Forschung ihren politischen Intentionen unterzuordnen versuchten. Auch das kollidierte mit den wissenschaftlichen Ansprüchen der Kommission.
Der VdH reklamierte für sich die Deutungshoheit über die Geschichte der deutschen Kriegsgefangenen – diese wüssten schließlich am besten, was dort geschehen sei. Die Kommission stellte aber den subjektiven Erlebnisberichten die Objektivität historischer Dokumente aus den Gewahrsamsländern und vor allem der neutralen Berichterstatter des Internationalen Komitees des Roten Kreuzes gegenüber. Eine in der vergleichenden Geschichtswissenschaft unverzichtbare Vorgehensweise, die jedoch politisch auf wenig Gegenliebe stieß. Und der Auftraggeber machte deutlich, dass er schließlich die Forschungsarbeit finanziere. Einen direkten Einfluss leitete das Ministerium daraus zwar nicht ab, jedenfalls nicht, was »Entscheidungen über die Methodik des Werkes und die Auswahl der Mitarbeiter« betraf. Aber man reklamierte ein Mitspracherecht bei den »politischen Aspekten des Dokumentationswerkes«. Die Bundesregierung behalte sich das Recht vor, »die Zweckmäßigkeit der Herausgabe einzelner Bände zu überprüfen« (Bundesarchiv-Militärarchiv BA-MA, B 205/1758, Hausmitteilung Mischnick an Kießling am 29. Juni 1962).
Als die Veröffentlichung der ersten Forschungsergebnisse zu Beginn der 60er Jahre bevorstand, intervenierte das Auswärtige Amt. Dort fürchtete man diplomatische Verwicklungen, die die Forschungsergebnisse hervorrufen könnten. In einem Schreiben des AA vom 14. September 1962 hieß es verklausuliert: »Es soll damit nicht gegen die Durchführung einer derartigen Dokumentation Stellung genommen werden, die nicht nur von historischem, sondern auch politischem Wert sein kann, wenn derartiges Material im Falle späterer Friedensverhandlungen bei der Erörterung etwaiger Reparationsansprüche bereitliegt. Im Falle Jugoslawien kann eine solche Dokumentation sogar geeignet sein, unangemessenen jugoslawischen Wiedergutmachungsansprüchen, wie sie erst kürzlich wieder erhoben worden sind, entgegengehalten zu werden oder sie abzuwehren.« Die Forschungsergebnisse sollten daher möglichst unter Verschluss gehalten und ausschließlich für den internen Gebrauch genutzt werden.
Die Wissenschaftliche Kommission bestand jedoch auf Veröffentlichung und Vertrieb im Buchhandel, wobei sie geschickt lavierte. Sie machte sich die Position der ehemaligen Kriegsgefangenen zu eigen, die »einen Anspruch auf die Veröffentlichung ihrer Geschichte« hätten. Erst eine Veröffentlichung würde »das Schicksal der Kriegsgefangenen wirklich zu einem Stück deutscher Geschichte machen«.





























