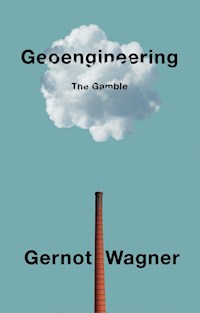Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Brandstätter Verlag
- Kategorie: Wissenschaft und neue Technologien
- Sprache: Deutsch
Wir haben die Wahl. In den Entscheidungen, wie wir wohnen, essen und reisen, wie wir unseren Alltag gestalten und welche Politik wir wählen, liegt der Schlüssel für eine zukunftstaugliche Welt. Dabei schließen sich wirtschaftliche Prinzipien und Umweltschutz aus? Klimafreundlich zu leben bedeutet Verzicht? Keineswegs! Gernot Wagner liefert anschauliche Beispiele aus seinem Leben und spricht über Fragen, die sich ihm und vielen von uns stellen. Der überraschende Befund: Ausgerechnet in den oft als naturfeindlich verschrienen Städten steckt die Lösung. Zwischen modernster Technologie und Fahrrad, Kreativität und Bodenständigkeit, Effizienz und Resilienz können wir ein neues Klimakapitel aufschlagen. Um gute Entscheidungen zu ermöglichen, braucht es aber mehr. Der renommierte Klimaökonom fordert ein Umdenken im großen Stil, um politische Weichen neu zu stellen, Anreize zu schaffen und Wirtschaftsströme umzulenken. Wissenschaftlich fundiert und leichtfüßig weist dieses Buch den Weg vom Klimaschmutz zu Klimaschutz.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 254
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Sammlungen
Ähnliche
Gernot Wagner
STADTLANDKLIMA
Warum wir nurmit einem urbanenLeben die Erde retten
Inhalt
Vor(w)ort
TEIL IWARUM
1Klima
2Natur
Von Stelzenhäusern und Passivhausluftschlössern, der wunderbaren Welt der Klimabuchhaltung und unserem Natursch(m)utz
TEIL IIWO
3Stadt
4Land
4½Suburbia
Ein Liebesbrief an die Stadt und einer an das Land, über das Wohnen im „Na ja, eigentlich“, kontraproduktive Klimapolitik und die Stadt als Idee, in der wir das wahre Klimapotenzial finden
TEIL IIIWAS
5Essen
6Wohnen
7Mobilität
Über lokales Essen und globales Denken, Quadratmeterfragen und Bumerang-Effekte, Abenteuerreisen, die Qual des Pendelns und Mobilität als Chance
TEIL IVWIE
8Moral
9Effizienz
10Resilienz
Der Fußabdruckrechner und die Erdöllobbys, Moral und CO2-Absolution und eine Einladung: Beginnen wir beim individuellen Handeln, sorgen wir aber für einen Systemwandel!
Vor Ort
Anmerkungen und Quellen
Vor(w)ort
Kaffee, Kuchen – und Quadratmeter
Als ich noch klein war, bekamen wir an Sonntagnachmittagen oft Besuch. Das ist bei einer großen Familie mit einem Dutzend Onkeln und Tanten nun einmal so. Sogar die Tante aus dem fernen Berlin und der Onkel aus München kamen zu uns nach Amstetten im Westen Niederösterreichs. Es kamen nie alle zusammen, und nicht alle gleich oft. Aber fast an jedem Wochenende saßen die Erwachsenen rund um den Tisch im Esszimmer oder jenen auf der Terrasse oder auch um den draußen im Garten. Sie aßen Muttis Kuchen, tranken Vatis Kaffee und unterhielten sich angeregt.
Damals, als Kind in den Achtzigerjahren, habe ich nicht weiter darüber nachgedacht, warum so viele der sonntäglichen Familien-Kaffeekränzchen bei uns zu Hause stattfanden. Waren wir selbst vielleicht so schlechte Hausgäste? Oder schmeckten Kaffee oder Kuchen bei uns einfach am besten? Erst Jahre später wurde es mir klar: Der Hauptgrund waren unsere 78 Quadratmeter Wohnfläche.
Diese 78 Quadratmeter waren groß genug, um den Besuch bequem zu Tisch zu bitten. Sie waren auch deutlich mehr als die 48 Quadratmeter in der Stadtwohnung, in der bis zu zehn meiner Onkel und Tanten gleichzeitig ihre Kindheit verbracht hatten. Es waren zwar nur 15 Minuten Fußweg von dieser Wohnung zu uns in die kleine Vorortsiedlung – doch die Größensteigerung war enorm.
Gleichzeitig waren die 78 Quadratmeter immer noch bescheiden genug, um nicht selbst zum dominierenden Gesprächsthema zu werden. Sie waren nicht das großzügige Haus in Hanglage, wo man sich sonntags vielleicht über die Größe des Swimmingpools unterhalten hätte. Sie waren auch nicht das noch weitläufigere Haus unten an der Donau, wo die „Jahrhundert“-Hochwasser inzwischen – bedingt durch den Klimawandel – alle paar Jahre kamen und das Erdgeschoss daher immer regelmäßiger renoviert werden musste: zwei Mal alleine in den zehn oder zwölf Jahren meiner Kindheit und Jugend, an die ich mich gut erinnern kann. Selbst abseits notwendiger Renovierungen ließ sich das große Haus als eigenes Gesprächsthema nicht vermeiden: Noch vor der Frage, ob man Kaffee oder lieber Tee wolle, kam die Frage, ob wir in der Wohnküche, im vorderen oder doch lieber im hinteren Wohnzimmer Platz nehmen sollten.
Unsere 78 Quadratmeter Wohnfläche waren vor allem eines: Durchschnitt. Guter Mittelklasse-Durchschnitt. Sie drängten sich nie direkt in den Vordergrund.
Diese 78 Quadratmeter waren das ideale Zuhause für unsere vierköpfige Familie. Ein Schlafzimmer, ein Kinderzimmer, Wohnzimmer, Esszimmer, Küche, Toilette und Bad. Wohlgemerkt eine Toilette – nicht etwa zwei oder gar vier, die mittlerweile in vielen amerikanischen Vororten und Vorstädten, meist kollektiv Suburbs genannt, zum Goldstandard geworden sind: für jedes Kind ein eigenes Schlafzimmer mit eigener Toilette und eigenem Bad. Wie käme die Zwölfjährige dazu, mit ihrem 14-jährigen Bruder ein Badezimmer zu teilen? Ein gemeinsames Schlafzimmer wäre ohnehin keine Option. Damit hat schon die Großeltern-Generation Schluss gemacht – diejenigen, die in den Fünfziger- und Sechzigerjahren aus den Städten wieder nach Suburbia geflohen sind: auf Suche nach mehr Platz, weg vom Schmutz und Lärm der Stadt. Die eigenen Schlafzimmer waren dabei sowohl redlich erarbeiteter Luxus – der mittlerweile zum Standard geworden ist – als auch Entschädigung für die Distanz zur Stadt, zur Arbeit, zu den urbanen Unterhaltungsmöglichkeiten.
Ein Mittelklasse-Leben verlangt bestimmte Dinge: den Überseeurlaub zum Beispiel, das Auto für den Weg zur Arbeit und zur Schule, ein entsprechendes Zuhause ebenso. All das – die Erwartungen, die Übererfüllung von Erwartungen, der Wintergarten, der zweite Wintergarten, das Heimbüro, der Weinkeller neben der Sauna, die Sauna neben dem Pool – all das macht auch viele Sonntagnachmittage komplizierter.
Das Haus ist dann nicht mehr nur der Ort, wo man mit anderen Menschen zusammenkommt, um mit ihnen entspannte Gespräche zu führen. Das Haus ist der Inhalt des Gesprächs. Oder zumindest weiß man nie so recht: Kam die Einladung, weil der nachmittägliche Besuch genauso zum Sonntag gehört wie der morgendliche Kirchenbesuch? Oder kam sie, weil es etwas Neues zu bestaunen gibt: den neuen Swimmingpool, den nochmals vergrößerten Gartenteich? Ist die Sauna neu oder doch nur größer? Oder war sie beim letzten Besuch einfach nur nicht Teil der Haustour?
Manchmal freilich kann der Drang nach mehr auch nach hinten losgehen: Einer meiner Onkel baute nicht nur einfach in attraktiver Hanglage – er kaufte sich ein Mehrfamilienhaus ganz oben am Hügel mit Fernblick bis nach Amstetten hinten am Horizont. Seine Idee war ursprünglich eine Komplettsanierung: Er selbst war Innenarchitekt, und mittlerweile ging es bei seinen Ambitionen um deutlich größere Projekte als das Wohnzimmer in unserer 78-Quadratmeter-Wohnung. Sein Haus hatte ein geräumiges Schlafzimmer – den Master Bedroom, ganz in amerikanischer Tradition. Von seinen vielen Nordamerikareisen kam auch die Inspiration für den Master Bathroom – Ausblick über die Dächer der „Normalsterblichen“ von der Badewanne aus inklusive. Alleine bei diesem repräsentativen Schlafzimmer mit eigenem Bad fehlte nicht mehr viel auf unsere 78 Quadratmeter.
Die grundlegende Frage, wo und wie wir leben (sollen), was die jeweiligen Motive dafür sind und was das alles mit unserem Klima zu tun hat, begleitet mich seit vielen Jahren. Sie treibt mich als Wissenschaftler an, und sie begleitet meine Familie und mich in unserem persönlichen Alltag. Als Klimaökonom beschäftige ich mich mit globalen Zahlen: mit den relativen Kosten von Klima-schmutz und Klimaschutz, mit Zahlen über Risiken und Ungewissheiten. Als Mensch frage ich mich: Was bedeuten diese Zahlen für mich persönlich? Welche Entscheidungen sollte ich treffen? Welche nicht? Und was ist notwendig, damit wir alle jene Entscheidungen treffen – und treffen wollen –, die uns ein gutes Leben ermöglichen und zugleich unseren Planeten schützen?
Dabei geht es um die Einstellung zum täglichen Leben; um Normen; darum, was einem selbst und seinen Nachbarn, Freunden und Verwandten wichtig ist – oder wichtig sein sollte. Es geht um Architektur, Design und Technologie ebenso wie um Mobilität: das tägliche Pendeln zur Arbeit und zur Schule, den Weg zum Bäcker und zum Wochenendeinkauf und den alljährlichen Familienurlaub. Es geht um Verkehrs- und Raumplanung, um Politik. Es geht um Zielkonflikte und um Kompromisse – sowohl auf volkswirtschaftlicher und gesamtgesellschaftlicher als auch auf ganz persönlicher Ebene. Es geht um die Frage: Wo leben wir wann und wie? Und vor allem auch: Warum?
Stadt, Land, Suburbia
Bei uns im Amstettener Vororthaus gab es genau genommen auch noch eine zweite Toilette: Die 78 Quadratmeter Wohnfläche bezogen sich nämlich auf unsere Familienwohnung im ersten Stock. Falls wirklich einmal viele Leute zu Besuch waren, gingen wir Kinder hinunter ins Erdgeschoss. Dort wohnten Oma und Opa. Kurz bevor meine Eltern noch einmal Nachwuchs erwarteten, zogen mein Bruder und ich nach unten, in das sogenannte Bügel- und Extrazimmer. Dort hatte zuvor manchmal unsere Uroma geschlafen, wenn sie zu Besuch kam. Mittlerweile war sie gestorben.
Das Haus lebte mit unserer Familie mit – wie ein Haus eben, das von drei Generationen einer großen Familie bewohnt wird. Inzwischen ist aus der Terrasse ein zusätzliches Zimmer geworden, 19 Quadratmeter groß, für den Fall, dass die vierte Generation zu Besuch kommt. Die jüngste Generation, das sind meine beiden Kinder, Annan und Sonja, die nun immer wieder das Vorortleben bei Oma und Opa in Niederösterreich genießen dürfen.
Beide sprechen in ihrem Alltag – in Manhattan, New York City – das ganze Jahr über davon, dass sie im Sommer wieder nach Amstetten reisen möchten. Dorthin, wo sie mit ihrem Opa einen ganzen Sommer lang das Radfahren perfektioniert haben; wo sie einmal pro Woche – und zwar jede Woche – mit ihren Fahrrädern zum Pizzaessen ins Amstettener Einkaufszentrum fahren dürfen. In den Vereinigten Staaten, wo ich seit meinem Schulabschluss am Amstettener Gymnasium lebe, waren meine Frau und ich mit unseren Kindern noch nie in einem solchen Shoppingcenter – wenigstens nicht, ohne es davor ausdrücklich als anthropologisches Experiment zu deklarieren: Shopping Malls sind für uns eine andere Welt.
Zugegeben: Meine Frau und ich haben als Familie – nach mittlerweile zwanzig Jahren in den Vereinigten Staaten – noch nie im tatsächlichen „Amerika“ gewohnt. Wir waren dort höchstens zu Besuch. Soweit sich das ohne Auto machen lässt, denn Führerschein habe ich keinen, so wie fast die Hälfte aller New Yorker. Über zwei Drittel besitzen hier auch kein Auto. Unseren letzten Umzug von Cambridge (im Bundesstaat Massachusetts) nach New York City haben wir per Fahrrad, Bahn und Schiff erledigt. Die 340 Kilometer zwischen den beiden Ostküstenstädten überwinden Auto und Bahn in weniger als vier Stunden. Wir waren ganze vier Tage unterwegs – Urlaub inklusive. Doch auch dieser Trip durch einen Teil des Nordostens der Vereinigten Staaten hatte nur wenig mit dem ländlichen Amerika zu tun. Weite Teile dieser Region sind riesige Suburbs: erst jene von Boston, dann die von Providence (in Rhode Island) und ein paar kleineren Städten entlang des Weges. Und dann kommt der Speckgürtel, der alle anderen Speckgürtel in den Schatten stellt: die Suburbs von New York.
New York City selbst hat knapp über acht Millionen Einwohner, ebenso viele wie ganz Österreich oder die Schweiz. Davon wohnen rund 1,6 Millionen Menschen in Manhattan, die damit die am dichtesten bebauten sechzig Quadratkilometer der Vereinigten Staaten sind. Diese Bevölkerungsdichte ist höher als jene in allen europäischen Städten; sie ist etwa siebenmal so hoch wie jene Berlins. Und sie konkurriert mit den am dichtesten besiedelten Metropolen der Welt wie Mumbai und Kolkata in Indien. Ganz New York mit seinen acht Millionen Einwohnern ist hingegen „nur“ etwa halb so dicht besiedelt, in etwa wie Peking oder Neu-Delhi – immer noch viel dichter als jede europäische Großstadt.
Die Suburbs von New York haben nicht minder gewaltige Ausmaße: Sie beherbergen um die zwölf Millionen Menschen. Die ganze Metropolregion hat über zwanzig Millionen Einwohner, mehr als Nordrhein-Westfalen. Dabei verschwimmen die Grenzen zusehends; die Suburbs ziehen sich mittlerweile über vier Bundesstaaten hinweg: New York, New Jersey, Connecticut und Pennsylvania.
Manche dieser Suburbs sind tatsächliche Orte, vergleichbar mit europäischen Kleinstädten: relativ kleine Häuser rund um einen beschaulichen Ortskern. Die Mittelklasse lebt in den nächstgelegenen Vororten: Die begehrtesten haben einen kleinen Bahnhof mit direkter Verbindung nach New York City. Zehn Minuten zu Fuß oder mit Rad zum Bahnhof, dreißig oder vierzig Minuten im Zug, und schon steht der Familienvater aus Montclair, New Jersey, in Midtown Manhattan, während die Mutter ihre Kinder in die großzügig angelegte Vorortschule bringt.
Das Familiendomizil ist ebenso großzügig gestaltet: Mittlerweile zählen 200 Quadratmeter als Standard, verglichen mit etwa 110 Quadratmetern in Deutschland – Tendenz da wie dort steigend. Vorortidylle, mit dem dazugehörigen, oft nur allzu traditionellen Familienbild: sonntagmorgens Kirchenbesuch, sonntagnachmittags Kaffee und Kuchen – freundschaftliche Haustouren inklusive.
Wenn beide Elternteile arbeiten, sind es manchmal noch mehr Quadratmeter, einschließlich Zimmer und Bad für das Au-pair. Und falls es nur einen alleinerziehenden Elternteil gibt oder sonst etwas „komplizierter“ wird, dann ist es eben so: kompliziert! Dann ist man vielleicht auch nicht geeignet für das Vorortleben. (Aus Sicht der dortigen Bewohner ist das sogar einer der großen Vorteile: eine ganz von selbst hergestellte und bewahrte Stabilität. Vorortidylle eben.)
Viele dieser Suburbs sind freilich nicht ganz so idyllisch. Sie sind vor allem eines: eine bequeme Schlafstätte. Der Besuch am Sonntagnachmittag ist dann kaum ein Thema, denn die Familienmutter arbeitet ohnehin im Krankenhaus: Die Wochenendschicht wird besser bezahlt, die Nachtschicht ebenso. Meine Frau Siri (ja, wie beim iPhone) wuchs so auf – in Yonkers, einer Vorstadt nördlich von New York, auf ungefähr doppelt so vielen Quadratmetern wie ich, und teils auch mit doppelt so vielen Personen im Haus.
Von Vorortidylle spricht in solchen Fällen kaum jemand: Man ist hier in Suburbia, weil das andere auch so machen. Die Anzahl der Quadratmeter ist dann fast schon egal. Groß genug ist es, und falls es doch einmal knapp werden sollte, lässt sich über der Garage leicht noch ein Schlafzimmer einrichten, dahinter ebenso. Ein Pool hätte im Garten auch noch Platz. „Könnte“, „wäre“, „hätte“ – es geht um die Möglichkeiten, um den Traum. Das Eigenheim gehört nun mal dazu. Das ist in Europa nicht anders. Hier schlägt es sich sogar sprachlich nieder – die deutsche Übersetzung für Family Home, das Zuhause für die ganze Familie, lautet nicht umsonst: Einfamilienhaus.
Über die Hälfte der Weltbevölkerung lebt heute in Städten, Tendenz steigend.1 Mit Städten ist tatsächlich das gemeint: dichte urbane Zentren. Platz ist dort knapp und in begehrenswerten Stadtteilen auch entsprechend wertvoll. Die Mittelklasse zieht es daher zunehmend hinaus in die Suburbs, die Vorstädte und -orte, auf der Suche nach mehr Platz.
Der Weg vom Land in die Stadt in die Suburbs scheint zum natürlichen Lauf der Dinge geworden zu sein: Zunächst wird das Leben in Hektar gemessen, dann in Stadtwohnungsdimensionen (48 oder 84 Quadratmeter oder irgendwas dazwischen), denen es zu entkommen gilt. Ein Drittel der Amerikaner wohnt in mehr oder weniger dicht bebauten Städten. Etwa 50 Prozent leben mittlerweile in Suburbia. Der kleine Rest lebt immer noch – oder auch wieder – am Land.2 Der Traum vom Einfamilienhaus ist aber bei Weitem nicht nur etwas typisch Amerikanisches. Genauso ist er asiatisch: Die Vororte von Bangkok dehnen sich ebenso aus wie jene in Kuala Lumpur. Der Traum ist australisch, südafrikanisch, südamerikanisch. Und er ist auch europäisch: Suburbanisierung, Speckgürtel und Zersiedelung gibt es mittlerweile auf der ganzen Welt.
In Deutschland zum Beispiel liegt der Anteil der Landbevölkerung auf dem niedrigsten Stand seit dem Jahr 1871. In der Region Berlin-Brandenburg leben heute 88 Prozent aller Einwohner im urbanen Raum.3 Die großen Städte wachsen zwar – allerdings fast nur mehr dank Immigration aus dem Ausland. Deutsche Staatsangehörige hingegen wandern seit 2014 noch stärker ins Umland der großen Städte ab.4 Die Landkreise, die am schnellsten wachsen, liegen rund um Städte wie Frankfurt /Main, München oder Stuttgart: im Speckgürtel, Suburbia.5
Der Grund für diese Entwicklung, so ist vielerorts zu hören, sind die hohen Quadratmeterpreise in den Innenstädten. Das stimmt in vielen Fällen, ist aber gleichzeitig nur ein Teil der Erklärung: Die teuersten Wohnungen sind oft in Städten zu finden, aber ebenso befinden sich auch die billigsten Wohnungen dort, und natürlich gibt es auch alles dazwischen. Der Traum vom Einfamilienhaus ist vor allem Lebenseinstellung. Er ist Erwartung, er ist Norm, er ist Werbung: die glückliche Vorortfamilie im idyllischen Einfamilienhaus mit eigenem Garten. Die dadurch entstehende Abhängigkeit vom Auto für die Fahrt zur Arbeit: purer Fahrgenuss, individuelle „Freiheit“! Die Erhaltungskosten für die 100 oder mehr Quadratmeter: volkswirtschaftliche Wertschöpfung.
Der Traum vom Einfamilienhaus ist auch Politik, mit all den dazugehörigen Steueranreizen und Subventionen: „Bausparverträge“ heißen nicht umsonst so. Die Einkaufszentren mit ihren riesengroßen Parkplätzen am Stadtrand, die dazu einladen, in immer größeren Gefährten die attraktivsten Schnäppchen zu immer größeren Häusern noch weiter weg zu kutschieren – sie sind ein direktes Ergebnis der Steuer-, Verkehrs- und Regionalpolitik, das gleichzeitig viele Innenstädte weiter vereinsamen lässt.
Nicht zuletzt ist der Vororttraum: Natur- und Klimakiller.
Stadt, Land, Klima
Klimaschmutz entsteht zwar überall – in Suburbs entstehen jedoch doppelt so viele CO2-Emissionen wie in Städten oder am Land.6 Klimaschutz liegt in der Stadt.
Die Logik ist einfach: Die entscheidenden Faktoren heißen Reichtum und Dichte. Reichtum bedeutet mehr CO2-Emissionen, Dichte weniger. Das Land ist relativ arm und dünn besiedelt. Städte sind relativ reich und dicht besiedelt. Suburbs liegen genau dazwischen: Sie haben zwar relativen Reichtum, aber kaum Dichte. Das bedeutet: größere Häuser, mehr Autos, mehr materieller Konsum – und daher auch deutlich mehr CO2-Emissionen.
Stadt selbst ist noch kein Garant für ein CO2-armes Leben. Reichtum und Dichte eröffnen allerdings echte Möglichkeiten. Ich als New Yorker blicke etwa wehmütig nach Barcelona und dessen autofreie „Superblocks“: Der Verkehr fließt auf den großen Adern, während die kleineren Straßen dazwischen für die Menschen reserviert sind. Auch Berlin, Wien und Zürich sind beim Nahverkehr und der Verkehrsplanung trotz aller Probleme globale Vorbilder: Das in Österreich geplante „1-2-3-Ticket“ – 1 Euro pro Tag, um alle öffentlichen Verkehrsmittel im eigenen Bundesland nutzen zu können, 2 Euro für zwei Bundesländer und 3 Euro für das ganze Land – ist dabei ebenso lobend zu erwähnen wie der Dreißig- oder gar 15-Minuten-Takt der Schweizer Bahn und sämtliche weiteren Maßnahmen, die Menschen gegenüber Autos bevorzugen.
Doch Verkehr ist nicht alles: Die Reduktion von CO2-Emissionen muss viel weiter gehen, als Radwege auszubauen. Möglichkeiten gibt es genug: von intelligenten Flächennutzungsplänen und Bauordnungen bis zu gänzlich neuen Geschäftsmodellen, in denen Vermieter finanzielle Vorteile genießen, wenn sie ihren Mietern effizientere Haushaltsgeräte zur Verfügung stellen. Wie immer hängt vieles von der Politik ab: Neben Wohnbauförderung plus Pendler- oder Kilometerpauschale gibt es auch Wohnungsförderung plus subventionierten städtischen Nahverkehr.
Vieles andere ist aber von Politik relativ unabhängig: Es geht ebenso um die persönliche Einstellung, um Umstellung, um Umdenken, um Potenziale. Es geht um Familie, um Zeit. Es geht um den Sonntagnachmittag genauso wie um den Montagmorgen. Es geht vor allem um die Zukunft: jene von Stadt, von Land und von Klima.
Dieses Buch ist mein persönlicher Versuch, das Thema aus den verschiedensten Perspektiven zu beleuchten. Ich begann daran zu arbeiten, als ich mit meiner Frau und unseren beiden kleinen Kindern per Fahrrad, Bahn und Schiff von Cambridge, Massachusetts, nach New York City zog. Die Frage, die dabei für mich im Mittelpunkt stand, lautete: Warum? Nicht bezogen auf den Umzug selbst, denn den hatten wir wie einen Urlaub geplant. Das „Warum?“ bezog sich auf unser Ziel: Wir hatten soeben unser erstes Family Home gekauft – ein neues Zuhause für unsere Familie. Allerdings war es kein „Einfamilienhaus“. Die Größe: 70 Quadratmeter.
Das ist klein, selbst für New York. Für eine vierköpfige amerikanische Familie ist es winzig. Das gab uns fast jeder auf seine Weise zu verstehen: der Blick der auf Stadtwohnungen spezialisierten Wohnungsmaklerin, die sichtlich noch nie mit Kindern zu tun hatte; der Kommentar der Bankangestellten, die unsere Wohnung wiederholt als Starter Home beschrieb, als „Einsteiger-Eigentum“. (Beiden schien unsere Wahl freilich mehr als gelegen zu kommen: Sie empfahlen sich sofort für unsere vermeintlich unausweichliche Wohnungssuche drei Jahre später, wenn es dann „weiterginge“. Das machen Jungfamilien mit ihren Einsteiger-Eigentümern doch so.)
Dass unsere eigene Wohnungssuche nicht der Norm entsprach, bestätigte uns auch die neue Lokalzeitung. Die New York Times verewigte unsere Wohnungssuche in einem Artikel nach dem Motto: „Effiziente vierköpfige Familie sucht Wohnung mit wenigen Wänden mitten in Manhattan.“7 Tatsächlich: Unsere Wohnung hat keine Innenwände, vom Badezimmer mal abgesehen. Das Wort „effizient“ kam in dem Artikel ganze drei Mal vor – nicht zwingend als Kompliment gemeint.
Wir haben freilich keinen Grund, uns zu beschweren. Ganz im Gegenteil: Wir halten die Größe unserer Wohnung für nahezu perfekt. Verbunden mit der Lage könnten die 70 Quadratmeter nicht idealer sein. Gleichzeitig fragen wir uns: Warum sehen das im Allgemeinen die wenigsten so?
Weder amerikanische noch europäische Durchschnittsfamilien wohnen so, wo und wie wir es tun. Familien gibt es in unserer unmittelbaren Nachbarschaft kaum: Ich kann die Nachbarskinder an zwei Händen abzählen – zumindest jene, die so wie wir leben. Denn Millionärs- oder gar Milliardärsfamilien gibt es hier ebenso, in New York City mehr als in jeder anderen Stadt. Die logieren im dreistöckigen Penthouse und schweben gleichsam über dem Rest der Stadt, mit der sie kaum jemals persönlich in Kontakt kommen.
Die ärmsten New Yorker – jene, die sich nicht unbedingt aussuchen können, was sie ihr Zuhause nennen – wohnen auch in Kleinstwohnungen, aus denen viele gerne entkommen würden. Viele leben in Schlafstädten innerhalb der Stadt. Jemand, der die Wahl hat, entscheidet sich anders.
Viele kleinere und größere Familien auf allen Kontinenten – von Shanghai bis Tokio, von São Paulo bis hin zur kleinen Stadtwohnung im niederösterreichischen Amstetten – können von 70 Quadratmetern nur träumen. Von jener Milliarde Menschen, die in den urbanen Slums wohnen, ganz abgesehen. Doch genau darum geht es: um den Traum von „mehr“.
Es gibt immer wieder irgendwo auf der Welt das Beispiel eines höchst effizient lebenden Designerpärchens mit Kleinstwohnung, das seine treue Anhängerschaft auf Instagram an seinem Alltag teilhaben lässt – hypermodernes skandinavisches Design inklusive. Designbücher, die das „einfache Leben“ im „kompakten Zuhause“, die „Sehnsucht nach weniger“ und den „Minimalismus“ preisen, gibt es zur Genüge. Und es gibt den Internetmillionär, dessen neues Statussymbol das Mikrohaus ist – die Trendikone in der kargen Wohnung. Exzentriker leben so, Familien kaum.
Bei Familien ist allzu oft von „Kompromiss“ die Rede: vom Leben auf eng(st)em Raum als notwendigem Ausgleich, um andere Prioritäten setzen zu können. „Effizienz“ ist dabei oft nur der Versuch, einen schöneren Begriff für „Kompromiss“ zu finden. Das eigentliche Ziel ist Effizienz dabei selten. Vielleicht wird sie das am Lebensabend, in der Pension, wenn die Kinder groß geworden sind und das Haus verlassen haben. Doch warum so lange warten?
Warum sich nicht bewusst für das effiziente Stadtleben entscheiden: als ideal für das tägliche Leben, für die persönliche Balance, für die Familie, für das eigene Wohnklima – und, ja, auch für das Weltklima?
Von Stadt zu Stadt
Wir nennen unsere Wohnung den Great Room. Für einen einzelnen Raum sind die Ausmaße beachtlich: Die Decke ist bis zu vier Meter hoch. Das Klavier ist elektronisch, die Kaffeemühle für die Zubereitung des Morgenkaffees, während die Kinder noch schlafen, funktioniert manuell. Meine Arbeit an diesem Buch (und jede andere konzentrierte Tätigkeit) verdanke ich den Audioingenieuren der Firma Sennheiser, deren geräuschreduzierende Kopfhörer ich zwei Straßen weiter gekauft habe.
Ansonsten ist hier alles „gleich um die Ecke“. Das Lebensmittelgeschäft: zwei Straßen in die eine Richtung. Das Schwimmbad: am Weg zum Lebensmittelgeschäft. Die öffentliche Bücherei: zwei Straßen in die andere Richtung, am Weg zu unserem Lieblingsbuchladen, der sich eine Straße weiter befindet. Ich sitze am Schreibtisch – dem einzigen Schreibtisch in unserer Wohnung, versteht sich – und kann aus dem Fenster gleichzeitig auf das katholische Eventzentrum von New York und auf die örtliche Abtreibungsklinik blicken: Die beiden teilen sich eine Außenwand. Über Effizienz und Diversität im Abstrakten zu referieren, ist das eine. Beide täglich zu leben, ist noch mal etwas ganz anderes.
Jede Stadt hat ihre Besonderheiten. New York ist in manchen Bereichen sicher einzigartig. Dennoch gilt: Stadt ist Stadt. New York hat etwa mit Berlin viel mehr gemeinsam als mit einer geografisch viel näher gelegenen Gemeinde oder Kleinstadt im ländlichen Bundesstaat New York. Dasselbe gilt für Berlin und Wien, verglichen mit jeder kleinen Gemeinde in Brandenburg oder im Burgenland. Stadt ist Stadt – fast egal, wo auf der Welt: Städte gleichen sich auf entscheidende Weise. Die jeweiligen ländlichen Regionen, die sie umgeben, tun es ebenso. Warum das so ist – und warum das für das Klima von enormer Bedeutung ist –, darum geht es in diesem Buch.
Ich kann mich noch gut an ein Gespräch mit meinem Opa erinnern, damals, im Garten in Amstetten. Es war den ganzen Tag über schon nebelig gewesen: Tiefdruck. In Peking, Delhi, Lagos, Mexiko-Stadt oder Los Angeles steigen die Ozonwerte bei solchen Wetterbedingungen in gefährliche Bereiche – Großstädte und ihre Verschmutzung.8 Plötzlich stank es auch hier. Nicht etwa nach Rauch und Ruß von der Heizung des Nachbarn. Viel stärker. Meine Augen begannen zu tränen.
„Oh ja, das ist die Vöest“, sagte Opa. Er meinte damit Österreichs größtes Stahlwerk, fünfzig Kilometer weiter westlich, im oberösterreichischen Linz, gelegen: „Die Vöest putzt ihre Hochöfen.“ Ob es wirklich die Vöest war oder vielleicht auch eine der vielen anderen Fabriken, die es in und rund um Amstetten – am „Land“ – gab, weiß ich zwar bis heute nicht. So viel aber zum oft geäußerten Vorurteil, dass nur Großstädte schmutzig, umwelt- und gesundheitsschädlich seien.
Andererseits kann ich mich auch noch gut an einen der vielen Sonntagsbesuche erinnern: Diesmal waren Cousins meines Vaters, die ihren eigenen Bauernhof bewirtschafteten, bei uns zu Gast. Plötzlich erstarrte der Großcousin, hielt ein paar Sekunden inne und sagte nur: „Bei euch in der Stadt ist es so ruhig. Bei uns am Land fährt immer irgendwo ein Auto vorbei.“
Stadt und Land sind eben auch relativ. Neben räumlicher Dichte und technischer Effizienz geht es vor allem um eines: die Lebenseinstellung.
Vor ein paar Jahren, als ich aus den Vereinigten Staaten wieder einmal auf Kurzbesuch zu meinen Eltern nach Österreich kam, habe ich zum ersten Mal in Amstetten ein Brompton-Faltrad gesichtet, am dortigen Bahnhof. Damals war ich selbst mit einem solchen Faltrad einmal wöchentlich zwischen Cambridge und New York unterwegs: mit dem Rad zur Bahn, nach der Zugfahrt wieder weiter per Rad. Von Stadt zu Stadt.
Für die Besitzerin dieses Faltrades ging die Fahrt von Amstetten nach Wien, zur Arbeit. Den Morgencappuccino hatte sie dabei, Laptop und geräuschreduzierende Kopfhörer ebenso. Ihre beiden kurzen Telefongespräche im Zug führte sie auf Deutsch und Englisch. Diese pendelnde Faltradfahrerin, Mitte dreißig, hätte leicht auch ich selbst sein können. Ich wusste nichts über ihre Wohnverhältnisse – ob Haus oder Wohnung, ob 48 oder 78 Quadratmeter oder doch mehr, und ob sie sich diese Quadratmeter mit jemandem teilte, mit Kindern, mit ihren Eltern oder sonst jemandem. Ich hatte keine Ahnung, ob sie mit den 70 Quadratmetern von meiner Familie und mir tauschen würde und ob sie vielleicht doch lieber direkt in Wien, in der Nähe des Arbeitsplatzes, leben würde – keine Ahnung also, ob sich die äußeren Symbole auch mit der Einstellung dieser Person deckten. Mein Stadtmensch-Radar schlug jedenfalls an.
Stadtmenschen finden sich überall und in den verschiedensten Situationen. Die Einstellung ist etwas Persönliches. Und sie ist flexibel – sie hängt von vielen externen Faktoren ab.
Menschen, die in Städten leben und arbeiten, gibt es viele, wie auch die Daten zur globalen Urbanisierung bestätigen. Doch wie viele davon sind Stadtmenschen? Die Frage nach dem Warum ist dabei oft entscheidend.
Teil I
WARUM
Von Stelzenhäusern und Passivhausluftschlössern, der wunderbaren Welt der Klimabuchhaltung und unserem Natursch(m)utz
1 Klima
Omas Stelzenhaus
Der Stadtteil SoHo in New York – der Bezirk Soho in London: Die Namen der beiden Viertel mögen verschiedene Ursprünge haben. Doch ähnlicher könnten sich zwei großstädtische Nachbarschaften auf zwei verschiedenen Kontinenten kaum sein. Hier wie dort finden sich zahlreiche Theater, Restaurants, Kopfsteinpflaster. Es sind die urbanen Spielplätze der Reichen und Schönen und jener, die es noch werden wollen. Egal ob Berlin, Barcelona oder Basel: Jede größere Stadt hat eine solche Spielwiese.
Bengaluru, die Zehn-Millionen-Stadt im Süden Indiens, hat sie, Bangkok in Thailand ebenso. In Bangkok findet man sie mitunter entlang der Sukhumvit-Straße. Dort schwebt eine effiziente Einschienenbahn über den Verkehr hinweg. Es gibt Cafés, Millionen-Dollar-Wohnungen, Theater und Restaurants – Stadtleben eben: global, urban, teuer. Bangkoker Jungfamilien sind dort inzwischen rar: Die Aufstiegsorientierten, die gute Jobs, genug Geld und damit auch die Wahl haben, zieht es mittlerweile in die unzähligen auf dem Reißbrett entworfenen Suburbs.
Und dann gibt es noch die ländlichen Gegenden Thailands. Dort zieht es kaum jemanden hin – außer vielleicht nach dem Erwerbsleben, in der Pension. Vier Stunden nordöstlich von Bangkok liegt Phimai. Manche Rucksacktouristen kommen hier vorbei, um die historischen Ruinen zu erkunden. Diese sind zwar nicht so bedeutend wie die Tempelanlage Angkor Wat im benachbarten Kambodscha, aber ein Wat, ein buddhistischer Tempel, sind sie allemal.
Fünf Gehminuten vom historischen Tempel entfernt wohnt meine Oma. Also die andere Oma, jene meiner Frau Siri. Wir nennen sie (Yai). Sie ist alt und der Ort klein genug, dass sie in der unmittelbaren Umgebung noch unter ihrem Mädchennamen bekannt ist: Yu Phimai – „die in Phimai Ansässige“. Vor achtzig Jahren war sie die lokale Schönheitskönigin; mittlerweile ist sie über hundert Jahre alt. Lesen und Schreiben lernte sie nie – Schule hätte nur von der Arbeit am Reisfeld abgelenkt. Das Foto von der Abschlusszeremonie ihrer Enkelin Siri an der Harvard University hängt in ihrem eigenen Great Room.
Omas Haus ist alt genug, dass es auf Stelzen steht – mit einem Kanu, das an den Stiegen angebunden auf seinen Einsatz wartet. Das darunterliegende Land wird seit jeher einmal jährlich überflutet. Die Oma kann nur herzlich über die Nachbarhäuser lachen, deren Erdgeschosse jährlich unter Wasser stehen: Warum sollte man sich so ein Haus bauen? Warum nicht mit der Natur, mit dem Klima leben?
Die Fluten sind in den letzten Jahren unberechenbarer, gefährlicher geworden. Und heißer ist es mittlerweile auch. Heiß war es in Thailand schon immer. Aber früher reichte meist die allabendliche Brise zur Abkühlung. Mittlerweile verfügt Omas Haus sowohl über einen Kühlschrank als auch über eine vom Arzt verordnete Klimaanlage.
Natur und Klima bedeuten in der Stadt etwas gänzlich anderes als am Land. Einerseits ist das Leben in der Stadt von den täglichen Launen der Natur deutlich stärker abgeschirmt: Zwei der Dachfenster unserer Wohnung in New York öffnen sich automatisch, wenn der CO2-Gehalt im Innenraum zu hoch steigt. Sie schließen sich automatisch, wenn es zu regnen beginnt. Bei hohem CO2-Gehalt drinnen und Regen draußen vibriert das Handy: „Fenster öffnen.“
Andererseits sind durch den Klimawandel ganze Städte in existenzieller Gefahr. Die jährliche Flut im ländlichen Phimai ist eine Sache – die Vororte der Millionenmetropole Bangkok befinden sich da schon in einer gänzlich anderen Lage. Dort hat zwar selbstverständlich jedes Haus eine Klimaanlage; eine Garage fürs Auto ohnehin. Auf Stelzen baut dort jedoch niemand. Eine Überflutung in Teilen Bangkoks legt wiederum die thailändische Wirtschaft und wichtige Teile der globalen Autozulieferkette und somit die Produktion von Benzinfressern am anderen Ende der Welt lahm. (Klimaschutzironie ist eine ganz eigene Kunstform.)
Rapide ansteigende Meeresspiegel bedeuten für viele Küstenstädte auf der ganzen Erde nichts Gutes. Ein paar einzelne Häuser umzusiedeln, ist schon schwer genug. Doch Städte wie Bangkok oder auch New York auf höherem Niveau wiederaufzubauen, wäre noch mal ein gänzlich anderes Vorhaben. Natürlich wäre New York – oder noch viel dringender etwa Bangkok, Manila oder Miami – nicht die erste Stadt, die die Menschheit aufgrund von Klimawandel aufgeben müsste. Uruk etwa, im heutigen Irak gelegen, hatte vor ungefähr 5000 Jahren über 40.000 Bewohner und war damit die größte Stadt der Welt. Heute ist sie eine archäologische Ausgrabungsstätte in der Wüste.9 Die Launen von Natur und Mensch sorgten dafür.
Ein großer Unterschied zur heutigen Situation ist freilich der Faktor Zeit: Der Fall von Uruk zog sich über 3000 Jahre hinweg. Viele Teile Bangkoks, Manilas oder Miamis haben hingegen keine hundert Jahre mehr.10 Der zweite große Unterschied: Eigentlich wissen wir all das schon jetzt. Ungewissheiten gibt es zwar genug, doch selbst die optimistischsten Prognosen sind schlimm genug.