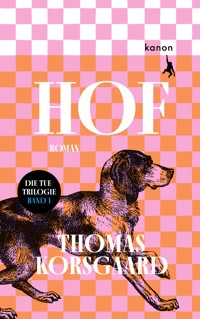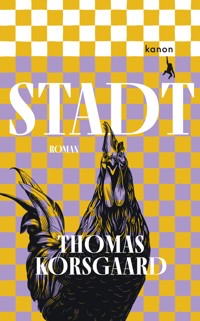
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Kanon Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Die Tue-Trilogie
- Sprache: Deutsch
Die Sommerferien bevor Tue in die Oberstufe kommt. Auf dem Hof ist es verdächtig ruhig. 900.000 Kronen hat die Versicherung gezahlt. Zumindest die Schulden sind sie los. Für neue Gartenmöbel hat es auch noch gereicht, einen der Plastikstühle hat Tues Mutter an der Flaggenstange gehisst. Wer auf etwas Gutes wartet, wartet nie vergeblich, sagt sie. Sie ist verliebt. Aber nicht in Tues Vater. Dieses Geheimnis muss Tue hüten, sonst verrät die Mutter dem Vater seins: dass Tue schwul ist. Das Wohnheim, in dem seine beste Freundin Iben wohnt, ist dagegen ein Ort voller Möglichkeiten. Dort hängt eine Discokugel von der Decke, unter der sie Walzer tanzen, Wein aus Kaffeebechern trinken und Tue Ibens roten Kimono anziehen darf. – Thomas Korsgaard erzählt mit großer Zärtlichkeit vom Aufspannen der Flügel. »Tue wächst einem ans Herz.« WDR 5
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 309
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Die Sommerferien, bevor Tue in die zwölfte Klasse kommt. Auf dem Hof ist es verdächtig ruhig. 900.000 Kronen hat die Versicherung gezahlt. Zumindest die Schulden ist die Familie los. Für neue Gartenmöbel hat es auch noch gereicht, einen der Plastikstühle hat Tues Mutter an der Flaggenstange gehisst. Wer auf etwas Gutes wartet, wartet nie vergeblich, sagt sie. Sie ist verliebt. Aber nicht in Tues Vater. Dieses Geheimnis muss Tue hüten, sonst verrät die Mutter dem Vater seins: dass Tue schwul ist. Das Wohnheim, in dem seine beste Freundin Iben wohnt, ist dagegen ein Ort voller Möglichkeiten. Dort hängt eine Discokugel von der Decke, unter der sie Walzer tanzen, Wein aus Kaffeebechern trinken und Tue Ibens roten Kimono anziehen darf.
THOMAS KORSGAARD, geboren 1995, schrieb seinen Debütroman »Hof« mit gerade mal 21 Jahren. Band 2 und 3 der Trilogie folgten wenige Jahre später. Seine Romane haben sich in Dänemark mehr als 300.000 Mal verkauft. Für seinen letzten Roman wurde Thomas Korsgaard mit dem wichtigsten Literaturpreis Dänemarks »Der Goldene Lorbeer« ausgezeichnet. Er ist damit der jüngste Preisträger aller Zeiten. Bei Kanon erschien Band 1 »Hof« im Herbst 24, Band 3 »Paradies« ist in Arbeit.
JUSTUS CARL studierte Politikwissenschaften, Romanistik und Skandinavistik in Frankfurt am Main und arbeitet seit 2017 als Übersetzer aus dem Dänischen, Schwedischen und Norwegischen. Stipendiat der Berliner Übersetzerwerkstatt 2020 im LCB Berlin.
KERSTIN SCHÖPS arbeitet seit zwanzig Jahren als Übersetzerin und Lektorin aus den skandinavischen Sprachen. Stipendiatin der Berliner Übersetzerwerkstatt 2016 im LCB Berlin. Zu den von ihr übersetzten Autoren zählen Arne Dahl, Jesper Juul und Stina Jackson.
STADT
ROMAN
THOMASKORSGAARD
Aus dem Dänischen von
Justus Carl und Kerstin Schöps
kanon verlag
Die Originalausgabe erschien 2018 unter dem Titel En dag vil vi grine af det bei Forlaget Lindhardt og Ringhof, Kopenhagen.
Die Übersetzung dieses Buches wurde von der Danish Arts Foundation gefördert.
ISBN 978-3-98568-141-9
eISBN 978-3-98568-142-6
1. Auflage 2025
© Kanon Verlag Berlin GmbH, 2025
Belziger Straße 35, 10823 Berlin
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Covergestaltung: zero-media.net
Herstellung: Daniel Klotz / Die Lettertypen
Satz: Ingo Neumann / boldfish
Druck und Bindung: Pustet, Regensburg
Printed in Germany
www.kanon-verlag.de
Thomas Korsgaard
Stadt
Meiner Mutter gewidmet.
Hab Dank für alle Geschichten.
INHALT
KAPITEL 1
KAPITEL 2
KAPITEL 3
KAPITEL 4
KAPITEL 5
KAPITEL 6
KAPITEL 7
KAPITEL 8
KAPITEL 9
KAPITEL 10
KAPITEL 11
KAPITEL 12
KAPITEL 13
KAPITEL 14
KAPITEL 15
KAPITEL 16
KAPITEL 17
KAPITEL 18
KAPITEL 19
KAPITEL 20
KAPITEL 21
KAPITEL 22
KAPITEL 23
KAPITEL 24
KAPITEL 25
KAPITEL 26
KAPITEL 27
KAPITEL 28
KAPITEL 29
KAPITEL 30
KAPITEL 31
KAPITEL 32
KAPITEL 33
KAPITEL 34
KAPITEL 35
KAPITEL 36
KAPITEL 37
KAPITEL 38
KAPITEL 39
KAPITEL 40
KAPITEL 41
KAPITEL 42
KAPITEL 43
KAPITEL 44
KAPITEL 45
KAPITEL 46
KAPITEL 47
KAPITEL 48
KAPITEL 49
KAPITEL 50
KAPITEL 51
KAPITEL 52
KAPITEL 53
KAPITEL 54
KAPITEL 55
KAPITEL 56
KAPITEL 57
KAPITEL 58
KAPITEL 59
KAPITEL 60
KAPITEL 61
KAPITEL 62
KAPITEL 63
KAPITEL 64
KAPITEL 65
KAPITEL 66
KAPITEL 67
KAPITEL 68
Vielleicht war da gar nichts. Vielleicht fiel es mir nur schwer, zu erkennen, was echt war. Deshalb fing ich an, Details zu sammeln. Das hier ist auch so ein Detail:
KAPITEL 1
Der Motor war aus, und der Wagen stand mit den Vorderreifen fast im Wasser. Die Wellen brachen sich unter dem Kühler, und die Rückspiegel reflektierten die Sonne. Es war Juni. Auf der Hauptstraße fuhr ab und zu jemand vorbei, und vielleicht dachte der ein oder andere, wir hätten einen Unfall gehabt, aber sie fuhren alle weiter. Ich wusste nicht, warum meine Mutter mit mir ausgerechnet hierher gefahren war. Wir waren einkaufen gewesen. Die Eistorten lagen auf dem Rücksitz und tauten langsam auf. Die Plastiktüte war beschlagen. Zwischen meinen Beinen hatte ich zwei Hotdogs festgeklemmt, sie wurden langsam kalt. Der Curryketchup tropfte meiner Mutter auf die Hand, als sie einen Hotdog nahm und das Papier abriss.
»Herrlich! So schön hier!«
So fing meine Mutter meistens an. Sie hatte ihre Ellenbogen auf das Lenkrad gelegt und kaute. Der Strand war leer. Auf dem Sand waren schwarze Ölflecken und Haufen aus Tang und Krabbenbeinen. Am liebsten hätte ich das Fenster zugemacht, aber meine Mutter würde bestimmt gleich eine rauchen.
»Ist es nicht schön hier, Tue? Wir wohnen an einem der schönsten Orte im ganzen Land, was geht es uns gut«, sagte sie. »Du solltest diese Iben mal mit hierher nehmen. Man soll mit den Menschen, die man liebt, die schönsten Orte teilen.«
»Iben ist nicht meine Freundin.«
»Nein, nein, das habe ich ja auch gar nicht gesagt.«
Sie öffnete die Fahrertür und ließ ein Bein heraushängen. Das Handschuhfach klappte auf und gab den Blick auf drei leere Dosen frei. Eine Fantadose kullerte raus, es tropfte auf meine Hose. Kam sie immer hierher?
Früher hatte meine Mutter ihren abgewetzten Ledersessel mit den Brandlöchern nie verlassen. Jetzt stand sie morgens auf, wenn wir oft genug nach ihr gerufen hatten, setzte sich ins Wohnzimmer, trank Kaffee und nahm artig ihre Tabletten. Sie verbrachte die Tage in ihrem Tempo, auf ihre Weise. Dinge brauchen ihre Zeit, sagte sie und versprach, wieder ganz gesund zu werden. Manchmal stieg sie in den Wagen und fuhr weg, ohne Bescheid zu sagen.
Wir ließen sie fahren. Sie wird wieder gesund, sagte mein Vater, aber ab und zu sagte er, dass sie nicht zurückzukommen brauchte. Aber sie kam immer zurück.
Manchmal nach ein paar Stunden, manchmal blieb sie einen halben Tag weg. Aber sie kam immer wieder zurück nach Hause.
»Es ist so schön hier«, sagte sie und holte tief Luft. »Irgendwie wie in einem Film.«
Ich starrte aufs Wasser und versuchte, etwas Schönes zu entdecken, was ich vielleicht übersehen hatte. Dann kurbelte ich das Fenster ganz nach unten und warf das Hotdogpapier raus. Es flatterte durch die Luft und landete in der Brandung. Meine Mutter aß ihren Hotdog auf. Ein Containerschiff hatte sich in die Aussicht geschoben. Große, blaue Vierecke warfen Schatten aufs Wasser.
»Wir haben keine Geheimnisse voreinander, oder?« Meine Mutter hatte den Blick gesenkt und hustete. Sie dachte nach, rutschte auf dem Sitz herum. Das tat sie immer, wenn es schlechte Nachrichten gab.
»Was ist denn los?«, fragte ich.
»Nichts«, murmelte sie und schüttelte den Kopf. »Vergiss es wieder. Das ist nichts, was man mit seinem Sohn besprechen sollte.«
Sie schaltete das Radio ein. Radio Alfa spielte »Super Trooper« von ABBA, und sie summte mit.
»Jetzt komm schon, du beleidigte Leberwurst.«
Sie stupste mich in die Seite, aber ich drehte mich weg und sah aus dem Fenster.
»Jetzt sing schon mit, das haben wir doch immer gemacht«, sagte sie.
»Ich kann nicht singen«, sagte ich und sah sie an. »Und du auch nicht.« Sie zuckte zusammen, als hätte sie Angst vor mir. Sie hatte vor allem Angst. Ihre Mascara war verschmiert, und sie trug noch ihren Schlafanzug. Die lila Pyjamahose hatte sie in die Gummistiefel gestopft. Ich biss von meinem Hotdog ab und streckte den freien Arm aus dem Fenster, fuhr mit den Fingern über die Kratzer im Lack. Am Rückspiegel hing ein Lufterfrischer, der Zigarettengestank hatte noch nicht gewonnen. Sie hatte den Wagen vor ein paar Monaten gekauft, einen grünen Opel mit sechs Sitzen und Klimaanlage. Sie hatte ihn bar bezahlt. Der Mann war für eine Viertelstunde in seinem Laden verschwunden, nachdem sie gesagt hatte, dass sie den Wagen gern kaufen würde.
Mit dem Brief von der Versicherung hatte niemand gerechnet. Fast 900.000 Kronen als Entschädigung für ihren Verdienstausfall. Ein junger Arzt hatte vor etwa einem Jahr bei einer verpfuschten OP sechs Sehnen in ihrem Arm durcheinandergebracht.
Sie ließ auch jetzt noch ständig Sachen fallen und würde wahrscheinlich nie wieder arbeiten können. Ich hatte das Schreiben aufgesetzt, die Kommata an die richtigen Stellen gesetzt und den Brief professionell aussehen lassen. Es hatte lange gedauert, die vielen Fremdwörter nachzuschlagen, aber ich habe 500 Kronen dafür bekommen. Meine Mutter hatte versprochen, dass sich alles ändern würde, wenn sie die Entschädigung bekam. Und es wurde auch besser. Mein Vater plante mit dem Rest des Geldes ein neues Dach, er meinte, wir sollten langfristig denken und investieren. Und wir würden nie wieder Schulden haben, sagte er. Das hätte zu viel Schaden angerichtet.
Meine Mutter leckte sich die Finger ab und sah sich im Auto um.
»Jetzt sag schon«, sagte ich.
»Mir geht es nicht gut, Tue.«
»Aber dir ging es doch wieder ganz gut. Du hast versprochen, dass es besser wird.«
»Es ist ja auch besser geworden. Darum geht es nicht.«
Sie sah mich an.
»Ich habe jemanden kennengelernt«, sagte sie. »Wir chatten zusammen, bei Kom og Vind.«
Auf dieser Seite war sie jeden Tag. Poker, Casino, Yahtzee. Schiffe versenken und Rubbellose. Rechts gab es ein Chatfenster, in dem sie mit anderen Spielern über dies und das schrieb. Sie redete mit wildfremden Leuten über persönliche Sachen. Ich hatte es selbst gelesen, als ich ihr einmal über die Schulter geschaut hatte.
Mit dem Typen aus Fünen war sie seit über einem halben Jahr zugange. Er hatte ein kleines Haus außerhalb von Middelfart und wohnte dort allein. Nun hatte er Sklerose bekommen, und jetzt überlegte sie, zu ihm zu ziehen, um für ihn da zu sein.
»Papa und ich werden uns wohl scheiden lassen.«
»Und was wird aus Papa?«
»Tja«, sagte sie und bekam einen komischen Gesichtsausdruck. »Was wird aus ihm?«
»Ach, auch egal.«
»Aber sag ihm nichts. Das werde ich schon selbst regeln.«
Sie tastete unter ihrem Sitz nach einem Feuerzeug und zündete sich eine Prince 100 an.
»Und was wird aus uns?«, fragte ich.
»Jetzt hör auf, dich so anzustellen. Es ist doch noch gar nicht sicher, dass ich das mache. Ich habe nur darüber nachgedacht. Außerdem könnt ihr ja mitkommen.«
»Auf gar keinen Fall ziehe ich nach Fünen!«
»Er ist supernett. Ich glaube, du würdest ihn mögen.«
Sie schaltete das Radio wieder ein und fing an, bei Toto mitzusummen. Dann streckte sie den Kopf aus dem Fenster und sang laut mit, bis ihre Stimme brach. Sie legte die Stirn aufs Lenkrad und weinte, ein unkontrollierbares Schluchzen.
»Bitte erzähl es niemandem«, sagte sie und hob den Kopf. Der Rotz lief ihr aus der Nase, sie wischte ihn mit dem Ärmel weg.
»Wem sollte ich das denn erzählen?«
»Was weiß ich, ist auch egal. Du bist ein großer Junge. Du weißt, was dann los wäre.«
»Was wäre denn los?«
Sie holte tief Luft.
»Du weißt genau, wie dein Vater sein kann.«
»Ja.«
»Deshalb ist es besser, wenn er davon nichts erfährt.«
Ich schaltete das Radio wieder aus.
»Versprichst du es mir?«, fragte sie. Ich konzentrierte mich darauf, ihr keine Antwort zu geben. Sie packte mich am Arm und rüttelte an ihm.
»Versprichst du es?«
Ich nickte, aus Versehen. Sie ließ meinen Arm los und schaltete den Motor an. Die Reifen drehten im nassen Sand durch. Es gelang ihr schließlich, rückwärts auf den Weg zu fahren, der zwischen dem Strand und den schwarzen, verblühten Rapsfeldern hindurchführte. Wir fuhren an den verblichenen Wahlplakaten der Danske Folkeparti vorbei, die in den Bäumen oder an Strohballen am Straßenrand hingen. Wir kamen an der Kirche in Nørre Ørum vorbei, wo der Totengräber mit seiner Thermoskanne in einer Schubkarre saß. Er sah hoch, wandte sich ab und betrachtete einen der Buchsbäume. Uns grüßte niemand mehr, weder mich noch meine Eltern. Ich weiß nicht, wann sie damit aufgehört haben. Meine Mutter bog beim Bordell in der Nummer 23 ab und fuhr den Sejstrupvej hinunter. Es knirschte unter den Reifen, als wir auf den Hof fuhren.
KAPITEL 2
Die Hitze verbrannte den Rasen und hinterließ an mehreren Stellen gelbe Flecken. Mein Vater schob den Rasenmäher mit freiem Oberkörper vor und zurück und trat nach den Hunden, die um ihn herumsprangen. Er zog ein Tuch aus der Hosentasche und wischte sich damit über die Stirn. Die Haustür schlug mit einem lauten Knall zu. Alle anderen Türen im Haus standen offen, jedes Geräusch drang nach draußen auf die Terrasse, auf der ich in einem der neuen Gartenstühle aus Plastik saß. Meine Mutter hatte sieben Stück im JYSK Bettenlager gekauft, obwohl wir nur zu fünft waren.
Meine Mutter hatte sich in den Wagen gesetzt und den Motor gestartet. Es staubte, als sie vom Hof fuhr und verschwand. Mein Vater bekam es nicht mit. Ich hatte große Lust, zu ihm zu rennen und ihm zu sagen, dass sie gefahren war, aber ich blieb sitzen und trank mein Wasser mit Zitrone und Zucker. Ich starrte auf das Sudoku, mit dem ich gerade beschäftigt war. Meine Füße schwebten über dem Moos zwischen den Fliesen. Eigentlich hätte ich mich vorbereiten müssen, die Zwölfte würde das schwerste Schuljahr werden. Oder ich könnte wenigstens versuchen, herauszufinden, wer ich nach den Ferien sein wollte. Ich könnte mich in den kommenden Wochen ändern und zu dem werden, mit dem sich alle unterhalten wollten. Aber ich hatte keine Vorstellung davon, wer ich gerne sein wollte. Stattdessen füllte ich die kleinen Kästchen mit Zahlen aus, es tat gut, einfache Dinge in Ordnung zu bringen. Ab und zu wurde ich von einem Geräusch unterbrochen, wenn ein Insekt die Drähte des elektrischen Fliegenfängers berührte, der an einer Kette vom Vordach hing.
Mein Vater hatte seine wenigen freien Tage im Garten verbracht. Er hatte Rasen gemäht und Büsche dorthin gepflanzt, wo die Felder angrenzten, die früher einmal uns gehört hatten. Sie waren alle verkauft worden. Wir schuldeten jetzt niemandem mehr etwas außer uns selbst, sagte mein Vater. Den ganzen Sommer über arbeitete er als Landschaftsgärtner, er hatte es sich alles selbst beigebracht, und die Saisonarbeit war gut bezahlt. Gärtner im Sommer, Schlachter im Winter. So sah sein Leben jetzt aus, andere Jahreszeiten gab es nicht mehr.
Er hatte im letzten Jahr einiges mitgemacht. Zuerst hatte er auf einer Nerzfarm gearbeitet, dann für eine Zeitarbeitsfirma, die ihm einen Gelegenheitsjob vermittelte, bei dem er die Rinder und Schweine von anderen Bauern versorgte. Danach war er Fensterputzer gewesen. Für ein paar Wochen hatte er auch bei der Müllabfuhr gearbeitet. Es kam immer jemand, der für weniger Geld arbeitete, obwohl mein Vater die bessere Arbeit leistete. Aber er wollte nicht für unter 100 Kronen die Stunde arbeiten, das verdienen nur Polen und Kinder, sagte er.
Im Frühsommer hatte er in allen Supermärkten in Skive Zettel aufgehängt. Ich hatte den Text überflogen, nach Rechtschreibfehlern gesucht, aber das meiste war unleserlich gewesen. Ich hatte ihm den Text trotzdem zurückgegeben und gesagt, dass es nichts zu verbessern gab. Er hatte ihn abgetippt, einen Stapel ausgedruckt, die Abreißzettel zurechtgeschnitten, Buntstifte gekauft und war alle Läden abgefahren, wo er die Zettel an das schwarze Brett hängte. Danach hieß es einfach abwarten, bis das Telefon klingeln würde. Zum Glück sind wir in unserer Familie sehr gut darin, zu warten. Und wer auf etwas Gutes wartet, wartet nie vergeblich, hatte meine Mutter einmal gesagt.
Das Sudoku war schwer, O. P. hatte mir das Heft geschenkt. Er hatte es nach Omas Tod in ihren Sachen gefunden und es nicht übers Herz gebracht, es wegzuwerfen. Für die schweren brauchte ich manchmal fast den ganzen Tag. Ich fand Zahlen zwar nicht besonders toll, aber wir mussten in der Schule schon so viele Bücher lesen.
Hin und wieder schaltete mein Vater den Rasenmäher aus, kratzte sich die Mückenstiche auf, die seine Arme und den Rücken übersäten. Er überlegte, mit dem Singen in einem Chor anzufangen. Er sang jetzt »Opa, mach die Zähne rein«. Er sang immer dieselben zwei Lieder. »Opa, mach die Zähne rein« oder »Ich sammle das Lächeln der Kinder«. Seine Stimme klang schön. Dunkel und wie ein Schnulzensänger der alten Schule. Aber es war zu spät, daraus noch etwas zu machen. Wer man mit 40 ist, der bleibt man für den Rest seines Lebens, hatte er nach seinem Geburtstag gesagt.
Er achtete sorgfältig darauf, den kleinen Kreis aus Kieselsteinen in der Mitte des Gartens zu umfahren. Dort sollte eines Tages der weiße Gipsschwan von Großmutter stehen, wenn sie starb.
»Ist dir nicht zu heiß?«
Ich zog den Pulli aus, er klebte mir am Rücken. Mein Vater kam auf mich zu, knipste ein paar Zweige ab und rief mir ein zweites Mal zu. Er war immer so ungeduldig, deshalb habe ich nie gelernt, mir Dinge genau zu überlegen. Ich hob den Kopf.
»Ob dir nicht zu heiß ist, habe ich gefragt! Oder bist du jetzt genauso taub wie deine Mutter?«
»Ich habe dich gehört«, sagte ich und füllte mein Glas auf.
»Dann antworte gefälligst, wenn ich dich was frage.«
Er zog seine Sicherheitsschuhe aus und trank das Glas leer, das ich mir gerade eingegossen hatte. Seine Finger waren ölig und schwarz und hinterließen fettige Flecken auf dem Glas. Er rülpste und stellte es zurück auf den Tisch.
»Hast du Sonnencreme drauf?«, fragte er.
Er stellte sich hinter mich, legte seine Hand auf meinen Rücken und kniff mir in die Haut. Ich schüttelte den Kopf.
»Ich habe gelesen, dass gerade Hautkrebs rumgeht und man vorsichtig sein soll.«
»Aber dann werde ich ja niemals braun.«
»Habe ich eh nie kapiert, warum die Leute braun werden wollen. Willst du im Winter etwa auch ins Solarium gehen?«
»Nein, glaube ich nicht.«
»Zum Glück. Die Ausländer können ihre Farbe ruhig für sich behalten. Und jetzt reib dich mit Sonnencreme ein.«
Ich sah an meinem mit Sommersprossen übersäten Körper herab und ging im Kopf alle Sachen aus dem Badezimmer durch. Die Strumpfschublade. Die Deos und die Eutercreme. Die silberne Hand, an der Schmuck hing. Die xxl-Zahnpasta von Linds. Das Kartoffelmehl für die Flecken. Der Rasierer von meinem Vater und das Shampoo, das nach Kaugummi roch.
»Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir keine haben«, sagte ich.
»Habt ihr sie aufgebraucht?«
»Ich glaube, wir hatten nie welche.«
»Na, dann müssen wir welche kaufen. Ich mache das hier noch fertig, es soll ja gut aussehen für die Party. Es ist tausend Jahre her, dass die alle hier waren.«
»Wer?«
»Die Familie!«
»Was für eine Party?«
»Die Petersilienhochzeit, wir haben Petersilienhochzeit! Das weißt du doch.«
»Das habe ich vergessen.«
»Sowas vergisst man doch nicht.«
»Das tut mir Leid«, sagte ich und bereute es direkt wieder. Ich entschuldigte mich viel zu oft, das fand Iben auch, aber man kann eine Entschuldigung ja nicht so einfach zurücknehmen.
Die Sprinkleranlage von den Feldern unseres Nachbarn Frank hatte unser Haus fast erreicht. Wir spürten die Tropfen auf unserem Rücken.
»Der Idiot, macht schon wieder auf dicke Hose«, brummte mein Vater, als die Wassertropfen die Fliesen dunkelgrau färbten.
Frank hatte unser Land komplett aufgekauft. Jetzt gehörte uns nur noch das Wohnhaus darauf, und das würden wir niemals loswerden. Niemand will ein Haus am Ende der Welt kaufen, ohne dass Ackerland dazugehört.
Mein Vater riss am Starterseil des Rasenmähers, der sofort ansprang. Er zerrte ihn mitten auf den Rasen. Das Gras flog in langen, dicken Halmen durch die Luft. Er fuhr über einen Maulwurfshügel, das Schneideblatt dröhnte, und Erde und kleine Steine schossen zu allen Seiten. Ich senkte den Kopf, starrte auf mein Heft mit den leeren Quadraten und schloss die Augen.
KAPITEL 3
Am nächsten Tag hatte ich alle Sudokus gelöst, bis auf das letzte. Das Killersudoku. Ich saß in meinem Zimmer und schrieb wahllos Zahlen in die leeren Felder. Mein Schreibtischstuhl war zu klein für mich geworden. Er quietschte bei jeder Bewegung. So wussten die anderen immer, ob ich zu Hause war. Ich hatte die Kommode vor meine Tür geschoben, damit niemand einfach ins Zimmer stürmen konnte. Ich rief O. P. an. Er legte sofort wieder auf. Ich versuchte es ein zweites Mal.
»Am Apparat!«, brüllte er, als es beim dritten Mal endlich klappte. Kratzende Geräusche im Hintergrund.
»Hier ist Tue.«
»Tach, Tue. Ich bin gerade auf dem Weg Richtung Grenze. Ich habe da was zu erledigen«, sagte er.
»Ich habe sie alle gelöst.«
»Was hast du gelöst?«
»Die Sudokus, die du mir gegeben hast.«
»Was soll das sein?«
»Na, das Sudokuheft, das du mir geschenkt hast.«
»Das ist doch mal was, Glückwunsch.«
»Die waren ziemlich einfach.«
»Was sagst du?«, rief er. Das Lachen im Hintergrund wurde lauter, dann hörte ich eine Frauenstimme etwas sagen. Aber ich konnte es nicht richtig verstehen.
»Die waren voll einfach«, brüllte ich. »Aber ich rufe wegen etwas anderem an, O. P.«
»Ja, was denn?«
»Kann ich in den Ferien zu dir kommen?«, fragte ich. »Nur für ein paar Tage. Ich kann dir dabei helfen, den Rasenmäher zu reparieren und in der Garage aufzuräumen und so.«
»Nicht notwendig«, sagte er. »Den habe ich verkauft.«
»Wir können auch was anderes machen.«
»Ich habe im Moment so viel um die Ohren«, antwortete er. »Hör mal, Tue, man darf beim Autofahren nicht telefonieren, sonst bekommt man Punkte. Und denk an Tante Trunte, die ist beim Telefonieren letzten Sommer gegen einen Baum gefahren. Ich muss doch ein gutes Vorbild sein.«
»Nur für ein paar Tage. Hier draußen ist es so langweilig.«
»Geh raus in Gottes schöne Natur, vor allem gibt es die auch noch umsonst.«
»Das ist nicht dasselbe.«
»was?«, brüllte er.
»Es ist nicht dasselbe.«
»Ich bin erst in einer Woche wieder da. Muss kurz nach Lettland und ein paar Dinge regeln. Wir sprechen, wenn ich zurück bin«, sagte O. P. »So, und jetzt muss ich auflegen, ich muss an der Tanke halten und dringend einen abseilen.«
»Kannst du dich dabei nicht mit mir unterhalten?«
»Bis bald! Und grüß deine Eltern von mir.«
Dann legte er auf. Ich saß reglos mit dem Telefon in der Hand, bevor ich es auf mein Bett schleuderte. Auf dem Regal stand die Topfpflanze, die ich vom Fensterbrett im Wohnzimmer mitgenommen hatte. Ich steckte meinen Finger in die noch feuchte Erde.
Meine Mutter saß im Wohnzimmer auf dem Fußboden. Sie hatte alle cds aus dem Regal genommen und packte sie in einen großen Karton.
»Ziehst du aus?«, fragte ich, als ich an ihr vorbeiging.
»Hör auf, so etwas zu sagen«, sagte sie. »Ich räume altes Zeug weg. Heute hört doch keiner mehr cds. Die nehmen nur Platz weg.«
Ich stellte mich an die Terrassentür und sah nach draußen. Mein Bruder Morten reparierte sein Fahrrad.
»Und was machst du so?«, fragte meine Mutter.
»Alles Mögliche.«
»Hast du Zeit, mit mir in die Stadt zu fahren? Ich will in den Baumarkt und Farbe kaufen.«
»Um was zu machen?«
»Na, um was zu streichen, natürlich.«
»Keinen Bock.«
»Ich dachte, wir könnten auch dein Zimmer streichen«, sagte sie. »Davon redest du doch schon so lange. Wolltest du es nicht schwarz streichen?«
»Ich dachte, das darf ich nicht?«
»Jetzt darfst du es, wenn du noch willst.«
»Ich fahre mit dir nirgendwohin«, sagte ich. Sie rief mir hinterher, während ich die Treppe hinaufging.
KAPITEL 4
Am nächsten Morgen war ich schon früh wach. Ich sah aus dem Dachfenster. Das Auto meiner Mutter stand nicht unten im Hof. Morten saß schon in der Küche und aß Toast mit Schokoblättchen. Er stand immer früh auf, zusammen mit meinem Vater, der neben ihm am Tisch saß und das Folkebladet vom Vortag las.
»Wo ist Mama?«, fragte ich.
»Sie musste in die Stadt, irgendein Termin in der Gemeindeverwaltung«, murmelte mein Vater. Die Zeitung nahm fast den gesamten Küchentisch ein. Mein Vater fuhr mit dem Finger über die Zeilen und las Buchstabe für Buchstabe. Das erkannte ich an der Bewegung seiner Lippen.
»Soll ich dir helfen, Papa?«
Er sah hoch.
»Wobei?«
»Mit der Zeitung.«
»Was meinst du?«
»Soll ich dir vorlesen, damit es schneller geht?«
Er schnaubte. Ich stellte mich hinter ihn und legte meine Arme um seinen warmen Hals, lehnte meinen Kopf an seinen und las eine Überschrift vor. Er stieß mich weg und faltete die Zeitung zusammen. Ich setzte mich an den Tisch.
»Kannst du nicht jemand anderen finden, an dem du dich rubbeln kannst?«
»Tschuldigung«, sagte ich.
»Papa kann prima allein lesen«, sagte Morten.
»Ganz genau«, sagte mein Vater und faltete die Zeitung wieder auseinander. Der Wasserkocher dampfte, das Fenster war ganz beschlagen.
»Das Wasser kocht, Papa«, sagte Morten. Er öffnete den Mund, um mir seinen zerkauten Toast zu zeigen. Ich schob meine Hand vorsichtig über den Tisch und tippte gegen sein Glas mit Milch. Es kippte um und ergoss sich über die Zeitung.
»Mann, könnt ihr nicht stillsitzen?«, schimpfte mein Vater und holte einen Wischlappen, den er einmal quer über den Tisch warf. »Man könnte glatt denken, ihr seid beide fünf Jahre alt!«
»Brauchst du das heiße Wasser nicht?«, fragte Morten.
»Mir ist langweilig«, sagte ich.
»Hast du keine Freunde?«, fragte Morten.
»Hier in der Nähe wohnt niemand, mit dem ich mich verabreden will. Die sind alle komisch.«
»Die sagen über dich bestimmt dasselbe«, sagte Morten.
»Und was ist mit deiner Freundin?«, fragte mein Vater.
»Sie ist nicht meine Freundin, außerdem ist sie noch in den Ferien.«
Mein Vater blätterte die Seite um.
»Können wir nicht von hier wegziehen?«, fragte ich. Er sah mich mit seinem leeren Blick an.
»Warum sollten wir?«
»Um etwas Neues auszuprobieren. Wir wohnen schon so lange hier. Es ist tierisch weit weg von allem.«
Mein Vater stand auf, rollte die Zeitung zusammen und stopfte sie in den Mülleimer unter der Spüle.
»Geht es dir hier nicht gut genug?«
Der Mülleimerdeckel knallte zu.
»Doch«, sagte ich. »Darum geht es nicht. Alles ist nur so weit weg. Und ihr hasst es, uns durch die Gegend zu fahren.«
»Hast du kein Fahrrad?«
»Bis in die Stadt sind es 16 Kilometer.«
»Als ich so alt war wie du, da sind wir überall hin mit dem Rad gefahren. Da hat sich niemand beschwert. Ihr seid ein so verzogenes Pack. Euch wird alles in den Arsch geschoben, und ihr bekommt alles, worauf ihr zeigt. Findest du nicht, dass es an der Zeit ist, ein bisschen Dankbarkeit zu zeigen? Neues Handy, neue Hose, neues Dies, neues Das. Was haben wir falsch gemacht?«
»Ihr habt nichts falsch gemacht.«
»Richtig«, knurrte er. »Du bist schon so auf die Welt gekommen. Und weißt du was? Wir werden hier bis ans Ende unserer Tage wohnen bleiben.«
Das ist eine lange Zeit. Viel zu lang.
KAPITEL 5
Meine Mutter hatte in der Stadt günstig zwei Eimer schwarze Farbe bekommen. Sollte Farbe übrigbleiben, konnten wir noch den Balkon damit streichen. Mein Vater hatte mehrere Versuche unternommen, ihn instand zu setzen, aber es wurde nie richtig was daraus. Das Holz rottete still und leise vor sich hin.
Meine Mutter stand auf einer Leiter und klebte die Fensterrahmen ab, während ich meine Sachen in den Flur räumte. Da stand sonst nichts, wir hatten zu wenige Möbel für das riesige Haus. Ich schleppte meine alte Lampe in den Flur. Die Fassung war zerbrochen, die Birne baumelte gegen den Ständer. Nach dem Abkleben legte meine Mutter den Teppich mit alten Werbeprospekten aus.
»Das hat mein Vater immer gemacht«, sagte sie. »So konnte er gleich pissen und Bier trinken, ohne dem Teppich zu schaden.«
»Clever.«
»Das ist super eklig«, sagte meine Mutter und faltete ein Prospekt auseinander.
Ich schnappte mir einen Stapel und begann am anderen Ende des Raums. Wir trafen uns in der Mitte. Sie stand vornübergebeugt und las etwas in einem der Prospekte. Ich hatte große Lust, sie zu schubsen. Sie wäre umgefallen wie ein Baum.
»Was ist los?«, sagte sie und richtete sich auf.
»Nichts.«
»Wollen wir anfangen?«
Sie lächelte mich an. Ich starrte auf die Cholesterinflecken in ihren Augen. Sie sahen aus wie kleine, flache, blasse Pilze. Das musste an den vielen Tabletten liegen. Sie nahm welche gegen Gicht und Ibuprofen, manchmal was gegen Migräne, seltener Zopiclon, um besser schlafen zu können. Sie war dabei, die Glückspillen abzusetzen. Jetzt würde es bald wieder besser werden, es gab keinen Grund mehr, warum es das nicht werden sollte.
In meinem Regal stand das alte Aquarium. Das Glas schimmerte noch immer grünlich, obwohl das Wasser und die Pflanzen schon seit Langem entfernt worden waren. Die toten Fische hatte ich ins Klo geschüttet. Mir fehlte es, etwas Lebendiges in meinem Zimmer zu haben. Ich hatte Probleme mit dem Einschlafen, wenn es so still war.
Ich hob das Aquarium hoch und stellte es gleich wieder auf den Boden.
»Das ist viel zu schwer«, sagte ich.
»Lass mich das machen.«
Meine Mutter hob es hoch, aber bekam es nicht richtig zu fassen, sie kämpfte mit dem Gleichgewicht. Ihr schlechter Arm zitterte. Sie stolperte aus dem Zimmer und stürzte dann im Flur zu Boden.
»Ist was passiert?«, rief ich.
»Alles gut, ich bin noch ganz«, sagte sie.
»Ich meinte das Aquarium.«
Ich ging zu ihr und sah es mir an. Der Glaskörper saß noch fest in dem Aluminiumrahmen. Meine Mutter rappelte sich auf und hielt sich den Arm.
»Warum gibst du nicht eine Kleinanzeige auf und verkaufst es, dann könntest du noch ein bisschen Geld damit verdienen?«
»Darum«, sagte ich. »Vielleicht hole ich mir doch wieder ein paar Fische.«
»Ich füttere sie garantiert nicht für dich.«
»Hast du letztes Mal auch nicht, als ich noch welche hatte.«
»Natürlich habe ich das.«
»Nein, du hast das Geld verspielt, das du von O. P. bekommen hast.«
»So redest du nicht mit mir, verdammt nochmal!«, rief sie und setzte sich auf die unterste Treppenstufe, zündete eine Zigarette an und rieb sich den Arm. Sie hatte Schmerzen und fluchte leise vor sich hin.
Ich öffnete einen Farbeimer und rührte um. Meine Mutter riss die Packung mit den Pinseln mit den Zähnen auf und spuckte das Plastik auf den Boden. Sie nahm sich den breitesten Pinsel und tauchte ihn ein paar Mal in die Farbe, bevor sie ihn auf die weiße Raufasertapete drückte. Sie zögerte.
»Findest du nicht, dass es ein bisschen düster wird in einem total schwarzen Zimmer?«
»Nee. Das will ich so.«
»Sollen wir erstmal nur eine Wand machen?«
Ich riss das Fenster auf, es roch zu sehr nach Rauch und Farbe. Meine Mutter hatte einen der Gartenstühle aus Plastik an der Flaggenstange gehisst. Auf solche Ideen kam sie, wenn sie glücklich war. Sie veränderte die Bedeutung von Gegenständen und ließ alle anderen ihren Wahnsinn im Wind flattern sehen, als wäre sie stolz darauf. Meine kleine Schwester Nina lag auf einem gestreiften Handtuch unter der Eiche und sonnte sich. Sie telefonierte mit einer Freundin. Ich liebte ihre etwas heisere Stimme, vielleicht war eine Raucherstimme erblich.
»Du weißt schon, was dein Vater dazu sagen wird, oder?«, fragte meine Mutter.
Dein Vater. Mein Vater würde sagen, dass das Haus dadurch an Wert verliert. Und dass ich es nur machen darf, weil ich der Älteste bin. Er würde auch sagen, dass ich ein Sonderling bin, das sonderbarste seiner Kinder, und er nicht weiß, was er mit mir anfangen soll.
»Wenn wir es jetzt nicht machen, erzähle ich Papa alles.«
»Was erzählst du ihm?«
»Das weißt du ganz genau«, sagte ich. Sie sah mich ängstlich an, und das machte mich glücklich.
»Was soll das denn jetzt?«, fuhr sie mich an. »Ich habe doch nur gesagt, dass ich keine Lust darauf habe, dass du in einer Woche rosa oder grüne Wände willst, oder so.«
Sie tauchte den Pinsel in den Eimer und schrieb meinen Namen über die Dachschräge.
»Du bist doch gestört«, sagte ich.
»Warum ist das gestört? So heißt du doch.«
Meine Mutter sah hoch an die Decke und malte das T ein zweites Mal nach. Dabei bewegte sie ihre Lippen und wiederholte lautlos meine Worte. Ich nahm eine Farbrolle, tunkte sie tief in den Eimer und malte auf alle Wände breite Streifen, damit wir gezwungen waren, den ganzen Raum zu streichen.
»Das sieht echt gut aus«, sagte meine Mutter, als wir fast fertig waren. »Und es trocknet schneller, wenn es so warm ist. Sie haben gesagt, es sollen bei der Party 29 Grad werden.«
»Die haben bei der Wettervorhersage bestimmt nichts über die Party gesagt.«
»Warum hackst du so auf mir rum? Du weißt doch ganz genau, was ich meine.«
Wir aßen Toastbrot und tranken Limo auf dem Hof, während die Farbe trocknete. Meine Mutter stellte ihre Füße in eine Waschschüssel mit heißem Wasser und Seife, die schäumte. Das Wasser wurde ganz dunkel. Sie zog ihren Pullover aus und trocknete sich damit die Füße ab. Dann nahm sie einen kleinen Hobel und schabte sich die Hornhaut ab. Die Hautschuppen fielen lautlos in den Kies.
KAPITEL 6
In meinem Zimmer stand das Fenster offen, obwohl es reinregnete. Die Fensterbank war voller Wassertropfen.
Die schwarzen Wände machten das Zimmer sehr dunkel, und ich hatte nur zwei Lampen. Ich sah auf den Hof. Dort stand kein einziges Auto. Meine Mutter war früh losgefahren, kurz nachdem mein Vater zur Arbeit aufgebrochen war. Sie hatte Nina gesagt, sie würde nur kurz einkaufen fahren. Jetzt war es schon nach sieben.
Ich ging ins Wohnzimmer. Nina saß vor dem Fernseher, aß Knäckebrot und sah was auf Disney Channel. Zwischen den Geräuschen der Zeichentrickfiguren konnte man das Krachen und Knuspern hören, wenn sie abbiss. Die Fernbedienung lag in einer Saftpfütze auf dem Tisch. Sie war klebrig.
»Wann kommen Mama und Papa nach Hause?«, fragte Nina, ohne mich dabei anzusehen.
»Weiß ich nicht«, sagte ich.
»Können wir sie nicht anrufen?«
»Klar können wir das.«
Ich zog mein Handy aus der Hosentasche und suchte die Nummer meines Vaters heraus.
»Machst du das?«, fragte Nina.
»Nein«, sagte ich und rief ihn an. Ich schaltete den Lautsprecher ein, bevor ich ihr mein Handy gab. »Du sprichst mit ihm.«
»Warum?«
»Papa mag dich am liebsten.«
»Das stimmt nicht.«
»Doch.«
»Papa mag uns alle gleich gern.«
»Nicht alle.«
»Doch.«
Nina machte den Fernseher leiser. Es war nicht sicher, dass er rangehen würde. Vielleicht steckte sein Telefon in seiner Jackentasche oder in der Konsole des Transporters. Es hörte nicht auf zu tuten. Ich wartete darauf, dass die Mailbox ansprang und starrte Nina an.
»Ich bin’s«, hörten wir ihn plötzlich sagen.
»Kommst du bald nach Hause?«, fragte Nina.
»Ich bin noch bei der Arbeit. Ich komme später.«
»Und was gibt es zu essen?«
»Mama macht euch was zu essen.«
»Sie ist nicht zu Hause«, sagte Nina.
»Klar. Sie sitzt in ihrem Zimmer und spielt.«
»Nein«, sagte Nina. »Sie ist weggefahren.«
Ich stieß ihr in die Seite und riss ihr das Telefon aus der Hand.
»Hier ist Tue«, sagte ich. »Nina will wissen, wann du nach Hause kommst.«
»Das habe ich doch gerade gesagt, verdammt nochmal. Ich bin bei der Arbeit. Ich komme später.«
»Tschuldigung«, sagte ich.
»Hör auf, dich immer zu entschuldigen.«
Ich legte auf und steckte das Handy zurück in meine Hosentasche. Nina war wieder in ihre Zeichentrickserie vertieft. Der Stuhl knarrte, als ich aufstand.
Es war still in der Küche. Im Gefrierfach waren noch ein paar Brötchen.
»Nina!«, rief ich, und sie kam sofort angerannt. »Kannst du den Backofen anmachen?«, fragte ich.
Sie nickte und hüpfte los. Ich holte alles an Aufschnitt aus dem Kühlschrank.
»Kannst du die Sachen hier auf den Tisch stellen?«, fragte ich sie und gab ihr den Käse und Schinken. Sie nickte und trug sie zum Tisch.
»Was willst du trinken?«, fragte ich.
»Cola!«
»Dann hol was aus dem alten Badezimmer.«
»Dürfen wir das denn?«
»Ja«, antwortete ich. »Wenn Mama und Papa nicht zu Hause sind, darf man alles.«
KAPITEL 7
Morten und ich standen in der Küche und verzierten die Eistorten mit Marzipanrosen, damit sie wie selbstgemacht aussahen. Meine Mutter hatte auch Tortenfontänen gekauft. Wir sollten die Torten zum Abschluss des Abends an den Tisch bringen, während von irgendeinem Handy der »Champagner-Galopp« abgespielt wurde. Eigentlich hatte ich schon beschlossen, bei der Party nicht dabei zu sein.
»Du bist so egoistisch, du willst immer nur allein sein«, hatte meine Mutter mich angeschnauzt, als ich ihr das mitteilte. Ich hatte schlagartig Bauchschmerzen bekommen, weil sie recht hatte. Jetzt galt es nur, diesen Abend zu überstehen.
Das Küchenfenster stand offen, und wir mussten uns beeilen, weil die Eistorten schon anfingen zu schmelzen. Sie sollten bis zu ihrem Einsatz zurück in die Gefriertruhe.
»Kann ich jetzt mal fröhliche Gesichter sehen?«, rief uns meine Mutter durchs Fenster zu. Sie war auf dem Hofplatz und hängte Lichterketten an die Wäscheleine, unter der zwei Gartentische standen, die sie zusammengeschoben hatte. An der Leine hing auch ein schimmernder blauer Luftballon. Die anderen in der Packung waren bröselig und ließen sich nicht aufblasen. Mein Vater hatte rosa Bauernrosen mitgebracht, die auf dem Tisch standen und die Köpfe hängen ließen.
»Die Gäste kommen bald, her mit der guten Laune! Ich will ein Lächeln sehen, Kinder!«, rief meine Mutter.
»Ich kann nicht lächeln, wenn ich mich konzentrieren muss!«, rief Morten und ging ins Badezimmer, um sich die Haare zu machen.
»Freust du dich denn gar nicht, Tue?« Meine Mutter sah durchs Küchenfenster.
»Nein«, sagte ich, weil ich nicht lügen wollte. »Ich will nicht dabei sein. Das willst du ja auch nicht. Wolltest du nicht nach Fünen ziehen?«
»Sei still. Darüber reden wir heute nicht. Heute wird gefeiert.«
Meine Mutter hatte sich ihr Hochzeitskleid umnähen lassen, damit es ihr wieder passte. In den vergangenen zwölfeinhalb Jahren hatte sie einige Kleidergrößen zugenommen. Irgendwie hatte das Fett sie in die Knie gedrückt, sie krumm gemacht. In einem Fotoalbum bei O. P. und Oma hatte ich sie als junge Frau gesehen. Damals war sie hübsch gewesen. Das war lange vor meinem Vater und uns. Lange vor der Totgeburt, den vielen Rechnungen, den Nachrichten von der Kommune und der Depression. Sie hätte so hübsch sein können.