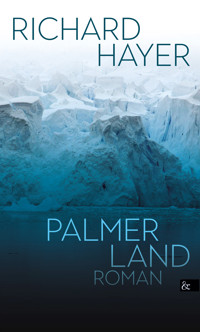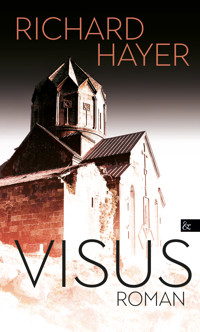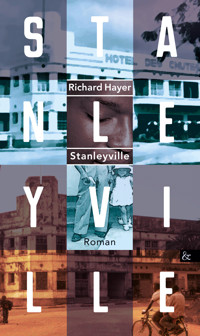
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Buch&media
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Das Jahr 1964. In dem von Belgien unabhängig gewordenen Kongo tobt ein Bürgerkrieg. Zauberer, die Unverwundbarkeit versprechen, führen die Rebellen an. Menschen werden massakriert, tausende als Geiseln verschleppt. Mehr als drei Monate wird die kleine Kim Lacquemont in der Stadt in der Mitte des endlosen Regenwaldes mit ihrer Familie in einem Keller gefangen gehalten. Sie überlebt, scheinbar unter dem Schutz einer rätselhaften hölzernen Maske, dem Abbild eines entsetzlichen dämonischen Mischwesens aus Mensch und Insekt. Fünfundvierzig Jahre später: Dutzende Exemplare der gleichen Maske tauchen in einem stillgelegten Parkhaus im Stadtzentrum von Brüssel auf. Täglich verschwinden Kinder spurlos, die Zahl wächst rasant, ein Ende ist nicht abzusehen. Die Polizei steht vor einem Rätsel, manche sprechen gar von einem Krieg. Kim ist mittlerweile Ärztin. Auf der verzweifelten Suche nach ihrer verschwundenen siebzehnjährigen Nichte ist sie gezwungen, an den Ort zurückzukehren, an den sie sich ihr Leben lang nicht denken konnte, ohne das Bewusstsein zu verlieren zurück in den Kongo, zurück in die Erinnerungen an das Jahr 1964, zurück nach Stanleyville.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 497
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Richard Hayer
STANLEYVILLE
All rights reserved.
© Buch&media GmbH, 2024
Lektorat: Sabine Krieger-Mattila, Königswinter
Satz: Felix Bartels, Osaka
Umschlag: Maja Bechert, Hamburg
ISBN 978-3-95780-305-4
www.buchmedia-publishing.de
Für Margarethe
Es gab Augenblicke, da die eigene Vergangenheit vor einem aufstieg in Gestalt eines ruhelosen und schreienden Traums, an den man sich verwundert erinnerte – hier unter der überwältigenden Wirklichkeit dieser seltsamen Welt der Pflanzen, des Wassers und des Schweigens. Diese Stille des Lebens ähnelte in nichts dem Frieden. Es war die Stille einer unversöhnlichen Macht, die über einer unerforschlichen Absicht brütete. Sie blickte einem rachedurstig entgegen.
Joseph Conrad,
»Das Herz der Finsternis«
Inhalt
Belgien
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Kapitel 31
Kapitel 32
Kapitel 33
Kongo
Kapitel 34
Kapitel 35
Kapitel 36
Kapitel 37
Kapitel 38
Kapitel 39
Kapitel 40
Kapitel 41
Kapitel 42
Kapitel 43
Kapitel 44
Kapitel 45
Kapitel 46
Kapitel 47
Kapitel 48
Kapitel 49
Kapitel 50
Kapitel 51
Kapitel 52
Kapitel 53
Kapitel 54
Kapitel 55
Kapitel 56
Kapitel 57
Kapitel 58
Kapitel 59
Kapitel 60
Kapitel 61
Kapitel 62
Kapitel 63
Kapitel 64
Kapitel 65
Stanleyville
Kapitel 66
Kapitel 67
Kapitel 68
Kapitel 69
Kapitel 70
Kapitel 71
Kapitel 72
Kapitel 73
Kapitel 74
Kapitel 75
Kapitel 76
Kapitel 77
Danksagung
Quellen Der Zitate
BELGIEN
1
FREITAG, 26. JUNI
Kim Lacquemont erwachte mit der Karte eines Taxiunternehmens in der Hand. Es war sieben Uhr, und sie konnte sich beim besten Willen nicht daran erinnern, wie sie gestern Nacht nach Hause gekommen war. Je genauer sie darüber nachdachte, desto deutlicher tat sich ein Loch von einigen Stunden auf.
Sie schlug die Bettdecke mit dem blassblauen Blütenmuster zurück und sprang auf. Farben in hellen Mustern, schoss es ihr durch den Kopf, wie komme ich immer wieder zu der unbeschwerten Schmetterlingswelt eines kleinen Mädchens? Mit Bedacht setzte sie ihre Schritte. Der Fußboden war mit Reisegepäck, Impfbescheinigungen, Pass und Flugtickets übersät.
Sie streckte sich in ihrem blassroten Schlafanzug, der blassrot gepunkteten Jacke über blassrot karierter Hose aus einem warmen, weichen Baumwollstoff, und legte eine CD mit Klaviertrios von Mozart in ihre Stereoanlage. Als es an der Tür klingelte, warf sie sich einen Mantel über.
Mit den Spediteuren, die kamen, um die Praxiseinrichtung ihrer verstorbenen Mutter abzutransportieren, strömte ein Schwall frischer Sommerluft ins Haus. Der Chef der Truppe, ein massiger Mann von fast siebzig Jahren, der einen altmodischen Filzhut wie angewachsen auf dem Hinterkopf trug, trat als Letzter ein.
Eine Weile blieb Kim vor der Rückseite ihres Hauses in Ukkel stehen. Noch war die Luft frühlingshaft warm, bald würde es unter dem strahlend blauen Himmel so heiß werden wie all die Tage zuvor. Achtunddreißig Grad im Schatten waren keine Seltenheit, jedermann in Brüssel ächzte unter der staubtrockenen Hitze. In den Straßen sah man Passanten, die sich Mineralwasserflaschen über den Köpfen entleerten, manche unternahmen leichtsinnige Aktionen auf den Dächern ihrer Häuser, doch die meisten Menschen bewegten sich schneckenhaft träge in ihren abgedunkelten Wohnungen. Kim erschien es wie ein Menetekel, dass ausgerechnet jetzt, kurz vor ihrer Abreise auf die Antillen, tropische Glut Einzug hielt. Als wollte eine höhere Macht sie zwingen, es sich noch einmal zu überlegen. Ein weißer Mercedes mit Weißwandreifen, Baujahr 1976, rollte vor ihr aus.
Kim hatte den ehemaligen Kollegen ihrer Mutter, der die Praxiseinrichtung übernehmen und das Verpacken beaufsichtigen wollte, erwartet. Mit festem Händedruck begrüßte sie einen großen Mann, in dessen Gesicht unter einem dichten weißen Haarschopf sich auffallend fröhliche Augen bewegten. Kim führte ihn zu den Umzugsarbeitern im Haus und ging dann in ihr Bad. Unter der Regendusche öffnete sie den Mund und trank, den Kopf weit in den Nacken gelegt. Sie sehnte sich danach, etwas anderes als heißes Wasser auf ihrer Haut zu spüren. Warum war Warren jetzt nicht in ihrer Nähe? Jetzt, wo sie ihn verdammt noch mal brauchte.
Das Wasser ließ ihre Haare im Nacken zusammenfließen. Sie liebte Warren. Selten gestand sie es sich ein, vor allem aber liebte sie die Distanz. Was ihr zu nahe kam, erdrückte sie, aber wenn sie sich alleingelassen fühlte, belebte sich ihr Innenleben mit unerträglichen Ameisenvölkern unruhiger Ideen. Wie wollen wir auf diesem schmalen Grat gemeinsam ein Haus bewohnen?
Eine Musik war in ihrem Ohr, ein melancholisches Lied, das sie gestern gehört haben musste, gesungen von einer Frau. Weder konnte sie sich an den Text noch an die genaue Melodie erinnern, mehr als eine harmonische Wehmut in ihrem Kopf war davon nicht übrig geblieben.
Plötzlich traf es sie wie ein Schlag ins Genick. Der Betonboden zu ihren Füßen war mit Dingen bedeckt, die in flackerndem Licht schwarzen Schildkröten glichen. Herden großer, wie abgewetztes Leder glänzender, regloser Tiere.
Kim schaffte es, den Kaltwasserhahn ihrer Dusche aufzudrehen. Der Schwall verscheuchte die Illusion. Sie stand sicher auf dem weißen Fliesenboden der Dusche. Was war das? Erinnerungen an die letzte Nacht? Unmöglich. Was sie soeben gesehen hatte, war zu abstrus und surreal. Ein Albtraum, Nachwirkungen eines Films. Vielleicht die Panik vor dem aufwendigen Renovierungsprogramm des alten Hauses, das sie sich vorgenommen hatte.
Ihr Herzschlag beruhigte sich nur langsam.
Eingewickelt in einen flauschigen, viel zu großen gelben Bademantel, den ihr Warren irgendwann in London gekauft hatte, trocknete sie sich die Haare. Kurz nach acht saß sie vor einer Tasse Kaffee und einem großen Glas Leitungswasser in der Küche. Einige ihrer Lebensgeister waren wieder geweckt. Appetit hatte sie höchstens auf eine einzige rostbraun getoastete Scheibe Brot mit einem hauchdünnen Butteraufstrich. Sie liebte das Geräusch, wenn das Messer über die krosse Oberfläche knisterte, sie liebte den Biss hinein, den zarten Hauch von Butter. Eine Scheibe sollte ihr für die morgendliche Meditation über die einfachen Dinge des Lebens reichen. Mehr war nicht nötig.
Sie wendete die Karte von »Taxi Orange« in der Hand. Wie war sie in der Nacht heimgekommen?
Die Straße vor der Vorderseite ihres Hauses wirkte wie ausgestorben. Im Bademantel trat sie einige Schritte vor die Tür. Inzwischen herrschte auf der Straße wieder die drückende, staubtrockene Hitze, die jeder seit Wochen kannte. Eine Wüste musste sich der Brüsseler Stadtgrenze genähert haben.
Ihr Auto war nirgends zu sehen. Sie brauchte nicht lange, um festzustellen, dass es auch nicht in der Garage stand.
Wie konnten mehrere Nachtstunden und ein rotes Auto abhandenkommen? Hatte sie selbst es irgendwo in der Stadt gelassen, weil sie schon in der Nacht nicht mehr wusste, wo es war? War sie betrunken gewesen? Unmöglich. Nach zu viel Alkohol fühlte sich in ihrem Innern nichts an.
Das Letzte, an das sie sich erinnern konnte, war eine Verabredung mit ihrer Nichte im Zentrum der Stadt. Vielleicht fand sich im Haus etwas, das ihrer Erinnerung auf die Sprünge half.
An der Flurgarderobe hing der Rucksack ihrer Nichte Caline. Sie tastete mit der Hand hinein. Eine leere Champagnerflasche, ein abgebrochenes Stück Holz. Nichts klingelte in ihrer Erinnerung.
Das Haus, vor ihrem geistigen Auge schon ausgeräumt, erschien Kim größer denn je. Solange sie sich erinnern konnte, hatte sie seine Dimensionen als selbstverständlich hingenommen, jetzt wirkten sie bedrohlich.
Sie ging hinüber in den hinteren Teil des Hauses, das 1910 an einem Hang errichtet worden war. Als ihr Großvater es bauen ließ, hatte er das Ziel verfolgt, den ganzen Clan unter einem Dach zu versammeln. Die große Anwaltskanzlei Boerrinck & Boerrinck wurde im Hochparterre auf der Rückseite untergebracht, wo es zwei Stockwerke mehr gab als auf der vorderen Seite. Am Anfang der Avenue d’Orbaix, die sich in einer schmalen Haarnadelkurve krümmte, machte das Haus Nummer 3 den Eindruck eines blendend weißen englischen Landhauses. Wer sich vom Ende her näherte, meinte, mit der Nummer 14 ein großes städtisches Wohn- und Geschäftshaus vor sich zu haben.
Von unten drangen laute Rufe herauf, als die Männer der Spedition weißlackierte Blechschränke durch die Türen jonglierten.
Am hinteren Eingang erkannte sie einen Lieferwagen der Firma, der sie das gesamte Ausräumen, Einlagern und das genau geplante Wiedereinräumen ihres Hauses vor, während und nach der Renovierung übertragen hatte. »Transporteur Jucquois« verkündete die gelbe Aufschrift auf hellblauem Grund.
Kim rief bei »Taxi Orange« an. Der Abbruch der Verbindung erlöste sie aus einer endlosen Warteschleife. Dann wählte sie die Nummer der Polizei. Bis sie Gelegenheit bekam, zu melden, dass ihr roter Saab letzte Nacht von seinem Platz vor ihrem Haus verschwunden war, wurde sie mehrfach von einem Beamten zum nächsten weitervermittelt.
»Gestohlen?«, wiederholte sie die Frage des Beamten, »ich habe keine Ahnung. Vielleicht von Jugendlichen für eine Spritztour genutzt.«
»Also gestohlen.«
»Wohl ja.«
»Oder haben Sie vergessen, wo Sie ihn geparkt haben?« Sie konnte förmlich sehen, wie er einen Kollegen angrinste, der in einem anderen Gespräch zu hören war.
»Ich weiß genau, wo er war«, sagte sie fest, »vor meinem Haus. Dort ist er nicht mehr. Gestohlene Wagen dienen, wie Sie wissen, der Vorbereitung weiterer Straftaten. Helfen Sie mit, die zu verhindern, indem Sie meinen roten Saab finden.« Armleuchter. Sie gab alle nötigen Daten an den Beamten weiter und beendete das Gespräch.
In der oberen Etage wartete sie vor Calines geschlossener Zimmertür, hinter der sich früher die kleine Einliegerwohnung ihrer Großmutter befunden hatte. Noch schlief ihre Nichte. Um zwölf Uhr sollten in ihrer Schule bei einer großen Zeremonie in der Aula Abschlusszeugnisse und die Zeugnisse der jüngeren Jahrgangsbesten übergeben werden. Caline war eine von ihnen.
Für dieses stolze Ereignis hatten sie am letzten Samstag ein elegantes, dunkelblaues Kostüm beschafft. Caline hatte sich darin vor dem Spiegel mit allen Grimassen, die ihr Gesicht hergab, überprüft und war ausnahmsweise nicht in nervendes Gejammer ausgebrochen. Ein Zeichen für allerhöchste Zufriedenheit. Sie hatte zauberhaft in diesem Kostüm ausgesehen, fand Kim.
Sie zögerte eine Weile. Aus irgendeinem Grund hatte sie das Gefühl, dass sie jetzt nachsehen sollte. Vielleicht wusste Caline, was gestern Nacht geschehen war – und wo sich der Saab befand.
Es war noch mehr als eine Stunde Zeit, bis sie sie wecken musste. Sollte sie noch ausschlafen. Vorher war der Dachboden an der Reihe.
Seit ihren Kindertagen hatte Kim den Speicher nicht mehr betreten. Sie musste endlich mit ihren Aufräumarbeiten beginnen, damit die Handwerker am Sonntagnachmittag, wenn sie das Haus zwei Wochen lang für sich allein haben würden, mit der groß angelegten Renovierung loslegen konnten.
Auf ihrem Weg nach oben begleitete sie die Angst, unter der Dusche könnte sie doch eine echte Erinnerung überfallen haben. An welchem verrückten Ort habe ich, um alles in der Welt, die letzte Nacht zugebracht?
2
In der leer geräumten Diele am oberen Treppenabsatz waren die Planungsunterlagen für das abschließende Gespräch mit dem Bauingenieur ausgebreitet. Wie der zweigeschossige, niemals so recht fertiggestellte Keller erstreckten sich auch alle Räume des Dachbodens über die vollen zweihundertvierzig Quadratmeter der Grundfläche – über das dreistökkige Kontorhaus und das ebenerdige Landhaus. Die Fläche unter dem Dach war in etwa geviertelt zwischen der kleinen Wohnung mit Calines Zimmer, einem leer geräumten Teil, der früher zum Trocknen von Wäsche gedient hatte, einem Teil, in dem die Baustoffe aus verschiedenen Renovierungsphasen des Hauses gelagert waren, und dem Speicher, der achtzig Quadratmeter belegte. Über vier kleine Dachluken drang nicht genug Licht in den großen vollgestopften Raum. Kim schaltete eine Reihe nackter Glühbirnen ein, die von den Deckenbalken hingen. Angesichts der sich auftürmenden Überbleibsel früheren Lebens, der ungeordneten Erinnerungen, der Andenken, des Ausrangierten und Abgelagerten überkam sie die schiere Verzweiflung.
In einem weißen Laborkittel aus der ehemaligen Praxis ihrer Mutter setzte sie sich in einen roten Plüschsessel, der eine Wolke von Staub ausstieß. Ein Schrank mit Packen von Akten. Sie schlug die erste auf. Eine Patientenakte aus dem Jahr 1980. Kim klebte einen roten Punkt auf den Schrank: Alles darin konnte vernichtet werden.
Nach einer Stunde holte sie sich aus der Küche einen Kaffee. Die dampfende Tasse in den Händen lehnte sie sich wieder in dem Sessel zurück. An den Glühbirnen unter den Dachbalken verbrannte Staub. Es roch alt. Es roch nach der großen Welt des Dachbodens, auf dem sich die kleine Kim vor ihrem Bruder Claes versteckte. Inzwischen hatten sich die roten Punkte wie ein Schwarm Feuerkäfer über den Dachboden verbreitet.
Sie stieß auf einen Karton »Kim«. Er war angefüllt mit einem Sammelsurium von Schulheften und Büchern, Zeug, das ihre Mutter zusammengeworfen hatte, um es aus dem Weg zu haben.
Dann fand sie eine großformatige Kladde mit der Aufschrift »1997«. Die erste Seite war zu einem Drittel mit Notizen für den anstehenden Besuch bei einem Dr. Georges Tassignon gefüllt. Sie las den Satz: »... wahnsinnige Kopfschmerzen, an Afrika zu denken ...« Es war ihre Schrift, es waren ihre eigenen Notizen. Der Rest des Buches war leer.
Kim horchte in sich hinein. Afrika? Sie fühlte keine Kopfschmerzen. Aber sie erinnerte sich an die Therapie, die sie begonnen, aber schnell abgebrochen hatte, bei der es um ihre Kindheit in Afrika gehen sollte.
Sie hob sich einen Karton mit Briefen und Fotos aus dem Besitz ihrer Großmutter auf den Schoß, die von ihrer Mutter abgelegt worden waren – und war von Afrika umgeben.
Briefe und Sendungen, die ihre Mutter in den Jahren 1955 bis 1964 aus dem Kongo nach Hause geschickt hatte. Ansichtskarten aus einer Utopie. Auch wenn ihr Puls höher zu schlagen begann, wenn sie an Afrika dachte, konnte Kim sich dem Zauber nicht entziehen, den die schwarz-weiß fotografierten, überrealen Landschaften verströmten.
Aus einem Brief mit einem längeren Bericht ihrer Mutter vom September 1957 rutschte ein Foto. Es zeigte ein strahlend weißes Gebäude, das langgestreckt und zweistöckig, in der Mitte geteilt von einem großartig aufragenden Portal, zwischen locker gruppierten Palmen lag. Auf der Treppe des Portals hatte sich eine Gruppe von Männern und Frauen unter einer Schrifttafel »Symposium on Virus Diseases in Africa« aufgebaut. Auf der Rückseite fand sich eine Notiz in der Handschrift ihrer Mutter:
»Einweihung des neuen Laboratoriums in Stanleyville, in dem wir medizinische Proben aus allen Hospitälern der zentralen und östlichen Provinzen des Kongo untersuchen werden.« Darunter eilig hingeschrieben der Ausruf: »Großer Gott! Das Meer ist so weit, und mein Boot ist so klein!« Die letzte Nacht hatte Kim hautnah mit Afrika in Berührung gebracht. Deshalb hatte sie die Erinnerung verloren. Wann immer Afrika ihr zu nah kam, stieg physisches Unbehagen in ihr hoch. Solange sie sich erinnern konnte, hatte sie versucht alles, was mit diesem Kontinent zu tun hatte, von sich fernzuhalten.
Sie atmete mehrfach tief durch, bevor sie sich wieder der heilen Welt der Postkarten zuwandte.
In den Fünfzigerjahren hatte man alles entdeckt, was hinaus in die Zukunft führte. Die Welt hatte ihre größte Ausdehnung erreicht – zugänglich überall, aber noch nicht geschrumpft, wie in den Jahren danach. Auch die Zukunft hatte ihre größte Ausdehnung erreicht. Die unendliche Kraft des Fortschritts, die Zivilisation, die sich bis ans Ende der Milchstraße träumte – der Kongo, Stanleyville in der Mitte Afrikas, schien da nur ein Planet der Wildnis auf dem Weg zum Horizont des Universums zu sein. Elegante Limousinen vor einem »Hotel Cosmopolite«, gebaut in den geschwungenen Linien des Optimismus dieser Zeit, in der die Schaffung des Paradieses eine Aufgabe der Tagespolitik war. Die unsichere belgische Nation hatte einen Planeten in der Mitte der Dunkelheit besiedelt, hinter der sich die Zukunft verbarg. Afrika. Der Kongo. Die fortschrittlichste Kolonie der Welt.
Eine der Postkarten zeigte ein Luftbild von einer tropischen Villenvorstadt. Große Einfamilienhäuser, in deren Gärten als helle Rechtecke Swimmingpools zu erkennen waren, lagen aufgereiht an geschwungenen Straßen unter Palmen. Am östlichen Bauch der Biegung einer Wendeschleife war ein Kreuz eingezeichnet, ein Pfeil und die Nummer »32B«. Auf der anderen Seite trug die Karte das Datum 16. Mai 1964 und nur wenige Worte in der Schrift ihrer Mutter. »Endlich wieder im wunderschönen Yangambi. Ein Traum, der zu Ende geht.«
Yangambi. Ein märchenhafter Name, der nach der Heimat freundlicher Fabelwesen klang.
Kim blätterte in einem Reiseführer aus dem Jahr 1954. Er zeigte Fotos schnurgerader Straßen zwischen Palmen, Aufnahmen von Avenuen, die sich zwischen sanften Hügeln in die Ferne schwangen, die Wälder waren zu schmalen Einrahmungen zurechtgestutzt. Nur auf einem Bild erkannte sie den Ozean des Lebens jenseits der Straßen, die in Wahrheit Fäden waren, die man über ein lebendiges Ungeheuer gesponnen hatte. Sie blickte auf malerische Touristenattraktionen in den östlichen Bergregionen, zu denen frisch geebnete Straßen führten. Sie sah Wildhüter in ihren Wagen, Schulen, Missionen, Bahnhöfe inmitten unwegsamer Wälder, an Flüssen, in den Bergen, auf deren Gipfel Hospitäler thronten. Hospitäler für die Belgier, für die Eingeborenen, Hospitäler der katholischen Mission und amerikanischer Missionen, Hospitäler der Plantagen- und Minengesellschaften.
Kaum jemals waren Menschen auf den Bildern zu erkennen, die Promenaden, die Straßen, die Rondelle, die Uferwege waren leer. Die Zivilisation drang mit der Leere vor. Unaufhaltsam. Die Menschen jenseits der Fotos mussten ihr Leben nach dem Rhythmus der Elektrizität, der Motoren, der Flieger und Kraftwagen, nach dem Raster von Straßen, nach den Regeln von Hospitälern und Schulen richten. Mit der Kenntnis des weiteren Schicksals des Kongo erschien es Kim, als wäre in der utopischen Naivität der Fotos bereits die Wehmut des blutigen Scheiterns angelegt. Zu großartig, um real werden zu können. Zu schön, um von Bestand zu sein. Die Perfektion der Wolken, des Lichts, der geschwungenen Formen von Kraftwagen und Häusern: Die Reinheit des Schwunges in die Utopie war wie ein Filmset aufgebaut. Jenseits des fotografierten Ausschnitts mussten Hunderte von Menschen mit Besen und Farbeimern, mit Gartenscheren, Gießkannen und Straßenwalzen präsent sein, die für die langen Belichtungszeiten der Fotos aus der Bildfläche gewinkt worden waren. Die Linien der Eisenbahnen, die Fernstraßen, das Gewebe der Zivilisation waren auf einer Eisfläche errichtet worden. 1960 hatte es zu tauen begonnen, 1964 tobten Sommergewitter, heute war der Kongo ein chaotisches Meer, auf dessen Grund die Ozean-Liner der Utopien von damals lagen. Von unten erklang die Haustürklingel.
Kim legte das Buch zur Seite und nahm eine große Papiertüte mit der Aufschrift »1955« in die Hand. Vielleicht hatte sie Glück und fand ein Foto ihres Vaters, von dem im ganzen Haus nie ein Bild existiert hatte. Briefe, ein Foto. Sie warf einen kurzen Blick darauf: eine Hochzeitsgesellschaft vor einem »Hôtel des Chutes« an palmenbestandener Promenade vor träge dahinströmendem Fluss, weit wie ein Meer. Der Kongo. Die Braut. Die Gäste.
Kein Bräutigam.
Sie glaubte, nicht recht zu sehen. Das einzige Foto in dem einzigen Brief über die Hochzeit ihrer Mutter mit Pierre Lacquemont im Jahr 1955 und der Bräutigam war nicht zu sehen? In der Handschrift ihrer Mutter stand auf der Rückseite »Deine Tochter am glücklichsten Tag ihres Lebens, fotografiert von dem glücklichsten Mann der Welt«. Kein Bild ihres Vaters. Was für eine Hochzeit war das gewesen? Sie steckte die Papiere in die Kitteltasche. Später würde sie sich alles sehr genau ansehen.
Es klingelte wieder, jetzt länger.
»Ich komme«, rief Kim, »einen Moment.« In einem kleinen Bücherschrank mit Fachbüchern wie »Malaria Front Line: Australian Army Research During World War 2« und »Malaria Eradication Program in Mexico 1955« erregte ein Buch ihre Aufmerksamkeit, das nicht in diesen Zusammenhang gehörte: »Out of the Jaws of the Lion«. Den Fängen des Löwen entkommen. Der Bericht eines Amerikaners über eine Revolte in Stanleyville, heute Kisangani, der Stadt, in der sie geboren wurde. 1964. Das Jahr, in dem sie aus dem Kongo nach Brüssel gezogen waren. Offenbar hatte ihre Mutter dieses Buch gelesen, denn in viele Seiten waren Eselsohren eingekniffen und Passagen waren angestrichen. Kim begann zu lesen.
»Vier Schamanen in ihrem vollen Schmuck tanzten an der Spitze der Invasionsarmee nach Stanleyville hinein. Gekleidet in Pflanzen und Federn des Dschungels verkörperten sie eine Macht, die einen in Erschauern versetzte. Um jeden Nacken hing ein Fetischbeutel, der die mysteriöse Quelle ihrer Kraft enthielt. In Panik warfen Stanleyvilles Verteidiger ihre Bazookas von sich und flüchteten. Zwei Tage später kontrollierten die Simbas die Stadt.«
Mehr als diesen kurzen Absatz schaffte sie nicht.
Ein Blatt segelte aus dem Buch auf die Dielen herab. »Motiyo« war darauf handschriftlich notiert, darunter: »Der Ndoki des Erscheinens und Verschwindens.«
Auf einem angehefteten Zettel linierten Papiers war in der säuberlichen Schrift ihrer Mutter vermerkt: »Bericht der Belgischen Marine, November 1964 – für Kims Therapie im Juli 1997 an ihren Psychologen Georges Tassignon gegeben.«
Sie drehte das Blatt um.
Mit beiden Händen musste sie sich an der Rückenlehne des Sessels festhalten. In ihrer Hand hielt sie das Foto einer afrikanischen Maske, groß, geradezu gewaltig schien sie das Format des Abzugs zu sprengen.
Mehr als ihre Augen konnte Kim nicht bewegen – schon das kostete unglaubliche Anstrengungen. Sie starrte in die Dachschräge über ihrem Kopf.
Licht. Staub. Zeitlose Ruhe.
Als Caline etwa fünf war, hielt sie sich gern in den Ästen der beiden Eschen auf, die damals auf dem Grundstück standen. Sie liebte es, Kim von oben zu erschrecken, sie von dort still zu beobachten, in das eine oder andere Fenster zu blicken, vor allem aber, ihr mit einem lauten Vogelschrei aus der Höhe Angst einzujagen. Kim zeigte ihre Angst lautstark, keinesfalls wollte sie Caline zu waghalsigen Manövern verleiten, weil sie nicht genug erschrak.
Jetzt hing Kims Blick oben im Gebälk wie ein Paar zitternder blauer Vögel. In die fein gesponnene Erinnerungswelt des Dachbodens war ein ungeheuerliches Monstrum getreten. Ein Wesen zwischen Mensch und Dämon, das jede Sekunde der letzten Nacht wiederbrachte.
3
DONNERSTAG, 25. JUNI
Die Hitzeglocke über der Stadt war wie geschaffen dafür, siebzehnjährige Mädchen auf verrückte Ideen zu bringen. Die Luft hatte sich seit Wochen keinen Zentimeter bewegt, es war ein Glück, wenn man Gelegenheit hatte, mit der Bahn die Stadt zu durchqueren.
Kim betrachtete Caline, die ihr im Zug von Watermaal zum Residenzpalast gegenübersaß. Die blonden Haare flatterten im Fahrtwind, als würden sie von einem Sturm ihrer Fantasien bewegt. Was Caline ihr weismachte, um Kim zu einer mitternächtlichen Tour in das Zentrum der Stadt zu bewegen, war komplett verrückt. Dafür liebte Kim ihre Nichte.
»Brüssel besteht aus drei Städten«, erklärte Caline, »gebildet von drei Arten von Bauwerken. Obwohl sie eng benachbart sind, haben sie wenig miteinander zu schaffen: Bürgerhäuser der alten flämischen Handelsmetropole, Paläste der Monarchie, die den zusammengewürfelten belgischen Staat vereinen sollte, und die Türme von Europas Bürokratie. Aber«, behauptete sie mit leuchtenden Augen, »es gibt eine vierte Stadt. Der Eingang zu ihr besteht aus einem einzigen Gebäude.« Als Baumedizinerin im Brüsseler Umweltamt in Kraainem sollte Kim ihrer Nichte vor Ort erklären, was notwendig war, um das Bauwerk zu nutzen. Die Vermessung eines Luftschlosses hört sich leichter an, dachte Kim.
Alles in Brüssel lechzte seit Wochen nach Wasser und Kühlung. Sie streckte die Hand nach der Flasche aus, die Caline gerade abgesetzt hatte und nahm einen kräftigen Schluck. Die vollgepackt durch die Tunnel stampfenden Züge kamen ihr vor wie Kompressionszylinder einer viel zu weit entfernten Kühlmaschine. Im Zug jedenfalls kam nichts Kühles mehr an.
Den ganzen Tag hatte Kim im Auftrag einer Wohnungsgesellschaft mit ihrem Team des flämischen Umweltamtes »Bruxelles Environnement« ein Haus am Drève des Gendarmes untersucht, in dem eine einsame Frau innerhalb der letzten drei Jahre lebensgefährlich von Allergien heimgesucht worden war. Sie hatten in dem verdreckten und vom Schwamm zerfressenen Gebäude Proben von Holz und Erdboden genommen, hatten Mauern aufgestemmt und Stichgräben angelegt. Kim war wild entschlossen, mit ihrem Team die Quelle des Problems zu finden und ihren Bericht abzuschließen, bevor sie am Sonntag zu den Antillen aufbrechen würde.
»Wir wollen dort je zweihundert Zuschauer in mindestens drei Veranstaltungen unterbringen.« Caline zwirbelte ihre Haare mit beiden Händen.
Seit Wochen und Monaten redete ihre Nichte von nichts anderem. Alle Schulprüfungen hatte sie mit Bravour bestanden, ohne ein Wort darüber zu verlieren. Über das Stück »Malpertuis« nach Jean Rays düsterem Roman aus dem Jahr 1943, an dem ihre Schultheatergruppe unter Anleitung eines professionellen Regisseurs arbeitete, sprach sie seit Anfang des Jahres. Die Götter des Olymps fristen heute ihr trauriges Dasein in einem belgischen Landhaus, ausgezehrt, kraftlos, weil niemand mehr an sie glaubt. Welch eine schräge Kombination. Die belgische Spezialität, Dinge zusammenzufügen, die nichts miteinander verbindet, dachte Kim, wird uns glücklicherweise gelegentlich als Kreativität nachgesehen.
»Ich bin gespannt«, sagte sie.
»Es ist eine so rabenschwarze Geschichte«, erklärte Caline. »Kann man sich als Gott, der in der Antike das gesamte Universum regierte, Schlimmeres vorstellen, als auf dem Land in Belgien zu verkommen?« Sie lachte. Den Waggon schien die Belgische Bahn seit Urzeiten in Betrieb zu halten. Winzige Sitzecken, in denen man kaum die Beine einer einzigen Person unterbringen konnte, geschweige denn die von vier. Muffige Polster. In diesen Abteilen erlebte man die Hölle, sobald sie sich in Bewegung setzten. Caline machte das Geräusch der Schienenstöße nach.
»Von Schuman fahren wir mit deinem Auto?«
»Du musst fahren.« Kim erteilte ihre illegale Fahrgenehmigung, etwas, das nur eine Tante tun durfte. Die Tochter ihres Bruders Claes war das reinste Sonnenkind. Groß und blond, intelligent, mit einem kauzigen Humor gesegnet, Nervensäge, Kleinkind gelegentlich. Weil sie außer ihr selbst nicht viele andere Menschen wirklich interessierten, war sie im Umgang mit allen freundlich und offen. Viele ihrer Freundinnen hielten sie für die beste Freundin, die sie hatten. Caline selbst betrachtete keine von ihnen als solche. Sie wühlte in ihrem Rucksack, wobei sie sich Mühe gab, den Inhalt vor Kim zu verbergen.
Mit einer Hand zupfte sie herum, bis der Hals einer Champagnerflasche sichtbar wurde. »Überraschung.«
Kim hatte es als Grund für die mitternächtliche Stunde dieses Ausflugs vermutet. Ihr Geburtstag. Ihr letztes Jahr vor der großen Zahl. Das »Noch-einmal-davongekommen-Jahr« begann nach Mitternacht. Der Zug hielt am Bahnhof Résidence. Sie beeilten sich herauszukommen.
Kim trat einige Schritte von dem Torbogen zurück, der sich vor ihr in der Fassade öffnete. Sie zog ihr helles Leinenjackett aus. In ihrer kurzärmligen hellbraunen Baumwollbluse und den knapp sitzenden dunkelbraunen Hosen fand sie sich nach dem Verlassen ihres klimatisierten Autos für die Wetterlage noch immer viel zu warm angezogen. Links von ihr lag ein Gebäude, das man in den Sechzigerjahren als ein spitzwinkliges Dreieck in den Zwickel zwischen Rollebeekstraat und Keizerlaan eingepasst hatte. Darin versuchte eine Bowlingbahn über einer Total-Tankstelle ihr Glück. Zu ihrer Rechten, die Straße weiter hinauf, beherrschten belebte Straßencafés vor dreistöckigen efeubewachsenen Häusern die Szene der Nacht. Auf der anderen Straßenseite gab es die ersten Antiquitätenläden, deren Reihe sich von hier bis in die Marollen fortsetzte. Kim würde sich hüten, die Schaufenster mit afrikanischen Kunstwerken in ihrem Rücken näher zu betrachten.
Caline meldete sich neben ihr mit einem Niesanfall. Umständlich nestelte sie eine Packung Taschentücher aus dem Rucksack. Obwohl sie in der heißen Nachtluft wie in einem zähen Gelee steckten, wehte aus dem Hof hinter der Durchfahrt ein kühler Luftzug auf die Straße. Etwas musste dort den ganzen heißen Tag lang Schatten produzieren und Feuchtigkeit bewahren. Es konnte nicht einfach ein verkommenes Haus sein. Für den Zug, den Kim auf der Haut spürte, besaß eine niedrige Hinterhausruine nicht genügend Fläche. Sie spürte die kalte Wand der Durchfahrt in ihrem Rücken. Es roch nach feuchtem Putz und Zigarettenrauch.
Vor ihr öffnete sich ein Innenhof. Müll aus leer geräumten Häusern, umliegenden Gaststätten und Läden lag in Bergen neben überquellenden Abfallcontainern. Nahezu der gesamte Innenraum des Hofes war ausgefüllt von dem Ungetüm eines stillgelegten zweistöckigen Parkhauses.
Versteckt. Vergessen. Nicht älter als vierzig Jahre, aber von prähistorischer Anmutung. Aus einer Zeit, als man viel grober mit Beton und Stein umging als heute. Groß, kalt und unsichtbar, nur wenige Meter von der tagsüber mit Touristen gefüllten Straße entfernt, dämmerte der Betonklotz dort vor sich hin.
Kim erinnerte der Anblick an ein Foto, das sie vor Jahren in einer Ausstellung des Fotografen Robert Polidori in der Tate in London gesehen hatte. Es zeigte das Innere eines ehemals prächtigen Opernhauses in Detroit – die samtbespannten Wände, das Parkett, die Bühne, die Logen mit samtroten Brüstungen. In das Opernhaus war ein Parkhaus gebaut worden, als hätte sich eine außer Kontrolle geratene Autofähre hineingebohrt. Die Logen bildeten den Rand eines Parkdecks. Chromglänzende Kühlergrills warteten auf nie mehr stattfindende Aufführungen.
»Ist das deine vierte Stadt?«, fragte sie Caline. Ihre Nichte stand neben ihr, den Rucksack auf dem Rücken, wie eine Touristin, die tausend Kilometer gewandert war, um vor einer prähistorischen Ruine im Innern Yucatans zu stehen.
»Das ist der Eingang zu der Stadt, in der die Götter warten«, erklärte sie mit gedämpfter Stimme. »Wären sie nicht schon hier, wäre es nicht für ›Malpertuis‹ geeignet.«
»Sie sind anwesend?«, fragte Kim. Was sollte das bedeuten?
»Natürlich sind sie anwesend«, Caline lachte. »Sie warten auf dich. Sie sind deine Geburtstagsüberraschung.« Kim konnte mit den Bemerkungen nichts anfangen.
»Zweihundert Gäste?«, fragte sie.
»In diesem Deck werden die Gäste parken«, sagte Caline. »Einfacher geht es nicht.« Sie sah auf die Uhr. »Noch zehn Minuten.« Sie marschierte voran, den Rucksack auf dem Rücken.
Sorgfältig setzte Kim ihre Absatzschuhe Schritt vor Schritt, das Jackett über den Arm gelegt. Caline bestieg vor ihr eine Leiter in das zweite Parkdeck. Mit der Champagnerflasche wies sie den Weg.
Caline hielt eine Stablampe in der Hand. Ihr Strahl verlor sich in der weiten Ebene des oberen Parkdecks, auf dessen Betonfußboden sie jetzt standen. Er versackte im Müll, den Generationen von Kids und Obdachlosen hinterlassen hatten, zwischen zerbrochenen Flaschen, in muffigen Lagern aus nassen Matratzen, bei zerbrochenen Spritzen, gebrauchten Kondomen und den Überresten anderer erledigter Geschäfte.
»Warte hier«, sagte Caline, »ich bereite es vor.« Kim musste sich eingestehen, dass sie hoffte, es schnell hinter sich zu bringen. Ein »Happy Birthday«. Einige Schlucke Champagner. Kerzenschein, ein paar umständlich verpackte winzige Geschenke. All das wäre in Ordnung. Danach nichts wie weg.
Während ihre Nichte die Rampe hinunterlief, wanderte Kim in der leeren Betonfläche umher. Es gab nichts Mystisches. Es gab den Dreck, es gab Verwahrlosung, es gab kalkige Zapfen, die durchsickerndes Regenwasser erzeugt hatte, es gab Pfützen und Müll. Es gab keine Götter. Es gab nicht einmal Obdachlose, die von sich behauptet hätten, welche zu sein. Es gibt keine vierte Stadt in Brüssel, es gibt vernachlässigte Winkel, in denen es stinkt und auch im Sommer kalt ist. Das ist alles.
Hier eine Veranstaltung mit zweihundert Gästen? Kim fror. Abgesehen davon, dass man Toiletten verfügbar haben, Luftqualität messen und Zugänge schaffen musste: Selbst im Sommer würde man es beheizen müssen.
Caline tauchte aus dem Erdgeschoss wieder auf der Rampe auf. Null Uhr. Sie schoss den Korken in die Luft. Plötzlich hatte sie zwei Gläser, die sie mit Champagner füllte. Dann fiel sie ihrer Tante um den Hals.
Zwölf Jahre alleinerziehende Tante. Kim wusste, dass es eine Ehre für sie war, an einen so geheimen Ort geführt zu werden. Keine siebzehnjährige Tochter hätte ihre Mutter hierher geschleift. Kim war etwas anderes für Caline. Sie war Tante und Freundin, nur sehr selten Mutter. Kim würde sich eher in die Zunge beißen, als Caline zu fragen, wie sie auf diesen schrecklichen Ort gekommen war.
Caline hielt das Glas hoch. Sie prosteten sich zu. Irgendwo rollte ein Stück Holz.
»Du musst mir sagen, was ich tun muss, damit Aufführungen vor Publikum problemlos funktionieren können.« Als sie Kims skeptische Miene sah, fuhr sie fort: »Aus einem verrückten Grund ist dieses Haus für uns bestimmt. Du wirst es sehen.« Sie kramte in ihrem Rucksack und nahm etwas in die Hand, was sie von dort unten zum Zuprosten eine Etage höher geschleppt haben musste. Es schien groß wie ein Pferdekopf zu sein. Kim hatte ein ungutes Gefühl. Dann zog Caline etwas heraus, das Kim nicht sehen wollte.
Nur das Blinken eines Blickes erlaubte sie sich, bevor sie sich abwandte. Eine afrikanische Maske. Groß. Geradezu gewaltig. Zwei Gesichter in einem. Augenschlitze. Hornähnliche Auswüchse eines Insektenkopfes. Ein Wesen von jenseits des menschlichen Universums. Ein Stück davon brach ab und blieb im Rucksack hängen. Caline ignorierte es.
Wie in Trance folgte Kim ihrer Nichte, während sie sich das Jackett wieder um die Schultern legte. Ihr war kalt. Sie gingen zur Rampe, die ins untere Parkdeck führte. Es roch nach – konnte das sein? – nach einem Hauch von Kakao, nach einem fremden Duft von geräuchertem Tee. Neben allem Gestank nach Beton, nach Schimmel, Pisse und Fäkalien, neben dem Geruch des ausgetrockneten Staubes, der einen Hauch von Zeitlosigkeit in dieses Verlies brachte, roch es aber vor allem nach dem Rauch von Kerzen. Flackerndes Licht drang von unten hervor. Caline löschte das Licht der Stablampe.
Das Parkdeck, in das sie jetzt hinabsteigen, schwebt in flackernden Lichtern wie ein Schiff auf einem bewegten Meer, die Wände sind bis an den Horizont zurückgewichen.
Heerscharen von Exemplaren derselben afrikanischen Maske, als hätte auf dem Betonboden eine Schlacht zwischen Ungeheuern und ihren Drachentötern stattgefunden.
Die Lichter kommen von einer weit entfernten Seite, wo eine verquere Geometrie den Bau in eine Keilform zwingt. Dorthin geht Kim.
Im spitzen Winkel sieht sie nichts anderes mehr. Nicht den festen Boden aus Beton. Nicht die Decken, nur die Wände, die sie umschließen.
In ihrem Kopf sind Gerüche, die von anderswo herkommen. Stickige, feuchtwarme Luft. Geruch ausgebrannter Kerzen, lange nachdem es dunkel geworden ist. Auf der Zunge liegt Geschmack nach Blut. Pochende Angst vor dem undurchdringlichen Dunkel. Der strenge Geruch medizinischer Chemikalien. Die Masken sind nicht aus einem afrikanischen Olymp gefallen. Sie befindet sich in einer anderen Welt in einer anderen Zeit. Einen Meter unter dem Paradies liegt die Hölle. Das ist mein Ort. Dort bin ich.
An den Wänden im äußersten Winkel des Parkdecks umgab sie das immer gleiche Gesicht mit den Augenschlitzen und den sechs gebogenen hornähnlichen Auswüchsen eines Insektenkopfes, neunundvierzig Mal. Lichter flackerten aus den Augen. Calines »Happy Birthday« erstarb in Schluchzen, als Kim in die Schatten versank.
4
FREITAG, 26. JUNI
Oh Lord, won’t you buy me a Mercedes Benz. Janis Joplin brach den Bann. Auf Kims Blackberry meldete sich eine Nummer, die ihr unbekannt war. Sie schaffte es, das Foto der Maske mit spitzen Fingern in die Tasche des Kittels zu stecken, ohne es noch einmal anzusehen. Oh Lord, won’t you buy me ...
Wichtiger als jedes Telefonat war es jetzt, Caline endlich zu wecken. Die Erinnerungslücke hatte sich mit etwas gefüllt, das Kim noch immer nicht für ein eigenes Erlebnis halten mochte. Etwas daran stimmte ganz und gar nicht.
Sie öffnete die Tür zum Zimmer ihrer Nichte. Sprachlos sah sie sich um, ging zu dem mit Papieren und Schulbüchern vollgestapelten Schreibtisch – so ungefähr dem Einzigen, was sie außer dem unbenutzten Bett wiedererkannte.
Wie geistesabwesend, den Blick auf die Wände gerichtet, nahm sie die Kladde der zusammengehefteten Kopie von »Malpertuis« in die Hand und wedelte sich damit Luft zu, dabei ließ sie die Wände für keinen Augenblick aus den Augen.
In den verlassenen Häusern, den stillgelegten Asbestruinen oder feuchten, von Schimmel überzogenen Fabrikhallen, die zu besuchen ihr Job mit sich brachte, waren Graffitis die allgegenwärtigen Blütenblätter der Verwahrlosung. Texte, ganze Geschichten, Ausrufe, Botschaften an alle, die den Graffiti-Malern wichtig waren, gelegentlich Kunstwerke.
Soweit sie mit der Polizei zusammenarbeiten musste, kannte Kim die Urheber. Schüler, Jugendliche, Arbeitslose, selbst ernannte Künstler, Vagabunden. Es gab so viele verschiedene Motivationen, wie es Motive an den Wänden gab. Freie Wände zwangen dazu, sich der Nachwelt mitzuteilen. Hingeworfene Menschenfiguren, Zeichen und Buchstaben spielten eine Hauptrolle dabei, Farben und Grafik.
Was Kim in Calines Zimmer umgab, war etwas vollkommen anderes. Zeichnungen, die die Wände bis unter die Decke bedeckten. Caline musste dafür auf einen Stuhl gestiegen sein und auf Zehenspitzen den dicken schwarzen Filzstift hochgereckt haben.
Aber es waren keine Graffitis.
Gittermuster, Schlangenlinien, Wellenlinien, Büschel aufgesprühter Hände wie das Blattwerk eines fremdartigen, sich in einer Strömung wiegenden Unterwassergeschöpfes. Immer wieder Abschnitte von Ringen, die konzentrisch ineinander lagen wie ein in Perspektive gezeichneter Podest. Liegende Mondsicheln wie sich nähernde Wikingerschiffe, die aus den gleichen Kreisbögen zusammengesetzt waren. Alles war schwarz. Alles zeugte von einem zwanghaften Drang, eine Botschaft aus einer anderen Welt auszudrücken, die sich nicht in Zahlen oder Buchstaben oder Farben fassen ließ.
Keine Tiere, keine Menschen, keine Pflanzen oder Häuser – nur Muster, die Kim Angst einflößten, weil sie mit brennender Energie über die Wände verteilt worden waren. Es war nicht zu begreifen, was sich vor ihren Augen entfaltete.
Mit einigen Schritten war sie tiefer im Zimmer. Sie öffnete den Kleiderschrank. Im Anflug einer verrückten Hoffnung dachte sie, dass Calines blaues Kostüm für das heutige Ereignis in der Schule fehlen würde, weil Caline die Nacht bei einer Freundin verbracht hatte.
Offenbar hatte sie in dem Parkhaus das Bewusstsein verloren. Hatte sie etwas mit Caline verabredet? Noch immer wusste sie nicht, was zwischen Mitternacht und dem Morgen geschehen war.
Unberührt hing das Kostüm an seinem Platz. Wenn Caline an dem größten Ereignis des Jahres in ihrer Schule teilnehmen wollte, wenn sie nach einem Violinquartett von Mozart und der Festrede des Direktors als Beste ihres Jahrgangs vor sechshundert Schülern und Eltern ihr Zeugnis auf der Bühne entgegennehmen wollte, musste sie zu Hause vorbeikommen, um sich umzuziehen. Halb elf!
An den Wänden befand sich sonst nichts. Was vorher dort geklebt hatte, war in das Bücherregal gestopft worden. An der Tür heftete das Plakat der Theateraufführung nach »Malpertuis« von Jean Ray im kommenden Oktober. Kim fiel auf, dass sie noch immer die zerlesene Kladde der Romankopie in der Hand hielt.
Das Bett war sorgfältig geordnet. In einer Ecke saß Frans, der große Affe, zu dem Caline sich auch mit siebzehn noch mit entwaffnender Weisheit bekannte. Frans ist das, was eine Frau in meinem Alter braucht. Geblümte Kissen. Ein geblümt eingebundenes pralles Tagebuch, von einem dicken Gummiband zusammengehalten. Unter dem Bett Kartons mit Wäsche. Auf dem vollgepackten Schreibtisch Stapel von Schulunterlagen. Hefter. Bücher. Ihr Notebook. Kim nahm Tagebuch und Adressbuch ihrer Nichte an sich. Sie legte die zusammengehefteten Kopien von Jean Rays Roman zurück. Ihr Blick blieb an einer unterstrichenen Textpassage haften.
»... Der Abbé hat von einer ›Falte im Raum‹ gesprochen, um das Nebeneinandervorhandensein zweier Welten zu erklären, die grundsätzlich verschieden sind. Malpertuis wäre nach dieser Theorie ein abscheuliches Übergangsgebiet.«
Ist von dem Parkhaus die Rede oder von diesem Zimmer, in dem ein fremder Volksstamm gehaust haben muss? Schon einmal hatte Kim Bildern wie diesen fassungslos gegenübergestanden.
Diese Reise würde sie niemals vergessen, die letzte mit ihrem Ehemann, bevor es mit ihrer Verbindung in Buenos Aires in einer katastrophalen Auseinandersetzung zu Ende ging. Mit einigen Kollegen ihres damaligen gemeinsamen Arbeitgebers, Kelvin Pharmaceuticals, waren sie zu einer Tour nach Patagonien in eine unterirdische Welt aufgebrochen, die vollkommen anders war, als Kim sich bis dahin prähistorische Höhlen vorgestellt hatte. Versunkene Städte, deren Himmel man erst als versteinert erkennt, wenn man den Kopf weit genug in den Nacken legt. Mit diesem Himmel waren alle Wesen in den Untergrund gesunken, die ihn einmal bevölkert hatten, verstand sie in diesem Moment nachträglich.
Es hatte dort alles gegeben: Landschaften, Dünen, Flüsse, Hügel, aufragende Baumstämme, herabhängende Fäden – aus Stein. Wer in dem versteinerten Land umhergestreift war, musste den Zwang gespürt haben, Tiere der farbigen Oberwelt dorthin zu bringen. Eine Welt, wie geschaffen als Rückzugsgebiet toter Götter.
Die Bilder an den Wänden in Calines Zimmer ähnelten den Zeichnungen, die sie damals an den steinernen Wänden der Cueva de las Manos, der »Höhle der Hände«, in der Provinz Santa Cruz gesehen hatte. Caline hatte prähistorische Höhlenzeichnungen auf den Wänden verteilt.
Nachdem sie alles mit ihrem Handy fotografiert hatte, wählte Kim Calines Nummer. »Caline ist nicht da, bitte rede mit der Box.« Kein Anschluss. Keine Nachricht.
Konnte es sein, dass das Zimmer für etwas vorbereitet worden war? Für die Theateraufführung? Was sie umgab, wies auf anderes hin als auf einen vertrödelten Termin oder eine vergessene Verabredung.
Um elf musste Kim am Drève des Gendarmes sein, dem Ort ihres letzten Projektes vor der Urlaubsreise, eine Stunde später mit Caline in der Aula. Es sah so aus, als würde sie Caline von unterwegs so oft anrufen müssen, bis sie sie erreichte.
Wieder läutete es an der Haustür.
Kim öffnete die Fenster und schloss sorgfältig die Tür hinter sich. Der Raum, in dem Caline wohnte, schien auf einmal tief unter der Erde zu liegen.
Auf dem Weg nach unten meldete sich erneut das Telefon mit dem Gesang von Janis Joplin.
»Kim Lacquemont?«, fragte eine Stimme. Die Polizei.
Es war kurz vor elf, sie würde den Termin am Drève des Gendarmes verschieben müssen, und noch immer gab es keine Spur von Caline. Kims Sorge wurde zu bohrender Angst. Du bist verantwortlich. Ich habe dich nicht gebeten, dich um meine Tochter zu kümmern, wenn ich abwesend bin. Du hast es angeboten. Nun beschwer dich nicht. Sie hatte ihren Bruder vor Augen. Damals hatte es ein kleines Problem mit Caline gegeben. Eine Autokarambolage.
»Wir haben heute früh über Ihren roten Saab gesprochen«, sagte der Polizist. Erneut läutete es Sturm an der Haustür.
»Ja.« Kim war im Erdgeschoss angekommen.
»Er wurde auf einem Parkplatz am Bahnhof Schaerbeek im Nordosten von Brüssel abgestellt, der Schlüssel steckte im Zündschloss.«
»Gut.« Kim musste hörbar durchatmen. Jemand hatte versucht das Auto zu stehlen, ein Gelegenheitstrip von Jugendlichen. Wenn Caline wirklich verschwunden ist, ist sie dort, wo ich sie zuletzt gesehen habe. In dem zugigen Eingang zu ihrer ominösen vierten Stadt in einem stinkenden Parkhaus.
»Der Beamte vor Ort möchte wissen, ob Sie einen Zweitschlüssel besitzen. In diesem Fall würde er den Schlüssel im Handschuhfach deponieren und das Auto arretieren.«
Sie öffnete die Haustür. In der Morgensonne stand ein Radfahrer.
»Kim Lacquemont?«, fragte er. Als sie nickte, das Handy noch am Ohr, streckte er ihr eine Schreibunterlage hin.
»Richten Sie ihm aus, dass er es so machen kann.« Kim kritzelte etwas auf das Formular des Boten. »Gab es Auffälligkeiten?«, fragte sie. »Wurde jemand erkannt, der den Wagen gefahren hat?«
»Wir versuchen herauszufinden, ob es eine Aufzeichnung einer der Überwachungskameras gibt, mit denen der Bahnhof bestückt ist. Es kann eine Weile dauern. Aber vielleicht haben Sie eine Vermutung, wer gefahren sein könnte.«
Der Bote öffnete die Klappe seines Fahrradanhängers. Ehe Kim es sich versah, überreichte er ihr einen Armvoll gelber Rosen. Unübersehbar hing daran eine Karte. »Happy Birthday«.
»Herzlichen Glückwunsch«, rief der junge Mann schon fast im Fahren. Als er in die Pedale trat, wirbelte er eine Staubfahne auf.
»Es könnte meine Nichte gewesen sein. Sie ist bisher nicht aufgetaucht. Meinen Sie, ich sollte eine Vermisstenanzeige aufgeben?«
»Wann haben Sie sie zuletzt gesehen?«
»Gestern Abend. Jetzt ist sie dabei, ihre Zeugnisübergabe in der Schule zu verpassen.«
»Wenn Sie das Gefühl haben, mit jemandem darüber sprechen zu wollen, der sich auskennt, kann ich einen Kontakt herstellen.«
»Das ist nett.« Kim konzentrierte sich auf die Rosen in ihrer Hand.
»Sie heißen Child First. Der Mann, den Sie sprechen sollten, heißt Pascault. Sehen Sie zu, dass sie möglichst schnell ihr Auto abholen. Vielleicht haben wir die Aufzeichnung der Überwachungskamera bereits ausgewertet, wenn Sie mit der Hilfsorganisation reden.« Der Polizist machte eine Pause. »Haben Sie Anzeichen dafür, dass es etwas Ernstes ist?« Wovon sollte Kim berichten? Von dem verwandelten Zimmer? Von dem Parkhaus? Es gab erhebliche Anzeichen dafür, dass es etwas Ernstes war.
»Nein«, sagte sie, »Anzeichen für etwas Ernstes gibt es nicht.«
5
Für einige Atemzüge senkte sie ihr Gesicht in die Blumen. Warren. Plötzlich schimmerte eine Ahnung von dem Tag durch, der es hätte sein können. Der Tag mit der Aussicht auf einen langen Urlaub, mit dem genüsslichen Austausch der Reisepläne von ihr und Caline, die in den nächsten zwei Ferienwochen mit einigen Freundinnen Spanien unsicher machen wollte. Der Tag mit Plänen, die nichts Schlimmeres als die Renovierung eines Hauses betrafen, ein Tag des blauen Himmels und des grünen Rasens vor den gepflegten Villen und Konsulatsgebäuden der Avenue d’Orbaix, ein Tag der märchenhaften weißen Landhausseite ihres Hauses. In diesem anderen Tag, der es hätte sein sollen, gab es nichts als Farben, Licht und die Ruhe des Südens von Brüssel mit den Plänen, in die bunte Unterwasserwelt der südlichen Antillen abzutauchen.
Im Wohnzimmer fiel reflektiertes Sonnenlicht auf eine lindgrüne Bodenvase aus Muranoglas. Kim schnitt in der Küche die Blumen an, schüttete Dünger in die Vase und ließ Wasser einlaufen. Der Sonnenfleck am Boden ihres Wohnzimmers blühte auf wie ein Fest.
Rosen waren für Kim auf immer mit einem Geheimnis verbunden, das sie wahrscheinlich bis an ihr Lebensende nicht lösen würde.
Als sie nach Wochen von Brechdurchfällen, Hungerekstasen und geradezu autistischer Isolation ihr finales medizinisches Examen in der School of Medicine des King’s College in London hinter sich gebracht hatte, hatte ein Kommilitone, dessen Vater ärztlicher Direktor einer Londoner Klinik für Schönheitsoperationen war, im Haus der Familie unweit des Strandes in Brighton einen Tag in Pink veranstaltet. Wie Geschosse hatten Magnumflaschen eines Champagner Rosé bereitgestanden. Alle fünfzig Gäste waren pink gekleidet gewesen. Auch der Juliabend hatte von der See her der Nacht in Pink entgegengedämmert.
Als sie zurück ins Haus gekommen waren, hatte in der Mitte des Zimmers eine monumentale Vase mit einem Strauß von einhundert gelben Rosen gestanden. Daran ein Schild. »Für Kim«. Ein Anblick, der sie atemlos, peinlich berührt und auf ungeheuerliche Weise herausgehoben und geehrt zurückgelassen hatte. Der Urheber wurde nie identifiziert. Alle waren am Strand gewesen, um mit einem Glas in der Hand den Sonnenuntergang zu verfolgen. Ein ankommendes Auto hätten sie sehen müssen. Der Abend hatte sein Thema. Einhundert Rosen.
Inzwischen vermutete sie, dass die Rosen nur von dem Vater ihres Kommilitonen gekommen sein konnten. Sie hatte nie mehr als hundert Worte mit ihm gewechselt, er war mindestens dreißig Jahre älter als sie. Das Rätsel der Rosen, fragte sie sich seitdem, stand es für den großen Angriff, für das Geschenk eines lebenslangen Geheimnisses oder für seinen Abschied von einer hoffnungslosen Illusion? Sie hoffte, dass für Warrens Geschenk, das ihr jetzt half, bei Verstand zu bleiben, nicht die letzte Option zutraf.
Es war still im Haus geworden, die Ausräumarbeiten mussten abgeschlossen sein. Der alte Kollege ihrer Mutter stand in der Wohnzimmertür.
»Ihre Mutter war eine bemerkenswerte junge Frau«, stellte er fest. Kim lud ihn auf ein Glas eisgekühlten Malventee auf ihre Terrasse.
Es sah überhaupt nicht so aus, als wäre es nichts Ernstes mit Caline. Es sah nicht danach aus, als hätte ihre Nichte nur ihr Handy verloren, bei einer Freundin übernachtet und würde nun wegen der großen Verspätung unter Verzicht auf ihr neues Kostüm direkt zur Aula fahren. Allein würde Kim auf keinen Fall ihre Zeit mit der Feierlichkeit in der Schulaula vergeuden. Sie würde sich zur Sicherheit in der Schule erkundigen und dann alles daran setzen, herauszufinden, was geschehen war – auch später, während sie bei ihrem Team am Drève des Gendarmes sein würde.
Mit einer großen Glaskaraffe, in der Eiswürfel und Zitronenscheiben schwammen, trat sie vor das Haus. Bewundernd ließ ihr Besucher seine Blicke auf ihr ruhen.
»Ich kenne Sie schon lange, auch wenn Sie sich nicht an mich erinnern können.« Er lächelte Kim wissend zu. Eine der »Damals-waren-Sie-noch-so-klein«-Geschichten, die sich nie vermeiden ließen, wenn man Freunden seiner Eltern über den Weg lief. Sei es drum.
»Oh!«, sagte Kim. »Ich hoffe, ich habe mich als kleines Mädchen gut benommen.«
»Ehrlich gesagt, waren Sie damals in einem besonderen Zustand. Sie haben nicht geredet. Die ganze Überfahrt von Matadi nach Antwerpen haben Sie nichts als einen Singsang von sich gegeben.« Wohin führt das?, dachte Kim beunruhigt. Sie wollte nichts davon hören. Man musste nicht alles wissen. »Sie müssen drei oder vier Jahre alt gewesen sein. Ich durfte Sie nicht untersuchen, obwohl ich damals Schiffsarzt auf der ›Gouverneur Galopin‹ war. Meist trug Ihre Mutter Sie auf dem Arm.«
»Ich bin froh, dass Sie sich für die Praxis meiner Mutter erwärmen können«, sagte Kim. »Interessenten für Praxismöbel aus den Sechzigern haben mir nicht gerade die Tür eingerannt, auch wenn sie sehr gut erhalten sind, fast Antiquitäten.« Sie bemühte sich zu lächeln. Der Kollege ihrer Mutter begriff, dass seine Erinnerungen an Kims Kindheit nicht gefragt waren.
»Es war im Kongo eine wunderbare Zeit mit einem schrecklichen Ende. Leider redet man vom Paradies immer erst, nachdem man von dort vertrieben wurde.« Er erging sich in einer längeren Rede über die Wohltaten der alten Kolonie in der Mitte Afrikas. »Niemand macht sich heute die Dimension des Absturzes klar. 1960 lag der belgische Kongo wirtschaftlich gleichauf mit Südafrika, nicht weit entfernt von Brasilien. Heute bräuchte die kongolesische Wirtschaft fünfzig Jahre lang die Wachstumsrate Südafrikas, um wieder den Stand von 1960 zu erreichen. Es ist, als wären die USA auf das Niveau Italiens abgestürzt.« Seine Nase wurde rot. Seine Augen glänzten. »Es gab Menschen wie Ihre Mutter, die sich dafür aufopferten, eine hochentwickelte medizinische Versorgung aufzubauen.« Ein weiterer Schluck. »Oder wie der Urwaldarzt, den Ihre Mutter wie einen Heiligen verehrte.«
»Wie war sein Name?«, fragte Kim. Der Lastwagen, in dem die Praxis verstaut worden war, ließ von der anderen Seite des Hauses einen Hupton erklingen.
»Maleingreau.« Er erhob sich. »Es war sehr schön, mit Ihnen zu plaudern. Es ist gut, dass es junge Menschen gibt, die noch denken wie wir.« Kim fand nicht, dass sie etwas gesagt hatte, was auf ihre Ansichten hätte schließen lassen können. Sie begleitete den alten Arzt durch das Haus.
In der Tür drehte er sich um.
»Ich weiß, dass Sie es nicht hören wollen, weil es Sie belastet. Ich kann es gut verstehen. Ihre Mutter hat mir damals aufgetragen, Ihnen nach ihrem Tod etwas auszurichten.« Kim sah ihn mit versteinertem Gesicht an. Bis zum Tag ihres Todes hatte ihre Mutter noch neununddreißig Jahre in Brüssel gelebt, viele Jahre davon mit Kim unter einem Dach. Jeden Tag hätte es hundert Gelegenheiten gegeben, ihr etwas Wichtiges mitzuteilen, wovon sie zugegebenermaßen wenig Gebrauch gemacht hatte. Wozu damals eine Botschaft in eine undefinierbare Zukunft? »Es war kurz vor unserem Einlaufen in den Hafen von Antwerpen.«
»Bitte«, sagte Kim. »Wenn es so wichtig ist.«
Er hielt die Klinke in der Hand.
»Ihre Mutter und ich standen uns nahe. Es war eine Zeit für sie, die man seinem ärgsten Feind nicht wünschen würde. Es gab niemanden, mit dem sie sprechen konnte. Wenn ich ehrlich bin, freue ich mich zwar über eine Praxiseinrichtung, die mich an meine frühere Zeit als Tropenarzt erinnert, aber gekommen bin ich, um das Versprechen einzulösen.« Der Fahrer des beladenen Lastwagens ließ den Motor an. »Nicht weit von uns entfernt zeichneten sich wenige Tage vor Weihnachten an dem kalten sonnigen Nachmittag unserer Rückkehr die Umrisse des Churchilldocks im Hafen von Antwerpen ab. Ihre Mutter trug Sie auf dem Arm. ›Unsere Rettung wird im Kongo einen Krieg des reinen Wahnsinns entfesseln. Sollte er irgendwann Belgien erreichen, wird es für uns schlimmer werden als Leopolds Krieg in Afrika ...‹ Das Schiff gab vor der Hafeneinfahrt laute Signale. Ich konnte Ihre Mutter kaum verstehen. ›... Wenn es jemals so weit kommt, gibt es für alle nur eine Hoffnung, mein kleines Mädchen muss sich an alles erinnern, was sie in den letzten Monaten in Stanleyville gesehen hat. Gibt es mich dann nicht mehr, müssen Sie es ihr ausrichten. Sie muss sich erinnern! An jedes Detail aus der Hölle.‹ Der alte Tropenarzt sah Kim ratlos an. »Ich weiß nicht, was sie damit meinte. Sie schien nur absolut sicher zu sein, dass Sie merken würden, wann es so weit ist.« Kim schüttelte sich, als hätte er sie gezwungen, ein stinkendes Getränk hinunterzuschlucken. Er reichte ihr seine Karte. »Rufen Sie mich an, wenn es etwas gibt, das Sie wissen müssen.«
Nahezu geräuschlos folgte sein schwerer weißer Mercedes dem mit der Praxiseinrichtung beladenen Lastwagen.
Kims Blick fiel auf einen hochgewachsenen Afrikaner auf der anderen Straßenseite, der sie musterte, als hätte er auf sie gewartet. Er nahm eine kleine Kamera vors Gesicht. Als sie die Straße überquerte, verzog er sich mit schnellen Schritten in die Avenue Fond’Roy, wo er in einer Straßenbahn der Linie 92 verschwand. Irgendwo begann ein elektrischer Rasenmäher zu brummen. Sonst war alles still.
Kim trank einen großen Schluck von dem kalten Tee. Es tat gut, die Eiswürfel im Mund zu spüren. Sie musste sich darauf vorbereiten, heute Nachmittag ihren Job am Drève des Gendarmes zu erledigen, damit sie am Sonntag sorglos in die Tropen aufbrechen konnte.
Sie versuchte, die Freundinnen anzurufen, deren Nummern in Calines Adressbuch verzeichnet waren, aber sie konnte niemanden erreichen, der etwas über den Verbleib ihrer Nichte wusste. Das mit einem Gummi zusammengehaltene Tagebuch gab auch nicht viel her. In den letzten vierzehn Tagen hatte Caline nichts mehr hineingeschrieben.
Aus einer Schublade unter dem Spiegel in ihrem Badezimmer zog sie wenig später mit an die Schulter geklemmtem Telefon eine weiße Tasche, die ein ungeordnetes Chaos von Medikamenten füllte. Davon hatte sie lange nicht mehr Gebrauch gemacht. Einen Ausflug in das leere Parkhaus, das sie im Notfall noch einmal aufsuchen musste, konnte sie sich jedoch ohne ihren alten Helfer Propaphenin nicht vorstellen. Sie fand einen Rest von drei Filmtabletten, deren Haltbarkeit seit zwei Jahren abgelaufen war.
Wenn ihr Leben weitergehen sollte, wie es mit dem heutigen Tag begonnen hatte, würde sie sich um Nachschub kümmern müssen.
Sie kramte in der Tasche, bis sie den Rezeptblock mit dem Aufdruck der seit zwölf Jahren nicht mehr betriebenen tropenärztlichen Praxis ihrer Mutter fand.
Um halb eins unterbrach eine SMS ihres Teams aus dem Haus am Drève des Gendarmes ihre ergebnislosen Telefonate. Dort war alles geklärt. Kim sollte sich für ihre zusammenfassende Empfehlung einen Eindruck von der Lage der Dinge vor Ort verschaffen.
6
Das Haus lag am südlichen Rand einer Siedlung aus den Fünfzigerjahren, die auf der östlichen Seite vom Wald des Parks unweit der Pferderennbahn begrenzt war. Direkt daneben befand sich eine asphaltierte Parkfläche, die bei Pferderennen mit den Fahrzeugen der Besucher vollgeparkt war.
Der Taxifahrer setzte Kim unweit des Hauses ab, vor dem Baustellenfahrzeuge und Absperrungen jede verfügbare Fläche blockierten.
Während sie durch die staubige Glut der Sonne auf das Haus zuging, konzentrierte sie sich auf dessen Vorgeschichte.
Hélène De Pré hatte seit dem Tod ihres Mannes ihr Leben im Rollstuhl in dem Haus Nummer 43 allein verbracht.
Es gab keinen anderen Kontakt als den zu einer Enkelin, die viel mit sich selbst zu tun hatte und ihr meist einmal in der Woche den großen Kühlschrank füllte, die Wäsche besorgte, ihr beim Baden half und immer in Eile war. Die Frau lebte in zwei Räumen im Erdgeschoss, das übrige Haus war nicht mehr bewohnt. Irgendwann begann sie über Kopfschmerzen zu klagen, sich generell nicht wohl zu fühlen und enorm an Gewicht zu verlieren. Nach einem Zusammenbruch infolge eines Allergieschocks unternahmen Schwiegertochter und Enkelin erstmals nach vielen Jahren einen Gang durch alle Geschosse.
Schräg auf dem Bürgersteig stand ein Krankenwagen, vor dem die alte Frau im Rollstuhl saß. Stumm betrachtete sie die Berge stinkenden Holzes, das man aus ihrem Keller geholt, die Stahlstützen, die man durch die Wände getrieben hatte, um das Gebäude am sofortigen Zusammenbrechen zu hindern, und den Container, der mit Schutt gefüllt worden war. Vor allem aber beobachtete sie sprachlos die Experten in weißen Schutzoveralls, die wie Mitglieder eines Mondlandeteams in ihr Zuhause eingefallen waren. Mit Messinstrumenten, Laptops und gezückten Schreibblöcken durchstreiften sie das Innere des Gebäudes und den Schutt.
Kims Handy meldete sich. Auf dem Display stand eine Nummer, die nicht in ihrem Verzeichnis gespeichert war. Da sie nicht wusste, wie lange sie von zu Hause abwesend sein würde, hatte sie dort ankommende Anrufe auf ihr Mobiltelefon weiterleiten lassen. Sie trat einige Schritte zur Seite.
Eine Freundin aus Calines Parallelklasse fragte aufgeregt, warum sie nicht zur Abschlussfeier gekommen sei.
Erneut versuchte Kim, ihre Nichte auf dem Handy zu erreichen. Ohne Ergebnis. Wegen der Umstellung des Telefons konnte sie jetzt nicht zu Hause anrufen. Vielleicht war Caline ja inzwischen dort. Vielleicht lag sie nach einer aus dem Ruder gelaufenen Party erschöpft in ihrem Bett.
Das Bild der schwarzen Wände ihres Zimmers passte nicht zu dieser Theorie. Etwas hatte das Mädchen verändert, ohne dass Kim es gemerkt hatte.
Ein hagerer Mann von Mitte fünfzig im weißen Overall, einen aufgeklappten Laptop mit beiden Händen vor sich hertragend, gratulierte ihr zum Geburtstag. Joseph Lettmans, Biologe und abgebrochener Mediziner, war als Baubiologe ihr wichtigster Mitarbeiter bei dieser Aufgabe. Er informierte sie kurz über die neuesten Erkenntnisse, bevor sie auf zwei in ein Gespräch vertiefte Männer zugingen.
Der eine stellte sich als Beauftragter der Wohnungsgesellschaft vor. Der andere war ein auf Pilzschäden spezialisierter Anwalt, mit dem Kim in anderen Fällen in Berührung gekommen war.
»Dass dieses Haus hinüber ist, sehe ich«, stellte der Beauftragte der Wohnungsgesellschaft fest, während er seinen schwarzen Anzug abklopfte und heranschwebende Staubwolken von sich wedelte. »Mich interessiert nur, ob die anderen fünfzehn Häuser der Siedlung gefährdet sind und wen ich für das angerichtete Schlamassel haftbar machen kann.«
Der Anwalt, der einen prall sitzenden Overall trug, führte sie zu einem Campingtisch mit vier Aluminiumstühlen.
»Ich glaube, wir können Ihre Fragen beantworten«, sagte Kim. »Zumindest einen Teilverantwortlichen für das Desaster werden wir benennen können.« Sie verteilte vier Becher auf dem Tisch und goss aus einer großen grünen Plastikflasche Mineralwasser ein.
Das Theater. Malpertuis. Der einzige Sachverhalt, der alle Fakten wenigstens annähernd erklären könnte. Caline war mit ihrer Theatertruppe unterwegs, in einer Dauerprobe beschäftigt oder auf der Suche nach einem anderen Spielort. So schnell es ging, musste sie diese Vermutung überprüfen.
»Das Problem begann mit der Anlage der Siedlung im Jahr 1954«, legte sie mit ihrem Bericht los. Der Anwalt nickte dem Mann von der Wohnungsgesellschaft zu, als hätte der lange vor seiner Geburt einen Fehler gemacht. »Alte Luftaufnahmen aus der Kriegszeit zeigen, dass sich dort, wo die Siedlung liegt, Wald erstreckte, wie heute noch in dem angrenzenden Park. Brüssels Einwohnerzahl wuchs. Man hatte es eilig. Es musste kostengünstig und schnell gebaut werden. Man verzichtete auf die langwierige Prozedur, die Wurzelstümpfe der gefällten Eschen, Pappeln oder Buchen aus der Erde zu graben. Man ließ sie liegen, planierte sie zu und deckte sie mit Asphalt ab.« Der Baubiologe sorgte dafür, dass alle den Bildschirm seines Laptops sehen konnten, auf dem jetzt eine aktuelle Luftaufnahme der Siedlung über ein altes Luftbild aus dem Jahr 1944 geblendet wurde. Er vergrößerte die Aufnahme immer weiter, bis ein Ausschnitt mit dem Haus Nr. 43 und der anliegenden Parkfläche den Bildschirm füllte.
»Mit einem Bodenradar haben wir die noch heute unter dem Parkplatz befindlichen Wurzelstümpfe der alten Bäume lokalisiert.« Kim deutete auf verschiedene rote Kreise, die in der schwarzen Fläche des Parkplatzes erschienen.
Während sich das Bild weiter veränderte, versuchte sie mit dem Handy jemanden ausfindig zu machen, der für die Theatertruppe sprechen konnte. Die Sekretärin der Schule gab ihr die Nummer des Théâtre Littéraire de la Clarencière, zu dem der betreuende Regisseur gehörte. Dort konnte sie niemanden erreichen.
Zwanzig rote Kreise.
Unruhig blickte der Anwalt hinüber zu Kim. Die Sonne war weitergewandert. Der Platz des Mannes von der Wohnungsgesellschaft lag nicht mehr im Schatten, er begann zu schwitzen.
»Die Rache des Waldes«, erklärte der Anwalt seinem Kunden unter bemühtem Lachen. Er erntete einen gelangweilten Blick.
»Serpula lacrymans, der Hausschwamm, hat keine Probleme, größere Entfernungen zu überbrücken«, setzte Kim ihre Erklärungen fort. »Als er mit der Verarbeitung der Baumstümpfe fertig war, streckte er sein Myzel in das Haus. Die nötige Feuchtigkeit konnte er durch seine gewachsenen Rohrleitungen heranschaffen.« Lettmans betätigte die Eingabetaste. Die roten Kreise auf dem Bildschirm bekamen Auswüchse, die sich bis an das Haus zogen. »Er kann Wände durchdringen und den Mörtel in Material umwandeln, mit dem er seine Röhren ausbaut. Hier sehen Sie die Situation, die wir jetzt vorfinden.« Vielleicht war Caline mit der Theatertruppe in einem Probenraum eingeschlossen und hatte keinen Handyempfang. Alles war möglich. Kim selbst hatte einmal in London in der Tiefgarage eines Kaufhauses übernachten müssen, weil sie die Öffnungszeiten nicht beachtet hatte. Aber nun war ein ganz normaler Freitag. Spätestens seit zehn Uhr waren alle Türen geöffnet.
»Warum hat sich das alles gerade jetzt ereignet?«, fragte der Mann im schwarzen Anzug.
»Das ist die Frage, die uns zu dem führt, den wir für einen Teil des Schadens haftbar machen könnten«, erklärte Kim. Ihr Handy meldete sich mit der Weiterleitung eines Anrufs auf ihr Haustelefon.
»Rollo Mankes«, sagte die Stimme eines Mannes, »ich möchte Caline Lacquemont sprechen.«
»Worum geht es?«, fragte Kim.
»Ich bin Regisseur des Schultheaters, in dem sie sich engagiert. Heute um ein Uhr sollte die letzte Probe vor der Sommerpause stattfinden. Wir arbeiten seit langer Zeit mit großem Aufwand an diesem Stück.«
»›Malpertuis‹, nehme ich an.« Kim spürte einen Druck in ihrem Kopf, der nichts Gutes verhieß.
»Sie sind die Einzige, die ich erreichen kann«, sagte Mankes. »Die ganze Truppe hätte vor einer guten Stunde mit der Probe beginnen müssen. Keiner von ihnen ist erschienen.«
7